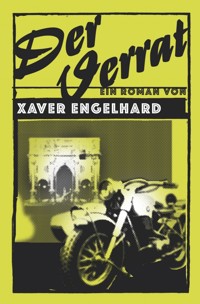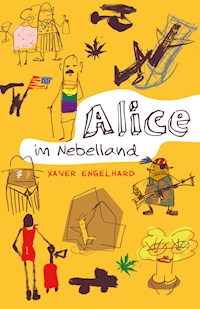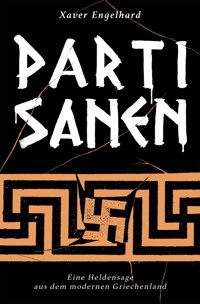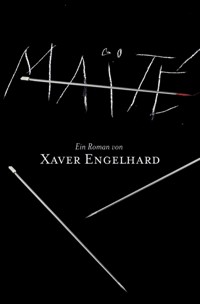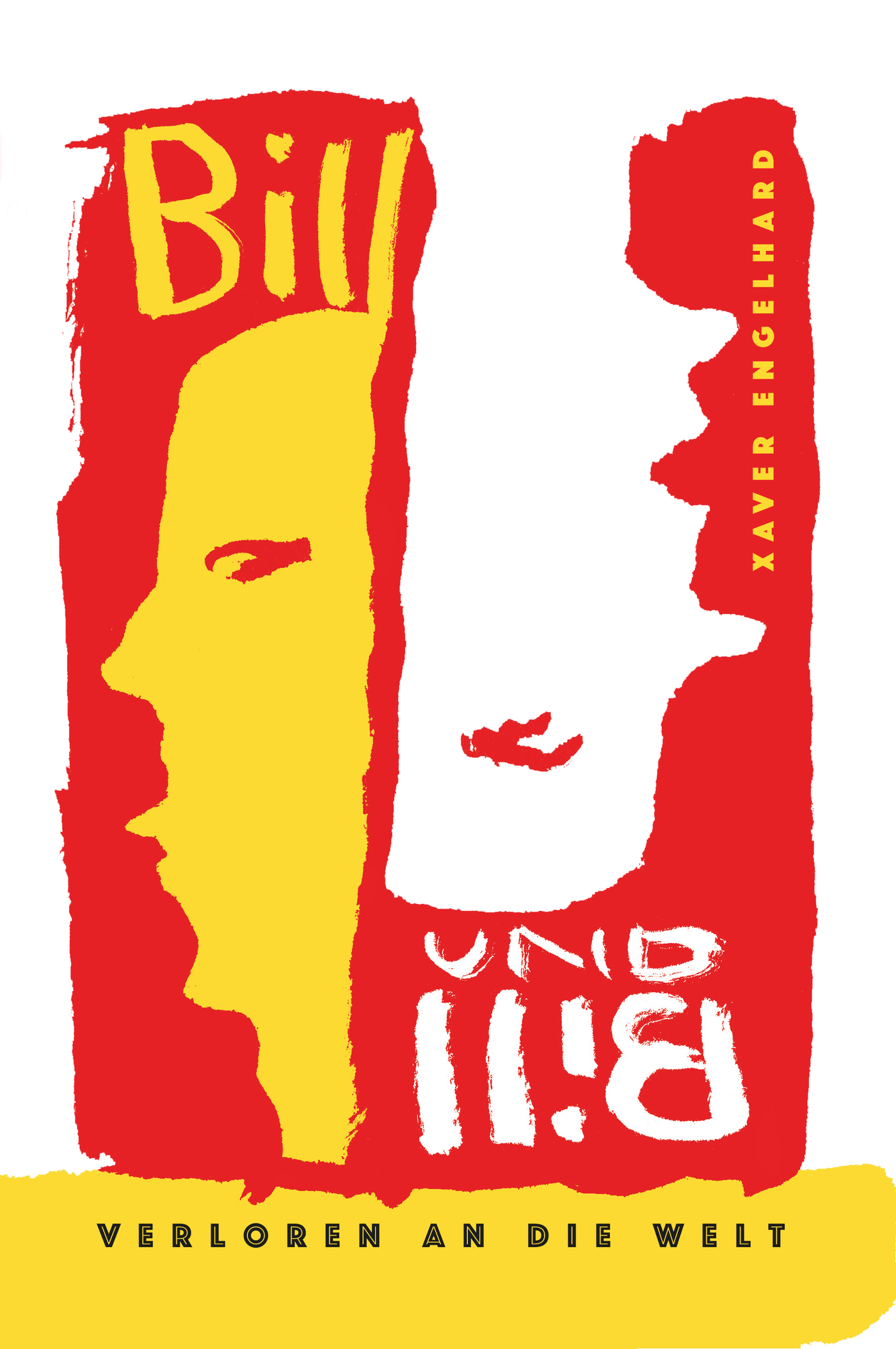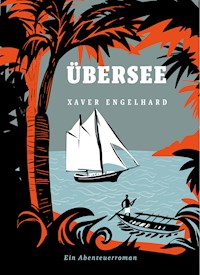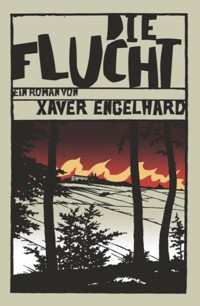
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Noch an Weihnachten 1945 glaubt die 15jährige Walburga auf einem Gut im hintersten Ostpreußen fest an einen Sieg der deutschen Truppen, aber schon ein paar Tage später flieht sie mit Karlchen, ihrem 5jährigen Bruder, nach Westen: Zuerst auf einem Pferdeschlitten, später zu Fuß und in Gesellschaft von Leo, einem jungen Juden, der sich aus einem der Züge Richtung Vernichtungslager befreien konnte. Sie überqueren die gefrorene Weichsel, entkommen aus einem Internierungslager und erreichen auf einem Wehrmachtsmotorrad die rettende Elbe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Flucht
Walburga und Karlchen. Und Leo.
XAVER ENGELHARD
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung ohne Zustimmung des Verlags ist unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
Texte: © Copyright by Xaver Engelhard
Umschlag: © Copyright by Georg Engelhard Druck: epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Printed in Germany
Gesetzt aus der Malaga
Unterwegs
Sie schrak mitten in der Nacht auf, kalt unter den Decken und Mänteln, und noch bevor sie wusste, wo sie sich befand und was geschehen war, streckte sie eine Hand aus und tastete nach ihrem kleinen Bruder, der sich wie ein Tier zusammengerollt und dicht an ihren Rücken gepresst hatte, und spürte, wie sich seine Brust hob und senkte, spürte ihn schlafen, spürte die Nacht, nicht schwarz, sondern eine graue Winternacht, eine der letzten vielleicht, denn sie wurden schon kürzer, die Nächte, wurden kürzer, ohne dass es half, denn die Tage waren nicht besser. Eher im Gegenteil. Tagsüber waren sie sichtbar und schutzlos und mussten weiter. Immer weiter nach Westen und weg von dem, was geschehen war.
Sie fegte das spröde, mit einem kristallinen Pelzrand besetzte Laub beiseite, in das sie sich zum zusätzlichen Schutz vor der Kälte gegraben hatten, schlug die Decke zurück und richtete sich mühsam auf in dem stinkenden Kutschermantel, den sie seit Tagen nicht mehr abgelegt hatte, kratzte sich unter der Wollmütze, die sie bis zu den Brauen herabgezogen hatte, schaute sich nach Leo um und fand ihn am Waldrand, wo er gegen den Stamm einer kahlen Birke gelehnt am Boden saß und die Straße beobachtete, die leer da lag, erfroren unter einem Bett aus Morgennebel. Sie wusste nicht, ob er vor ihr aufgestanden war oder sich am Abend gar nicht erst hingelegt hatte.
„Es wird einfach nicht wärmer.“ Sie schlug die Arme um den Leib und stampfte mit den Füßen auf den harten Boden. Sie wickelte den Schal neu um Hals und Kinn.
Leo schüttelte den Kopf. Er redete nicht viel. Manchmal kam es ihr vor, als wäre er ein Gespenst und ein wesentlicher Teil von ihm woanders geblieben, in einer anderen Welt, einer anderen Zeit. Vielleicht brauchte er deshalb so wenig: kein Brot, keine Wärme, keinen Schlaf. Vielleicht bestand sein Gesicht deshalb zur Hälfte aus Schatten: In die Höhlen, die unter den schwarzen Brauen und den bleichen Wangenknochen lagen, fiel auch mitten am Tag nur selten Licht.
Sie kehrte zu ihrem Bruder zurück, kauerte bei dem Jägerrucksack nieder, der ihr als Kopfkissen gedient hatte, zog eines der zwei Paar Handschuhe aus, die sie getragen hatte, kramte die ihnen verbliebenen Vorräte hervor und sägte mit einem großen Klappmesser, das sie im Mantel versteckt trug, drei Scheiben von einem gefrorenen Schwarzbrot und zwei Scheiben von einem kleinen gefrorenen Schinkenrest und ein paar Brocken von einem dunklen Tilsiter und breitete alles auf dem Reitpelz aus, der ihnen als Matratze diente.
Karlchens Lider begannen zu zittern und sprangen auf. Er brauchte nicht lange, um wach zu werden. Kaum fiel sein Blick auf die Schwester, die vor ihm kniete, lächelte er.
„Guten Morgen!“
„Guten Morgen!“, antwortete er.
„Hast du gut geschlafen?“
„Es ist kalt.“ Er richtete sich fröstelnd auf. „Ist es noch weit?“
Walburga nickte.
„Aber wir schaffen es!“
„Wo ist Leo?“
„Er kommt gleich. Er riecht den Schinken schon.“
„Nein!“ Karlchen lachte glucksend und warf den Kopf nach hinten. „Leo mag keinen Schinken.“
„Aber du schon, oder?“ Leo glitt beinahe lautlos zwischen den Bäumen hervor.
„Ja!“, jubelte Karlchen. „Ich will doch groß und stark werden.“
„Größer und stärker als ich?“
„Nein! Genauso! Genauso wie du!“
„So willst du nicht werden, glaub mir!“ Leo setzte sich zu Karlchen auf den Pelz und rieb sich die Finger, die er dazu von den Handschuhen befreite. „Da hat deine Schwester aber wieder ein tolles Frühstück gezaubert, was? Mit einem heißen Kaffee wäre es perfekt.“
„Wir haben noch ein bisschen Wasser.“ Walburga reichte ihm eine verbeulte Feldflasche, die sie in der Nacht unter den Mantel gesteckt hatte, damit das Wasser nicht gefror.
„Danke!“ Leo hob abwehrend eine Hand. „Vielleicht später!“ Er schob den grauen Schal nach unten, der sein Gesicht bis zur Nasenspitze verbarg, nahm vom Käse und vom Brot und knabberte daran, als schäme er sich, Nahrung aufzunehmen.
Karlchen zog die dicken, viel zu großen Fäustlinge aus, steckte sich ebenfalls ein Stück Käse in den Mund und lutschte daran, bis es allmählich warm wurde und Geschmack absonderte. Er brummte zufrieden. Walburga zog ihm die Mütze zurecht und bediente sich auch vom Käse.
„Er ist immer noch gut“, bestätigte sie.
Sie ließen sich Zeit mit dem Frühstück und hofften, dass der Nebel, der sich in den Flussniederungen teilweise den ganzen Tag hielt und dort den Frost konservierte, lichten würde. Sie tranken ein paar Schluck von dem Wasser in der Blechflasche, dann rollten Walburga und Karlchen die Decken zusammen und schnallten alles auf den Rucksack, der neben dem Essen nur noch etwas Wäsche und ein paar Hemden enthielt. Leos Beutel war längst gepackt.
Sie nahmen den Schlitten, den sie mit dem Pelz gepolstert hatten, und liefen über das Laub, das unter dem Druck ihrer Füße knackte wie Insektenleiber. Die Straße lag jenseits eines mit Schnee bedeckten Felds, das ihre Fußstapfen vom Vorabend zerschnitten. Leo bedeutete Walburga und ihrem Bruder zu warten, ging hinaus bis zu einer Stelle, von der aus er ein größeres Stück der Straße überblicken konnte, und vergewisserte sich, dass niemand unterwegs war. Die großen Trecks gab es längst nicht mehr, und sie waren ohnehin weiter im Norden der Küste gefolgt. Deutsche durften sich inzwischen nur noch auf Befehl und mit Genehmigung der Kommandatura, irgendeiner Kommandatura, bewegen und die drei hatten keinen Befehl und keine Genehmigung. Leo winkte den Geschwistern und gehorsam folgten sie seinen Spuren und marschierten zur Straße.
Der Schnee war von LKW und Kettenfahrzeugen platt gewalzt. Auf den Kuppen und den nach Süden gerichteten Böschungen kamen schon Steine und Erde zum Vorschein. Sie schlugen den Weg nach links ein. Walburga zog den leeren Schlitten hinter sich her, weil Karlchen erst ein bisschen laufen sollte, damit ihm warm wurde. Außerdem sparte sie so Kraft. Sie wusste nicht, wo sie waren, und hatte nur vage Vorstellungen davon, wohin sie wollten, aber sie war zufrieden, dass sie wenigstens konsequent blieben und den einmal eingeschlagenen Weg fortsetzen. Von Leo war in dieser Hinsicht wenig Hilfe zu erwarten. Er wusste genauso wenig, wo sie waren, und noch weniger, wohin er wollte.
Steinheil
Nichts mehr wollte Walburga für sich selbst, die ahnte, dass es längst um alles ging. Immer wieder hatte sie den langen, mit Kerzen, Engeln und Tannenbäumen verzierten Zettel hervorgeholt und immer neuen Revisionen unterzogen. Das Herrenzimmer, mit dem sie ihr Puppenhaus zu erweitern gehofft hatte, erschien ihr auf einmal frivol, der neue Sattel konnte warten, so lange der alte noch einigermaßen hielt, auch die Vogelflinte, mit der sie sich im Jagen hatte üben wollen, wirkte plötzlich überflüssig und einem deutschen Mädel in dieser Stunde der Prüfung, in der die Männer an der Front aus allen Rohren um ihr Leben schossen, doppelt unangemessen. Einen Wunsch nach dem anderen hatte sie gestrichen, nur den einen nicht, den innigsten und allerersten, den, dass endlich die herrlichen, vom Führer längst versprochenen Wunderwaffen kommen und den Unholden im Osten den Garaus bereiten und den Feinden im Westen Furcht und Respekt einjagen und überhaupt den Krieg beenden würden. Sie war ihn inzwischen gründlich leid, diesen Krieg, auch wenn er für sie bisher keine größere Beeinträchtigung bedeutet hatte, als dass ihr schon in Friedenszeiten oft abwesender Vater gar nicht mehr nach Hause kam und dass in den letzten Wochen immer häufiger ihr nur halb vertraute oder sogar völlig fremde Menschen auf dem Gutshof ein Unterkommen suchten, Tante Detterbeck mit Onkel Klaus aus dem angeblich völlig zerbombten Essen etwa oder die Sippe Flochow, die mit Kind und Kegel, Sack und Pack aus dem Memelgebiet geflohen war und bis auf weiteres in Steinheil festsaß und den Eichentisch im Esszimmer so hartnäckig belagerte wie bis vor kurzem noch die tapferen deutschen Truppen das widerspenstige Leningrad.
Fünf Jahre dauerte der Krieg jetzt schon, so lange, dass sie sich kaum an eine Zeit ohne Krieg erinnern konnte und für ihren Bruder, das anstrengende Karlchen, galt das noch mehr, denn dieser war beinahe mit Kriegsbeginn auf die Welt gekommen. Von diesem Karlchen war keine Erinnerung an anderes als Krieg zu erwarten und leider auch keine irgendwie geartete Vernunft, keine Opferbereitschaft, keine selbstlose Hingabe an Volk und Führer. Er war klein und dumm und egoistisch und würde nicht einsehen wollen, dass in dieser schweren Stunde, da die Völker miteinander rangen und das Schicksal Europas, ja der ganzen Welt auf Generationen bestimmt werden sollte, das eigene Wohl hintanzustellen war, nein, Karlchen würde nicht begreifen, dass auch er zurückstecken und Größe zeigen und Verzicht üben musste und nicht ergänzend zu dem ihm an einer Paketschnur traulich überall hinfolgenden Tigga auch noch den neueren, an allen Fronten angeblich fast schon wunderwaffenhaft Angst und Schrecken wirkenden Kampfpanzer Panther in verkleinerter, kindgerechter Form als Geschenk erhalten konnte.
Walburga seufzte. Sie liebte ihren Bruder trotz allem, und sie fürchtete seine Wutanfälle. Sie erfand ihm abends zum Einschlafen - er im Bett bis zur Nasenspitze unter einer Daunendecke verborgen, sie daneben auf einem Stuhl in eine Stola ihrer Mutter gehüllt - immer neue Heldentaten, die sein alter ego Fähnrich Karl an allen Fronten dieses Krieges beging: mal auf Skiern in Finnland im Verbund mit den dortigen Waldjägern, mal am Fallschirm über Kreta oder eben rittlings auf dem Panther inmitten der unendlichen Steppen Russlands. Karlchens Zimmer hing voll detailgetreu bemalter Dorniers, Messerschmidts und Heinkels, die Walburga mit dem Bruder aus Wellpappe, Stanniolpapier, Draht und Holz verfertigt hatte und die sich jetzt gemächlich und ohne kriegerische Hast in der vom Heizkörper aufsteigenden Luft drehten. Und schon den Tiger hatte sie, die waffentechnisch wesentlich bewanderter war als das Christkind oder die Mutter, im vergangenen Jahr beim Förster Lohwitz in Auftrag gegeben, der ihn samt Kanone aus einem großen Klotz Tannenholz geschnitzt, forstgrün angemalt und auf sechs lustig eiernde Rädchen gesetzt hatte, was dem Panzer insgesamt eine derart ungefährliche, direkt putzige Anmutung verlieh, dass sogar Karlchen, nachdem sich die erste Begeisterung gelegt hatte, empört war. Mit so was kann ich keinen Kriech nich gewinnen, maulte er und zog den Tigga anfangs nur unter Protest hinter sich her und hatte bereits im September verlangt, dass das nächste Modell gefälligst martialischer und aus Blech und ein echtes Kettenfahrzeug zu sein habe, und zwar mit Ketten, die wo rasseln und Krach machen, und mit Funken, die wo sprühen. Und genau hier lag das Problem. Vielleicht hätte man in Berlin noch ein diesen Anforderungen genügendes Spielzeug auftreiben können, aber bestimmt nicht hier, im hintersten Ostpreußen, und erst recht nicht jetzt, Ende 1944, mitten im Krieg. Walburga hatte sich gestern trotzdem noch einmal zum Förster aufgemacht, wofür sie zu Pferd eine halbe Stunde brauchte, denn das Forsthaus lag, wie es sich gehörte, am Rande des Guts in den ersten Ausläufern der Buchen- und Eichenwälder, die sich von hier bis zur Pregel und den Masurischen Seen erstreckten. Lohwitz war ein dicker, gemütlicher Mann, der selber nicht mehr ritt, sondern sich zur Fortbewegung einer einspännigen Kalesche bediente, die unter seinem Gewicht schief auf den Blattfedern saß. Er war alles andere als ein Krieger und nahm selbst anlässlich der herbstlichen Treibjagden, die auf den Gütern den Abschluss des Jahres bildeten, bevor der Schnee alles bedeckte und alle Arbeiten außer Eis-Sägen und Holz-Schlagen unmöglich machte, nur widerwillig ein Gewehr in die Hand und zielte mit diesem, wenn überhaupt, nur halbherzig auf die Tiere seines Walds und vermied, wenn möglich, das Schießen ganz, um hinterher nicht die Waffe putzen zu müssen. Dieser Lohwitz also hatte auf Walburgas Frage, ob er für Karlchen nicht einen besseren, gefährlicheren, einen wunderwaffenhafteren Panzer schnitzen könne, nur achselzuckend Panzer is Panzer geantwortet. Wenn Se durchaus wollen, gnä Frau, mach ich einen größeren, hatte er dann noch wie zum Ausgleich angeboten und damit vollends seine kriegs- und wehrtechnische Ignoranz unter Beweis gestellt, denn dieser größere Panzer wäre letztendlich genauso putzig und nutzlos gewesen wie der letztjährige, womit er allerdings, wie Walburga sich eingestehen musste, in nichts dem zu Beschenkenden nachgestanden hätte, denn das diesjährige Karlchen war genauso putzig und nutzlos wie das letztjährige, nur eben um ein paar Zentimeter gewachsen.
Karlchen will eine Waffe für den Endsieg, hatte Walburga gezischt und vor Empörung und frustriertem Fanatismus kaum an sich halten können. Menschen wie der Förster Lohwitz, die so völlig unbeteiligt wirkten, was den Krieg und das Schicksal ihrer Volksgemeinschaft anging, waren ihr unverständlich. Lohwitz, immerhin Veteran des ersten Kriegs, schien in keiner Weise mitzufiebern, sondern wie eh und je und unbekümmert um Bolschewiken und amerikanische Terrorbomber seinem Handwerk im tiefen Wald nachzugehen. Er war kein Parteimitglied, wie ihr Vati offenbart hatte, der die entsprechende Nadel schon seit Jahren bei festlichen Gelegenheiten am Revers trug, und das erklärte sicher manches, aber es lag auch an der generellen Dickköpfigkeit und Gemütsruhe des seit Jahrhunderten hier ansässigen, mehr der Scholle und den Bäumen und dem Korn und den Kornblumen inmitten von diesem als den wechselnden, mal preußischen, mal deutschen, mal polnischen, mal russischen Herrschern verbundenen Menschenschlags.
Lassen Se ma jut sein!, hatte Lohwitz aufreizend gleichmütig gebrummt. Der Lütte will doch bloß spielen. Und dann hatte er auf die Tür gedeutet, die von dem breiten, kalten Flur in die gute, sicher beheizte Stube führte und gefragt, ob er ihr einen Kräuteraufguss anbieten dürfe. Der Schwarztee sei vor ein paar Wochen leider zu Ende gegangen.
Walburga, die eine Mütze und Handschuhe aus Wolfsfell trug, hatte den Kopf geschüttelt und war empört über so viel Defätismus wieder hinaus zu ihrem Pferd gestapft, das dampfend, nur mit einer dünnen Decke bedeckt, unter einem kahlen Apfelbaum auf sie wartete. Wie konnte jemand so gleichgültig sein, so unempfänglich für das Wort und das Wirken des Führers? Warum brannten nicht alle Deutsche wie Vati, wie sie? Wie sollten sie da die übermenschliche Aufgabe bewältigen, die vor ihnen lag, und sich aus der Umklammerung ihrer Feinde befreien? Es waren Menschen wie Lohwitz und nicht irgendwelche mit amerikanischem Material aufgepäppelten Sowjetarmeen, die den Deutschen in letzter Zeit das Siegen so schwer machten. Ein paar Monate noch, ein letzter Durchbruch bis zum Don, bis zum Ural vielleicht, und sie hätten alles erreicht, wovon sie jemals geträumt hatten, aber das begriffen Holzköpfe wie Lohwitz nicht, die viel zu tief in ihrem Wald steckten, um zu sehen, was hier auf dem Spiel stand.
Walburga sah zu den Flugzeugen hoch, die an ihren Bindfäden kreisten. Es würde keinen Panzer geben, beschloss sie finster. Keinen Panther und ganz sicher nicht noch einen Holztiger! Karlchen würde lernen müssen, zu verzichten. Verzicht war das Gebot der Stunde. Nichts wollen als was dem Volke nützt, das würde sie ihren Bruder lehren. Vati würde stolz auf sie sein und auch Karlchen würde sie spätestens, wenn er tatsächlich Fähnrich wurde, verstehen. Sie holte die Liste aus der Schublade, auf der bis auf das neue Paar Winterstiefel inzwischen ohnehin bereits alle Wünsche getilgt waren, zerriss den Zettel in kleine Schnitzel und warf diese in den Papierkorb. Sie erhob sich. Sie war zehn Jahre älter als ihr Bruder, blond wie dieser und erregte immer wieder den Unmut ihrer Mutter, weil sie lieber Hosen trug als Röcke und lieber mit ihrem Pferd über die Stoppeläcker jagte, als sich mit dem Stickrahmen neben den Kachelofen zu setzen. Sie bedauerte es, als Mädchen geboren worden zu sein. Der Volksempfänger hatte empört von den Flintenweibern der Bolschewiken berichtet, eine unehrenhafte, bei Gelegenheit durch die ritterliche Wehrmacht mit aller gebotenen Rücksichtslosigkeit zu bestrafende Anomalie der alliierten Kriegsführung wie die afrikanischen Hilfstruppen der Franzosen und die Negersoldaten der Amerikaner, aber Walburga konnte daran nichts Schlimmes finden und hätte sich liebend gerne in einer Stuka oder einem Panzerwagen, am liebsten jedoch zu Pferde auf die Feinde des deutschen Volks gestürzt, eines Volks, das sie, die am äußersten Rand des gewaltigen Reichs lebte, eigentlich kaum kannte, wie sie sich gelegentlich eingestand. Nach Königsberg fuhren sie ab und zu und erledigten Besorgungen oder besuchten Verwandte, aber nur selten, denn es war eine lange, mühselige Unternehmung und lohnte sich kaum, wenn man am gleichen Tag wieder nach Steinheil zurückkehren wollte, aber schon Berlin war ihr gänzlich fremd, obwohl ihre Mutter aus Potsdam stammte und gerade im Winter von Heimweh gebeutelt wurde. Als Kleinkind, bevor der Krieg das Reisen kompliziert machte und der Tod die dortige Großmutter holte, die sich im Gegensatz zum strengen Großvater sehr um das verwilderte Enkelkind bemüht hatte, war sie noch ein paar Mal dort gewesen, nur erinnerte sie sich an kaum etwas außer breite, staubige Alleen und das Licht im Laub der Lindenbäume hinterm Brandenburger Tor. Inzwischen kamen die Menschen von dort verstärkt zu ihnen, Ausgebombte und Ausgebrannte, und brachten Neuigkeiten mit, berichteten nicht von Tanztees und geistreichen Soireen, müßigen Nachmittagen in Karlshorst und am Wannsee oder fröhlichen Ausritten durch den Grunewald, sondern von Ruinen, Luftschutzbunkern und Sirenen und rissen seltsame, fatalistische Witze, die Walburga überhaupt nicht behagten, ja viel unanständiger auf sie wirkten als alles, was Onkel Rickert, ein eingefleischter Junggeselle, in angetrunkenem Zustand und ohne Rücksicht auf das Zischen seiner Schwägerin und die Anwesenheit minderjähriger Verwandter gelegentlich von sich gab.
Zwei Familien und ein paar Versprengte hatten sie allein im Gutshof aufgenommen, einige mehr noch in den umliegenden Gehöften. Die Magd und die Köchin bekamen von drei weiteren Frauen Unterstützung, ununterbrochen wurde in der großen, im Keller gelegenen Küche gekocht, gebacken und gebrutzelt, und es war ein Glück, dass wegen der Jagden und der großen Feste, die man früher auf Steinheil veranstaltete, die Backrohre und Schüsseln und Töpfe und auch die Vorratskammern, in denen das Mehl noch säckeweise lagerte und ganze Schweinehälften vom Haken hingen, für solche Belastungen ausgelegt waren. Nur fühlte sich Walburga, seit so viele Fremde im Haus wohnten, nicht mehr recht zu Hause hier, und zog sich, wann immer es ging, in das Kinderzimmer zurück, das sie jetzt wieder mit ihrem Bruder teilen musste, seit zwei der Flochows aus Essen in ihrem eigenen Zimmer untergebracht worden waren. Widerwillig nur ging sie also hinunter ins Erdgeschoss, das auch jetzt, am Nachmittag, von den Back- und Kochgerüchen erfüllt war, die vom Keller nach oben drangen, und fand nach längerem Suchen ihre Mutter endlich im ganz im Biedermeier gehaltenen Damensalon. Walburga plante, ihre Mutter mit dem Geständnis der eigenen Enthaltsamkeit und Opferbereitschaft zu beeindrucken und hoffte, für diese Opferbereitschaft um so reicher belohnt zu werden - mit dem Endsieg nämlich, und zwar möglichst schon im Verlauf des nächsten Jahres. Sie wusste, dass ihre Mutter wenig Einfluss hatte in Dingen von militärischer oder gar weltpolitischer Bedeutung und sich eher für anderes interessierte, gesellschaftliche Verpflichtungen zum Beispiel oder die Frage, ob ihre Schneiderin nicht von den Schnitten der aktuellen Mode aus Berlin überfordert wurde, oder den Tratsch ihrer paar wenigen Freundinnen, gutmütigen und unbedarften, von allem Großen ähnlich unberührten Schicksalsgenossinnen, Gestrandeten inmitten einer Wüstenei aus Wald und Weizen, einer vorzeitlichen, von Junkern und Rittern beherrschten, von landlosen Pächtern und Tagelöhnern bestellten Einöde. Trotzdem hatte sie ein Recht, von der moralischen Größe ihrer Tochter zu erfahren, meinte Walburga.
„Mutti ...“, begann Walburga langsam und gedehnt und erinnerte sich gerade noch rechtzeitig, die Hände aus den tiefen Taschen ihrer Breeches zu ziehen und ihre leicht gebeugte, von der Mutter als amerikanischer Kintopp gescholtene Haltung, zu korrigieren.
„Was gibt’s?“ Die Mutter, die an einem zierlichen Tisch saß, wandte sich ihr zu. Sie hatte ihre Lesebrille auf der Nase, was ungewöhnlich war. Sie war in Potsdam auf die Schule für höhere Töchter gegangen, hatte Etikette, Konversation, Tanz, Handarbeiten und ein wenig Französisch gelernt, Bücher aber und überhaupt alles Geschriebene empfand sie als trocken und mühsam. Sie hielt einen Brief in der Hand. Das graue Papier der Feldpost. Walburga erstarrte.
„Hat Vati geschrieben?“
„Er wird nicht kommen. Er bekommt keinen Urlaub. Nicht einmal zwei Tage!“ Die Mutter ließ das Papier sinken. Ihre Lippen waren blass, die Augen hinter den Brillengläsern glänzten.
„Ich habe ihn jetzt seit April nicht mehr gesehen.“ Walburga schob die Unterlippe schmollend nach vorne, ließ sich auf ein zerbrechlich wirkendes Kanapee fallen, als wäre ihr der Boden unter den Füßen weggezogen worden, und kippte theatralisch zur Seite.
„Ich weiß, Schätzchen. Mir geht es da ja nicht anders!“ Walburgas Mutter Hedwig hatte eingeheiratet in die Sippe der von Steinheils, und das unter falschen Voraussetzungen. Sie hatte Erich in Potsdam kennen gelernt, wo er als Offizier stationiert war. Ihr war es charmant erschienen, dass er aus Ostpreußen stammte, dem wilden Osten, der mit seinen Sümpfen, Auen und Wäldern, seinen langen, harten Wintern und kurzen, unbarmherzig heißen Sommern eher für Elche, Pferde und Mücken geschaffen schien als für zivilisierte, an Pariser Mode und Charlottenburger Tratsch gewöhnte Menschen, aber charmant und anregend gerade deshalb, weil Erich sich aus diesen Sümpfen hervor gearbeitet und sie hinter sich gelassen hatte. Sie verliehen seinem vielleicht ein bisschen blassen, ein bisschen zu eilfertigen Charakter eine gewisse Tiefe, etwas Uriges, Ursprüngliches, ja Männliches, was sonst weder die adlige Abstammung noch die Uniform so richtig zu bewirken vermochten. Aber sie blieben eben im Hintergrund, sie waren eine bloße Erinnerung, denn Erich war der Zweitgeborene - oder sogar nur Drittgeborene, wenn man die mit einem sanften, aber für immer kindischen Gemüt geschlagene Schwester mit einrechnete, die ihr Leben in einem Heim in Königsberg zubrachte - und nicht er, sondern der Bruder Günther war Erbe des Titels und des Gutshofs, was allen Beteiligten ganz recht war, denn Erich war anders als der Bruder kein Freund der Arbeit und kommandierte lieber gefügige Rekruten als widerspenstige, des Deutschen kaum mächtige Erntehelfer und kämpfte lieber in den Sandkästen des Generalstabs als gegen Sommerdürre und Winterfrost. Dieses gefällige Arrangement fand ein jähes Ende, als Günther sich beim Reiten das Genick brach und Erich um seine Demission bitten musste, damit er das Gut übernehmen konnte. Seine Frau, die von Ostpreußen nicht mehr wollte als jeden Sommer ein paar Wochen auf dem Gut und am Strand von Palmnicken, war entsetzt und ließ sich nur widerwillig und Schritt für Schritt davon überzeugen, dass es eine heilige Pflicht war, die 400jährige Familientradition aufrecht zu halten.
Inzwischen waren mehr als zehn Jahre vergangen und Hedwig tat sich immer noch schwer mit dem Leben auf dem Gutshof, das ihr allem Luxus zum Trotz bäuerlich erschien, einsam und primitiv, den Jahreszeiten unterworfen, restlos der Nahrungsmittelproduktion und dem Überleben von Mensch und Vieh gewidmet. Die wenigen Feste, die es gab, waren lächerlich und schmerzten eher, als dass sie Spaß bereiteten, weil sie deutlich machten, wie weit entfernt Glanz und Witz der Hauptstadt waren. Das gesellschaftliche Leben beschränkte sich auf Besuche bei den Gutsbesitzern, die mit vertretbarem Aufwand zu erreichen waren, und das waren nicht viele und interessant war für eine junge Frau aus der Großstadt keiner von ihnen oder man lud diese Leute zu sich ein, was einem die Fahrt in der Kutsche ersparte, aber für die Gastgeberin und ihre Helferinnen hektische Vorbereitungen in der Küche, der Schlachtkammer, dem Speisezimmer bedeutete, denn alles Essen - Brot, Butter, Käse, Wurst, Schinken, Geflügel, Wild - wurde auf dem Hof produziert, und zwar auch noch während des Kriegs in überwältigenden Mengen. Und hatte Hedwig anfangs gehofft, wenigstens in ihrer Tochter, die ja in Potsdam geboren war, irgendwann eine Verbündete zu finden, sah sie sich nach ein paar Jahren auch darin bitter getäuscht, denn Walburga lief mit wehenden Fahnen zu den Eingeborenen über, war nur noch mit Gewalt im Haus zu halten, egal wie das Wetter war, und jagte mit den übrigen Kindern des Gutshofs, denen der Pächter und der Angestellten, über die Felder und durch die Wälder, spielte mit ihnen am Löschteich mit seinem Entenhaus Störtebeker und in der Fichtenschonung jenseits der Auffahrtsallee aus alten Eichen Winnetou und unterschied sich von ihnen bald nur noch dadurch, dass sie Schuhe trug und nicht in die Dorfschule ging, sondern, wann immer diese ihrer habhaft wurden, von Privatlehrern und Gouvernanten mehr schlecht als recht in Deutsch, Französisch und ein bisschen Rechnen unterrichtet wurde. Als der Krieg begann, war dieser in den Augen des zunehmend verwildernden Kinds eine Fortsetzung dieser Abenteuer mit anderen Mitteln, und es brauchte nicht viel, da sprang die Begeisterung, welche die Feldzüge der Wehrmacht im Vater geweckt hatten, der als Offizier der Reserve sofort einberufen und erst in Frankreich, dann in Berlin stationiert worden war, auf die Tochter über.
Erich war anders als der inzwischen verstorbene Großvater, der mit der Arroganz alten Adels Abstand gehalten hatte zu den braunen Emporkömmlingen, schon früh zu den Nationalsozialisten konvertiert, was ein wenig damit zusammenhing, dass er als Soldat in Potsdam gelebt hatte, und sehr viel damit, dass er sich vom übermächtigen Vater, der irgendwelchen verklärten mittelalterlichen Ritteridealen anhing, unterscheiden und sich im Gegensatz zu diesem im Ostpreußischen Morast verwurzelten Junker der modernen Welt öffnen und sich dem populären Verlangen nach ausreichendem Lebensraum und völkischer Reinheit nicht verschließen wollte. Seine Autorität zumindest zu Hause, auf dem Gutshof und in der Familie, war keine gewachsene oder irgendwie verdiente, sondern wirkte immer künstlich und angemaßt, was er wohl ahnte und was ihn oft schreien und toben und wüten ließ, was wiederum seiner Autorität nur noch weiter Abbruch tat, aber die Erzählungen vom Führer und seinen Wundertaten, vom neuen Berlin und seinen Übermenschen, mit denen er während der anfangs noch recht häufigen und ausgedehnten Front- und Heimaturlaube seine Tochter zu Bett brachte, machten auf diese viel mehr Eindruck als die Märchen und Rittersagen, die ihr die Mutter und das Kindermädchen in seiner Abwesenheit vorlasen. Für Walburga stand schnell fest, dass in den Soldaten der Wehrmacht und im Führer und seinen getreuen Gefolgsleuten die Recken des Deutschen Ordens wiederauferstanden waren. Ihr Vater bestätigte sie in diesem Kinderglauben gerne, kam aber immer seltener nach Hause, je düsterer die im Volksempfänger verlesenen Wehrmachtsberichte wurden. Walburga, die regelmäßig den in ihrem Schulatlas mit Bleistift eingetragenen Frontverlauf aktualisierte, war sich auch so längst bewusst, was die angeblichen Begradigungen tatsächlich bedeuteten und dass der Krieg sich ihrer Heimat näherte. Und jetzt bekam ihr Vater nicht einmal zum Julfest frei! Die Entscheidungsschlacht musste kurz bevor stehen.
„Ist es wegen unserer Offensive?“ Walburga richtete sich wieder auf. Ihre Wangen röteten sich vor Aufregung. Sie hatte es geahnt. Irgendwann mussten sie ja endlich kommen, die Wunderwaffen. „Greifen wir jetzt schon an? Das würde den Russki ganz schön überraschen.“
„Keine Ahnung!“ Hedwig blickte ihre Tochter an, als habe sie es mit einer Fremden zu tun. Vor allem der dauernde Enthusiasmus ihrer Tochter war der unermüdlich erschöpften Mutter ein Rätsel. Sie fragte sich, wie dieses bewegungssüchtige Kind neun Monate lang in ihrem Bauch hatte ausharren können. „Absolute Urlaubssperre, mehr verrät er nicht.“ Es klang wie ein Vorwurf, auch wenn Mutter und Tochter wussten, dass die Zensur ausführlichere Informationen gar nicht zugelassen hätte. Sie erinnerten sich allerdings auch daran, dass Erich bei seinem letzten, auf zwei hektische Tage beschränkten Besuch ungewöhnlich wortkarg gewesen war und nicht wie sonst von den Kameraden, den Waffen, den eroberten Ländern und Städten geschwärmt, nicht über die besiegten Armeen und ihre Offiziere gelästert, nicht die Effizienz und Findigkeit, mit der er in der Etappe den Nachschub organisierte und die Erfolge an der Front überhaupt erst ermöglichte, herausgestrichen hatte. Er war ein Angeber, das wusste seine Frau längst, die Tochter aber hing mit weit aufgerissenen Augen an seinen Lippen und glaubte ihm alles und sah die Panzerfahrer in goldenen Rüstungen gegen die roten Drachen ins Feld ziehen, welche die Heimat zu verwüsten drohten. Bis zum bitteren Schluss hatte sie gehofft, Stalingrad werde sich noch als geniales Gambit erweisen, mit dem der Führer den tumben Bolschewisten überraschend und endgültig den Garaus bereitete, und um so enttäuschter war sie damals gewesen, als ihr Vater sie bei seinem Besuch kaum eines Wortes würdigte, um so erschrockener, weil er sie schon bei der ersten vorsichtigen Frage nach dem Stand der Dinge anblaffte und eine dumme Gans nannte und für die restliche Zeit in mürrisches, von gelegentlichen Flüchen auf die Fremdarbeiter, die statt der eingezogenen Deutschen auf dem Gut arbeiteten, unterbrochenes Schweigen verfiel. Faul, verfressen und aufsässig seien die Franzosen, war ihm apropos Pierre eingefallen, der sich seit zwei Jahren um die Kühe des Guts kümmerte, als wären es die eigenen, die er in der Bretagne mitsamt Familie zurücklassen musste, und der auch hier, in der Fremde, als gleichsam versklavter Gefangener, so wirkte, als wäre er sein eigener Herr und als gingen ihn das Kriegsgeschehen und die Erfolge und Rückschläge der deutschen Truppen nichts an, und der mit seiner Fröhlichkeit, seiner Hilfsbereitschaft und seiner Geschicklichkeit in allen Dingen, der mit dem Erfinden von immer neuen Spielen für die Kinder ebenso wie mit koketten, durch sein niedliches Deutsch von jeder Anzüglichkeit befreiten Komplimenten für die Frauen die Herzen aller gewann.
Machen Sie Pause vom Siegen? hatte Pierre mit der Mistgabel in der Hand in seinem eher baltisch als bretonisch gefärbten Deutsch gefragt, als Erich den Stall inspizierte, und sein schiefes Grinsen bewies dabei, dass er ganz genau wusste, wie es stand an der Front im Allgemeinen und vor Stalingrad im Besonderen, genauer jedenfalls, als irgendwer auf dem Gut zuzugeben wagte.
Mit euch rechnen wir ab, wenn’s so weit ist, hatte Erich lahm gedroht. Und kaum war Pierre in seinen Galoschen weitergeschlurft, hatte er wie für sich, aber für die Tochter an seiner Seite durchaus verständlich angefügt: Der wird sich noch wundern! Der wird seinen de Gaulle noch dafür verfluchen, dass er uns nicht gegen die Bolschewisten helfen wollte!
Brauchen wir denn Hilfe? hatte Walburga vorsichtig gefragt, als sie endlich den Mut dafür gefunden hatte, denn sie fürchtete einen erneuten Ausbruch ihres Vaters und noch mehr die Antwort, die er ihr vielleicht geben würde.
Ihr Vater, der immer noch dem impertinenten Franzmann hinterher sah, hatte nur geschnaubt und den Blick ein letztes Mal über das Dutzend Milchkühe schweifen lassen und war wortlos hinaus gestampft.
„Ich bin sicher, diesmal schaffen wir es bis nach Moskau!“, verkündete Walburga jetzt voll künstlicher Begeisterung ihrer Mutter. „Dem Panther sind sie nicht gewachsen.“
„Dem Panther?“, fragte Hedwig zerstreut und nahm die Lesebrille ab.
Walburga seufzte. Es würde zu weit führen, ihrer Mutter alles auszuführen, was sie wusste. Besser, sie, die im eigenen Nähzimmer oder eher noch den Salons von Berlin und Potsdam zu Hause war, nicht mit den Details des Kriegs zu belasten!
„Karlchen will auch einen, aber den kriegt er nicht, weil wir jetzt alle zurückstecken müssen für Volk und Führer.“ Walburgas Blick wanderte wie von selbst zu der kleinen Anrichte mit der Marmorplatte, über welcher der Führer in einem schlichten Holzrahmen hing, eine Hand auf die andere gelegt, und streng und doch gütig über Mutter und Tochter wachte.
„Karlchen!“, wiederholte die Mutter wie in Erinnerungen schwelgend und lächelte. Sie sah in Karlchen nicht den kommenden Fähnrich, sondern die verkörperte Unschuld, Überbleibsel einer Welt ohne Krieg und letzte Erinnerung an diese.
„Das Problem sind die Ketten.“ Walburga hoffte, mit diesem betont technischen Detail aller Sentimentalität seitens der Mutter vorbeugen zu können. „Er ...“
„Vielleicht ist es besser, wenn ihr schon mal abreist“, fuhr die Mutter im gleichen verträumten Ton fort, einem Ton, der ihre Tochter regelmäßig zur Weißglut trieb.
„Wie ... schon mal abreist?“
„Ich habe den Amberließens geschrieben. Maud würde sich freuen, und es wäre ein gutes Stück weiter im Westen.“
„Wovon redest du überhaupt?“ Nicht zum ersten Mal kamen Walburga Zweifel, ob ihre Mutter noch bei Verstand und voll und ganz im Hier und Jetzt verankert war.
„Von Weihnachten! Wenn euer Vater nicht hier ist, macht es eh nicht viel Sinn.“
„Das Julfest hat doch mit Vater nichts zu tun. Es ist alter germanischer Brauch. Überall in Europa, in Narvik, in Finnland, in Russland, auf Kreta, auf dem Atlantik und in der kalten Nordsee werden unsere Truppen innehalten und sich ihres gemeinsamen Erbes und der Verpflichtung zu Großem, die daraus erwächst, besinnen.“ Walburga deklamierte dies wie Altbekanntes, das ihre Mutter, dieser in vielem hoffnungslose Fall, eigentlich längst wissen müsste.
„Natürlich, mein Schatz!“ Ihre Mutter lächelte nachsichtig, was Walburgas Wut nur noch steigerte. „Und genau deshalb kann es uns ja auch egal sein. Wir gehören nicht zur Truppe.“
„Gehören wir wohl!“, rief Walburga empört. „Alle vom Säugling bis zum Greis sind gefordert bei diesem entscheidenden Ringen der Völker. Onkel Alfred sagt ...“ Onkel Alfred war gar kein Onkel, sondern der örtliche Kreisleiter, ein entfernter Verwandter der von Steinheils, der an dem blonden, so völkisch empfindenden, so zutraulich seinen pompösen Phrasen lauschenden Mädel Gefallen gefunden hatte - ein bisschen zu viel Gefallen, wie die Mutter meinte. Besonders, dass Walburga auch mit ihren 15 Jahren immer noch wie selbstverständlich auf seinen Knien Platz nahm und sich von seinen langen, bleichen Fingern kitzeln und zwicken ließ, missfiel ihr.
„Onkel Alfred sagt viel.“
„Er trägt das Ritterkreuz!“
„Dann soll er selber an die Front, anstatt hier den Leuten Vorhaltungen zu machen!“, entfuhr es der Mutter und sowohl Walburga als auch Hedwig selbst erschraken über diesen Ausbruch, der so gar nicht zu der resignierten, ganz der Nostalgie und den Modezeitschriften ergebenen Person passen wollte, die sie hier, verbannt in ein barbarisches Land, kultiviert hatte. Schon eine eigene Meinung zu haben und diese laut zu äußern war ungewöhnlich für sie, aber dass sie derart offen den Konflikt mit ihrer Tochter suchte, war fast schon ein Skandal.
„Vorhaltungen?“ Onkel Alfred hatte in der Woche zuvor wie fast jede Woche das Gut besucht und ein wenig nach dem Rechten gesehen, wie er es nannte, also die Fremdarbeiter kontrolliert und gezählt und nach zwei Söhnen eines Pächters gefahndet, die jetzt trotz ihres teilweise polnischen Bluts zur Wehrmacht eingezogen werden sollten, aber Walburga konnte sich nicht erinnern, dass es dabei zum Streit mit ihrer Mutter gekommen wäre. Diese konnte Alfred nicht leiden und konnte dies auch nicht verbergen, das war bekannt. Sie hielt ihn für einen Wichtigtuer und Denunzianten und, das wog in ihren Augen am Schwersten, für einen pedantischen Kleinbürger, aber sie hatte ihn immer toleriert, weil er in gewissem Sinn zur Familie gehörte und weil sie ohnehin nicht viel zu sagen hatte auf Steinheil. Auch in Abwesenheit ihres Mannes nicht!
„Er lässt uns nicht weg.“ Es hatte Hedwig sichtlich Kraft gekostet, dies zuzugeben. „Er will uns keine Erlaubnis zur Evakuierung ausstellen. Nicht einmal die Wagen dürfen wir vorbereiten.“
„Du wolltest fliehen?“, rief Walburga entsetzt.
„Ich will zumindest vorbereitet sein, falls das Schlimmste eintritt.“
„Was soll das? Das ist Defätismus. Das ist ... Wir siegen doch. Jetzt kommen die Wunderwaffen. Wir werfen die Russen zurück bis hinter den Ural. Dahin, wo sie hingehören! Wir ...“
„Du redest schon genauso wie er.“ Hedwig schüttelte traurig den Kopf.
„Wie der Führer?“, fragte Walburga hoffnungsvoll.
„Nein, Gott bewahre! Wie Onkel Alfred! Aber dem merkt man die Angst an! Er weiß genau, wie es ausgehen wird, nur will er es nicht zugeben. Und er will die ganze Welt mit reinreißen. Wenn es ihm und seinen Spießgesellen an den Kragen geht, sollen auch alle anderen daran glauben: Kinder, Frauen, unsere Franzosen. Aber noch ist es nicht zu spät! Wir könnten uns ins Reich retten. Nach Potsdam, vielleicht sogar zu Tante Käthe in München!“
„Weiß Vati, was du da redest?“
„Wie denn? Er muss doch schauen, dass die Versehrten nicht den Nachschub an noch Unversehrten blockieren. Er hat keine Zeit für uns.“
„Er kämpft für uns. Er kämpft für Deutschland.“
„Mein Kind, was soll das? Uns ging es doch Gold. Wir hatten alles und noch mehr. Was wollen wir mit Polen? Was wollen wir mit Russland?“
„Wir müssen uns befreien. Wir brauchen Lebensraum.“
„Sag das meinen Brüdern!“
„Sie sind für Deutschland gefallen. Eine größere Ehre gibt es nicht.“
„Ich verbitte mir solche dummen Phrasen! So was will ich von dir, einem halben Kind, das nichts weiß vom Leben, nicht hören, und schon gar nicht in Bezug auf Reiner und Karl.“
„Ich bin kein Kind mehr.“ Walburga starrte ihre Mutter wütend an.
„Vielleicht, aber du hast keinen Schimmer von dem, was uns droht! Und du musst nur in Alfreds Gesicht sehen, um zu erkennen, dass es unausweichlich ist.“ Hedwig massierte sich die Nasenwurzel, auf der die Brille rote Flecken hinterlassen hatte. „Es würde wie ein Weihnachtsbesuch aussehen, wogegen auch ein Fanatiker wie Alfred nichts einzuwenden haben dürfte. Wir würden euren Schlitten mit Geschenken vollladen, ein paar Schinken zum Beispiel, Mehl und Schmalz, dann brauchen wir das nicht auch noch mitzuschleppen, wenn es endlich so weit ist und wir alle nachkommen dürfen: Onkel Rickert, die Essener und der Rest! Vermutlich werden wir uns auch um die Franzosen kümmern müssen. Ich bin mir sicher, dass die Herrschaften, von denen sie hierher verschleppt wurden, sich einen Dreck um sie scheren, sobald die Russen anrücken.“
„Was sollen wir denn in Markow?“
„Charlottchen war mal deine beste Freundin.“
„Charlottchen trägt den ganzen Sommer über weiße Kleidchen. Sie ödet mich an.“
„Es ist nicht mehr Sommer. Schon lange nicht mehr! Und es wird lange dauern, bis er wieder kommt und wer weiß, was bis dahin alles mit uns passiert ist.“
Walburga zog eine Schnute. Die Amberließens waren ebenfalls Gutsbesitzer und hatten eine Tochter und ein Zwillingspaar und Charlotte und die beiden Jungs waren ungefähr in dem Alter von Walburga beziehungsweise Karlchen. Maud Amberließen war eine Freundin von Hedwig aus Potsdamer Tagen und hatte als Tochter eines englischen Tuchhändlers einen ehrgeizigen, an der Humboldt Universität ausgebildeten Agronom geheiratet, der ein hoch verschuldetes Gut übernommen hatte, um mit diesem beispielhaft zu demonstrieren, wie Ostpreußens veraltete Landwirtschaft zu modernisieren wäre. Die Familien besuchten einander zwei- bis dreimal im Jahr, aber die Amberließens hatten ihren Betrieb auf amerikanische Dieselschlepper umgestellt, fuhren mit dem Auto statt mit der Kutsche und hielten daher keine Pferde mehr, stammten nicht nur von außerhalb, sondern waren auch noch bürgerlich, was Walburga, die im tiefsten Inneren ihres Herzens ein Snob war, am allermeisten störte. Sie und Karlchen spielten zwar mit den Kindern der Pächter und Angestellten, bauten mit ihnen Ritterburgen und Indianertipis, Häuser im Wald und Käfige für die Kaninchen, aber Walburga übernahm immer ganz selbstverständlich das Kommando, entschied, was gemacht wurde, und trug stoisch die Verantwortung, falls etwas schiefging und sich der Sohn des Stallmeisters mit der Axt in den Fuß hieb oder die Kaninchen wegen eines falsch konstruierten Dachs dem Fuchs zum Opfer fielen. Die Kinder der Amberließens aber hatten sie bei den letzten Treffen nicht mehr als ihre Lehnsherrin akzeptieren wollen und sich offen gegen ihre Herrschaft aufgelehnt.
Wir sind nicht deine Vasallen! hatte Charlotte mit zornbebender Stimme geantwortet, als Walburga mal wieder beiläufig und doch nachdrücklich wie eine geborene Befehlshaberin festgelegt hatte, wer zu den Elfen und wer zu den Trollen gehörte und wer sie, die verbannte Prinzessin, befreien, wenn auch nicht ehelichen dürfe. Wir glauben nicht an Prinzessinnen und auch nicht an Drachen. Ihre Zwillingsbrüder John und James nickten dazu eifrig und Walburga fürchtete seither, dass die Amberließens an überhaupt nichts glaubten, nicht an Elfen, nicht an Trolle und vermutlich nicht einmal an den Führer, dass sie zänkische Demokraten waren oder gar völlig ehrlose, allein dem Eigennutz verschriebene Krämer, so wie die englischen Vorfahren ihrer Mutter.
„Ich setzte mich nicht mit dem Feind unter den Julbaum.“
„Aber Kind, was redest du da?“
„Sie haben englisches Blut. Sie können gar nicht unsere tiefsten, innigsten Traditionen verstehen.“
„Jetzt sei nicht albern! Die Amberließens sind so deutsch wie du und ich. Abgesehen davon spielt das alles gar keine Rolle mehr. Es geht nur noch darum, nicht russisch zu werden.“
„Das ist doch lächerlich.“ Walburga erhob sich abrupt. Sie glaubte, es war am Besten, ihre Mutter nicht ernst zu nehmen.
„Ihr fahrt, ob du willst oder nicht. Ich habe Heinrich bereits angewiesen. Er wird für den zweiten Weihnachtstag einen Schlitten vorbereiten und euch nach Markow bringen. Er muss nur wieder zurückkommen. Wir brauchen ihn leider hier noch und er will sicherstellen, dass auch seine Frau den Russen entkommt.“
„Das hast du dir ja alles fein ausgedacht. Aber nicht mit mir! Ich habe Vati und dem Führer versprochen, die Stellung zu halten. Bis zum Letzten, wenn es sein muss!“
„Dein Vater ist sicher meiner Meinung. Er hat sich nur nichts mehr gegen Onkel Alfred zu sagen getraut, seit der in der Partei Karriere gemacht hat, das ist alles.“
„Und was, wenn ich nicht will?“
Die Mutter wusste längst, dass ihr die Tochter fremd geworden war, ja, ihr eigentlich schon immer fremd gewesen war. Als ein ihr fremdes Stück Fleisch war sie aus ihrem Bauch geschlüpft, als ein ihr fremdes Stück Fleisch war sie an ihrer Brust gehangen, gierig, unermüdlich, undankbar. Wild und herrisch war sie, schlimmer noch als der Bruder, der ihr gefolgt war, und weder an Puppen noch an Schleifen interessiert, sondern allein daran, die Mutter, die insgeheim auf eine Verbündete und eine Leidensgefährtin in der barbarischen Verbannung gehofft hatte, zu demütigen und zu enttäuschen. Sie war eher ein Kind der Wälder und der Sümpfe, der Pferde und der Elche als das der Berlinerin Hedwig und ihres miesepetrigen und blutarmen, weder am Jagen noch am Reiten wirklich interessierten Ehemanns, ein Wechselbalg, der ihnen von Kobolden oder irgendwelchen heidnischen, den Deutschrittern entgangenen Geistern untergeschoben worden war. Der spärliche Unterricht in der lokalen Dorfschule hatte daran nichts geändert, sondern im Gegenteil eher befürchten lassen, dass Walburga dort in der Gesellschaft des nur halb zivilisierten Nachwuchses von Bauern, Köhlern und Waldarbeitern weiter verwilderte, weshalb schon bald eine endlose Reihe von Privatlehrern mit dem Versprechen fürstlicher Entlohnung nach Steinheil gelockt worden war, wo diese sich bemühten, das bockige Kind mittels Tanz, Musik und französischer Konversation zu domestizieren, woran sie ebenso scheiterten wie an dem Versuch, sich an ein einsames, kulturloses Leben zwischen Mücken, Seen und Wäldern zu gewöhnen. Im Frühjahr und im Herbst machte bodenloser Schlamm auf den unbefestigten Wegen ein Fortkommen fast unmöglich, im Winter verbannte einen klirrender Frost hinter den nächsten Ofen, die Hitze des Sommers ließ einen von Schatten zu Schatten schleichen und die Bücherkisten, deren Inhalt einem Abkömmling der gebildeten Stände das Überleben sicherte, leerten sich schneller, als sie sich in Königsberg, dieser Oase, diesem Leuchtturm inmitten einer geistesfernen Wüste, auffüllen ließen. Kurz: Die Pädagogen hielten es selten länger als ein halbes Jahr aus auf dem Gut und Walburga war jedes Mal froh, wenn wieder einer von ihnen Köfferchen und Schiffstruhe packte und sich mit dem Pferdekarren auf den langen, holperigen Weg zur Schmalspurbahn in Radnitz machte. Ihre Bildung, wenn man sie überhaupt als eine solche bezeichnen wollte, war unter diesen Umständen äußerst unvollständig geblieben und es bestand wenig Aussicht, dass sie zu mehr als der Aufnahme in einem Institut für höhere Töchter in Berlin oder Potsdam genügen würde, aber ausgerechnet dort konnte sich die Mutter ihre Tochter am allerwenigsten vorstellen, dort, wo sie selbst sich so wohl gefühlt hatte und wo sie von einem Leben geträumt hatte so ganz anders als dem, dem sie inzwischen unterworfen war: von einem Leben leicht und fein wie Seide, süß und sanft wie ein parfümierter Hauch.
„Was du willst, ist ganz egal“, zischte Hedwig. „Ich befehle es dir einfach.“
Walburga zitterte. Sie war verwirrt. Sie war es nicht gewohnt, ihrer Mutter zu gehorchen, weil diese ihr so selten etwas befahl und es meistens vorzog, durch Jammern, Klagen, Flehen und verzweifelte Appelle an das kindliche Gewissen zu wirken. Andererseits waren Befehle etwas Besonderes. Sie banden jeden Deutschen an den einen, den allerersten und absoluten Befehlshaber, den Führer, und waren damit letztendlich Ausdruck seines Willens, Zeichen seiner Fürsorge und Manifestation der Gnade. Walburga verstand sich als vorletztes Glied einer langen Kette, die bis ganz nach oben, bis ins Führerhauptquartier reichte, und befahl ihrerseits Karlchen gerne und mit Nachdruck und erwartete dann Gehorsam, keine Debatten, und wenn er ihr nicht unverzüglich das Butterbrot holte, das sie sich wünschte, oder sich weigerte, ins Bett zu gehen, weil er störte, dann zog sie ihm empört und voll gerechtem Zorn die Ohren lang. Sie gehorchte voll Inbrunst, denn wer gehorchte, spürte den Geist des Führers in sich, aber sie gehorchte nicht jedem. Sie unterwarf sich voll Freude Respektspersonen von tadelloser Gesinnung wie ihrem Vater oder Onkel Alfred, die wiederum von höheren Ebenen angewiesen wurden und in ihrem fraglosen Tun und Kommandieren immer nur Deutschlands Wohl und Größe vor Augen hatten, aber sie hatte sich zum Beispiel ihren manierierten, vornehmlich an ästhetischem Schnickschnack interessierten Lehrern verweigert, die französische Vokabeln forderten, die mit Deutschlands Größe nichts, aber auch rein gar nichts zu tun hatten, und Tanzschritte, die das ungelenke, eher dem Marschieren zugetane deutsche Wesen geradezu verhöhnten. Und jetzt erteilte ihr ausgerechnet Hedwig einen Befehl, die für ihre Rolle als Mutter und Lebensspenderin vom Führer zwar mit besonderen Weihen versehen war, die aber gleichzeitig einen bedauerlichen, Walburga seit langem schier unerträglichen Hang zum Oberflächlichen und bloß Häuslichen pflegte, keinerlei Interesse an weltpolitischen Zusammenhängen hatte, allen Ideen, die von völkisch gestimmten, aber schlecht riechenden Menschen wie Onkel Alfred vorgebracht wurden, skeptisch, wenn nicht gar ablehnend gegenüberstand und urdeutsche Tugenden wie Leidensfähigkeit und Opferbereitschaft für Zumutungen hielt, die unnötig waren in einer idealen Welt voll Tanztees und galanten Festen, Kurkonzerten und Modezeitschriften.
Walburga spürte, dass es ihrer Mutter diesmal ernst war, ernster als es für diese frivole, sogar im Krieg aller wesentlichen Sorgen und Nöte, aller grundsätzlichen Bedenken ledigen, höchstens von instinktivem Widerwillen und geschmacklichen Vorbehalten geleiteten Frau typisch war. Und dieser Ernst imponierte ihr. Er verlangte ihr einen Respekt ab, den sie bisher noch nie für ihre Mutter empfunden hatte. Sie fragte sich, was diese neu gewonnene Statur und Autorität für sie, die Tochter und Befehlsempfängerin, in der nächsten Zeit wohl heißen würde und erkannte, dass sie nur Hedwigs Befehl Gehorsam leisten musste, um möglichen Konflikten mit einer erstarkten Widersacherin und einem eventuellen Verlust an Freiheit zu entgehen. Auch wenn sie dies ihrer Mutter gegenüber nicht eingestehen würde, so könnte die Schlittenfahrt zu den Amberließens außerdem die lang ersehnte Abwechslung in einem bisher so trüben, lustlos zwischen Hoffen und Bangen schwebenden Winter bedeuten.
„In Ordnung, Mutter!“, brummte Walburga, knickste ironisch, wandte sich von der verblüfften Hedwig ab und schlurfte ohne ein weiteres Wort davon. Es sollte ihrer herzlosen Mutter eine Lehre sein. Sie würde schon noch sehen, was sie davon hatte, ihre Kinder ausgerechnet jetzt auf eine Schlittenexpedition zu schicken. Sie fragte sich, wie lange es wohl dauern würde, im Winter und im Krieg nach Markow zu reisen, wenn die Fahrt dorthin schon im Sommer und mit der Eisenbahn einen vollen Tag in Anspruch nahm. Es würde sicher ein Abenteuer werden und wenn sie vermutlich auch keine Russen zu Gesicht bekommen würden, dann vielleicht doch wenigstens Wölfe. Sie machte sich auf die Suche nach Karlchen, um ihn von diesen aufregenden Aussichten zu berichten. Im Keller herrschte wegen des bevorstehenden Fests, aber auch, wie Walburga sich jetzt eingestehen musste, wegen der von ihrer Mutter vermutlich schon länger heimlich und verräterisch geplanten Flucht aufgeregte Betriebsamkeit. Ein Schwein war geschlachtet worden und jetzt mussten Schinken geräuchert und Würste gekocht werden und überall dampften große Töpfe, Schwaden hingen unter der Decke, Wasser und Blut machten den Boden rutschig, und die Köchin Martha, die beiden Hausmädchen und zwei weitere, extra für dieses Ereignis herbei befohlene Helferinnen liefen mit hochgeschobenen Ärmeln und verschwitzten Gesichtern hin und her und hatten keine Zeit für irgendwelche Kinderangelegenheiten und auch nicht für Walburga, obwohl die sich längst erwachsen glaubte.
„Weiß Herr Hinkebein, dass ihr geschlachtet habt?“, fragte Walburga ganz allgemein in das Tohuwabohu der Küche hinein, brach ein Stück von dem frisch gebackenen Brot und tunkte es in die mit Grütze und Schwartenstücken versetzte Blutsuppe, die in einem der Töpfe vor sich hin blubberte. Der Dorfschullehrer Hinkebein war von Onkel Alfred zum Ortsgruppenführer ernannt worden und sollte insbesondere darauf achten, dass die auf Steinheil noch reichlich vorhandenen natürlichen Ressourcen möglichst vollständig dem Kriegszweck oder wenigstens der Partei und ihren Mitgliedern zugeführt wurden.
„Hinkebeen hat schon immer weniger wie seine Kinner gewusst, und nu muss er erst recht nich allet wissen“, brummte die dicke Köchin, die eine Zinkwanne voll dampfender Gedärme zu den Steinbecken der Waschküche schleppte, wo sie gewendet und gereinigt werden sollten.
„Weißt dann wenigstens du, wo mein Bruder steckt?“ Walburga griff in ein Fass und streute eine Handvoll Salz in den Blutbrei.
„Der wär mir fast in een von den Pötten gefallen für ne Wurst nach Gutsherrnart, da hab ick ihn schnell zum Heinrich geschickt. Früher ham die Kinder Christbaumschmuck gebastelt, jetzt schnitzen se Wunderwaffen.“ Die Köchin schüttelte verständnislos den Kopf. „Na ja, wern wohl wirken wie die echten“, fügte sie an und stellte die Schüssel neben die Spüle.
Walburga überhörte diese Spitze und sah sich um.
„Und der Majoran, wo ist der?“
„Is Krieg, gibt keen Majoran mehr und keen Anstand.“ Die Köchin schnitt das Fettende vom Darm.
„Wieso Anstand?“ Walburga war der Köchin unwillkürlich gefolgt.
„Haste nich gehört? Dein sauberer Hinkebeen war mit zween von seinen Radaubrüdern bei der Toni und hat ihr den Franz genommen. Drei tote Söhne sin wohl nich genug.“
„Wenn der Führer das wüsste, ich bin mir sicher ...“
„Hör mich doch mit deinem Führer uff, Kindchen! Dem sin wir einfache Leut genauso egal wie die Franzosen auf’m Kartoffelacker draußen. Die ham nüscht zum Anziehen und stopfen sich unsere Zeitungen unters Hemd, damit se nich erfrieren.“ Sie machte sich mit einem langen Holzstab, in dessen eines Ende ein Haken geschraubt war, daran, den Darm umzustülpen. „Voll mit durchsichtige Lügen, wie dat Papier is, wird es die armen Franzmänner och nich wärmen.“
„Aber Martha!“, rief Walburga, entsetzt und fasziniert zugleich. „So habe ich dich noch nie reden gehört. Das ist Verrat. Gerade jetzt, wo alles auf der Kippe steht!“
„Da steht nüscht auf da Kippe, dat geht allet längst den Bach runter. Nur sagen tut’s uns keener.“
„Du redest schon wie meine Mutter. Ihr seid widerlich. Kaum gibt’s mal Probleme, verliert ihr den Glauben. Wenn alle so wären, würde überhaupt nichts Großes mehr gelingen.“ Walburga standen die Tränen in den Augen. Sie drehte sich um und rannte hinaus.
Der Kutscher Heinrich hatte sich neben der Sattelkammer eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der er Zaumzeug, Räder und Deichseln, aber auch Möbel und alles, was sonst noch im Herrenhaus und den übrigen Gebäuden des Gutshofes kaputt ging, reparierte. Er hatte einen grauen Bart und einen dicken Bauch, trug winters wie sommers eine grüne Schürze und eine Schiebermütze und gab für Walburga und Karlchen den herzlichen Großvater, den sie eigentlich nicht hatten, denn der auf der väterlichen Seite war kurz nach Kriegsbeginn vor lauter Empörung über den ehemaligen Gefreiten, der sich anmaßte, ein Feldherr zu sein, gestorben, und der auf Seite der Mutter lebte weit weg in Charlottenburg und brachte als ehemaliger Offizier nicht die Geduld und Nachsicht auf, die der Umgang mit den in der ostpreußischen Wildnis zusehends verlotternden Enkelkindern erfordert hätte.
„Nu, wat gibt’s Neues?“, fragte Heinrich in gutmütigem Bass, als Walburga, die ohne Jacke oder Mantel den Hof überquert hatte, atemlos hereinplatzte. Er stand an der Hobelbank und hatte ein Stück Holz eingespannt, aus dem er eine Speiche für ein Kutschenrad drechseln wollte, und kramte reflexartig in einer der Taschen seiner Schürze, die neben so reizvollen und vor allem gefährlichen Werkzeugen wie Ahlen, Schnitzmessern und Stemmeisen immer eine Handvoll Karamellbonbons enthielt, mit denen sich auch Walburga noch gerne über gleich welchen Schmerz, welche Kränkung hinwegtrösten ließ.
Walburga, die hoffte, die Kälte würde als hinreichende Erklärung für ihre feuchten Augen gelten, sah sich schniefend um und wusste, sie konnte Heinrich, der seinen abgöttisch geliebten Enkel in Frankreich verloren hatte, schlecht beichten, was sie so geärgert und aufgebracht hatte.
„Nichts!“, murmelte sie und näherte sich dem kleinen Kanonenofen, der mit Holzresten gefüttert bei offener Türe bullerte. Die groben Dielen des Fußbodens waren übersät mit geringelten Spänen, Sägemehl, Nagelköpfen, verbogenen Nieten und rostigen Drahtstücken. An der Wand hing ein Kruzifix mit einem zusätzlich zu allen biblischen Martern auch noch von Kinderhand gevierteilten und mit Leim so großzügig wie ungeschickt geheilten Heiland.
„Schau mal, was ich mach!“, krähte Karlchen, der in der noch am wenigsten von Gerümpel und Gerätschaften aller Art bedrängten Ecke der Werkstatt an einem ausrangierten Esstisch saß und einen Holzzylinder grau anmalte, dessen eines Ende er mit einer großen, neben ihm liegenden Feile konisch angespitzt und dessen anderes Ende er mit vier Blechfinnen verziert hatte. „Eine Rakete für den Engländer, wo wir es ihm alles mit verkälten!“ Karlchen unterlag der Illusion, dass der Führer mit den neuen, hoch geheimen Vergeltungswaffen Schnupfen und Heiserkeit über die bösen Engländer bringen wollte, in seinen Augen eine gerechte Strafe für die ihm weitgehend unverständlichen Untaten, von denen die mal bellenden, mal in sonorem Singsang bedrohlich insinuierenden Stimmen des Volksempfängers berichteten.
„Schön!“ Walburga rang sich ein Lächeln ab und kam sich dafür unendlich erwachsen vor. „Die wird denen ganz schön Angst machen und sie endlich zur Vernunft bringen.“
„Im Sommer hat noch’n Flitzebogen gelangt.“ Heinrich blinzelte Walburga zu und hielt ihr den Bonbon hin. „Und ick hoffe, dat hier langt für dich, meene Lütte, sonst wees ick bald nich mehr weiter.“
„Deine Bonbons helfen gegen alles außer dem Krieg.“ Walburga zuckte mit der Schulter, schnappte sich das Zuckerstück und ließ sich auf die Bank plumpsen. „Mutter gibt ihn verloren und will uns auslagern.“
„Ick wees. Ick soll den Schlitten klar machen.“ Heinrich kratzte sich verlegen und kehrte an die Drehbank zurück. „Een Besuch in Markow, sagt se.“
„Sie will uns loswerden.“ Walburga glaubte nicht, dass das stimmte, aber sie wollte die Behauptung einfach einmal ausprobieren. Sie war empört, sie fühlte sich gekränkt und unverstanden und nicht zuletzt auch bedroht und suchte nach Worten dafür.
„Die meisten hier wär’n froh, wenn se sich schon mal up de Socken machen dürften.“
„Toni sagt, sie bleibt auf jeden Fall.“
„Toni is Bäuerin. Die hat hier ihre Wurzeln. Die hat hier ihre Gräber. Die meent, dat sie unterm Stalin genauso arme, gichtgeplagte Bäuerin sein kann als unterm Führer.“ Heinrich versteckte die Hände unter der Schürze. „Um de Jungs braucht sie sich ja nu nich mehr zu sorgen.“
„Mutter schickt mich weg wie einen Koffer! Bloß, weil Vati nicht kommt!“
„Weil noch nich Weihnachen is!“, rief Karlchen, der jetzt die Raketenspitze in Stanniolpapier wickelte. „Vati kommt ers Weihnachen und ich krieg dann einen Panta in echt mit Ketten, die scheppern, und einer Kanone, die schießt die Russkis tot.“ Karlchen kriegte sich kaum ein vor Begeisterung und warf die schmutzigen Hände hoch, die nur wenig über den riesigen Kinderkopf hinausragten.
„Natürlich!“ Walburga nickte beschwichtigend. „Die pusten wir alle zurück hinter den Ural, wo sie herkommen. Und wenn Vati damit fertig ist, bringt er einen Haufen Geschenke: für dich so Holzpuppen, die man ineinander stecken kann, für Mutti einen Pelz und für mich ...“
„Ich will aber einen Panta, und ich will Vati an Weihnachen.“
„Und einen Ausflug im Pferdeschlitten, schön in Pelz und Decken gemummelt, willst du den auch?“ Walburga warf ihm einen verschmitzten Blick zu. Karlchen und sein unerschütterliches Vertrauen in sie und den Gang der Dinge waren das Einzige, was ihr noch half. „Vielleicht sogar zu den Zwillingen? Dann könnten wir schauen, was die gekriegt haben vom Christkind, und vielleicht lassen sie dich ja diesmal mit dem Stöpselgewehr schießen, weil du doch jetzt viel größer bist.“
„So groß bin ich!“ Karlchen streckte wieder die Hände in die Höhe.
Als wollte er sich ergeben wie all die anderen, dachte Walburga und zuckte verächtlich mit einem Mundwinkel.
„Und du fährst dann wieder hierher zurück?“, fragte sie Heinrich.
„Muss ick ja wohl! Kann doch meene Jule nich’m Iwan lassen.“
„Falls er kommt!“
„Deern, lass jut sein! Die Sache is jelopen und wir ham uns dat allet selbst zuzuschreiben. In Russland haben wir nix, aber auch überhaupt nix verloren. Dat sin Wilde. Die brauchen keene Straßen und keen Jesetz. Die wern über uns herfallen wie früher, da haben se noch Tartaren oder Mongolen geheißen.“ Heinrich nahm schwerfällig auf einem dreibeinigen Schemel Platz und kramte in einer Kiste nach einem passenden Scheit für das Feuer. „Dat hier, dat is vorbei. Dat war früher Walachei, und dat wird wieder Walachei. Wir haben die in Berlin doch immer nur int’ressiert, wenn se mal wieder een Hirsken abknallen wollten.“
„Das hier ist deutscher Boden durch und durch!“, wandte Walburga eher müde denn empört ein. „Seit den Ordensrittern! Hier war nichts außer Wald und Sumpf! Wir erst haben das Land urbar gemacht und besiedelt.“
„Wird schon ein paar Wilde geben haben in de Wald. Aber wer jekommen is, kann och wieder gehen. Nix is von Dauer. Nur deine Bomen wern bleiben und ein paar von de Sumpen und den Hirsken schießt dann der Kommissar und nich mehr der Gauleiter, aber tot is tot.“ Heinrich seufzte und schob ein Stück von einem alten Eichenbalken in den Ofen.
„Und wenn die Zwillinge nich wollen, dann nehm ich ihnen das Gewehr einfach weg, weil ich bin nämlich so stark!“ Und wieder flogen Karlchens Hände in die Höhe.
Der Jägermeister Barmbeck lieferte am 23. wie jedes Jahr einen frisch erlegten Eber für die Weihnachtstafel und wegen der vielen Menschen, die inzwischen zusätzlich zur eigentlichen Familie und deren Angestellten auf dem Gut logierten, auch noch zwei Rehschlägel und drei Hasen, über welche sich Walburga am allermeisten freute, verlängerten diese doch das Leben ihrer Kaninchen um mindestens ein paar Wochen. Für den Weihnachtsbaum sorgte gewohnheitsgemäß der Förster Lohwitz, wie der Jäger ein Veteran des Ersten Weltkriegs und bisher für zu alt erachtet, um in dem neuen zu dienen, und beide, Jäger und Förster, wurden von der Gutsherrin ins Haus gebeten und mit Schnaps, frischem Brot und Leberpastete traktiert und das ließen sich die schon ein wenig hüftsteifen und schwerhörigen Herren einige Zeit lang gerne gefallen, bis der eine in der warmen Stube einzuschlafen drohte und der andere sich entsann, dass er noch seine Hundemeute zu füttern hatte, und Hedwig, die längst ungeduldig und der einsilbigen, sich hauptsächlich mit dem Wald und dessen vielfältigen, mal niedlichen, mal geradezu erhabenen Bewohnern befassenden Unterhaltung überdrüssig geworden war, komplimentierte die beiden erleichtert zur Tür hinaus, um sich sofort wieder in die hektischen, alle Menschen im weitläufigen Haus erfassenden Festtagsvorbereitungen zu stürzen.
Die Vorräte an Eiern, Butter und Schmalz wurden für Kuchen und Gebäck geplündert, Hasenläufe und Rehknochen zerkleinert, um Soße aus ihnen zu kochen, die Pilze, die seit dem Herbst an Schnüren aufgefädelt in der Scheune trockneten, wurden eingeweicht, die Kartoffeln wurden säckeweise zu Klößen verarbeitet, der Rotkohl aus dem Gemüsegarten garte mit Äpfeln und Wacholderbeeren auf kleiner Flamme. Es wurde gerollt, geknetet, geschlagen, gerührt, geseiht und passiert und für ein, zwei Tage schien der Krieg vergessen. Not und Sorge wichen der unbedachten Fülle früherer Jahre, die ausgebombten Flüchtlinge verwandelten sich in Festgäste, die mit einer Einlage am Klavier, einem ulkigen Krippenspiel und einem aus dem Reich geretteten Damasttischtuch zur allgemeinen Anstrengung beitrugen.