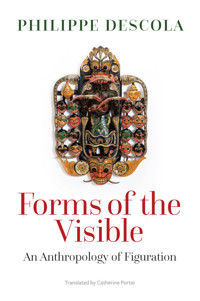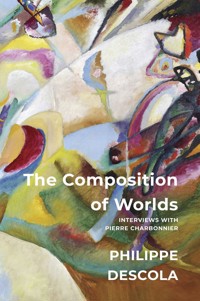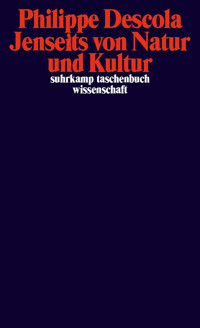32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ein Bild zeigt oder gerade nicht zeigt, enthüllt ein bestimmtes figuratives Schema, das durch die formalen Mittel und durch die Anordnung, mit der es seine Wirkungskraft entfaltet, gekennzeichnet ist. Bilder ermöglichen uns so einen Zugang zu dem, was unterschiedliche menschliche Lebensformen ausmacht. Gestützt auf einen globalen und historisch weit ausgreifenden Vergleich von Werken einer atemberaubenden Vielfalt, entwickelt Philippe Descola in seinem Buch die Grundlagen für eine Anthropologie der menschlichen Bildkunst.
Die bildliche Darstellung ist nicht allein der Phantasie derer überlassen, die die Bilder erschaffen. Wir stellen nur dar, was wir wahrnehmen oder uns vorstellen, und wir stellen uns nur vor und nehmen nur wahr, was uns die Gewohnheit zu unterscheiden gelehrt hat. Der visuelle Pfad, den wir bei der Abbildung der Welt einschlagen, hängt für Descola daher davon ab, welcher der vier Regionen des von ihm entdeckten ontologischen Archipels wir angehören: Animismus, Naturalismus, Totemismus oder Analogismus. Jeder von ihnen entspricht eine bestimmte Art, die Welt zu begreifen. Ein augenöffnendes Buch!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1168
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
3Philippe Descola
Die Formen des Sichtbaren
Eine Anthropologie der Bilder
Aus dem Französischen von Christine Pries
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Les Formes du visible. Une anthropologie de la figuration bei Éditions du Seuil.Verlag und Autor danken der Fondation Jan Michalski für die großzügige Förderung der deutschen Ausgabe.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2023
© dieser Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023© Éditions du Seuil, 2021
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Brian Barth
Umschlagabbildung: Kōla Sanniya-Maske, Sri Lanka, um 1890, Museum Fünf Kontinente, München, Inv.-Nr. B-3454, Foto: Nicolai Kästner
eISBN 978-3-518-77566-0
www.suhrkamp.de
Widmung
5In Erinnerung an meine Eltern und an meine Großeltern,von denen ich gelernt habe, Fragen an Bilder zu stellen
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
7Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Vorwort
1 Die Falten der Welt
Unterfütterungen durch das Unsichtbare
Verkörperte Zeichen
Bildontologien
Geometrien der Figuration
Zurschaustellungsformen und Wirkmächtigkeiten
Erster Teil Präsenzen
2 Körper-Geister
Tierische Personen
Eselsbrücken
Wer läuft denn da?
Ähnlichkeiten unterscheiden
Ontologische Tarnungen
3 Die Standpunkte vervielfachen
4 Relationale Identitäten
Zweiter Teil Indizes
5 Gattungswesen und Lebenswege
Die Figuration des Ordnungsakts
Die Figuration des Ordnungsstifters
Die Figuration der Spuren der Ordnungsstiftung
6 Eine Heraldik der Qualitäten
7 Die Macht der Spur
Variation
1
Repertoire-Bild und Personen-Bild
Dritter Teil Korrespondenzen
8 Kompositionsexerzitien
Hybride und Schimären
Bildhafte Bindungen
Die große und die kleine Welt
Einbettung und Wiederholung
9 Räumliche Verbindungen
10 Rollenspiele
Vierter Teil Simulakren
11 Der Welt gegenüber
Die Eroberung des Sichtbaren
Die Seele malen
Die Einführung der Natur
In Richtung Immanenz
Die Unmöglichkeit von Objektivität
12 Die Objektivierung des Subjektiven
13 Die Ähnlichkeit ausfindig machen
Variation
2
Mit allen Stilen vertraut
Schluss Was ein Bild ausmacht
Ontologien
Formen
Handlungsmächte
Inkarnationen
Postskriptum Gerüstarbeiten
Der Streit um Ähnlichkeit
Die Belebtheit von Bildern
Bildsprachen
Dank
Anmerkungen
Vorwort
1
. Die Falten der Welt
Erster Teil Präsenzen
2
. Körper-Geister
3
. Die Standpunkte vervielfachen
4
. Relationale Identitäten
Zweiter Teil Indizes
5
. Gattungswesen und Lebenswege
6
. Eine Heraldik der Qualitäten
7
. Die Macht der Spur
Variation
1
: Repertoire-Bild und Personen-Bild
Dritter Teil Korrespondenzen
8
. Kompositionsexerzitien
9
. Räumliche Verbindungen
10
. Rollenspiele
Vierter Teil Simulakren
11
. Der Welt gegenüber
12
. Die Objektivierung des Subjektiven
13
. Die Ähnlichkeit ausfindig machen
Variation
2
: Mit allen Stilen vertraut
Schluss: Was ein Bild ausmacht
Postskriptum: Gerüstarbeiten
Bibliographie
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Namenregister
Register der Orte und Völker
Bildnachweise
Informationen zum Buch
3
5
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
91
92
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
217
218
221
222
223
224
225
226
228
229
230
231
232
233
234
235
237
238
239
240
241
242
243
244
245
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
262
263
264
265
266
267
268
269
270
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
297
298
300
301
302
303
304
305
307
308
309
310
311
312
313
314
316
318
319
320
321
322
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
337
338
339
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
354
355
356
357
358
359
360
361
362
364
365
366
367
368
369
371
372
373
374
375
376
377
378
380
381
382
384
386
387
389
390
391
392
393
394
395
396
398
399
400
401
402
403
404
406
407
409
410
411
412
413
415
416
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
443
445
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
460
461
462
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
483
484
485
486
487
488
490
491
492
493
494
495
496
497
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
551
552
553
554
556
558
559
560
561
562
563
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
597
598
599
600
601
602
603
604
605
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
11Vorwort
[E]s [ist] dem Sichtbaren eigentümlich […], im strengsten Sinne des Wortes durch ein Unsichtbares gedoppelt zu sein, das es als ein gewissermaßen Abwesendes gegenwärtig macht.
Maurice Merleau-Ponty, Das Auge und der Geist1
Dieses Buch bildet den Abschluss einer Reihe von Experimenten, deren Verknüpfung den Umständen geschuldet ist. Zunächst einmal den Lebensumständen, die mich Mitte der 1970er Jahre zu den Achuar am oberen Amazonas führten, um die Beziehungen zu untersuchen, die sie zu ihrer Umwelt unterhielten, wobei ich am Ende zu dem Schluss kommen musste, dass keine der Beschreibungskategorien, die ich in meinem Ethnologenköcher mitgebracht hatte, sich als adäquat für das erwies, was meine Gastgeber taten und sagten. Ich habe bei ihnen vergeblich nach etwas gesucht, das an Natur oder Kultur erinnern würde, an Geschichte oder Religion, an ein sauber von den magischen Praktiken trennbares ökologisches Wissen oder an eine systematische, allein technischer Effizienz gehorchende Ressourcennutzung. Schon der Gesellschaftsbegriff, also jene Hypostase, auf die das Selbstverständnis unserer so eigentümlichen Wissenschaften Bezug nimmt, lieferte eine ziemlich schlechte Beschreibung der Ansammlung von Menschen, Tieren, Pflanzen und Geistern, deren alltäglicher Umgang miteinander sich über artspezifische Schranken zwischen den Wesen und ihre unterschiedlichen Fähigkeiten hinwegsetzte. Alle analytischen Ebenen, die zu unterscheiden ich gelernt hatte, vermischten sich hier – ökonomische Aktivitäten waren durch und durch religiös, die politische Organisation gab sich nur andeutungsweise in Riten und Blutrache zu erkennen, die flüchtige ethnische Identität beruhte im Wesentlichen 12auf der Erinnerung an Konflikte –, sodass ich mir eine Beschreibungsweise einfallen lassen musste, die diesem ethnographischen Tohuwabohu gerecht wurde und Kohärenz verlieh, ohne die üblichen Wege einzuschlagen.2
An dieses erste induktive und reflexive Experiment schloss sich ein zweites, in höherem Maße theoretisches Experiment an, das mich lange beschäftigt hat. Die Achuar hatten mir bewusst gemacht, dass die geistigen Werkzeuge der Sozialwissenschaften einen ganz bestimmten, auf die Aufklärungsphilosophie zurückgehenden Typ von kosmologischer und epistemologischer Konfiguration fortschrieben – eine Universalität, von der die unzähligen Einzelkulturen nur begrenzte Versionen abgeben –, die dem, was ich bei der Feldforschung beobachtet hatte, und dem, was andere Ethnographen über andere Weltregionen berichteten, genauso wenig entsprach wie dem, was Historiker im Hinblick auf andere Zeiträume der Menschheitsgeschichte beschrieben. In der Absicht, auf etwas aufmerksam zu machen, das man Formen der »Welterschaffung« nennen könnte, habe ich deshalb eine vergleichende Untersuchung der verschiedenen Weisen in Angriff genommen, wie sich Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen Menschen und Nichtmenschen ausfindig machen und verstetigen lassen, für die ethnographische und historische Zeugnisse Anhaltspunkte bieten.
Entgegen der klassischen anthropologischen und historischen Vorstellung, dass es lediglich eine einzige Welt in Gestalt einer sich selbst genügenden Totalität gibt, die nur darauf wartet, eine verschiedenen Standpunkten gemäße Darstellung zu finden, war es meiner Meinung nach sachdienlicher und zollte es denjenigen mehr Respekt, deren Vorgehens- und Lebensweisen wir zu beschreiben versuchen, jene verschiedenartigen Bräuche als Verfahren zu betrachten, wie die Welt jeweils zusammengesetzt wird.3 Darunter sind die Aktualisierungsweisen der unzähligen Qualitäten, Phänomene, Wesen und Beziehungen zu verstehen, die Menschen mit Hilfe jener ontologischen Filter objektivieren können, die ihnen zur Unterscheidung aller in ihrer Umwelt wahrnehmbaren Dinge dienen. Deswegen bringt ein Mensch, sobald diese Welterschaffung eingesetzt hat, das heißt seit seiner Geburt, keine »Weltanschauung«, das heißt keine bloße Version einer transzendenten, allein der Wissenschaft oder Gott vollständig zugänglichen Realität, hervor, sondern eine sinnhafte, vor kausaler Vielfältigkeit wimmelnde 13Welt im eigentlichen Sinne, die sich an ihren Rändern mit ähnlichen, von anderen Menschen unter vergleichbaren Umständen aktualisierten Welten überlappt. Und die relative Koinzidenz einiger dieser Welten, die gemeinsamen Anhaltspunkte und die geteilten Erfahrungen, von denen sie zeugen, liegen dann dem zugrunde, was man gewöhnlich Kultur nennt.
Unter Rückgriff auf den Gedanken von Marcel Mauss, dass »sich jeder Mensch mit den Dingen identifiziert und die Dinge mit sich selbst, wobei er ein Gefühl für die Unterschiede und für die Ähnlichkeiten hat, die er feststellt«,4 habe ich jene die Welterschaffung strukturierenden ontologischen Filter »Identifikationsmodi« genannt. Man kann sie als während der Sozialisierung in ein bestimmtes soziales und natürliches Milieu inkorporierte kognitive und sensomotorische Schemata betrachten, die als Rahmenbedingungen unserer Praktiken, Anschauungen und Wahrnehmungen fungieren, ohne propositionales Wissen in Anspruch zu nehmen. Es handelt sich mit anderen Worten um jene Art von Mechanismen, die uns erlauben, die Bedeutsamkeit bestimmter Dinge zu erkennen und anderen keine Beachtung zu schenken, Handlungssequenzen zu verknüpfen, ohne darüber nachdenken zu müssen, Vorkommnisse und Aussagen auf eine bestimmte Weise zu interpretieren, unsere Schlussfolgerungen in Bezug auf die Eigenschaften der in unserer Umwelt vorkommenden Objekte in eine bestimmte Richtung zu lenken, kurz: um alles, was sich von selbst versteht und sich behaupten lässt, ohne einen Gedanken darauf zu verschwenden.
Trotz der großen Verschiedenartigkeit der Qualitäten, die sich an Wesen und Dingen entdecken lassen oder auf die man aufgrund der Anzeichen bzw. Indizes schließen kann, die ihr äußeres Erscheinungsbild und ihr Verhalten bieten, ist es jedoch plausibel anzunehmen, dass es nicht besonders viele Möglichkeiten gibt, diese Qualitäten zu organisieren. Unsere Identitätsurteile, das heißt das Erkennen von Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Gegenständen oder Vorkommnissen, dürfen nicht auf einer Reihe von nach und nach vorgenommenen analytischen Vergleichen beruhen. Aus Gründen kognitiver Sparsamkeit müssen sie schnell und auf nicht bewusste Weise gefällt werden können, durch Induktion auf der Grundlage gemeinsamer Schemata als jenen Dispositiven, welche die Strukturierung der wahrgenommenen Qualitäten und die Einordnung der Verhaltensweisen erlauben. Auf der Basis eines ziemlich 14einfachen Gedankenexperiments habe ich deshalb die These aufgestellt, dass es nicht mehr als vier Identifikationsmodi, das heißt Möglichkeiten, gibt, ontologische Schlussfolgerungen zu systematisieren, die sich jeweils auf die Arten von Ähnlichkeit und von Unterschieden stützen, die Menschen auf zwei Ebenen, physisch und moralisch, zwischen sich und den Nichtmenschen feststellen. Teilweise in Fortführung der konventionellen Begrifflichkeit habe ich diese vier gegensätzlichen Weisen, in den Falten der Welt Kontinuitäten und Diskontinuitäten aufzuspüren, als Animismus, Totemismus, Analogismus und Naturalismus bezeichnet.5
Beim Animismus, den ich im Laufe meiner Unterhaltungen mit den Achuar entdeckt hatte, wird Nichtmenschen in Verbindung mit der Einsicht, dass jede Klasse von Existenzen, jede Art von Ding über einen eigenen Körper verfügt, der ihr Zugang zu einer bestimmten Welt verschafft, die sie auf ihre eigene Weise bewohnt, Interiorität im Sinne eines Innenlebens menschlicher Art zugeschrieben – die meisten Wesen haben eine »Seele«. Die Welt eines Schmetterlings ist nicht dieselbe wie die Welt eines Welses und auch nicht wie die eines Menschen, einer Palme, eines Blasrohrs oder des Geistergeschlechts, das Affen Schutz gewährt, weil jede dieser Welten zugleich die Bedingung und das Ergebnis der Aktualisierung einzelner physischer Funktionen ist, welche die anderen Lebensformen nicht besitzen. Insofern er meine bequemen Gewissheiten erschütterte und mich entdecken ließ, dass sich am Rande der Welt, in der ich mich eingerichtet hatte, noch andere Welten entfalten können, hat der Animismus die Untersuchung angestoßen, von der dieses Buch einen Teilabschnitt bildet. In den Texten und großen Monographien über die australischen Aborigines von Anfang des letzten Jahrhunderts habe ich indes zu meinem großen Erstaunen zu ahnen begonnen, was Totemismus ist. Denn entgegen der üblichen Auffassung besteht die totemistische Identifikation darin, die Ähnlichkeiten der Menschen, Tiere und Pflanzen, die derselben Totemklasse angehören, nicht auf ihr gemeinsames äußeres Erscheinungsbild, sondern darauf zurückzuführen, dass sie eine Reihe von physischen und moralischen Qualitäten teilen, die der totemistische Prototyp – der im Allgemeinen mit einem Tiernamen belegt wird – von Generation zu Generation an die menschlichen und nichtmenschlichen Individuen weitergibt, aus denen sich die Gruppe, die seinen Namen trägt, zusammensetzt. Die menschlichen und nichtmenschlichen Mitglieder der 15Klasse des Adlers ähneln also dem Adler nicht und stammen auch nicht von ihm ab, wie von einem Ahnen, vielmehr teilen sie Eigenschaften mit diesem Vogel – Schnelligkeit, Entschlossenheit, Sehschärfe, Kampfgeist, Durchhaltevermögen –, die bei ihm stärker hervortreten als bei jedem anderen, doch deren tatsächliche Quelle auf eines der Totemwesen zurückgeht, die einstmals der Welt Ordnung und Sinn verliehen haben.
Ein dritter Identifikationsmodus hat sich im Zuge meines Lesepensums aus der unerwarteten Überschneidung des chinesischen Denkens, wie Marcel Granet es betrachtet, des Denkens der Renaissance durch die Brille von Michel Foucault und des Denkens der Azteken in der Sichtweise von Alfredo López Austin herausgeschält. Trotz des kulturellen Abgrundes, der diese Zivilisationsformen zu trennen scheint, waren sie alle drei richtiggehend besessen von der Analogie als einem Mittel, die wildwuchernden Unterschiede zwischen den Objekten der Welt, ihren konstitutiven Bestandteilen, den Zuständen, Situationen und Qualitäten, die sie beschreiben, und den Eigenschaften, die man ihnen zuschreibt, dadurch zu verringern, dass sie zu ausgedehnten Korrespondenznetzwerken verknüpft werden.6 In den »analogistischen« Ontologien ergibt alles einen Sinn, alles verweist auf alles, keine Absonderlichkeit entgeht auf Dauer den Pfaden der Interpretation, die dafür sorgen, dass sich eine Farbe mit einer moralischen Qualität, ein Tag im Jahr mit einem Sternbild oder ein Temperament mit einer sozialen Funktion verkoppeln lässt. Die letzte Welterschaffungsform ist die, in der ich groß geworden bin, und ich habe sie nicht sonderlich einfallsreich als »naturalistisch« bezeichnet. Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie das Modell des Animismus umkehrt, natürlich ohne dass diejenigen, die sie praktizieren, es bemerken, weil sie nicht vermuten, dass es noch andere Modelle gibt: Beim Naturalismus unterscheiden die Menschen sich durch ihren Geist und nicht durch ihre Körper von den Nichtmenschen, und durch diese unsichtbare Disposition unterscheiden sie sich auch untereinander, bündelweise, aufgrund der vielfältigen Verwirklichungen, die ihr kollektives, sich in unterschiedlichen Sprachen und Kulturen äußerndes Innenleben zulässt. Was die Körper anbelangt, so sind sie alle denselben Naturgesetzen unterworfen. Anders als im Fall des Animismus erlauben sie keine Singularisierung nach Lebensformen, da die innere Verschiedenartigkeit der Menschen sich vollständig nach 16ihrer Denkweise richtet. Obwohl sie eine beispiellose Entwicklung von Wissenschaft und Technik möglich gemacht hat, führte diese Ontologie außerdem nicht nur zur »Entzauberung« der Welt, sondern auch und in erster Linie dazu, dass die Welterschaffungsformen, die nicht auf denselben Prinzipien beruhten, nur noch schwer verständlich waren. Denn eine ganze Reihe der Begriffe, mit deren Hilfe wir die moderne Kosmologie – Natur, Kultur, Gesellschaft, Geschichte, Kunst, Ökonomie, Fortschritt – gedanklich erfassen, sind in Wirklichkeit genauso jung wie die Gegebenheiten, die sie bezeichnen. Schließlich wurden sie erst vor einigen Jahrhunderten geprägt, um den Umwälzungen Rechnung zu tragen, denen die europäischen Gesellschaften unterworfen waren, bzw. um sie herbeizuführen. Um den Zivilisationsformen Rechnung zu tragen, die, weil sie nicht dieselbe historische Wegstrecke zurückgelegt haben, die Grenzen zwischen Menschen und Nichtmenschen nicht dort ziehen, wo wir selbst sie errichtet haben, sind sie wenig aussagekräftig.
Dies war eines der Ergebnisse des zweiten Experiments, das ich durchgeführt habe. Im Unterschied zum ersten, bei dem ich die Stichhaltigkeit meiner Interpretationen sozusagen an mir selbst erprobt hatte, nahm dieses Experiment die Form einer Untersuchung zur Hypothesenüberprüfung an. Es mündete in einem allgemeinen Modell der Systeme von Qualitäten, die sich an den Objekten einer nach den Kombinationen abgestuften Welt feststellen lassen, welche innerhalb einer ihre Grundprinzipien ostentativ zusammenfassenden Ontologie an verschiedenen Stellen verkörpert werden können: entweder als moralische Kontinuität zwischen Menschen und Nichtmenschen und Diskontinuität ihrer physischen Dimensionen (Animismus), als moralische Diskontinuität und physische Kontinuität (Naturalismus), als doppelte, moralische und physische, aber in diskontinuierliche Einheiten von Menschen und Nichtmenschen aufgeteilte Kontinuität (Totemismus) oder aber als doppelte, physische und moralische Diskontinuität, der Korrespondenznetzwerke vergeblich Kontinuität verleihen sollen (Analogismus). So gesehen, kann man zum Beispiel sagen, dass die Ontologie der Achuar in Amazonien für den Animismus repräsentativ ist, die Ontologie der australischen Aborigines für den Totemismus, die neukantianische Epistemologie für den Naturalismus oder die Ontologie der mesoamerikanischen Amerindianer für den Analogismus. Ziemlich häufig existieren diese Systeme von Qualitäten jedoch nur ansatzweise 17oder überlappen sich teilweise. Anstatt sie als in sich geschlossene und voneinander abgeschottete Kosmologien oder Kulturen im klassischen Sinne zu betrachten, ist es besser, sie als phänomenale Auswirkungen von vier unterschiedlichen Schlussfolgerungsarten in Bezug auf die Identität der Existenzen aufzufassen, die uns umgeben oder die wir uns gerne vorstellen. Je nach Situation ist jeder beliebige Mensch zu einer dieser Schlussfolgerungsarten in der Lage, doch die wiederkehrenden Identitätsurteile, zu denen er neigt (diese Existenz gehört in jene Kategorie und lässt sich in dieselbe Kategorie einordnen wie diese oder jene andere Existenz), werden sich in den meisten Fällen von der Art von Schlussfolgerung leiten lassen, die in der Gemeinschaft, in der er sozialisiert worden ist, bevorzugt wird.
Dieses zweite Experiment ist mit den üblichen Instrumenten der vergleichenden Anthropologie durchgeführt worden, das heißt, als Material wurden schriftlich oder mündlich überlieferte Diskurse herangezogen: ethnographische Studien über Personendarstellungen, über Rituale oder über die Klassifikation von Pflanzen und Tieren, philosophische Abhandlungen oder medizinische Lehrbücher, philologische Analysen, Mythensammlungen und ätiologische Berichte sowie noch eine ganze Reihe weiterer Textgattungen, deren Berücksichtigung in diesem Zusammenhang etwas mehr Kühnheit erforderte. Darauf geht die Idee zu einem dritten Experiment zurück, das im vorliegenden Buch seinen Abschluss findet. Wenn die Identifikationsmodi, deren Existenz ich behauptet hatte, wirklich die strukturierende Rolle spielen, die ich ihnen zuschreibe, wenn sie die Quelle der ursprünglichen, von menschlichen Kollektiven geteilten Welterschaffungsformen sind, dann müssen sie sich auch auf den Bildern entdecken lassen, die diese Kollektive hervorgebracht haben. Denn man bildet nur das ab, was man wahrnimmt oder sich vorstellt, und man stellt sich nur das vor oder nimmt nur das wahr, was im Rahmen unserer Traumbilder aufzunehmen und in der Flut der sinnlichen Eindrücke zu erkennen die Gewohnheit uns gelehrt hat. Man weiß schon sehr lange, dass die Malerei eine »geistige Angelegenheit« ist, wie Leonardo da Vinci geschrieben hat, buchstäblich ein Blick des Geistes. Und seither haben viele Künstler und Philosophen unausgesetzt wiederholt, dass Figuration keine Nachahmung der Wirklichkeit sei, keine Kopie dessen, was ist, keine Reproduktion des Sichtbaren; vielmehr beschwöre sie herauf, was sein soll, sie sei ein 18Mittel, Qualitäten, Situationen und Wesen wahrnehmbar zu machen, die uns wichtig sind oder deren Existenz wir spüren, die unsere Sinne und unsere Worte aber nur unzulänglich erfassen.7
Ein Bild kann mithin als Zurschaustellung von ontologischen Eigenschaften betrachtet werden, die sein Urheber in der Textur der Dinge oder tief in den Windungen seines Inneren erblickt hat, entweder weil er praktisch für ein solches Unterfangen ausgebildet wurde – was der verbreitetste Fall ist – oder weil die Figuration, insofern sie die Bildkünstler von der erzwungenen Sequenzialität der gesprochenen Sprache befreit, es jenen, dem Sichtbaren Gestalt verleihenden, »sehenden Brüdern« erlaubt, wahrnehmbar zu machen, was niemand zuvor gesehen hat: Das gelingt ihnen mit Hilfe eines wundervollen Taschenspielertricks, indem sie nämlich unverrückbar vor Augen führen, dass das, was sie aktualisieren, dem Referenten vollständig angemessen ist, der sich erahnen lässt und den man selber gerne herbeigeführt hätte, wenn man dafür begabt genug gewesen wäre. Das Bild ist faktisch das einzige Mittel, über das wir verfügen, um sehen zu können, was die anderen sehen, um am eigenen Leibe die mehr oder weniger große Koinzidenz zwischen dem visuellen Pfad, den unsere Ausbildung, unsere Sinnlichkeit und unsere Biographie uns gewöhnlich entlang bestimmter Falten der Welt hat einschlagen lassen, und dem Pfad zu empfinden, dem andere – an anderen Orten, zu anderen Zeiten, nach anderen figurativen Codes – wiederum entlang anderer, genauso einleuchtender Falten der Welt zu folgen gelernt haben.
Eine bescheidene Zeichenbegabung, eine Reihe von Malern unter meinen Vorfahren väterlicherseits und ein laienhaftes Vergnügen an Kunstgeschichte schützten mich nicht vor anfänglicher Blauäugigkeit. Absehbarer- und vielleicht unvermeidlicherweise hatte ich dieses Experiment mit der Zusammenstellung eines Katalogs der Bilder begonnen, die von der Sache her den Ontologien entsprachen, welche ich zur genaueren Bestimmung der Wesenszüge der einzelnen Identifikationsmodi herangezogen hatte. Masken aus Amazonien, Inuit-Effigien aus Walrosselfenbein bzw. sibirische Trommeln für den Animismus, Aborigines-Malereien auf Baumrinde und Tuch für den Totemismus, europäische Gemälde und Fotografien für den Naturalismus und im Fall des Analogismus eine große Menge ungleichartiger Figurationen aus Afrika, Asien, den Amerikas, von den bunten Fadenbildern der 19mexikanischen Huicholen über ivorische Schutzamulette bis zu chinesischen Landschaftsrollen. Dabei bin ich auf den Fehler verfallen, den sogar Kunsthistoriker nicht immer vermeiden können, nämlich bildliche Darstellungen als Illustrationen von symbolischen und diskursiven Systemen zu verstehen, die sie rechtfertigen und verständlich machen. Ich habe den Schlüssel für diese Bilder zwar nicht in ästhetischen oder moralischen Lehrbüchern gesucht und auch nicht in den Briefwechseln der Maler oder in Atelierabrechnungen, wie die Spezialisten für europäische Malerei es machen, aber ich habe sie als Anthropologe danach interpretiert, ob sie das ontologische Rüstzeug zum Ausdruck brachten, das ich vorher auf der Grundlage verbaler Darstellungen zu Tage gefördert hatte. In beiden Fällen stützt sich die Ikonologie jedoch auf das, was über Figurationen gesagt und geschrieben worden ist, anstatt schlicht und einfach den Gesichtspunkt der Dinge zu berücksichtigen, welche die Bilder enthüllen bzw. gerade nicht figürlich abbilden. Trotzdem war meine Vorgehensweise nicht nutzlos gewesen. Ich habe dabei nach und nach gelernt, bei der Betrachtung der Bilder auf das zu achten, was sie zeigten, und nicht auf das, was sichtbar zu machen ich von ihnen erwartet hatte. Durch ihre Zusammenstellung in Reihen, die an eine ontologische Gattung, das heißt nicht an ihre Herkunft oder ihre Epoche, gekoppelt waren, und die Untersuchung der visuellen Entscheidungen, die einige diese Reihen einheitlich machten, begann ich wiederkehrende Figurationsmechanismen zu erkennen, die »das unsichtbare Unterfutter« preisgaben, das jedem Identifikationsmodus eigen ist.
Der Wunsch, die ontologischen Schemata, die ich auf der Grundlage von Texten theoretisch angenommen hatte, in den Bildern verkörpert zu sehen, führte außerdem dazu, dass ich die Figuration zunächst für eine in einem zu engen Sinne mimetische Operation hielt. Bilder geben nun aber nicht bloß Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen Existenzen zu erkennen, Trennlinien, an denen entlang die Ausstattung, aus der eine Welt besteht, rekonstruiert werden kann, vielmehr haben sie auch noch die verstörende Fähigkeit, durch die Handlungskausalität, die einige von ihnen besitzen, in einem anderen Sinne ein Zeichen zu setzen. Wie zum Beispiel bei einer Marienikone, deren Gold sich im Lichte der Kerzen spiegelt, oder jenen hinduistischen Gottheiten, die durch riesige Menschenmengen getragen werden, kann diese Art 20von Bild durchaus eine wiedererkennbare Figuration dessen sein, was es darstellt. Aber seine Bedeutung liegt weniger in der ihm auferlegten Symbolik begründet als in der Macht, die man ihm zuschreibt. Die Bildgebung lässt sich nicht von der Inszenierung der Bilder trennen, das heißt von den pragmatischen Bedingungen ihrer Wirksamkeit als Akteuren im sozialen Leben, die eine ganze Reihe von Eigenschaften mit einem gewöhnlichen Menschen zu teilen scheinen. Auch an dieser Stelle musste ich einen Schritt weit von der traditionellen Kunstgeschichte abrücken und den häufig groben, aber doch so wirkmächtigen Bildern treu bleiben, mit denen Anthropologen sich beschäftigen.
Außerdem hatte ich die Möglichkeit unterschätzt, dass Bilder in einem anderen Identifikationsmodus als dem Modus existieren können, den die historische und ethnographische Dokumentation vorzeichnet. Dadurch habe ich ihrem Vermögen, ontologische und kosmologische Umwälzungen zu präfigurieren, nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt, die der Wandel der visuellen Kultur augenfällig macht, die in den Texten aber erst sehr viel später reflexiven Ausdruck finden. Da es in den meisten Fällen keine Belege für dieses Missverhältnis zwischen den Ordnungen figurativer und diskursiver Darstellung gibt, ist es nicht immer leicht nachweisbar, aber in einigen gut dokumentierten Beispielen, auf die ich im Verlauf dieses Buches zurückkommen werde, tritt es deutlich hervor. Das ist vor allem in Europa der Fall, wo Darstellungen der naturalistischen Ontologie in der Malerei aufkamen, lange bevor diese in den Schriften der Gelehrten und Philosophen zum Thema zu werden begann. Nicht nur die projektive Geometrie des 17. Jahrhunderts, die »ein Produkt der Künstlerateliers« ist, wie Panofsky schreibt,8 sondern höchstwahrscheinlich die gesamte epistemische Neuausrichtung, von der die Werke Galileis, Bacons oder Descartes’ Zeugnis ablegen, kann als Resultat einer zweihundert Jahre zuvor erstmals in Erscheinung getretenen neuen Betrachtungs- und Beschreibungsweise von Menschen und Dingen angesehen werden.
Von daher ist das Experiment, von dem ich am Anfang dieses Vorworts sprach, kein leeres Wort. Als ich mich auf das Abenteuer des für mich neuen und auch von anderen kaum erschlossenen Gebiets einer vergleichenden Anthropologie der Bilder bzw. der Figuration einließ, habe ich mich häufig tastend voranbewegt, ich bin in Sackgassen geraten und habe immer neue Experimente unternommen. Eine Ausstellung 21über dieses Thema, die ich 2010-2011 im Musée du quai Branly organisiert habe, entpuppte sich sogar als Experiment im Experiment, weil sie mir die Gelegenheit bot, an den Besuchern die Glaubwürdigkeit der visuellen Schemata zu erproben, die ich auf den Bildern ausgemacht hatte. Dieser Test war umso wertvoller, als die figurativen Traditionen der Zivilisationen, deren Objekte die Ausstellung zeigte, dem betreffenden Publikum weitgehend unbekannt waren, sodass die Vorurteile der Gelehrten, wie Werke in einem Museum anzuordnen sind, ihm nichts anhaben konnten.9 Das lange Herumbummeln im Labyrinth der Bilder war für mich wahrscheinlich unumgänglich. Abgesehen davon, dass es während der Untersuchung der Figuration die experimentelle Haltung nachstellte, die häufig von denen eingenommen wird, die etwas abbilden, zeugte es davon, dass ein Bild mehr noch als ein Text oder eine Situation stets in hohem Maße über das hinausgeht, was sich über es sagen lässt, weil es das synthetische Kondensat eines Gegenstandes gegenwärtig und lebendig macht, das die Linearität unserer Wörter nur schwer in einem analytischen Diskurs unterbringen kann.10
231
Die Falten der Welt
Jedwede Darstellung des Universums beruht auf einer Auswahl signifikanter Bestandteile.
Pierre Francastel, Medieval Painting1
Von den unzähligen Bildern, welche die Menschen in den mindestens 80000 Jahren seit Beginn der Figuration in Angriff genommen haben, entfällt nur ein winziger Bruchteil auf den Bereich der Kunst und ihrer Geschichte.2 Das haben die Kunsthistoriker selbst schon sehr früh erkannt. Zumindest einige von ihnen – von Gottfried Semper über Alois Riegl oder Aby Warburg bis zu Carl Schuster – haben es verstanden, alle Bilder gleichwertig zu behandeln, ob es sich dabei nun um ornamentale Kunst handelte, um Ziermotive und Kultobjekte von Stammespopulationen oder aber um anerkannte Meisterwerke des Altertums und der abendländischen Zivilisation. Unabhängig davon, ob in Form von Effigien, Masken, Höhlenzeichnungen, Malereien auf Pergament oder Baumrinde, Flechtmotiven, anthropomorphen oder zoomorphen Tongefäßen, Körpermarkierungen oder Sandzeichnungen, verfolgen die meisten Bilder »vor dem Zeitalter der Kunst«3 nicht die Absicht, einen Gegenstand möglichst getreu nachzuahmen, einem Schönheitsideal zu genügen, eine erbauliche Botschaft zu übermitteln oder ein einschneidendes Ereignis zu schildern. Ihre Funktion besteht darin, eine Gottheit, einen Geist, einen bestimmten Ort, ein Tier, einen Toten sichtbar und lebendig zu machen, kurz gesagt: die Präsenz von etwas Abwesendem herbeizuführen. Wie jedoch schon Alberti geschrieben hat, muss dieses Abwesende gleichwohl anhand irgendeines Zeichens identifizierbar sein, das auf dem Bild zum Vorschein kommt:
24[S]ie [die Malkunst] birgt eine geradezu göttliche Kraft in sich und leistet nicht nur, was man der Freundschaft nachsagt – dass sie Abwesende vergegenwärtigt –; vielmehr stellt sie auch Verstorbene erkennbar vor Augen, sogar noch denen, die viele Jahrhunderte später leben.4
Das unter Kunsttheoretikern verbreitete Gefühl reicht also schon sehr lange zurück, dass die Ausdrucksstärke von Bildern, ihre Fähigkeit, Wesen so zu verkörpern, als seien sie lebendig, auf eine »göttliche Kraft«, eine mysteriöse Gabe zurückgeht, die uns affektiv anzusprechen vermag, intellektuell aber nur schwer zu ergründen ist.
Auch wenn sich in den Texten der europäischen Tradition durchaus hier und dort Anspielungen auf diese schwer einzuordnende Dimension der Malerei finden lassen, ist sie erst mit Verspätung ernst genommen worden. Das könnte daran liegen, dass das unumwundene Eingeständnis der Wirkmächtigkeit von Bildern die Kenner und Gelehrten deklassiert hätte, deren Zahl der Kunstmarkt seit der Renaissance um ein Vielfaches erhöht hat: All jene kultivierten Menschen mit gutem Geschmack, die in der Lage waren, die Symbole auf den Gemälden zu entschlüsseln und die historischen Szenen, die sie wiedergeben, zu erkennen, wollten auf keinen Fall den primitiven Verehrern von Fetischen oder den leichtgläubigen Bauern ähneln, die auf eine von einer Marienstatue an sie gerichtete Botschaft warteten. Auf diese Weise ist die Kunstgeschichte seit Winckelmann zum überwiegenden Teil eine Wissenschaft der Umstände und der Zeichen geworden: Ihr Ehrgeiz besteht darin, die Bedeutung der Kunstwerke zu analysieren, die offensichtlichen oder versteckten Symbole ausfindig zu machen, mit denen sie übersät sind, die dargestellten Personen und Schauplätze zu identifizieren, den Einfluss philosophischer, politischer, literarischer und ästhetischer Vorstellungen auf die Entwicklung der Motive, Stile und Kompositionen nachzuvollziehen, Genealogien und Anleihen unter sowie Verwerfungen zwischen den Schulen, Ländern und Gattungen aufzuspüren, den Einfluss des Marktes, der Mäzene und des jeweils herrschenden Geschmacks auf die künstlerische Produktion einzuschätzen. Sie behandelt die Kunstwerke wie ikonische Zeichen und Symbolansammlungen: Sie stellen einen Gegenstand für einen Betrachter dar, der in der Lage ist, ihn wiederzuerkennen und ihm Bedeutung abzugewinnen.
25Eine Handvoll Historiker und Anthropologen hat mit dieser in erster Linie semiotischen Herangehensweise an Kunstwerke gebrochen und seit Ende des 20. Jahrhunderts angefangen, Bilder auf andere Weise zu untersuchen, indem sie sie nicht als Ansammlungen von Zeichen, Codes und Erzählungen behandeln, die sich mit Hilfe einer kontextbezogenen Untersuchung entschlüsseln lassen, sondern als eigenständige Akteure, die eine Wirkung auf das gesellschaftliche Leben und den Gefühlshaushalt ihrer Betrachter ausüben.5 Von David Freedberg und Hans Belting bis zu Alfred Gell und Horst Bredekamp ist es diesen Pionieren binnen etwa 30 Jahren gelungen, die Vorstellung weniger ausgefallen wirken zu lassen, dass Bilder sich Menschen gegenüber autonom verhalten und über eine Disposition verfügen, intentionale Wirkungen hervorzurufen, was seit dem 18. Jahrhundert von englischen Autoren agency genannt wird und ich in diesem Buch gerne mit »agence« im Sinne von Handlungsmacht übersetzen würde.6 Das vorliegende Buch folgt dieser Linie, verzichtet aber trotzdem nicht auf die Vorstellung, dass Bilder gleichwohl eine besondere Art von Zeichen sind, die dadurch etwas von der Welt zu erkennen geben, dass sie sie transfigurieren. Denn auch wenn die Kunstwerke mittlerweile ihre Rahmen verlassen haben und von ihren Sockeln heruntergestiegen sind, um ein autonomes Leben zu führen, auch wenn sie sich teilweise aus den Fängen des Symbolismus befreit haben, auf den die Kunstgeschichte sie beschränken wollte, auch wenn sie sich der riesigen Schar von Figurationen angeschlossen haben, welche die Menschen unentwegt als alltägliche Partner und intentionale Akteure in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens einbezogen haben, und auch wenn es einem dank einiger Pioniere mittlerweile freisteht, die neue Qualität der Bilder vorauszusetzen, so haben die meisten von ihnen trotzdem nicht aufgehört, etwas zu repräsentieren, nachzuahmen, figürlich darzustellen, kurz gesagt: in den Augen von jemandem für etwas anderes zu stehen. Muss man sie deshalb gleich als reine, sich selbst immanente Präsenzen betrachten, als so etwas wie Ektoplasmen, die in erster Linie als aktive Triebkräfte zu verstehen sind, bei denen allein die Wirkungen zählen, die sie ausüben, und die Mittel, die sie dazu einsetzen? Das wäre absurd. Und trotzdem hat die praxeologische Revolution möglicherweise im Bemühen um Überzeugungskraft dazu geneigt, die Wirkungen der ikonischen Dimension der Bilder hintanzustellen, ja im Extremfall sogar zu leugnen, dass Letztere auch26Repräsentationen sind. Durch das Aufstellen eines Scheingegensatzes zwischen dem direkten Erleben der Welt, das vor allem prämodernen Menschen zugänglich gewesen sei, und semantischen Vermittlungen, deren Zahl sich in der Moderne um ein Vielfaches erhöht habe, wurde versucht, aus der Repräsentation eine Art Schreckgespenst zu machen, das die Möglichkeit verneint, ein Bild als eine von mehreren denkbaren Äußerungen dessen wahrzunehmen, was es sichtbar macht.7
In den Schriften der Verteidiger der Handlungsmacht von Bildern finden sich zwar durchaus Verweise auf deren Figürlichkeit. So räumt Gell ohne Vorbehalte ein, dass die Kunstwerke, deren Wirkmächtigkeit er analysiert, auch eine ikonische Dimension besitzen, die auf Ähnlichkeit beruht, selbst wenn die Merkmale, auf die diese sich stützt, in manchen Fällen kaum näher umrissen werden: »In der visuellen Kunst kann man von Repräsentation nur dort sprechen, wo eine Ähnlichkeit besteht, die zu Wiedererkennung führt.«8 Trotzdem ist er nicht an diesem Aspekt von Bildern interessiert, sondern an ihrer Indexikalität, das heißt an ihrer Fähigkeit, auf die Intentionalität der Akteure zu verweisen, die sie wiedergeben, die sie gemacht haben oder die sie benutzen. Auch für Belting setzt ein Bild gleichzeitig »Erscheinung« und »Präsenz« voraus.9 In seiner Studie über die Wirkungsmacht christlicher Ikonen stellt Belting unter anderem fest, dass die unmittelbare Präsenz der Jungfrau Maria, von Jesus oder des Heiligen auf dem Bild – jede Ikone ist eine authentische Verkörperung des dargestellten Wesens, keine Kopie seines Erscheinungsbildes – nicht dagegen spricht, dass dieses auch ein ikonisches Zeichen ist, da es eine historische Persönlichkeit darstelle, die als solche anhand figurativer Konventionen wiedererkannt werden müsse. Vor den Ikonen stellten selbst die Reliquien die tatsächliche Präsenz der Heiligen im Altarraum auf metonymische Weise unter Beweis, das heißt durch ein figuratives Dispositiv, bei dem ein Teilstück für das gesamte abwesende Wesen stehe, das es repräsentiere.10 Es stimmt zwar, dass im Mittelalter ein Bruch mit der mimetischen Genauigkeit des klassischen Altertums erfolgte, insofern die Formen und Farben der Bilder zu dieser Zeit als Anzeichen für die Unsichtbarkeit Gottes gedeutet wurden, als figurales Äquivalent zum Mysterium der Inkarnation, und nicht als Nachahmungen, die nach Ähnlichkeit mit dem strebten, was sie darstellten. Trotzdem blieb Ikonizität im weitesten Sinne eine Aufforderung, die Personen zu identifizieren, deren Präsenz 27in Artefakten herbeigeführt wurde, und sie ihres Platzes in der biblischen Geschichte zu versichern, was unverzichtbare Bedingungen für eine wirksame Theophanie waren.11
Dass ein beliebiges Bild immer ein ikonisches Zeichen dessen ist, was es darstellt, und gleichzeitig ein Akteur, in dessen Handlungsvermögen die Intentionen der Personen synthetisiert sind, die es angefertigt und benutzt haben, wird in den Fällen deutlich, in denen vor allem die zweite Funktion die Oberhand zu gewinnen scheint. In seinem Meisterwerk Art and Agency hat Alfred Gell gezeigt, dass die Behandlung eines Bildes als Index anstatt als Symbol – das heißt eher als noch lebendiger Niederschlag einer Handlung oder Intention denn als sprachliche Äußerung – es möglich macht, auf ungleich ökonomischere und überzeugendere Weise Licht auf die Rolle zu werfen, die es im gesellschaftlichen Leben spielt, als wenn man es auf eine semantische Funktion beschränkt; das Bild ist demnach kein konventionelles Zeichen mehr, dessen Bedeutung aufgrund einer schon vorher beherrschten interpretativen Grammatik verständlich ist; es ist Teil von dem geworden, was es darstellt, eine zeitlich und räumlich sichtbare Verlängerung des Referenten, dessen Emanation es gleichsam zu sein scheint.12 Dies erlaubt vor allem eine Erklärung der Wirksamkeit, die Effigien beim Hexenzauber nachgesagt wird, der rätselhaft bliebe, wenn man ihre Macht bloß vom Standpunkt einer Hermeneutik dessen betrachten würde, was sie symbolisieren. Warum sollte meinem Feind dadurch ein Schaden entstehen, dass ich eine ihn darstellende Figur mit Nadeln spicke, wenn die Beziehung zwischen ihm und seiner Effigie innerhalb derselben Ordnung verbleibt wie das willkürliche Verhältnis zwischen einem sprachlichen Signifikanten und seinem Signifikat? Was James Frazer als sympathetische Magie bezeichnet hat, dass nämlich die Eigenschaften, die ein Objekt A und ein Objekt B teilen, Ersterem erlauben, auf Letzteres Einfluss zu nehmen, lässt sich also erklären, wenn man bereit ist, Gell zu folgen und die Figur des Opfers als einen substanziellen Teil desselben und nicht als Saussure’sches Zeichen zu betrachten, das es bezeichnet.13 Obgleich es kein Symbol und keine Symbolkonfiguration abgibt, ist das Hexenbild gleichwohl auch eine Repräsentation, im vorliegenden Fall ein ikonisches Zeichen, in dem bestimmte Qualitäten der figürlich dargestellten Person – ihr Geschlecht, ihre Gestalt, manchmal lediglich ihr Name – so wiedergege28ben werden, dass sie für das Individuum, das ihr schaden will, erkennbar ist. Beim Zaubern ist der Fetisch also zugleich deshalb ein im Rahmen interpersoneller Beziehungen (vermeintlich) wirksamer Akteur, weil er – häufig buchstäblich, da er von ihm ablösbare Teilstücke enthält – ein in ein Artefakt ausgelagerter Bestandteil des Opfers ist und weil er zumindest von demjenigen, der ihn manipuliert, als dessen Figuration identifizierbar ist.
Unterfütterungen durch das Unsichtbare
Die Untersuchung der Figuration, deren Ablauf dieses Buch nachzeichnet, zielt darauf ab, zu zeigen, inwiefern die auf ikonischen Bildern wiedergegebenen Gegenstände und Beziehungen, die Formen, in denen diese Bilder auftreten, und die Arten von Handlungsmacht, die sie ausüben, wechselseitig voneinander abhängen und in groben Zügen die Eigenschaften der einen oder anderen der im Vorwort erwähnten vier großen Welterschaffungssysteme zum Ausdruck bringen. Eine Frage stellt sich allerdings vorab: Warum die Figuration und nicht vielmehr die Kunst oder das Bild zum Gegenstand machen? In erster Linie weil die Figuration universell ist, was auf die Kunst nach ihrem alltäglichen Verständnis nicht zutrifft. Zudem bereitet es keine großen Schwierigkeiten, die Figuration unter Rückgriff auf die Angemessenheit der Mittel zu definieren, die sie einsetzt, um ihre Ziele – die Erschaffung von ikonischen Akteuren – zu erreichen, und zwar so, dass ihre unterschiedlichen Ausdrucksformen jeweils als Modalitäten ein und derselben kognitiven und praktischen Aktivität betrachtet werden können. Insofern bietet sie sich als exemplarischer Gegenstand für den anthropologischen Komparatismus an, dieses waghalsige Unterfangen, das darin besteht, nicht die Merkmale der kulturellen und sozialen Aktivität herauszuarbeiten, die alle Menschen teilen, sondern deren sich an verschiedenen Punkten des Erdballs wiederholende Unterschiede zu systematisieren. Das Wissen der Historiker über die flämische Kunst des 15. Jahrhunderts ist genauso unersetzlich wie die Erkenntnisse der Ethnologen über die Malerei der nordaustralischen Aborigines – und 29ich werde mich ihrer in diesem Buch ausgiebig bedienen; aber im Gegensatz zu dem, was ich hier anstrebe, erlauben sie nicht zu zeigen, inwiefern die Werke, mit denen Erstere sich auseinandersetzen, als mögliche Transformationen der Werke angesehen werden können, die Letztere untersuchen. Dass die ob nun wirksame oder verpönte Figuration ein universeller Trieb sein soll, macht aus ihren Hervorbringungen keine einheitliche Kategorie und aus diesem Grund haben sowohl die philosophischen Ästhetiker als auch die Kunsthistoriker sich erfolglos um die nähere Bestimmung einer transhistorischen Klasse von Kunstgegenständen allein auf der Basis von ihnen inhärenten, sinnlich wahrnehmbaren oder symbolischen Eigenschaften bemüht. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Hinzu kommt, dass die Figuration ein Prozess ist, der Bilder hervorbringt, sodass man nur begreift, was diese in all ihrer Verschiedenartigkeit auszeichnet, wenn die Handlungsformen verständlich sind, die ihnen zugrunde liegen. Außerdem ist die intentionale Autonomie, die wir den Bildern zuschreiben, ihnen nicht intrinsisch, sondern das Ergebnis einer Reihe von Interaktionen, die ihren Ursprung in allen Operationen haben, mittels derer sie für jemanden aktive und wiedererkennbare Präsenz erlangen, das heißt genau das, was von ihrer Anfertigung bis zu den Umständen ihrer Ausstellung die lange Kette dessen bildet, dem sich ihre Figürlichkeit verdankt. Jeder einzelne dieser Punkte ist präzisierungsbedürftig.
Zunächst einmal ist die von einer Anthropologie der Bilder bzw. der figürlichen Darstellung aufgebotene Ikonographie natürlich ungleich umfassender und vielschichtiger als die Werke, für die Kunsthistoriker sich interessieren. Auf diese Weise ist Gell in ein kurioses Paradoxon hineingeraten, als er es für richtig hielt, die Bilder, auf die seine Theorie sich stützte, als »Kunstgegenstände« zu bezeichnen, obwohl es sich bei der überwältigenden Mehrheit von ihnen um Artefakte für den alltäglichen oder rituellen Gebrauch handelte – Schilde, Fetische oder Keulen –, die als Ersatz für Personen und Auslöser von Emotionen dienten: Furcht, ängstliche Bewunderung, Begehren, Verführung, Ekel; diese Bilder sollten ihre Betrachter also nicht vorrangig mit ästhetischem Vergnügen erfüllen oder ihnen eine Botschaft übermitteln, die sich wie eine symbolische Sprache deuten ließ. Sich bei Gegenständen weiterhin auf Kunst zu beziehen, die erst durch ihren Eintritt in die Kreisläufe des Kunstmarkts »künstlerisch« geworden sind, führt 30in Gells Buch zu einer gewissen Zweideutigkeit, die im Wesentlichen auf einem allgemeineren Sachverhalt beruht. Es ist zweifelhaft, ob sich unter beliebigen historischen Umständen eine Klasse von künstlerischen oder ästhetischen Gegenständen erkennen lässt, die im Hinblick auf andere Arten von Gegenständen anhand eindeutiger Eigenschaften näher bestimmbar sind. Diesen Punkt hat Jean-Marie Schaeffer klar herausgearbeitet, weshalb ich mich damit begnügen werde, an seine Argumentation zu erinnern.14
Seit Marcel Duchamp eine Schneeschaufel in ein Kunstwerk verwandelt hat, ist es nicht mehr möglich, den ästhetischen Stellenwert einer Kategorie von Gegenständen allein auf der Basis von sinnlich wahrnehmbaren, ihnen jeweils eigenen Kennzeichen – zum Beispiel visuell reizvollen Formen oder Farben – zu definieren, die sozusagen zu den Wesenszügen gewöhnlicher Gegenstände hinzukämen und Erstere im Vergleich zu Letzteren näher bestimmen würden. Wenn man nämlich annimmt, dass Kunstwerke eine Untergruppe von ästhetischen Gegenständen sind, lässt sich eine wachsende Zahl jener in der Kunstgeschichte berühmt gewordenen Werke – Urinal, Flaschentrockner oder Brillo Box – nicht mehr von Gegenständen ohne ästhetische Qualitäten unterscheiden, wenn maßgebliche Institutionen – Museen, Galerien, Kritiker – dies nicht so beschlossen haben. Keine der Möglichkeiten, dieser Schwierigkeit aus dem Weg zu gehen, ist wirklich befriedigend. Erstens kann man den Begriff des Kunstwerks so eng fassen, dass Werke, die auf der Ebene der Wahrnehmung nicht von einfachen Gebrauchsgegenständen zu unterscheiden sind, nicht mehr dazugehören, doch das liefe darauf hinaus, eine große Zahl von Exponaten aus den sie ausstellenden Museen für zeitgenössische Kunst zu entfernen. Oder aber man kann den Begriff des Kunstwerks so sehr ausweiten, dass er so gut wie alle Artefakte umfasst, was diesem Begriff jegliche Bedeutung nimmt und eine kategoriale Unterscheidung hinfällig macht, deren soziale Existenz nicht von der Hand zu weisen ist.
Gell hat dieser Versuchung nachgegeben, und sie verhindert, dass in manchen Kulturen, in denen Werkzeuge, Waffen und Geräte als autonome, mit wirksamer, sozial anerkannter Handlungsmacht ausgestattete Akteure gelten, zwischen einem Kunstgegenstand und einem banalen Artefakt unterschieden werden kann. Der von Gell für Kunstwerke vorgeschlagenen Definition zufolge können nämlich ein Blasrohr 31bei den Achuar in Amazonien oder ein Schlitten bei den Koyukon in Alaska unter diese Kategorie fallen, das heißt, sie können als Gegenstände klassifiziert werden, die insofern »eine Vermittlung sozialer Handlungsmacht vorn[ehmen]«,15 als sie als Vermittlungsinstanz zwischen den menschlichen Intentionalitäten dienen, die sie inkorporiert haben und neu verteilen: Sowohl Blasrohr als auch Schlitten werden von denjenigen, die sie anfertigen und benutzen, ein Vermögen zugeschrieben, aus eigener Kraft zu handeln, was sich im vorliegenden Fall negativ auswirkt, insofern sie ihrem Besitzer, wenn sie sich durch seine Handlungsweise gekränkt fühlen, die Dienste verweigern, die von ihnen erwartet werden.16 Dabei handelt es sich jedoch nicht um Kunstgegenstände, ja noch nicht einmal um Objekte, bei denen sich eine Figurationsabsicht erkennen ließe. Möglicherweise könnte man sagen, dass sie schön sind, weil sie eine schlichte Geradlinigkeit besitzen und ihre Form perfekt auf ihre Funktion abgestimmt ist, aber sie dienen instrumentellen Zwecken und bilden gar nichts ab.
Ein letzter Ausweg besteht in der Behauptung, dass der Begriff des Kunstwerks einer irreduziblen ontologischen Kategorie entspricht, deren Eigenschaften die Gegenstände, die unter sie fallen, pauschal von allen anderen Artefakten unterscheiden, auch von den ästhetischen Objekten, die keine Kunstwerke sind (zum Beispiel – für manche – ein Sonnenuntergang oder das Federkleid eines Vogels). Das läuft auf eine neuerliche Unterscheidung zwischen ästhetischen Sachverhalten, die auf in der Natur (des wahrnehmenden Subjekts und der wahrgenommenen Objekte) verwurzelte, sinnlich wahrnehmbare Eigenschaften zurückgehen, und künstlerischen Sachverhalten hinaus, die wiederum vollständig der symbolischen Seite zugeschlagen werden, das heißt der Kultur und den Konventionen, in denen sie zum Ausdruck kommt. Die symbolischen Eigenschaften, die Kunstwerke vermeintlich von ästhetischen Gegenständen unterscheiden, laufen nun aber Gefahr, genauso schwer isolierbar zu sein wie die sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften, welche die ästhetischen Objekte charakterisieren sollen, zumindest wenn man ihnen den Universalitätsgrad verleihen möchte, der für ein normatives Vorhaben dieser Art erforderlich ist. Das Unvermögen der Kunstanthropologie, ihren Gegenstand zu definieren, ist kurz gesagt nicht bloß die Folge der Schwierigkeit, auf die sie bei dem Versuch stößt, einen Begriff, der sich im Abendland entwickelt hat, auf nicht32europäische Welten auszuweiten, vielmehr wohnt sie dem Unterfangen, ein beliebiges Artefakt als Kunstwerk zu qualifizieren, als solchem inne.
Der Begriff der Figuration ist mit keinem dieser Nachteile behaftet. In einer ersten Annäherung kann er als Bildgebung, das heißt als jene allen Menschen gemeinsame Operation, definiert werden, mittels derer ein beliebiger Gegenstand infolge einer plastischen Darstellung, Situierung oder Ornamentierung zum ikonischen Zeichen eines Wesens oder Vorgangs gemacht wird, die es diesem Gegenstand erlaubt, wiedererkennbare Qualitäten des Referenten heraufzubeschwören, auf den er sich bezieht, und gleichzeitig unter bestimmten Umständen und in den Augen bestimmter Personen eine Form von unabhängigem Handeln zu erlangen. Eine Figuration vorzunehmen heißt also, eine Repräsentation hervorzubringen, die in doppelter Hinsicht signifikant ist: als Ikon, das auf ostentative Weise das sichtbar macht, für das es steht – in manchen Fällen bloß die Eigenschaft, dass es existiert –, und als Index im Sinne eines Anzeichens, das für die Betrachter die Handlungsmacht des Prototyps und all der verschiedenen Intentionalitäten vergegenwärtigt und aktiviert, deren Wirkung dieses Zeichen ist. Gleichwohl bleibt dieser Prozess nicht der reinen Ausdruckskraft desjenigen überlassen, der die Figuration vornimmt; er lässt sich auch nicht auf das zufällige Zusammentreffen von Wesenszügen des figürlich dargestellten Gegenstandes und technischen Ausführungszwängen reduzieren. Er geht auf eine figurative Konvention zurück, auf ein sowohl sinnliches als auch geistiges Schema, mittels dessen Materie und Form nach häufig stillschweigenden Regeln kombiniert werden können, um einen ikonischen Akteur hervorzubringen, der den Erwartungen all jener entspricht, durch die und für die er geschaffen wurde.17 Der Herausarbeitung dieser Art von Schema ist das vorliegende Buch gewidmet.
Eine Figuration vorzunehmen heißt, eine Figur im Sinne einer Gestalt hervorzubringen. Wie Erich Auerbachs philologische Untersuchung klar gezeigt hat, verweist schon die Semantik des Begriffs »figura« auf deren Vermittlungsfunktion zwischen einer Idee und einer Form, einem abstrakten Modell und einem sinnlichen Ausdruck.18 Bei Varro, Lukrez und Cicero bezeichnet der Begriff figura die plastische Form, also dasjenige, was der Handwerker der Materie verleiht, die er modelliert. Er wird im Allgemeinen von dem der forma als jener »Form« im Sinne einer Gussform unterschieden, mit deren Hilfe eine Form hergestellt 33wird. Darauf beruht die Affinität zwischen den beiden Begriffen: forma bezieht sich auf dieselbe Weise auf figura, wie die Hohlform sich sowohl auf den modellierten Gegenstand, der auf sie zurückgeht, als auch auf den Prototyp bezieht, mit dessen Hilfe die Gussform hergestellt wurde. In diesem Sinne ist figura nicht nur das äußere Erscheinungsbild, die sichtbare Seite, sondern auch die Verkörperung des abstrakten Modells, der Abdruck des geformten Gegenstandes, der spiegelverkehrt vorliegt und in die Bilder, die seinem ursprünglichen Erscheinungsbild entsprechen, inkorporiert wurde.
Die Vorstellung, dass die Figur die dynamische Aktualisierung eines Formenpotenzials ist, findet sich im Übrigen in späteren, fachbegrifflichen Verwendungsweisen von figura wieder, die das philosophische Vokabular aus dem Griechischen übersetzen sollen: forma wird als Äquivalent für morphe und eidos benutzt, das heißt für das ideale Modell, die ontologische Dimension des Gegenstandes, während figura die Übersetzung von schema ist, der Form, wie sie sinnlich wahrgenommen wird, der sichtbarem Struktur als qualitativer Kategorie des Gegenstandes. Lange Ausführungen widmet Auerbach darüber hinaus einer noch späteren Verwendungsweise von figura, die das semantische Feld des Begriffs erweitert hat. In der lateinischen Patrologie bezeichnet figura nämlich die Präfiguration des Handelns von Christus im Handeln der Propheten. Die im Alten Testament angekündigten Ereignisse und ihr Eintreten im Neuen Testament gelten nun aber uneingeschränkt als historisch, also real, sodass, wie Augustinus erklärt, die Aktualisierung dessen, was eine Figuration erfuhr, nicht nur nachträglich die Wahrhaftigkeit der ankündigenden Figur bestätigt, sondern auch den realen Archetyp dessen bildet, was sie bildlich vorweggenommen hat.19 In der Genese des Figurationsgedankens hat sich also auf glückliche Weise jene Verknüpfung von Bild-Gestalt (Umriss, Hülle) und Form-Gestalt (Schema) niedergeschlagen, also die Kombination des sichtbaren ikonischen Indexes und des unsichtbaren Prototyps, der ihm seine Eigentümlichkeit verleiht, des ideellen Modells und seiner authentischen Aktualisierung. Kurz gesagt, sind Bilder die aktive Spur nicht nur der Gegenstände, die sie figürlich darstellen und mit denen sie wiedererkennbare Eigenschaften teilen, sondern auch der Seinsweisen dieser Gegenstände.
34Verkörperte Zeichen
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellen sich zwei Fragen. Erstens: Entziehen Bilder, die keine Figurationen sind, sich dieser Untersuchung oder muss man mit David Freedberg davon ausgehen, dass »der Begriff des Anikonismus völlig unhaltbar ist«?20 Zweitens: Durch welche Mechanismen gelingt den Bildern nicht nur die Sichtbarmachung von Existenzen, deren einzige Existenzweise sie in manchen Fällen sind, sondern auch von auf andere Weise nicht ausdrückbaren Prozessen und Zuständen sowie von Beziehungen zwischen Existenzen, die durch ihre Repräsentation Evidenzkraft erlangen? Beim Einstieg in die erste Frage ist zu beachten, dass die Grenze zwischen Figurativem und Nichtfigurativem schwer zu ziehen ist und eher die Gestalt eines stufenlosen Übergangs von einem Pol, der ikonischen, durch obsessive mimesis gekennzeichneten Darstellungen vorbehalten ist – der sogenannten »realistischen« Kunst –, zu einem anderen Pol annimmt, an dem willentlich anikonische Darstellungen ihren Platz haben, die wie beispielsweise einige Formen von Verzierung und nonfigurativer Kunst den Repräsentationsgedanken insgesamt zurückweisen. Dazwischen liegen entweder stilisierte Arten von Ornamentik, deren Motive oder Motivkombinationen auf einen Referenten verweisen, oder sogenannte »abstrakte« Kunstwerke, die einen Zustand oder eine Intention zum Ausdruck bringen, welche nach Einschätzung ihres Urhebers vom Betrachter wiedererkannt werden. Um diesem Ikonizitätskontinuum Substanz zu verleihen, ist etwas Typologie erforderlich.
Zunächst einmal gibt es Bilder, die nichts anderes sind als ihre eigene Figuration, weil sie die Präsenz eines Wesens inkorporiert haben, das normalerweise unsichtbar ist oder viele verschiedene Formen annehmen kann, wie zum Beispiel jene mehr oder weniger amorphen Steine, die in einer ganzen Reihe von Zivilisationen für den Kultus von Bedeutung sind. Das Gleiche gilt für die in manchen Fällen wie vom Himmel gefallenen Bätyle, grob oder ungelenk in konische oder viereckige Formen gehauene Steine, die in zahlreichen antiken Kulturen im westlichen Mittelmeerraum und in Arabien verehrt wurden und entweder mit den Götterstatuen realistischer Machart (zum Beispiel in Griechenland oder Rom) koexistieren konnten oder aber (in der semi35tischen Welt) die einzigen sichtbaren Ausdrucksformen einer Gottheit bildeten. An den Kultstätten der nabatäischen Zivilisation, vor allem in Petra, wo diese Bätyle weit verbreitet waren, wurden sie zuweilen mit spärlich ausgemeißelten, flachen Gesichtern verziert, doch in den meisten Fällen wurden sie nicht bearbeitet und nichts an ihrem Äußeren deutete direkt auf das hin, worauf sie sich bezogen. Dafür gab es gute Gründe: In zahlreichen Fällen – und darauf lässt auch die Etymologie des Wortes »Bätyl« schließen, das über das Griechische auf Hebräisch beth-el, »Gottes Haus«, zurückgeht – waren Bätyle keine Bilder im unmittelbaren Sinne, sondern ein Gefäß, das die Gottheit aufnahm, der Ort, an dem sie sich aufhielt, sodass ihre Anbetung sich nicht direkt auf den Stein richtete, sondern auf die heilige Präsenz, die er sichtbar machte und die über ihn zugänglich wurde. Wie Gell zu Recht mit Blick auf die griechische Form der Bätyle festhält, ist der Stein in diesem Fall die Figuration eines Gottes, der nicht notwendig eine eigene Form besitzt, eine Figuration, die ihn nicht auf mimetische Weise repräsentiert, sondern einige raumzeitliche Eigenschaften greifbar macht, die ihm von seinen Verehrern zugeschrieben werden.21 Der Stein »repräsentiert« die Gottheit also nicht in dem Sinne, dass er auf realistische Weise einen Prototyp wiedergibt, von dem man so gut wie gar nicht weiß, welche ursprüngliche Form er angenommen haben könnte, sondern so, wie man sagt, dass ein Diplomat sein Land repräsentiert: Er ist keine mimetische Figuration der Nation, die er repräsentiert, sondern das sichtbare Bild, das sie unter bestimmten Umständen in den Augen einer anderen, ihn empfangenen Nation abgibt.
Das Gleiche lässt sich über die huacas im alten Peru und ihre Entsprechungen in den heutigen Anden sagen. Auf Ketschua bezeichnete der Ausdruck Objekte, Orte, Personen oder Tiere, die von einer heiligen Präsenz umgeben waren und angebetet wurden, vor allem Berge, Höhlen, Quellen, Mumien, Heiligtümer und Monolithe. Letztere waren wahrscheinlich deren verbreitetste, noch heute dort sichtbare Erscheinungsform, wo die eifrigen Bekämpfer des Götzendienstes sie nicht zu entdecken vermochten. Diesen Fels-huacas wurden Opfer dargebracht; zu diesem Anlass schmückte man sie mit prächtigen Tüchern, was dazu führte, dass die Spanier sie schon sehr früh als Götzenbilder im ursprünglichen Sinne des Wortes Idol – eidolon – betrachteten, das heißt als Abbilder einer spirituellen Gegebenheit. Sie nahmen ihren Status 36also ganz genau wahr. Doch wovon genau waren diese Felsen ein ikonisches Zeichen? Von einer beständigen, lokal verankerten, aber deshalb undarstellbaren heiligen Macht, weil sie keine bestimmte Form aufwies: Der Monolith war eine Figuration der unwandelbaren Dauerhaftigkeit dieser Macht und schloss sie gleichzeitig in klar bestimmte Grenzen ein, wie zum Beispiel die Berg-huacas, deren metonymisches Echo er sozusagen bildete. Im Hinblick auf diese dreifache bildgebende Funktion – Fixieren, Ausdrücken, Abgrenzen – ähnelt der Fels-huaca den pokara der heutigen Chipayas in der bolivianischen Provinz Carangas.22 Das Gebiet dieser Gemeinschaft ist mit diesen kleinen kegelförmigen Monumenten aus ungebrannten Lehmziegeln übersät, die als Wohnsitz der mallku, also jener chthonischen Einzelgötter, gelten, die dort zusammen mit ihren Gemahlinnen leben. Die mallku der Chipayas ähneln den Berg-Gottheiten ihrer aymarischen Nachbarn und man kann die pokara, die als Gefäß für diese Gottheiten dienen, als einen Miniaturersatz für Berge betrachten, der einst auf einem Hochplateau ohne natürliche Erhebungen behauen wurde, um Wesen mit einer physischen Repräsentation auszustatten, die sich nirgendwo sonst inkorporieren ließen.
Zwei kurze Beispiele sollen diese Anmerkungen über die einzigartige Ikonizität mancher Bilder beschließen, die keinerlei Ähnlichkeit mit etwas anderem aufweisen. Das erste bezieht sich auf Alain Babadzans Beschreibung der unter den Namen mauri bekannten polynesischen Fruchtbarkeitssteine, die genauso wie die Bätyle, die huacas und die pokara nichtmimetische Figurationen einer Macht sind, die keine andere Form besitzt als die Form des Bildes, das der sie repräsentierende Gegenstand von ihr abgibt.23 Die bei den neuseeländischen Maori gebräuchlichen mauri