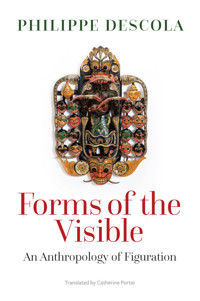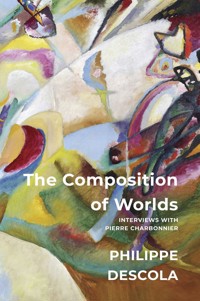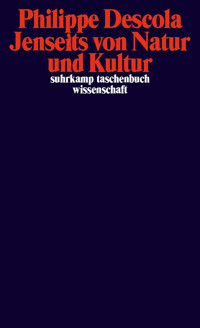
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit der Zeit der Renaissance ist unser Weltbild von einer zentralen Unterscheidung bestimmt: der zwischen Natur und Kultur. Dort die von Naturgesetzen regierte, unpersönliche Welt der Tiere und Dinge, hier die Menschenwelt mit ihrer individuellen und kulturellen Vielfalt. Diese fundamentale Trennung beherrscht unser ganzes Denken und Handeln. In seinem faszinierenden Buch zeigt der große französische Anthropologe und Schüler von Claude Lévi-Strauss, Philippe Descola, daß diese Kosmologie alles andere als selbstverständlich ist. Dabei stützt er sich auf reiches Material aus zum Teil eigenen anthropologischen Feldforschungen bei Naturvölkern und indigenen Kulturen in Afrika, Amazonien, Neuguinea oder Sibirien. Descola führt uns vor Augen, daß deren Weltbilder ganz andersartig aufgebaut sind als das unsere mit seinen »zwei Etagen« von Natur und Kultur. So betrachten manche Kulturen Dinge als beseelt oder glauben, daß verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Tieren und Menschen bestehen. Descola plädiert für eine monistische Anthropologie und entwirft eine Typologie unterschiedlichster Weltbilder. Auf diesem Wege lassen sich neben dem westlichen dualistischen Naturalismus totemistische, animistische oder analogistische Kosmologien entdecken. Eine fesselnde Reise in fremde Welten, die uns unsere eigene mit anderen Augen sehen läßt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 986
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Unser Weltbild wird seit der Renaissance von der zentralen Unterscheidung von Natur und Kultur bestimmt: dort die Naturgesetze, die die Welt der Tiere und Dinge beherrschen, hier die Menschenwelt und ihre kulturelle Vielfalt. In seinem faszinierenden Buch zeigt der große französische Anthropologe Philippe Descola, daß diese Kosmologie nicht selbstverständlich ist. Dabei stützt er sich auf das Material seiner Feldforschungen bei Naturvölkern und indigenen Kulturen in Afrika, Amazonien, Neuguinea oder Sibirien, deren Weltbilder ganz andere sind als unsere. Eine fesselnde Reise in fremde Welten, die uns unsere eigene mit anderen Augen sehen läßt.
Philippe Descola ist Professor für Anthropologie am Collège de France. Im Suhrkamp Verlag ist zuletzt erschienen: Leben und Sterben in Amazonien. Bei den Jívaro-Indianern (2011).
Philippe Descola
Jenseits vonNatur und Kultur
Aus dem Französischenvon EvaMoldenhauer
Mit einem Nachwortvon Michael Kauppert
Suhrkamp
4Titel der Originalausgabe:
Par-delà nature et culture © Éditions Gallimard, Paris, 2005
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Unterstützung des
Französischen Ministeriums für Kultur – Centre National du Livre
und der Maison des sciences de l’homme.
Ouvrage publié avec le concours du Ministère français
chargé de la culture – Centre National du Livre et
la Maison des sciences de l’homme.
Die Publikation wird mitgetragen vom Herder-Kolleg, Zentrum für transdisziplinäre Kulturforschung an der Universität Hildesheim.
Die Übersetzerin bedankt sich für die Förderung ihrer Arbeit durch den Deutschen Übersetzerfond e. V. sowie durch die DVA-Stiftung
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag 2011
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978–3–518–76840–2
www.suhrkamp.de
5
Inhalt
Vorwort
11
I. Die Natur in Trompe-l’œil
1.
Figuren des Kontinuierlichen
21
2.
Das Wilde und das Domestizierte
63
Nomaden-Räume
64
Der Garten und der Wald
71
Der Acker und das Reisfeld
80
Ager und silva
86
Der Hirte und der Jäger
90
Römische Landschaft, herzynischer Wald, romantische Natur
93
3.
Die große Trennung
99
Die Autonomie der physis
107
Die Autonomie der Schöpfung
112
Die Autonomie der Natur
115
Die Autonomie der Kultur
120
Die Autonomie des Dualismus
129
Die Autonomie der Welten
138
II. Strukturen der Erfahrung
4.
Die Schemata der Praxis
145
Struktur und Beziehung
146
Das Wissen des Vertrauten
155
Schematismen
161
Differenzierung, Stabilisierung, Analogien
169
65.
Beziehung zu sich, Beziehung zum Anderen
176
Identifikationsmodi und Beziehungsmodi
176
Der Andere ist ein »Ich«
181
III. Die Dispositionen des Seins
6.
Der wiederhergestellte Animismus
197
Formen und Verhaltensweisen
198
Die Gestalten der Metamorphose
206
Animismus und Perspektivismus
211
7.
Über den Totemismus als Ontologie
219
Die Traumzeit
222
Australisches Inventar
224
Semantik der Taxonomien
234
Varietäten von Hybriden
244
Rückkehr zu den Totems der Algonkin
250
8.
Die Gewißheiten des Naturalismus
259
Eine irreduzible Menschheit?
262
Tierische Kulturen und Sprachen?
269
Ein Mensch ohne Geist?
278
Rechte der Natur?
287
9.
Schwindelerregende Analogie
301
Die Kette des Seins
302
Eine mexikanische Ontologie
310
Afrikanische Echos
331
Kopplungen, Hierarchie, Opfer
337
10.
Terme, Beziehungen, Kategorien
345
Einbeziehungen und Symmetrien
349
Unterschiede, Ähnlichkeiten, Klassifikationen
356
IV. Der Gebrauch der Welt
11.
Die Institution der Kollektive
365
Jeder Art ihr Kollektiv
366
Eine asoziale Natur und exklusive Gesellschaften
378
7 Unterschiedliche komplementäre hybride Kollektive
380
Ein gemischtes, inklusives und hierarchisiertes Kollektiv
394
12.
Metaphysik der Sitten
412
Ein um sich greifendes Ich
414
Das denkende Schilfrohr
423
Das Kollektiv repräsentieren
426
Die Signatur der Dinge
436
V. Ökologie der Beziehungen
13.
Die Formen der Verbundenheit
451
Geben, nehmen, tauschen
453
Produzieren, schützen, übermitteln.
468
14.
Der Verkehr der Seelen
489
Räuber und Beute
491
Die Symmetrie der Verpflichteten
502
Die Gemeinsamkeit des Teilens
512
Das ethos der Kollektive
522
15.
Strukturgeschichten
529
Vom Karibu-Mann zum Herrgott-Stier
531
Jagd, Zähmung, Domestizierung
546
Genese der Veränderung
558
Epilog Das Register der Möglichkeiten
565
Danksagungen
585
Bibliographie
587
Verzeichnis der Abbildungen
610
Nachwort von Michael Kauppert
611
Register
626
8
9Für Léonore und Emmanuel
10
11Vorwort
Uns erstaunen und beschäftigen fremde Dinge mehr als die alltäglichen [...]; denn wenn man sich, meine ich, einmal näher betrachtete, was wir bei den unter uns lebenden Tieren alltäglich zu sehn bekommen, würde man genug Verhaltensweisen entdecken, die genauso erstaunlich sind wie die aus fernen Ländern und Jahrhunderten eifrig zusammengetragenen. Es ist ein und dieselbe Natur, die auf ihrer Bahn dahinrollt.
Montaigne, Apologie für Raymond Sebonde
Es ist noch gar nicht so lange her, daß wir uns an den Kuriositäten der Welt ergötzen konnten, ohne die aus der Beobachtung der Tiere gezogene Lehre von derjenigen zu trennen, die uns die Sitten der Antike oder die Bräuche ferner Gegenden erteilten. Es herrschte »ein und dieselbe Natur«, die zwischen den Menschen und den Nichtmenschen die Fülle der technischen Fertigkeiten, der Lebensgewohnheiten und der Denkweisen gerecht verteilte. Zumindest bei den Gebildeten ging diese Zeit einige Jahrzehnte nach Montaignes Tod zu Ende, als die Natur aufhörte, eine Ordnung zu sein, die die unterschiedlichsten Dinge vereinte, und zu einem Bereich autonomen Gesetzen unterliegender Gegenstände wurde, vor dessen Hintergrund die Willkür der menschlichen Tätigkeiten ihr verführerisches Schillern entfalten konnte. Eine neue Kosmologie war entstanden, eine außerordentliche kollektive Erfindung, die der Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens einen beispiellosen Rahmen bot und deren ein wenig ungenierte Hüter wir auch zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts noch immer sind. Zu den Kosten dieser Vereinfachung gehörte auch etwas, was um so leichter ignoriert wurde, als es nicht auf unser Konto ging: Zur gleichen Zeit wie die Modernen die bequeme Neigung der barbarischen und wilden Völker entdeckten, alles nach ihren Normen zu beurteilen, ließen sie ihren eigenen Ethnozentrismus hinter einer rationalen Suche nach Erkenntnis verschwinden, deren Irrwege seither unsichtbar blieben. Überall und 12zu allen Zeiten, so behauptete man, habe eine stumme und unpersönliche Natur ihren Einfluß ausgeübt, den die Menschen auf mehr oder weniger plausible Weise zu interpretieren sich befleißigten und aus dem sie mit mehr oder weniger Glück Nutzen zu ziehen suchten; die meisten Konventionen und Gepflogenheiten konnten von nun an nur dann Bedeutung erlangen, wenn sie auf natürliche Regelmäßigkeiten zurückgeführt wurden, die von denen, die ihnen unterworfen waren, mehr oder weniger richtig erfaßt wurden. Durch einen Gewaltstreich von mustergültiger Diskretion war unsere Aufteilung der Lebewesen und der Dinge zu einer Norm geworden, der sich niemand entziehen konnte. Das Werk der Philosophie fortsetzend, um deren geistige Vorherrschaft sie sie vielleicht beneidete, bestätigte die entstehende Anthropologie diese Reduktion der Vielfalt alles Existierenden auf zwei Ordnungen heterogener Realitäten und bot ihr sogar, dank dem Überfluß unter allen Breiten gesammelter Fakten, die Gewähr der Universalität, die ihr bislang noch fehlte. Im übrigen schlug sie diesen Weg ein, ohne recht darauf zu achten, so fasziniert war sie von der schillernden »kulturellen Vielfalt«, aus deren Aufzeichnung und Studium sie ihre Daseinsberechtigung bezog: die verschwenderische Fülle der Institutionen und Denkweisen wurde weniger großartig und ihre Zufälligkeit erträglicher, wenn man annahm, daß alle diese Praktiken, deren Logik sich bisweilen nur mühsam feststellen ließ, lauter besondere Antworten auf die gemeinsame Herausforderung waren, die vom Körper und der Umwelt gebotenen biophysischen Möglichkeiten zu disziplinieren und Nutzen daraus zu ziehen. Das vorliegende Buch ist aus einem Gefühl der Unzufriedenheit mit diesem Zustand und aus dem Wunsch entstanden, dem abzuhelfen, indem ich vorschlug, sich den Beziehungen zwischen Natur und Gesellschaft auf andere Weise zu nähern.
Die derzeitigen Umstände sind für ein solches Unterfangen besonders günstig. Denn die geräumige Wohnung mit ihren zwei übereinanderliegenden Etagen, in der wir es uns seit einigen Jahrhunderten bequem gemacht haben, beginnt Mängel zu zeigen. Im vornehmen Teil, in dem die Wissenschaften der Natur und des Lebens, nachdem sie die Vertreter der Offenbarungsreligionen aus den Salons vertrieben haben, in allem, was man von der Welt wissen kann, den Ton angeben, entdecken einige taktlose Ab13trünnige hinter Tapeten und Täfelungen die verborgenen Mechanismen, die es ermöglichen, die Erscheinungen der physischen Welt einzufangen, sie zu sortieren und ihnen einen autorisierten Ausdruck zu geben. Die Treppe zum Stockwerk der Kultur, die lange Zeit ihrer Steilheit wegen recht beschwerlich war, ist inzwischen so morsch geworden, daß nur wenige sie entschlossen zu erklimmen wagen, um den Völkern die materiellen Triebfedern ihrer kollektiven Existenz kundzutun, oder sie ohne Vorsichtsmaßnahmen hinabzusteigen, um den Gelehrten den Widerspruch des Gesellschaftskörpers zu melden. Aus der Vielzahl der Kämmerchen, die ganz unterschiedliche Kulturen beherbergen, tropfen bizarre Infiltrate ins Erdgeschoß, Bruchstücke fernöstlicher Philosophien, Brocken hermetischer oder mosaischer, vom New Age angehauchter Theorien, die zwar nicht sehr ernst zu nehmen sind, hier und da jedoch zwischen Menschen und Nichtmenschen einige Trennwände verunreinigen, die man für besser geschützt hielt. Was die Forscher betrifft, die in alle Ecken des Planeten geschickt worden waren, um dort die primitiver gebauten Häuser zu beschreiben, und die sich lange bemüht hatten, deren Inventar anhand des ihnen vertrauten Musterplans aufzustellen, so brachten sie allerlei ausgefallene Informationen mit: einige Häuser haben überhaupt kein Stockwerk, Natur und Kultur wohnen mühelos in einem einzigen Zimmer beisammen; andere Häuser scheinen zwar mehrere Stockwerke zu haben, doch in ihren seltsam aufgeteilten Funktionen teilt sich die Wissenschaft mit dem Aberglauben das Bett, läßt sich die politische Macht vom Kanon des Schönen inspirieren, Makrokosmos und Mikrokosmos befinden sich in vertrautem Gespräch; man sagt sogar, daß es Völker ohne Häuser geben soll, die auch ohne Ställe und Gärten auskommen, da wenig geneigt, die Lichtung des Seins zu bepflanzen oder ihre ausdrückliche Bestimmung in der Zähmung des Natürlichen in sich selbst oder um sich herum zu sehen. Von den großen Architekten des klassischen Zeitalters errichtet, um zu dauern, ist das dualistische Gebäude zwar noch immer solide, zumal es mit bewährtem Geschick unermüdlich restauriert wird. Doch springen seine strukturellen Mängel denjenigen immer deutlicher in die Augen, die es nicht auf mechanische Weise bewohnen, so wie all denen, die darin eine Unterkunft finden möchten, um Völker, die andere Arten von Behausungen gewohnt sind, damit vertraut zu machen.
14Dennoch wird man auf den folgenden Seiten nicht die Skizze eines neuen gemeinschaftlichen Hauses finden, das die nichtmodernen Kosmologien gastfreundlicher aufnehmen würde und besser an die Zirkulation der Tatsachen und Werte angepaßt wäre. Man darf wetten, daß die Zeit nicht mehr fern ist, in der ein solches Gebäude allmählich auftauchen wird, ohne daß man genau weiß, wer die Arbeiten übernehmen wird; denn auch wenn es üblich geworden ist, zu sagen, daß die Welten erbaut wurden, so kennt doch niemand ihre Architekten, und man beginnt gerade erst zu ahnen, aus welchen Materialien sie bestehen. Jedenfalls liegt eine solche Baustelle in der Zuständigkeit der Bewohner des Hauses, denen es darin zu eng sein könnte, und nicht der einer besonderen Wissenschaft, und sei es der Anthropologie.1 Deren Aufgabe, wie ich sie verstehe, besteht darin, zusammen mit anderen Wissenschaften und gemäß ihren eigenen Methoden dazu beizutragen, die Art und Weise verständlich zu machen, wie sich Organismen besonderer Art in die Welt einfügen, eine feste Vorstellung von ihr erwerben und dazu beitragen, sie zu verändern, indem sie, mit ihr und untereinander, dauerhafte oder gelegentliche Bindungen von bemerkenswerter, aber nicht unendlicher Vielfalt knüpfen. Bevor man also für eine in den Wehen liegende Zukunft eine neue Charta ersinnt, muß man als erstes die Kartographie dieser Bindungen erstellen, ihre Natur besser verstehen, ihre Vereinbarkeiten und Unvereinbarkeiten feststellen und untersuchen, wie sie sich in unmittelbar distinktiven Arten des In-der-Welt-Seins aktualisieren. Um ein solches Unternehmen glücklich zu Ende zu führen, muß sich die Anthropologie ihres konstitutiven Dualismus entledigen und vollständig monistisch werden; nicht im quasi religiösen Sinn des Wortes, zu dessen Apostel sich Haeckel gemacht hatte und den einige Umweltphilosophien übernommen haben, natürlich auch nicht mit dem Ehrgeiz, die Pluralität der Existierenden auf eine Einheit der Substanz, des Endzwecks oder der Wahrheit zu reduzieren, wie es die Philosophen des 19. Jahrhunderts versucht hatten, sondern damit deutlich wird, daß der Plan, den Beziehungen gerecht zu wer15den, die die Menschen zueinander und zu den Nichtmenschen unterhalten, sich nicht auf eine Kosmologie und eine Ontologie stützen kann, die so fest in einem besonderen Kontext verankert sind wie die unseren. Deshalb werden wir zunächst aufzeigen müssen, daß der Gegensatz zwischen Natur und Kultur nicht so universell verbreitet ist, wie behauptet wird, nicht nur, weil er für alle anderen außer für die Modernen sinnlos ist, sondern auch, weil er im Verlauf der Entwicklung des abendländischen Denkens selbst erst spät in Erscheinung trat, wo sich seine Folgen besonders stark in der Art und Weise bemerkbar gemacht haben, wie die Anthropologie ihren Gegenstand und ihre Methoden betrachtet. Dieser Klarstellung ist der erste Teil dieses Buchs gewidmet. Doch es reicht nicht aus, die historische Zufälligkeit oder die verzerrenden Auswirkungen dieses Gegensatzes hervorzuheben. Man muß ihn auch in ein neues analytisches Feld eingliedern können, in dem der moderne Naturalismus, weit entfernt, die Richtschnur zu sein, die es ermöglicht, zeitlich oder räumlich entfernte Kulturen zu beurteilen, nur eine der möglichen Ausdrucksformen weit allgemeinerer Schemata wäre, die die Objektivierung der Welt und der anderen beherrschen. Die Natur dieser Schemata zu spezifizieren, die Regeln ihrer Zusammensetzung deutlich zu machen und eine Typologie ihrer Anordnungen zu erstellen, dies ist die Hauptaufgabe, die ich mir in diesem Werk vorgenommen habe.
Da ich einer kombinatorischen Analyse der Beziehungsmodi unter den Existierenden den Vorrang einräumte, mußte ich das Studium ihrer Entwicklung aufschieben, eine Entscheidung der Methode und nicht der Umstände. Hätte ich diese beiden Unternehmungen kombiniert, dann hätte ich nicht nur bei weitem den vernünftigen Umfang überschritten, den ich für dieses Buch beibehalten möchte; ich bin auch überzeugt, daß die Erzeugung eines Systems erst dann analysiert werden kann, wenn die besondere Struktur dieses Systems aufgedeckt worden ist, ein Vorgehen, dem Marx mit seiner Untersuchung der Entstehung der kapitalistischen Produktionsformen zur Legitimität verholfen hat und das er in einem berühmten Satz zusammenfaßte: »In der Anatomie des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen.«2 Ge16gen den Historizismus und seinen naiven Glauben an die Erklärung durch die vorausgehenden Ursachen muß energisch daran erinnert werden, daß allein die Kenntnis der Struktur eines Phänomens es ermöglicht, auf angemessene Weise nach seinen Ursprüngen zu fragen. So wie die kritische Theorie der Kategorien der politischen Ökonomie für Marx notwendig Vorrang haben mußte vor der Untersuchung der Reihenfolge des Auftauchens der Phänomene, denen diese Kategorien Rechnung tragen wollten, ebenso kann die Genealogie der Elemente, die für die verschiedenen Typen der Beziehung zur Welt und zu den anderen konstitutiv sind, erst dann nachgezeichnet werden, wenn die stabilen Formen, zu denen diese Elemente sich verbinden, isoliert worden sind. Ein solches Vorgehen ist nicht ahistorisch; es hält sich an die Empfehlung Marc Blochs, der regressiven Geschichtsschreibung ihr ganzes Gewicht einzuräumen, das heißt zuerst die Gegenwart zu betrachten, um sodann die Vergangenheit besser interpretieren zu können.3 Allerdings ist die Gegenwart, die ich verwenden werde, häufig den Umständen geschuldet und tritt im Plural auf; wegen der Vielfalt des verwendeten Materials, der Ungleichheit der Quellen und der Notwendigkeit, Gesellschaften in einem entwickelten Zustand heranzuziehen, wird sie sich mehr der ethnographischen Gegenwart annähern als der zeitgenössischen Gegenwart, eine Art Momentaufnahme, die eine Gemeinschaft in einem bestimmten Augenblick ihres Wegs erfaßt, wo sie einen für den Vergleich exemplarischen Wert, anders gesagt: einen Idealtypus aufweist.
Zweifellos wird der Plan, eine monistische Anthropologie in Angriff zu nehmen, manchen als ein maßloses Unterfangen vorkommen, so groß sind die zu überwindenden Schwierigkeiten und so reichhaltig das zu behandelnde Material. Daher ist der Essay, den ich dem Leser vorlege, wörtlich zu nehmen: als ein Versuch, eine Probe, ein Mittel, sich zu vergewissern, daß diese Verfahrensweise möglich ist und der vorgesehenen Verwendung 17besser entspricht als die zuvor versuchten Experimente. Diese Verwendung ist also eine Art und Weise, die Grundlagen und die Folgen der Andersheit zu betrachten, die die ganze Vielfalt der Formen respektiert, unter denen die Dinge und ihr Gebrauch sich unseren Augen darbieten. Denn es ist an der Zeit, daß die Anthropologie der großzügigen Bewegung gerecht wird, die sie hat aufblühen lassen, indem sie einen unbefangeneren Blick auf die Welt wirft, zumindest einen Blick, der gereinigt ist vom dualistischen Schleier, den die Entwicklung der Industriegesellschaften zum Teil obsolet gemacht hat und der die Ursache so mancher Verzerrungen in der Wahrnehmung von Kosmologien war, die sich von der unseren allzusehr unterschieden. Diese galten als rätselhaft und daher als der gelehrten Aufmerksamkeit würdig, da hier die Grenzlinien zwischen den Menschen und den »Naturgegenständen« unscharf, ja sogar inexistent zu sein schienen – ein logischer Skandal, den es zu beenden galt. Aber man wurde sich kaum bewußt, daß bei uns die Grenze kaum deutlicher war, trotz der ganzen epistemologischen Apparatur, die aufgeboten wurde, um ihre Undurchlässigkeit zu gewährleisten. Zum Glück ist die Situation im Begriff, sich zu verändern, und es ist heute schwierig, so zu tun, als befänden sich die Nichtmenschen nicht überall mitten im sozialen Leben, ob sie nun die Form eines Affen annehmen, mit dem man in einem Labor kommuniziert, der Seele einer Yamswurzel, die den, der sie anbaut, im Traum aufsucht, eines elektronischen Gegners, der beim Schachspiel geschlagen werden muß, oder eines Ochsen, der bei einer zeremoniellen Opferung als Vertreter einer Person behandelt wird. Ziehen wir die Konsequenzen daraus: die Analyse der Interaktionen zwischen den Bewohnern der Welt kann sich nicht mehr auf den alleinigen Sektor der Institutionen beschränken, die das Leben der Menschen beherrschen, als wäre alles, was man außerhalb ihrer dekretierte, lediglich ein anomisches Konglomerat von Gegenständen, die auf Bedeutung und Verwendbarkeit warten. Viele sogenannte »primitive« Gesellschaften fordern uns zu einer solchen Überschreitung auf, sie, denen es nie in den Sinn gekommen ist, daß die Grenzen des Menschseins an den Toren der menschlichen Gattung haltmachen, sie, die nicht zögern, zum Konzert ihres sozialen Lebens noch die bescheidensten Pflanzen, die unbedeutendsten Tiere einzuladen. Die Anthropologie ist also mit einer 18großartigen Herausforderung konfrontiert: entweder mit einer erschöpften Form von Menschsein zu verschwinden oder sich zu verwandeln, indem sie ihr Gebiet und ihre Werkzeuge so überdenkt, daß sie in ihren Gegenstand nicht nur den anthropos, sondern die gesamte Gemeinschaft der Existierenden einbezieht, die mit ihm verbunden ist und der gegenwärtig eine Nebenfunktion zugewiesen wird. Oder um es konventioneller auszudrücken: Die Kulturanthropologie muß mit einer Naturanthropologie einhergehen, die offen ist für jenen Teil ihrer selbst und der Welt, den die Menschen aktualisieren und mittels dessen sie sich objektivieren.
1
Bruno Latour hat kürzlich in einem politischen Essay von wohltuender Kühnheit eine Skizze dessen vorgelegt, wie eine solche Umgestaltung aussehen könnte (Latour, B., 1999).
2
Marx, K., Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Einleitung, 1974, S. 26. Vor allem in diesem Teil der Grundrisse, der sich mit den Formen vor der kapitalistischen Produktion befaßt, hat Marx sein Verfahren der regressiven Geschichtsschreibung eingesetzt; siehe den glänzenden Kommentar hierzu von Maurice Godelier in seinem Vorwort zu Sur les sociétés précapitalistes, textes choisis de Marx, Engels, Lénine, 1970, S. 46–51.
3
Bloch, M., 1988 (1931), S. 47–51.
19I Die Natur in Trompe-l’œil
Daß es Naturbeschaffenheit gibt, das nachweisen zu wollen, wäre ein lächerlicher Versuch. Es liegt doch auf der Hand, daß Vieles unter dem Vorkommenden von der Art ist.
Aristoteles, Physik
Vi que não há Natureza,
Que Natureza não existe,
Que há montes, vales, planícies,
Que há árvores, flores, ervas,
Que há rios e pedras,
Mas que não há um todo a que isso pertença,
Que um conjunto real e verdadeiro
É uma doença das nossas ideias.
A Natureza é partes sem um todo
Isto é talvez o tal mistério de que falam.
Fernando Pessoa,Poemas de Alberto Caiero
20
211 Figuren des Kontinuierlichen
Am Unterlauf des Kapawi, eines schlammigen Flusses im oberen Amazonasbecken, habe ich angefangen, mich nach der Evidenz der Natur zu fragen. Dabei unterschied sich die Umgebung des Hauses von Chumpi kaum von den anderen Siedlungen, die ich zuvor in dieser an Peru angrenzenden Gegend von Ecuador besucht hatte. Dem Brauch der Achuar gemäß war die von Palmwedeln bedeckte Wohnstätte mitten in einer Rodung errichtet worden, auf der Maniokpflanzen vorherrschten und die auf einer Seite das brodelnde Wasser des Flusses säumte. Wenige Schritte durch den Garten, und ich stieß bereits auf den Wald, eine hohe dunkle Wand, die den helleren Saum der Bananenstauden umgab. Der Kapawi war die einzige Fluchtlinie aus diesem Kessel ohne Horizont, eine gewundene und endlose Öffnung, denn ich brauchte einen ganzen Tag, um mit dem Einbaum aus einer ähnlichen Rodung, der nächstgelegenen Nachbarschaft des Hausherrn, hierher zu gelangen. Dazwischen Zehntausende Hektar Bäume, Moose und Farne, Dutzende Millionen Fliegen, Ameisen und Moskitos, Rudel von Pekaris, Horden von Affen, Schwärme von Aras und Tukanen, vielleicht ein oder zwei Jaguare; kurz, eine nichtmenschliche Fülle an Formen und Lebewesen, die in völliger Unabhängigkeit ihren eigenen Gesetzen des Zusammenlebens überlassen waren ...
Etwa in der Mitte des Nachmittags, während sie die Küchenabfälle in das den Fluß überragende Gestrüpp leerte, war Chumpis Frau von einer Schlange gebissen worden. Als sie mit vor Schmerz und Angst geweiteten Augen zu uns rannte, schrie sie: »Die Lanzenspitze, die Lanzenspitze, ich bin tot, ich bin tot!« Augenblicklich rief die alarmierte Hausgemeinschaft im Chor: »Die Lanzenspitze, die Lanzenspitze, sie hat sie getötet, sie hat sie getötet!« Ich hatte ein Metekash-Serum gespritzt, und sie lag in der kleinen Isolierhütte, die man unter derartigen Umständen errichtet. Ein solcher Unfall ist in dieser Gegend keine Seltenheit, 22vor allem wenn es Abfälle gibt, und die Achuar fügen sich mit einem gewissen Fatalismus in seinen oft tödlichen Ausgang. Doch daß eine Lanzenspitze sich so nahe an ein Haus heranwagte, war anscheinend ungewöhnlich.
Chumpi schien ebenso getroffen zu sein wie seine Gattin; mit wütender, aufgewühlter Miene auf seinem geschnitzten Schemel sitzend, murmelte er einen Monolog, in den ich mich schließlich einmischte. Nein, der Metekash-Biß sei kein Zufall, sondern ein Racheakt, von Jurijri geschickt, einer jener »Mütter des Wildes«, die über das Schicksal der Tiere des Waldes wachen. Da die Zufälle des Tauschhandels meinem Gastgeber ein Gewehr beschert hatten, nach einer langen Zeit, in der er nur mit dem Blasrohr jagen konnte, hatte Chumpi gestern unter Wollaffen ein Blutbad angerichtet. Vermutlich von der Kraft seiner Waffe geblendet, hatte er blindlings in die Horde geschossen, dabei drei oder vier Tiere getötet und einige weitere verletzt. Er hatte nur drei Affen mitgenommen und einen verendenden in einer Astgabel zurückgelassen. Einige der Geflüchteten, vom Schrot getroffen, litten nun umsonst; vielleicht waren sie sogar gestorben, noch bevor sie den Schamanen ihrer Spezies hatten konsultieren können. Weil er, beinahe aus einer Laune heraus, mehr Tiere getötet hatte, als für die Nahrung seiner Familie nötig war, und weil er sich nicht um das Los derer gekümmert hatte, die er verkrüppelt zurückließ, hatte Chumpi gegen die Ethik der Jagd verstoßen und die stillschweigende Übereinkunft gebrochen, die die Achuar mit den Schutzgeistern des Wildes verbindet. Die Vergeltung hatte nicht auf sich warten lassen.
In dem ungeschickten Versuch, die Schuldgefühle meines Gastgebers zu zerstreuen, gab ich ihm zu bedenken, daß die Harpyie oder der Jaguar sich nicht genieren, Affen zu töten, daß die Jagd zum Leben notwendig sei und daß im Wald am Ende jeder einem anderen als Nahrung diene. Ganz offensichtlich hatte ich nichts begriffen:
Die Wollaffen, die Tukane, die Brüllaffen, alle Tiere, die wir töten, um zu essen, sind Personen wie wir. Auch der Jaguar ist eine Person, aber er ist ein einsamer Töter; er respektiert nichts. Wir, die »vollständigen Personen«, müssen diejenigen respektieren, die wir im Wald töten, denn sie sind für uns wie Heiratsverwandte. Sie leben unter sich mit ihrer eigenen Verwandtschaft; sie tun die Dinge nicht auf gut Glück; sie sprechen mit23einander; sie lauschen dem, was wir sagen; sie heiraten einander, wie es sich gehört. Bei der Blutrache töten auch wir Heiratsverwandte, aber es sind immer Verwandte. Und auch sie können uns töten wollen. So wie die Wollaffen töten wir sie, um zu essen, aber es sind immer Verwandte.
Die inneren Überzeugungen, zu denen ein Anthropologe im Hinblick auf die Natur des sozialen Lebens und die Lage des Menschen gelangt, sind häufig das Ergebnis einer sehr speziellen ethnographischen Erfahrung, erworben bei einigen tausend Individuen, die ihm in bezug auf das, was er vorher für selbstverständlich hielt, so tiefe Zweifel eingeflößt haben, daß er nun seine ganze Energie darauf verwendet, ihnen in einer systematischen Untersuchung Form zu geben. Dies ist in meinem Fall geschehen, als sich im Laufe der Zeit und vieler Gespräche mit den Achuar die Modalitäten ihrer Verwandtschaft mit den Naturwesen nach und nach verdeutlichten.1 Diese zu beiden Seiten der Grenze zwischen Ecuador und Peru verteilten Indianer unterscheiden sich kaum von den anderen Stämmen der Jívaro-Gruppe, mit der sie durch Sprache und Kultur verbunden sind, wenn sie sagen, daß die meisten Pflanzen und Tiere eine Seele (wakan) ähnlich der der Menschen besitzen, eine Eigenschaft, aufgrund deren sie zu den »Personen« (aent) zählen, insofern sie ihnen reflexives Bewußtsein und Intentionalität verleiht, sie befähigt, Gefühle zu empfinden, und es ihnen ermöglicht, Botschaften mit ihresgleichen sowie mit den Mitgliedern anderer Arten auszutauschen, darunter mit den Menschen. Diese außersprachliche Kommunikation verdankt sich der dem wakan zuerkannten Fähigkeit, ohne akustische Vermittlung Gedanken und Wünsche zur Seele eines Adressaten zu befördern und damit, zuweilen ohne dessen Wissen, seinen Geisteszustand und sein Verhalten zu verändern. Die Menschen verfügen zu diesem Zweck über eine große Palette an magischen Beschwörungsformeln, die anent, dank denen sie aus der Ferne auf ihre Artgenossen einwirken können, aber auch auf die Pflanzen und die Tiere sowie auf die Geister und bestimmte Artefakte. Die eheliche Harmonie, ein gutes Verhältnis zu den Verwandten 24und Nachbarn, der Erfolg bei der Jagd, die Herstellung schöner Töpfereien oder eines wirksamen Curare, ein Garten mit verschiedenen üppigen Pflanzungen – das alles hängt von den einvernehmlichen Beziehungen ab, die die Achuar zu einer Vielzahl ganz unterschiedlicher menschlicher und nichtmenschlicher Gesprächspartner herzustellen vermochten, indem sie mit Hilfe der anent ihre Gunst erlangten.
Im Geist der Indianer hängt das technische Wissen untrennbar mit der Fähigkeit zusammen, ein intersubjektives Milieu zu schaffen, in dem geregelte Beziehungen von Person zu Person entstehen: zwischen dem Jäger, den Tieren und den Geistern und Herren des Wildes sowie zwischen den Frauen, den Pflanzen des Gartens und der mythischen Person, die die kultivierbaren Arten erzeugt hat und bis heute für ihre Lebenskraft sorgt. Weit davon entfernt, sich auf prosaische Orte zu reduzieren, die Nahrung liefern, sind der Wald und die Rodungen Schauplätze einer subtilen Geselligkeit, bei der man Tag für Tag Wesen umschmeichelt, die sich in Wahrheit allein durch die Mannigfaltigkeit der äußeren Erscheinung und die fehlende Sprache von den Menschen unterscheiden. Die Formen dieser Geselligkeit unterscheiden sich indes je nachdem, ob man es mit Pflanzen oder mit Tieren zu tun hat. Als Herrinnen der Gärten, denen sie einen großen Teil ihrer Zeit widmen, wenden sich die Frauen an die Kulturpflanzen wie an Kinder, die man mit fester Hand zur Reifung bringen muß. Diese mütterliche Beziehung nimmt sich ausdrücklich die Vormundschaft zum Vorbild, die Nunkui, der weibliche Geist der Gärten, über die Pflanzen ausübt, die sie einst erschaffen hat. Die Männer wiederum betrachten das Wild als einen Schwager, eine instabile und schwierige Beziehung, die gegenseitigen Respekt und Umsicht erfordert. Die Heiratsverwandten bilden in der Tat die Grundlage der politischen Bündnisse, sind aber auch die unmittelbarsten Feinde in den Blutrachekriegen. Der Gegensatz zwischen Blutsverwandten und Heiratsverwandten, den beiden sich gegenseitig ausschließenden Kategorien, die die soziale Klassifikation der Achuar beherrschen und ihr Verhältnis zu den anderen ausrichten, findet sich somit in den gegenüber den Nichtmenschen vorgeschriebenen Verhaltensweisen wieder. Blutsverwandte für die Frauen, Heiratsverwandte für die Männer, werden die Naturwesen zu regelrechten Sozialpartnern.
25Doch kann man hier, der sprachlichen Bequemlichkeit halber, noch von Naturwesen sprechen? Gibt es einen Platz für die Natur in einer Kosmologie, die den Tieren und Pflanzen einen Großteil der menschlichen Eigenschaften zuerkennt? Kann man von Aneignung und Umwandlung der natürlichen Ressourcen sprechen, wenn die Subsistenztätigkeiten in Form einer Vielfalt individueller Paarungen mit vermenschlichten Elementen der Biosphäre ausgedrückt werden? Kann man überhaupt von einem wilden Raum in bezug auf jenen Wald sprechen, den die Achuar kaum berührt haben und den sie dennoch als einen riesigen, sorgfältig von einem Geist angebauten Garten bezeichnen? Tausend Meilen entfernt von Verlaines »wildem, schweigsamem Gott« ist die Natur hier weder eine transzendente Instanz noch ein zu sozialisierendes Objekt, sondern das Subjekt einer sozialen Beziehung; als Verlängerung des Hauses ist sie wirklich bis in ihre unzugänglichsten Winkel hinein ein Teil desselben.
Sicherlich treffen die Achuar Unterscheidungen zwischen den Entitäten, die die Welt bevölkern. Die Hierarchie der belebten und unbelebten Gegenstände, die sich daraus ergibt, gründet dennoch nicht auf Graden der Vollkommenheit des Seins, auf Unterschieden der Zugehörigkeit oder auf einer allmählichen Anhäufung innerer Eigenschaften. Sie stützt sich auf die Abweichung in den Kommunikationsweisen, zu der die Wahrnehmung ungleich verteilter sinnlicher Qualitäten berechtigt. In dem Maße, wie die Kategorie der »Personen« auch Geister, Pflanzen und Tiere umfaßt, die alle eine Seele haben, unterscheidet diese Kosmologie nicht zwischen Menschen und Nichtmenschen; sie führt lediglich eine Rangfolge je nach den Ebenen des Informationsaustauschs ein, die als machbar gelten. Wie es sich geziemt, nehmen die Achuar die Spitze der Pyramide ein: sie sehen einander und sprechen in derselben Sprache miteinander. Der Dialog ist noch möglich mit Mitgliedern der anderen Jívaro-Stämme, die sie umgeben und deren Dialekte gegenseitig einigermaßen verständlich sind, ohne daß sich zufällige oder vorsätzliche Mißverständnisse immer ausschließen lassen. Die Spanisch sprechenden Weißen, die benachbarten Populationen der Quechua-Sprache und auch den Ethnologen kann man sehen und mit ihnen reden, sofern es eine gemeinsame Sprache gibt; doch deren Beherrschung ist für denjenigen Partner, dessen Muttersprache sie nicht ist, 26häufig unzulänglich, so daß die Möglichkeit einer semantischen Unstimmigkeit entsteht, die die Entsprechung der Fähigkeiten, durch die sich die Existenz zweier Wesen auf derselben Ebene des Realen erweist, fraglich erscheinen läßt. Die Unterscheidungen verstärken sich, je weiter man sich vom Bereich der »vollständigen Personen«, penke aents, entfernt, die vor allem durch ihre Sprachfähigkeit definiert sind. So können die Menschen die Pflanzen und Tiere zwar sehen, von denen angenommen wird, sofern sie eine Seele haben, daß sie ihrerseits die Menschen sehen; doch wenn sich die Achuar dank den anent-Beschwörungen an sie wenden, erhalten sie nicht sofort eine Antwort: sie wird ihnen erst im Traum enthüllt. Dasselbe gilt für die Geister und bestimmte Heroen der Mythologie: zwar hören sie aufmerksam allem zu, was man ihnen sagt, sind jedoch gewöhnlich in ihrer ursprünglichen Gestalt unsichtbar, so daß man sie in all ihrer Fülle nur in Träumen und durch Halluzinogene hervorgerufenen Trancezuständen erfassen kann.
Die »Personen«, die kommunizieren können, sind auch entsprechend dem Perfektionsgrad der sozialen Normen hierarchisiert, die in den verschiedenen Gemeinschaften, auf die sie sich verteilen, gültig sind. Einige Nichtmenschen stehen den Achuar sehr nahe, da man annimmt, daß sie dieselben Heiratsregeln beachten wie sie: dies ist der Fall bei den Tsunki, den Geistern des Flusses, mehreren Wildarten (den Wollaffen, den Tukanen ...) und Kulturpflanzen (dem Maniok, den Erdnüssen ...). Dagegen gibt es Wesen, die der sexuellen Promiskuität frönen und damit permanent das Exogamieprinzip verhöhnen; dies ist beim Brüllaffen oder dem Hund der Fall. Die niedrigste Integrationsebene nehmen die Einzelgänger ein: die Iwianch-Geister, Verkörperungen der Seele der Toten, die vereinsamt im Wald umherirren, oder auch die großen Raubtiere wie der Jaguar oder die Anakonda. Doch so fern sie den Gesetzen der gewöhnlichen Zivilität auch sein mögen, alle diese einsamen Wesen sind die Vertrauten der Schamanen, die sie benutzen, um Mißgeschick abzuwenden oder ihre Feinde zu bekämpfen. An den Rändern des Gemeinschaftslebens angesiedelt, sind diese schädlichen Wesen in keiner Weise wild, da die Herren, denen sie dienen, nicht außerhalb der Gesellschaft stehen.
Heißt das, daß die Achuar in dem Milieu, in dem sie sich bewe27gen, keinerlei natürliche Entität kennen? Nicht ganz. Das große soziale Kontinuum, in dem sich Menschen und Nichtmenschen mischen, umfaßt nicht alles, und einige Elemente der Umwelt kommunizieren mit niemandem, da sie keine eigene Seele besitzen. Die meisten Insekten und Fische, die Kräuter, das Moos und die Farne, die Kieselsteine und die Flüsse bleiben deshalb außerhalb der sozialen Sphäre und des Spiels der Intersubjektivität; in ihrer mechanischen generischen Existenz könnten sie vielleicht dem entsprechen, was wir »Natur« nennen. Ist es deshalb legitim, diesen Begriff weiterhin zu verwenden, um einen Ausschnitt der Welt zu bezeichnen, der für die Achuar unvergleichlich kleiner ist als das, was wir darunter verstehen? Im modernen Denken ist die Natur zudem nur im Gegensatz zu den Werken des Menschen von Bedeutung, ob man diese in der Sprache der Philosophie und der Humanwissenschaften nun »Kultur«, »Gesellschaft« oder »Geschichte« oder in einer spezialisierteren Terminologie »anthropisierter Raum«, »technische Mediation« oder »Ökumene« nennt. Eine Kosmologie, in der die meisten Pflanzen und Tiere in eine Gemeinschaft von Personen einbezogen sind, die alle oder einen Teil der den Menschen zugeschriebenen Fähigkeiten, Verhaltensweisen und moralischen Regeln besitzen, entspricht in keiner Weise den Kriterien eines solchen Gegensatzes.
Vielleicht sind die Achuar ja eine Ausnahme2, eine jener pittoresken Anomalien, die die Ethnographie bisweilen in irgendeinem verborgenen Winkel des Planeten entdeckt? Vielleicht ist auch meine Interpretation ihrer Kultur falsch? Aus mangelndem Scharfblick oder aus dem Wunsch nach Originalität hätte ich die spezifische Form nicht erkennen können oder wollen, die bei ihnen die Dichotomie zwischen Natur und Gesellschaft angenommen hat. Doch einige hundert Kilometer weiter nördlich vertreten die Makuna-Indianer im amazonischen Wald Ostkolumbiens eine noch radikalere, entschieden nichtdualistische Theorie der Welt.3
Wie bei den Achuar fallen bei den Makuna die Menschen, die Pflanzen und die Tiere in die Kategorie der »Leute« (masa), deren 28Hauptattribute – Sterblichkeit, soziales und zeremonielles Leben, Intentionalität, Erkenntnis – in allen Punkten identisch sind. Die inneren Unterschiede dieser Gemeinschaft des Lebenden beruhen auf den besonderen Merkmalen, die der mythische Ursprung, die Ernährungsweise und die Fortpflanzungsart jeder Klasse von Lebewesen verleihen, und nicht auf der mehr oder weniger großen Nähe dieser Klassen zum Paradigma der Vollkommenheit, zu der die Makuna gelangt wären. Die Interaktion zwischen Tieren und Menschen wird ebenfalls in Form eines Verwandtschaftsverhältnisses aufgefaßt, auch wenn es sich leicht vom Achuar-Modell unterscheidet, da der Jäger sein Wild als potentielle Gattin und nicht als Schwager betrachtet. Gleichwohl sind die ontologischen Kategorisierungen aufgrund der allen zuerkannten Fähigkeit der Metamorphose noch sehr viel ausgeprägter als bei den Achuar: die Menschen können Tiere werden, die Tiere sich in Menschen verwandeln, und das Tier der einen Art kann ein Tier einer anderen Art werden. Der taxonomische Einfluß auf das Reale ist also immer relativ und kontextuell, da der ständige Austausch der Erscheinungsformen es nicht erlaubt, den lebenden Komponenten der Umwelt stabile Identitäten zuzuordnen.
Die den Nichtmenschen von den Makuna nachgesagte Geselligkeit ist daher reicher und komplexer als diejenige, die die Achuar ihnen zuerkennen. Wie die Indianer leben auch die Tiere in Gemeinschaften, in »Langhäusern«, die die Tradition in bestimmten Stromschnellen oder im Innern genau lokalisierter Hügel ansiedelt; sie legen Maniokgärten an, bewegen sich in Einbäumen fort und vollziehen unter der Leitung ihrer Häuptlinge Rituale, die ebenso ausgefeilt sind wie die der Makuna. Tatsächlich ist die sichtbare Form der Tiere nur eine Verkleidung. Wenn sie in ihre Behausungen zurückkehren, dann deshalb, um sich ihrer äußeren Erscheinung zu entledigen, Federschmuck und zeremoniellen Zierat anzulegen und ostentativ wieder zu den »Leuten« zu werden, die sie immer gewesen sind, wenn sie sich in den Flüssen tummelten und durch den Wald streiften. Das Wissen der Makuna über das Doppelleben der Tiere ist in der Unterweisung der Schamanen enthalten, dieser kosmischen Vermittler, denen die Gesellschaft die Leitung der Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Gemeinschaften des Lebenden überträgt. Doch es ist 29ein Wissen, dessen Prämissen von allen geteilt werden und das, zum Teil esoterisch, nichtsdestoweniger die Auffassung strukturiert, die sich die Profanen von ihrer Umwelt und der Art und Weise machen, wie sie mit ihr interagieren.
Kosmologien, die denen der Achuar und der Makuna ähneln, sind in großer Anzahl für die bewaldeten Regionen des Tieflands Südamerikas beschrieben worden.4 Trotz der Unterschiede ihrer inneren Anordnung ist es für alle diese Kosmologien charakteristisch, daß sie keine scharfe ontologische Unterscheidung zwischen den Menschen einerseits und einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten andererseits treffen. Die meisten Entitäten, die die Welt bevölkern, sind in einem großen Kontinuum miteinander verbunden, das von unitarischen Prinzipien beseelt und von demselben System der Geselligkeit geleitet wird. Tatsächlich zeigen sich die Beziehungen zwischen Menschen und Nichtmenschen als Beziehungen von Gemeinschaft zu Gemeinschaft, die zum Teil durch utilitarische Subsistenzzwänge definiert sind, jedoch eine jedem Stamm eigene Form annehmen können und dazu dienen, sie zu differenzieren. Dies zeigt das Beispiel der Yukuna recht gut, einer Arawak-Sprachgruppe, die im kolumbianischen Amazonien an die Makuna angrenzt.5 So wie ihre Nachbarn der Tukano-Sprachgruppe haben die Yukuna Präferenzverbindungen mit bestimmten Tierarten und bestimmten Varietäten von Kulturpflanzen entwickelt, die ihnen als bevorzugte Nahrung dienen, da ihr mythischer Ursprung und, bei den Tieren, ihre Gemeinschaftshäuser innerhalb der Grenzen des Stammesgebiets liegen. Den örtlichen Schamanen obliegt es, die rituelle Regeneration dieser Arten zu überwachen, die dagegen den die Yukuna umgebenden Tukano-Stämmen verboten sind. Somit fällt jeder Stammesgruppe die Aufgabe zu, über die spezifischen Pflanzen- und Tierpopulationen zu wachen, von denen sie sich ernährt, so daß diese Arbeitsteilung dazu beiträgt, die lokale Identität und das System der interethnischen Beziehungen entsprechend dem 30Verhältnis zu differenzierten Gruppen von Nichtmenschen zu definieren.
Daß die Geselligkeit der Menschen und die der Tiere und Pflanzen in Amazonien so eng miteinander verbunden sind, rührt daher, daß ihre jeweiligen Formen der kollektiven Organisation einem recht flexiblen gemeinsamen Modell folgen, das es ermöglicht, die Interaktionen zwischen den Nichtmenschen zu beschreiben, indem man sich der benannten, die Beziehungen zwischen den Menschen strukturierenden Kategorien bedient und bestimmte Beziehungen zwischen den Menschen mit Hilfe der symbiotischen Beziehungen zwischen Arten darstellt. In letzterem, seltenerem Fall wird die Beziehung nicht explizit bezeichnet oder qualifiziert, da ihre Merkmale aufgrund eines geteilten botanischen und zoologischen Wissens als allen bekannt vorausgesetzt werden. Bei den Secoya zum Beispiel meint man, daß die toten Indianer die Lebenden in zweierlei gegensätzlicher Gestalt wahrnehmen: sie sehen die Männer als Oropendola-Vögel und die Frauen als amazonische Papageien.6 Diese Dichotomie, die die soziale und symbolische Konstruktion der sexuellen Identitäten organisiert, stützt sich auf beiden Arten eigentümliche ethologische und morphologische Merkmale, deren klassifikatorische Funktion auf diese Weise zutage tritt, da Unterschiede in der Erscheinung und im Verhalten zwischen Nichtmenschen dazu verwendet werden, einen anatomischen und physiologischen Unterschied zwischen Menschen dadurch zu verstärken, daß man ihn hervorhebt. Umgekehrt haben die Yagua aus dem peruanischen Amazonien ein System zur Kategorisierung der Pflanzen und Tiere erarbeitet, das auf den Beziehungen zwischen Arten beruht, je nachdem ob sie durch verschiedene Grade der Blutsverwandtschaft, durch Freundschaft oder durch Feindseligkeit definiert werden.7 Die Verwendung sozialer Kategorien, um Beziehungen der Nähe, der Symbiose oder des Wettstreits zwischen natürlichen Arten zu definieren, ist hier um so interessanter, als sie weit ins Pflanzenreich hineinreicht. So unterhalten die großen Bäume eine Beziehung der Feindseligkeit: sie stacheln einander zu brudermörderischen Duellen an, um herauszufinden, wer als erster 31nachgibt; eine Beziehung der Feindseligkeit herrscht auch zwischen dem bitteren Maniok und dem süßen Maniok, wobei ersterer versucht, den anderen mit seiner Giftigkeit zu infizieren. Die Palmen dagegen unterhalten friedlichere Beziehungen, avunkulare oder Beziehungen der Vetternschaft, je nach den Ähnlichkeiten der Arten. Die Yagua – ebenso wie die Aguaruna-Jívaro8 – interpretieren auch die morphologische Ähnlichkeit zwischen wilden und kultivierten Pflanzen als Indiz einer Vetternbeziehung, ohne im übrigen zu behaupten, daß diese Ähnlichkeit das Indiz für einen den beiden Arten gemeinsamen Vorfahren ist.
Die Vielfalt der klassifikatorischen Indizien, die die Amerindianer verwenden, um den Beziehungen zwischen den Organismen Rechnung zu tragen, weist zur Genüge auf die Plastizität der Grenzen in der Taxonomie des Lebenden hin. Denn die Merkmale, die den den Kosmos bevölkernden Entitäten zuerkannt werden, hängen weniger von der vorherigen Definition ihres Wesens ab als von den relativen Positionen, die sie aufgrund der Anforderungen ihres Stoffwechsels, insbesondere ihrer Ernährungsweise, zueinander einnehmen. Die Identität der Menschen, der lebenden wie der toten, der Pflanzen, der Tiere und der Geister ist ganz und gar eine relationale und damit, je nach dem eingenommenen Standpunkt, Mutationen oder Metamorphosen unterworfen. Denn in vielen Fällen heißt es, daß ein Individuum der einen Art die Mitglieder anderer Arten entsprechend seinen eigenen Kriterien wahrnimmt, so daß ein Jäger unter normalen Bedingungen nicht sehen wird, daß seine tierische Beute sich selbst als Mensch sieht, auch nicht, daß sie ihn als Jaguar sieht. Ebenso sieht der Jaguar in dem Blut, das er leckt, Maniokbier; der Spinnenaffe, den der Gelbrücken-Stirnvogel zu jagen glaubt, ist für den Menschen nur ein Grashüpfer, und die Tapire, die die Schlange zu ihrer bevorzugten Beute zu machen meint, sind in Wirklichkeit Menschen.9 Dank dem ständigen Tausch der durch diese Perspektivenverschiebungen erzeugten Erscheinungsformen meinen die Tiere guten Glaubens, sie besäßen die gleichen kulturellen Attribute wie die Menschen: ihre Hauben sind für sie Federkronen, ihr Fell ein Gewand, ihr Schnabel eine Lanze oder 32ihre Krallen Messer. Das Wahrnehmungskarussell der amazonischen Kosmologien erzeugt eine zuweilen »Perspektivismus«10 genannte Ontologie, die den Menschen den Blick von oben abspricht und behauptet, daß die vielfältigen Erfahrungen der Welt zusammen bestehen können, ohne sich zu widersprechen. Anders als der moderne Dualismus, der eine Vielzahl von kulturellen Unterschieden vor dem Hintergrund einer unwandelbaren Natur aufbietet, betrachtet das amerindianische Denken den ganzen Kosmos als von derselben kulturellen Ordnung durchdrungen, die wenn nicht durch heterogene Anlagen, so doch durch unterschiedliche Weisen, einander wahrzunehmen, diversifiziert werden. Der gemeinsame Referent der Entitäten, die die Welt bewohnen, ist also nicht der Mensch als Spezies, sondern die conditio humana.
Sollte die Unfähigkeit, die Natur zu objektivieren, von der viele Völker Amazoniens zu zeugen scheinen, eine Folge der Eigenschaften ihrer Umwelt sein? In der Tat definieren die Ökologen den Tropenwald als ein »verallgemeinertes« Ökosystem, das sich durch eine außerordentliche Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten in Verbindung mit einem geringen Bestand und einer großen Dispersion der Individuen einer jeden Art auszeichnet. So kommen von etwa fünfzigtausend vaskulären Pflanzenarten Amazoniens nicht mehr als zwanzig spontan in größeren Beständen vor, und auch dann handelt es sich häufig um die unfreiwillige Folge menschlichen Handelns.11 Eingetaucht in eine monströse Vielfalt von Lebensformen, die sich selten zu homogenen Gruppen vereinen, könnten die Indianer des Waldes vielleicht darauf verzich33tet haben, das disparate Konglomerat, das ständig ihre Sinne bestürmte, als ein Ganzes zu erfassen. Notgedrungen der Täuschung des Verschiedenartigen erliegend, hätten sie es, kurz gesagt, nicht verstanden, sich von der Natur zu lösen, da außerstande, hinter der Mannigfaltigkeit ihrer besonderen Erscheinungen ihre tiefe Einheit zu erkennen.
Eine solche Interpretation legt eine etwas rätselhafte Bemerkung von Claude Lévi-Strauss nahe, die andeutet, daß der Tropenwald die einzige Umgebung ist, die es ermöglicht, jedem Mitglied einer Art idiosynkratische Merkmale zuzuschreiben.12 Zwar ist die Differenzierung jedes Individuums in einen besonderen Typus – den Lévi-Strauss »mono-individuell« nennt – dem homo sapiens eigentümlich, aufgrund seiner Fähigkeit, Persönlichkeit zu entwickeln, wie sie das Leben in Gesellschaft erlaubt. Doch ebenso könnte die extreme Überfülle der Tier- und Pflanzenarten diesem Prozeß der Singularisierung Vorschub leisten. In einem so diversifizierten Milieu wie dem amazonischen Wald war es vielleicht unvermeidlich, daß die Wahrnehmung der Beziehungen zwischen scheinbar unterschiedlichen Individuen Vorrang hatte vor der Konstruktion stabiler und sich gegenseitig ausschließender Makrokategorien.
Ebenfalls eine auf den Besonderheiten des Milieus gründende Interpretation legt Gerardo Reichel-Dolmatoff nahe, wenn er die Auffassung vertritt, daß die Kosmologie der Desana-Indianer des kolumbianischen Amazoniens eine Art deskriptives Modell der Prozesse ökologischer Anpassung bildet, formuliert in Termini vergleichbar denen der modernen Systemanalyse.13 Reichel-Dolmatoff zufolge fassen die Desana die Welt als ein homöostatisches System auf, in dem die verausgabte Energiemenge, der output, unmittelbar mit der erhaltenen Energiemenge, dem input, verbunden ist. Die Versorgung der Biosphäre mit Energie stammt aus zwei Hauptquellen: zunächst aus der regelmäßig durch ad hoc-Verbote eingedämmten sexuellen Energie der Individuen, die unmittelbar in das globale energetische Kapital zurückfließt, das alle biotischen Komponenten des Systems durchströmt; und dann aus dem Gesundheitszustand und dem Wohlbefinden der Men34schen, Ergebnis einer streng kontrollierten Nahrungsaufnahme, die für die von den abiotischen Elementen des Kosmos benötigte Energie sorgt (dies ermöglicht zum Beispiel die Bewegung der Himmelskörper). Jedes Individuum sei sich somit bewußt, lediglich Element eines komplexen Netzes von Interaktionen zu sein, das sich nicht nur in der sozialen Sphäre, sondern in der Gesamtheit eines Universums ausbreitet, das zur Stabilität tendiert, das heißt, dessen Ressourcen und Grenzen endlich sind. Dies erlegt allen Wesen ethische Verantwortung auf, insbesondere, das allgemeine Gleichgewicht dieses fragilen Systems nicht zu stören und niemals Energie zu verbrauchen, ohne sie durch verschiedene rituelle Operationen rasch wieder zu ersetzen.
Doch die Hauptrolle bei dieser Suche nach einem vollkommenen homöostatischen Gleichgewicht spielt der Schamane. Zunächst greift er ständig in die Subsistenztätigkeiten ein, um sich zu vergewissern, daß sie die Reproduktion der Nichtmenschen nicht gefährden. So kontrolliert der Schamane persönlich die Menge und den Konzentrationsgrad an Pflanzengift, das für den Fischfang in einem Flußabschnitt vorbereitet wurde, oder er legt die Anzahl von Individuen fest, die getötet werden darf, wenn ein Rudel Pekaris gesichtet wird. Mehr noch, die Rituale, die die Subsistenztätigkeiten begleiten, sind dem Schamanen sich bietende Gelegenheiten, »das Inventar der Vorräte zu erstellen, Kosten und Nutzen abzuwägen und eine Verteilung der Ressourcen vorzunehmen«; unter diesen Umständen »weist die rechnerische Bilanz des Schamanen die Gesamtheit der Energieeingänge und -ausgänge innerhalb des Systems auf«.14
Man kann nach der Gültigkeit einer solchen Transposition fragen, die den Schamanen zum klugen Verwalter eines Ökosystems und die Gesamtheit der religiösen Glaubensvorstellungen und Rituale zu einer Form von Abhandlung in praktischer Ökologie macht. Denn die bewußte Anwendung einer Art Optimierungskalkül der knappen Mittel durch den Schamanen scheint, auch wenn sie bestimmten, in der menschlichen Ökologie verwendeten neodarwinistischen Modellen entspricht, schwer mit der Tatsache vereinbar zu sein, daß die Desana, so wie die Makuna, deren Nachbarn sie sind, die Tiere und die Pflanzen außerdem 35mit den gleichen Attributen versehen, die sie sich selbst zuerkennen: deshalb ist schlecht vorstellbar, wie diese sozialen Partner der Menschen unter bestimmten Umständen plötzlich ihren Status als Person verlieren könnten, um nur noch als bloße, in einer energetischen Bilanz zu verteilende Rechnungseinheiten behandelt zu werden. Es steht außer Zweifel, daß die Indianer Amazoniens eine bemerkenswerte empirische Kenntnis der komplexen Zusammenhänge zwischen den Organismen ihrer Umgebung besitzen und daß sie diese Kenntnis bei ihren Subsistenzstrategien einsetzen. Ebenso steht außer Zweifel, daß sie sich der sozialen Beziehungen, namentlich deren der Verwandtschaft, bedienen, um eine ganze Skala von Beziehungen zwischen nichtmenschlichen Organismen zu definieren. Dagegen ist es unwahrscheinlich, daß diese Merkmale von der Anpassung an ein besonderes Ökosystem herrühren, das aufgrund seiner inneren Eigenschaften gewissermaßen das analogische Modell geliefert haben soll, das es ermöglicht, die Organisation der Welt zu denken.
Die Existenz überaus ähnlicher Kosmologien, erarbeitet von Völkern, die über sechstausend Kilometer nördlich von Amazonien in einem völlig anderen Milieu leben, ist das Hauptargument, das gegen eine solche Interpretation spricht. Im Unterschied zu den Indianern des südamerikanischen Tropenwalds erschließen die Indianer der subarktischen Region Kanadas in der Tat ein bemerkenswert einförmiges Ökosystem. Von der Labrador-Halbinsel bis Alaska breitet der große boreale Nadelwald einen kontinuierlichen Mantel aus Koniferen, in dem die typische Silhouette der Schwarzfichte vorherrscht, hier und da unterbrochen von einigen Gruppen von Erlen, Weiden, Papierbirken oder Balsampappeln. Die Tierwelt ist kaum vielfältiger: Elche und Karibus als Pflanzenfresser, Bieber, Hasen, Stachelschweine und Bisamratten als Nager, Wölfe, Braunbären, Luchse und Vielfraße als Fleischfresser bilden das grobe Kontingent der Säugetiere; hinzu kommen etwa zwanzig gewöhnliche Vogelarten und ein Dutzend Fischarten, wobei letztere sich recht bescheiden ausnehmen verglichen mit den dreitausend Arten in den Flüssen Amazoniens. Häufig sind diese Tiere Nomaden und lassen sich an einigen Orten mehrere Jahre lang nicht blicken, und wenn schließlich Karibus, Kanadagänse oder Störche auftauchen, dann in so großer Anzahl, daß für einen Augenblick die ganze Art ver36sammelt zu sein scheint. Kurz, die Merkmale des borealen Waldes sind genau das Gegenteil derjenigen des amazonischen Waldes: nur wenige Arten leben in diesem »spezialisierten« Ökosystem zusammen und sind jeweils durch eine große Zahl von Individuen vertreten. Doch trotz der offenkundigen Homogenität ihres ökologischen Milieus – auch trotz ihrer Ohnmacht angesichts der Hungersnöte, die ein extrem hartes Klima regelmäßig hervorrief – scheinen die subarktischen Völker ihre Umwelt nicht als einen Realitätsbereich anzusehen, der sich deutlich von den Prinzipien und Werten des sozialen Lebens entfernt. Im hohen Norden wie in Südamerika steht die Natur nicht in Gegensatz zur Kultur, sondern verlängert und bereichert sie in einem Kosmos, in dem sich alles nach den Maßen des Menschlichen ordnet.15
Zunächst besitzen viele Züge der Landschaft eine eigene Persönlichkeit. Mit einem Geist identifiziert, der sie mit einer diskreten Gegenwart beseelt, sind die Flüsse, die Seen und die Berge, der Donner und die vorherrschenden Winde, die Eisschollen und die Morgenröte lauter Erscheinungsformen, von denen angenommen wird, daß sie auf die Worte und Handlungen der Menschen achten. Doch vor allem in ihren Auffassungen der Tierwelt lassen die Indianer des kanadischen borealen Waldes die größte Übereinstimmung erkennen. Ungeachtet des Unterschieds der Sprachen und der ethnischen Affiliationen lenkt allenthalben der gleiche Komplex von Glaubensvorstellungen und Riten die Beziehung des Jägers zum Wild. Genau wie in Amazonien werden die meisten Tiere als Personen aufgefaßt, die eine Seele besitzen, was ihnen Attribute verleiht, die mit denen der Menschen völlig identisch sind, wie reflexives Bewußtsein, Intentionalität, Gefühlsleben oder Beachtung der ethischen Vorschriften. Die Cree-37Gruppen sind auf diesem Gebiet besonders explizit. Ihnen zufolge ähnelt die Geselligkeit der Tiere denen der Menschen und speist sich aus denselben Quellen: Solidarität, Freundschaft und Ehrerbietung gegenüber den Ahnen, in diesem Fall den unsichtbaren Geistern, die für die Wanderungen des Wildes verantwortlich sind, seine territoriale Zerstreuung leiten und für seine Regeneration sorgen. Wenn sich die Tiere von den Menschen unterscheiden, dann also nur durch ihre äußere Erscheinung, eine bloße Sinnestäuschung, da die unterschiedlichen körperlichen Hüllen, die sie gewöhnlich zur Schau tragen, lediglich Verkleidungen sind, die die Menschen täuschen sollen. Wenn die Tiere letztere im Traum aufsuchen, zeigen sie sich so, wie sie in Wirklichkeit sind, das heißt in ihrer menschlichen Form, so wie sie auch in der Sprache der Einheimischen sprechen, wenn ihr Geist sich im Verlauf des sogenannten Rituals des »bebenden Zelts«16 öffentlich äußert. Und die allgemein bekannten Mythen, die die Vereinigung eines Tiers mit einem Mann oder einer Frau in Szene setzen, bestätigen, daß die einen und die anderen ihrer Natur nach identisch sind: eine solche Vereinigung wäre unmöglich, so heißt es, wenn nicht ein zärtliches Gefühl dem menschlichen Partner die Augen geöffnet hätte, so daß er hinter dem tierischen Kleid die wahre Gestalt eines begehrenswerten Ehegatten zu erkennen vermochte.
Zu Unrecht würde man in dieser Humanisierung der Tiere eine bloße Spielerei des Geistes sehen, eine Art metaphorische Sprache, deren Triftigkeit kaum über die Umstände hinausreichte, wie sie dem Vollzug der Riten oder dem Erzählen der Mythen eignen. Selbst wenn sie in höchst prosaischen Worten von der Hetzjagd, der Tötung und dem Verzehr des Wildes sprechen, bringen die Indianer unzweideutig die Idee zum Ausdruck, daß die Jagd eine 38soziale Interaktion mit Entitäten ist, die sich der sie beherrschenden Konventionen vollkommen bewußt sind.17 Wie in den meisten Gesellschaften, bei denen die Jagd eine wichtige Rolle spielt, versichert man sich hier dadurch des Einverständnisses der Tiere, daß man ihnen Achtung erweist: es gilt, Verschwendung zu vermeiden, sauber und ohne unnötige Leiden zu töten, die Knochen und den Balg würdevoll zu behandeln, Prahlerei zu unterlassen und sogar das der Beute bevorstehende Schicksal nicht allzu deutlich zu erwähnen. So beziehen sich die der Jagd geltenden Ausdrücke selten auf ihren Endzweck, die Tötung; so wie die Achuar Amazoniens nur in vagen Ausdrücken von »in den Wald aufbrechen«, von »die Hunde ausführen« oder auch von »die Vögel wegpusten« (Jagd mit dem Blasrohr) sprechen, so sagen die Montagnais-Indianer »auf die Suche gehen« für die Jagd mit dem Gewehr oder »nachsehen«, um die Fallenstrecken zu überprüfen.18 Ebenfalls wie in Amazonien ist es üblich, daß der junge Jäger, der zum ersten Mal das Tier einer bestimmten Art tötet, ihm eine besondere rituelle Behandlung zuteil werden läßt. Bei den Achuar zum Beispiel weigert sich der junge Mann, das Wild, das er mitgebracht hat, selbst zu essen, denn die noch fragile Beziehung zu der neuen Art würde unwiderruflich abreißen, wenn er gegen diese Zurückhaltung verstieße, da sich die Artgenossen der Beute künftig bei seinem Nahen zurückzögen. Dasselbe Prinzip scheint bei den Ojibwa aus Ontario das Verhalten des jagenden Neulings zu diktieren: zwar wird er seine Beute in Gesellschaft der Männer seiner Umgebung verzehren, jedoch im Laufe eines zeremoniellen Mahls, das mit einer Art Bestattungsritual für die Überreste des Tieres endet.19
Doch können sich über diese Achtungsbezeigungen hinaus die Beziehungen zu den Tieren noch auf spezifischere Weise äußern, zum Beispiel durch Verführung, die das Wild als Geliebte darstellt, oder auch durch magischen Zwang, der den Willen einer Beute und seine Kraft, sich dem Jäger zu nähern, ausschaltet. Doch die üblichste dieser Beziehungen, die auch die Gleichheit zwischen den Männern und den Tieren am besten unterstreicht, 39ist das freundschaftliche Band, das ein Jäger im Laufe der Zeit mit einem besonderen Mitglied einer Art knüpft. Der Waldfreund wird als tierischer Gefährte aufgefaßt und dient bei seinen Artgenossen als Mittler, damit sie sich willig in Schußweite begeben; gewiß ein kleiner Verrat, jedoch ohne Folgen für die Seinen, da sich das Opfer des Jägers wenig später in einem Tier derselben Art reinkarniert, wenn sein Balg die vorgeschriebene rituelle Behandlung erfahren hat. Denn welche Strategien auch angewandt werden, um ein Tier zu verleiten, sich in die Nähe des Jägers zu begeben, immer liefert sich die Beute infolge eines Gefühls der Großmut demjenigen aus, der sie verzehren wird. Das Wild empfindet Mitgefühl für die menschlichen Leiden, für jene der Hungersnot ausgesetzten Wesen, die für ihr Überleben von ihm abhängen. Weit davon entfernt, lediglich eine episodische technische Manipulation eines autonomen natürlichen Milieus zu sein, ist die Jagd hier ein fortwährender Dialog, in dessen Verlauf, wie Tim Ingold schreibt, »sich die menschlichen und tierischen Personen mit ihren Identitäten und ihren besonderen Zielen gegenseitig konstituieren«.20
Noch nördlicher, in jenen fast verödeten Gegenden, in denen allein die Völker der Eskimo-Sprache zu leben vermochten, scheint eine identische Wahrnehmung der Beziehungen zur Umwelt vorzuherrschen.21 Menschen, Tiere und Geister sind koextensiv, und wenn sich erstere von den zweiten dank dem Wohlwollen letzterer ernähren können, so deshalb, weil das Wild sich denen darbietet, die es wirklich wünschen, ganz so wie bei den Cree. Die Jagd- und Geburtsriten der Inuit zeigen, daß die Seelen und das Fleisch, so selten und so kostbar, unablässig zwischen den verschiedenen Komponenten der Biosphäre zirkulieren, Komponenten, die durch ihre relativen Positionen und nicht durch ein ihnen seit Ewigkeit verliehenes Wesen definiert sind: so wie Wild nötig ist, um die Menschen hervorzubringen – gewiß als Nahrung, aber auch deshalb, weil die Seele der harpunierten Robben in den Kindern wiedergeboren wird –, so bedarf es der Menschen, um bestimmte Tiere hervorzubringen – die Überreste der 40Verstorbenen werden den Raubtieren überlassen, die Plazenta wird den Robben dargeboten, und die Seele der Toten kehrt bisweilen zu dem Geist zurück, der über das Wild des Meeres herrscht. Wie es der Schamane Ivaluardjuk Rasmussen anvertraute: »Die größte Gefahr für das Dasein besteht darin, daß die Nahrung der Menschen ganz und gar aus Seelen gemacht ist.«22 Denn wenn die Tiere Personen sind, dann kommt ihr Verzehr einer Form von Kannibalismus gleich, den nur der ständige Austausch der Substanzen und der geistigen Prinzipien zwischen den Hauptakteuren der Welt in gewissem Maße zu mildern vermag. Vor diesem Dilemma stehen nicht nur die Bewohner des hohen Nordens, und viele amerindianische Kulturen sehen sich mit demselben Problem konfrontiert: Wie soll ich mich des Lebens eines Anderen bemächtigen, der mit denselben Attributen ausgestattet ist wie ich, ohne daß diese zerstörerische Tat die Bande des Einverständnisses gefährdet, die ich mit der Gemeinschaft seiner Artgenossen herstellen konnte? Eine schwierige Frage, auf deren Erörterung uns unsere humanistische Tradition vorbereitet hat und auf die ich im Verlauf dieser Arbeit zurückkommen werde.
Von den üppigen Wäldern Amazoniens bis hin zu den eisigen Gegenden der kanadischen Arktis konzipieren einige Völker ihre Einfügung in die Umwelt auf eine ganz andere Weise als wir. Sie denken sich nicht als soziale Kollektive, die ihre Beziehungen zu einem Ökosystem verwalten, sondern als einfache Bestandteile eines größeren Ganzen, in dem keine wirkliche Unterscheidung zwischen Menschen und Nichtmenschen besteht. Zwar gibt es Unterschiede zwischen all diesen kosmologischen Anordnungen: so ist aufgrund der geringen Anzahl der in den nördlichen Breiten lebenden Arten das Netz der Beziehungen zwischen den Bewohnern der Biosphäre für die Indianer im Norden nicht so reich und komplex wie für die im Süden. Aber die Strukturen dieser Netze sind in allen Punkten analog, ebenso wie die ihren Elementen zugeschriebenen Eigenschaften, was auszuschließen scheint, daß die symbolische Ökologie der Indianer Amazoniens das Resultat einer lokalen Anpassung an eine diversifiziertere Umwelt sein kann.
Sollte es sich dann um eine amerikanische Besonderheit han41deln? Tag für Tag zeigen Ethnologie und Archäologie, daß das indianische Amerika ursprünglich ein kulturelles Ganzes war, dessen Einheit noch heute hinter der von der Kolonialgeschichte verursachten Zersplitterung wahrzunehmen ist. Davon zeugen natürlich die Mythen und ihre Variationen, die sich um ein homogenes semantisches Substrat ordnen und von denen sich schwer vorstellen läßt, daß sie nicht einer gemeinsamen Weltauffassung entstammen, die sich seit Jahrtausenden im Laufe von Bewegungen der Ideen und Völker herausgebildet hat. Über diese präkolumbianische Geschichte, die weit länger ist, als man sich früher vorstellte, wissen wir sehr wenig. So daß die moderne Ethnographie uns nur noch zusammenhanglose Chroniken jenes »Mittelalters, dem sein Rom fehlte«, um die Formulierung von Lévi-Strauss aufzugreifen23, liefern kann, bloße Hinweise auf einen alten gemeinsamen Fundus, dessen Elemente hier und dort auf unterschiedliche Weise kombiniert wurden. Könnte es sein, daß eine bestimmte Art und Weise, sich die Beziehungen zwischen Menschen und Nichtmenschen vorzustellen, von diesem sehr alten Synkretismus herrührt, der bis heute in einem panamerikanischen Schema zutage tritt?
So bestechend die Hypothese einer amerikanischen Originalität auch erscheinen mag, sie hält der Prüfung nicht stand. Denn man braucht nur die Beringstraße zu überqueren, in die entgegengesetzte Richtung der Migrationen, die die Vorfahren der heutigen amerindianischen Populationen von Ostsibirien nach Alaska führten, um zu erkennen, daß die Jägervölker der Taiga ihre Beziehungen zur Umwelt ganz ähnlich formulieren.24 Bei den Tungusen wie bei den Samojeden, bei den Chanten und den Mansi wird angenommen, daß der gesamte Wald von einem Geist beseelt ist, der im allgemeinen als großer Hirsch dargestellt wird, sich aber auch in einer Fülle von Inkarnationen zeigen kann; er wohnt insbesondere in den Bäumen und bestimmten Felsen. Im übrigen können auch die Bäume eine eigene Seele haben oder das pflanzliche Double eines Menschen sein, was dem Verbot zugrunde liegt, die jungen Bäume zu fällen. In der 42Sprache der Burjaten »Reicher-Wald« genannt, besitzt der Geist der Wälder zwei Gestalten: die eine, positive, schenkt den Menschen das Wild und hält Krankheiten von ihnen fern; die andere, häufig als der Sohn oder der Schwager dargestellt, verbreitet dagegen Unglück und Tod und beschäftigt sich damit, die Seele der Menschen zu jagen, um sie zu verschlingen. Die Ambivalenz von »Reicher-Wald« – die auch für die Figuren des »Herrn des Wildes« im indianischen Amerika charakteristisch ist – zwingt die Menschen zu zahlreichen Vorsichtsmaßnahmen in ihren Beziehungen zu den wilden Tieren, über die diese aufgespaltene Person ihre Vormundschaft ausübt.