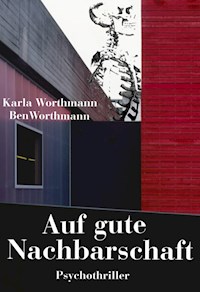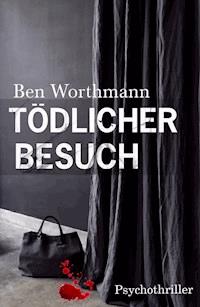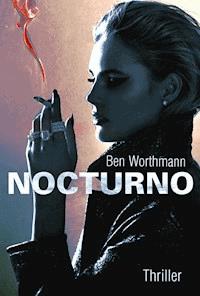Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
***Verhängnisvolle Begegnung mit einer schönen Frau*** Robert Kessler, ein schon etwas älterer, einst sehr bekannter, weitgereister Reporter, führt ein zurückgezogenes Vorstadtleben. Auf einem nächtlichen Spaziergang in seinem Viertel trifft er am Tor eines Hauses auf eine völlig verwirrte junge Frau, die ihn verzweifelt um Hilfe bittet. Ohne zu wissen, auf was er sich einlässt, folgt er ihr ins Haus und findet dort einen Toten mit einem Küchenmesser in der Brust. Er hilft Julia, so der Name der jungen Schönen, die Leiche beiseite zu schaffen. Von nun an gerät Kesslers eben noch so beschauliches Leben völlig aus den Fugen. Und dann steht auch noch die Polizei vor der Tür und konfrontiert ihn mit weiteren Leichenfunden. +++++DER ERFOLGSROMAN IN EINER ÜBERARBEITETEN FASSUNG+++++ Außerdem von Ben Worthmann im Handel: Die Thriller "Das Grab der Lüge", "Nocturno", "Tödlicher Besuch", "Auf gute Nachbarschaft" und "In einer Nacht am Straßenrand" sowie die Familienromane "Etwas ist immer", "Meine Frau, der Osten und ich" und "Leben für Fortgeschrittene"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ben Worthmann
Die Frau am Tor
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Impressum neobooks
1.
Sie tauchte auf, gerade als er in Höhe des Gartentors war, und im ersten Augenblick glaubte er, es mit einer Schlafwandlerin zu tun zu haben. Sie kam über den schmalen, von dichten, teilweise überhängenden Fliederbüschen gesäumten Pfad, der zum Hauseingang auf der Rückseite führte. Er war tagsüber gelegentlich hier vorbeigekommen und hatte sich gefragt, wer wohl in diesem schmucken Haus mit den Sprossenfenstern, den taubenblauen Schlagladen, die nur der Dekoration dienten, und dem schiefergedeckten Walmdach leben mochte, ohne allerdings je einen der Bewohner gesehen zu haben.
Die Frau, die jetzt von dort auf ihn zukam, war so gut wie unbekleidet, wie trotz des spärlichen Lichts, das der kaum halbvolle Mond und die fahle Hausnummernbeleuchtung spendeten, unschwer zu erkennen war. In ihren Bewegungen lag etwas Verhaltenes, Verzögertes, sodass es fast wie ein Waten durch einen unsichtbaren Nebel aussah. Bei den letzten, plötzlich schnelleren Schritten bis zum Tor geriet sie beinahe ins Stolpern. Sie öffnete es und erstarrte, so als bemerke sie ihn erst jetzt, da sie nur noch wenige Zentimeter voneinander getrennt waren. Doch ihr Blick galt gar nicht ihm, so weit das für ihn auszumachen war, sondern schien auf irgendeinen fernen Punkt gerichtet, von dem wahrscheinlich nicht einmal sie selbst wusste, wo er sich befand.
Das alles spielte sich in Sekunden ab, und er registrierte es mehr instinktiv als bewusst, viel zu verblüfft, um einen Sinn darin auch nur erahnen zu können. Im nächsten Moment spürte er ihren Körper gegen seinen sacken und packte sie, einem Reflex gehorchend, um sie aufzufangen. Es war ein sehr schlanker, fester, junger Körper, was ihm trotz seiner Verwirrung nicht entging, zumal der Körper mit nichts als einem dünnen, kurzen Hemd bedeckt war, das kaum bis zu den Hüften reichte und unter seinem Griff auch noch hochrutschte.
Ihre Arme hingen schlaff herab. Auf einmal hob sie den Kopf – sie war nur wenig kleiner als er – und wandte ihm ihr Gesicht zu. Es war ein hübsches, etwas katzenhaftes Gesicht mit großen, ziemlich weit auseinander stehenden Augen, umrahmt von knapp schulterlangem, dunkelblondem Haar, das allerdings ziemlich unordentlich wirkte, was zu ihrem aktuellen Gesamtbild passte. Ihm ging kurz durch den Kopf, dass sie bei anderer Gelegenheit gewiss noch weit attraktiver auszusehen verstand, mit einem Make-up, das nicht zerlaufen und einem Mund, der ordentlich geschminkt statt mit Lippenstift verschmiert war.
Die Lippen bewegten sich schwach, als wollten sie etwas sagen, während ihr Blick zwischen jenem fernen, undefinierbaren Punkt und dem Anblick des Mannes, dessen Arme sie hielten, hin und her zu irren schien. Und dann, eher er sich versah, hatte sie sich plötzlich von ihm losgerissen und versuchte, sich an ihm vorbei zu drängen. Gleichzeitig stieß sie einen lauten Schrei aus. Er versperrte ihr den Weg und nahm sie am Arm, um sie zurückzudrängen, und warf einen prüfenden Blick die Straße entlang. Sie lag still und friedlich da, kaum beleuchtet von den wenigen Laternen, mit ihren hohen Platanen auf beiden Seiten, die eine Art Dach über ihr bildeten, und mit den soliden, zumeist etwas älteren, gepflegten Häusern, die von großzügigen Grundstücken umgeben und in gebührendem Abstand voneinander aufgereiht waren. Die Kolbestraße – so hieß sie, wie er sich entsann – gehörte zu jenen Vorortstraßen tief im Südwesten Berlins, in denen es so gut wie immer ruhig war, vor allem, wenn es, wie jetzt, auf Mitternacht zuging.
Die Frau ließ sich ohne weitere Gegenwehr auf den dunklen Pfad am Haus entlang in Richtung des Eingangs dirigieren, dem eine kleine Terrasse vorgesetzt war, auf die man über fünf Treppenstufen gelangte. Über der Haustür, die halb offen stand, brannte eine Lampe, die den gesamten Eingangsbereich beleuchtete und ihm noch mehr von der Frau enthüllte, als er bereits gesehen hatte. Bevor sie hinaufstiegen, blieb sie stehen und klammerte sich an ihn.
„Ich habe Angst, ganz schreckliche Angst”, stieß sie hervor.
Du lieber Himmel, dachte er, in was gerate ich hier denn nur hinein. Da gehst du, wie so oft, an einem schönen Sommerabend noch ein bisschen spazieren – und dann passiert dir so etwas. Am besten siehst du zu, dass du schleunigst von hier weg kommst.
„Nun bleiben Sie doch mal ruhig”, sagte er und versuchte sich vorsichtig loszumachen. „Was ist denn eigentlich los mit Ihnen?”
„Ich brauche Hilfe, dringend. Jemand muss mir helfen. Helfen Sie mir? Bitte sagen Sie Ja, helfen Sie mir, bitte!”, fuhr sie in einem solch verzweifelten, flehenden Ton fort, dass ihn ein ungutes Gefühl überkam, dem jedoch noch etwas anderes beigemischt war, das er nicht hätte benennen können.
„Kommen Sie, kommen Sie mit”, drängte sie und nahm seine Hand, um vorauszugehen. Er konnte nicht anders, als ihr zu folgen, den Blick unwillkürlich auf das Muskelspiel ihres nackten Gesäßes geheftet, wobei er gegen ein diffuses Gefühl von Scham ankämpfte. Sie betraten die von zwei herabgedimmten Wandlampen matt erhellte Diele, auf deren Terrakotta-Fliesen einige weibliche Kleidungsstücke verstreut lagen. Doch die bemerkte er nur mit halbem Blick. Der wesentlich größere Teil seiner Aufmerksamkeit wurde von etwas anderem beansprucht.
Der Mann lag auf der Schwelle der Tür zur Küche, die von der Diele abging und in der ebenfalls Licht brannte. Zunächst sah er von ihm nur die Beine, die leicht gespreizt in die Diele ragten. Die Füße steckten in braunen geflochtenen Slippern. Der Oberkörper befand sich auf dem schwarzweiß gefliesten Küchenboden. Es handelte sich um einen ziemlich großen, ziemlich kräftigen Mann, soweit sich das aus dieser Perspektive abschätzen ließ. Er war mit einem hellen, modisch geschnittenen Anzug bekleidet, dessen Jackett nicht zugeknöpft war und die Brust freigab, sowie mit einem Hemd, das er am Hals offen trug. Das Hemd war rosafarben. Zumindest war es das einmal gewesen. Jetzt war der größte Teil dessen, was davon sichtbar war, in ein dunkles Rot getaucht. Den Mittelpunkt des großen dunkelroten Fleckens bildete der schwarze Kunststoffgriff eines Messers, der daraus hervorragte.
Verdammt, dachte er abermals, wo bin ich hier bloß hineingeraten, und tausend Fetzen von Gedanken wirbelten ihm durch den Kopf, verschlangen und verknoteten sich und stieben wie ein irrer Schwarm wieder auseinander. Er musste an das viele Sterben denken, über das er aus verschiedenen Teilen der Erde berichtet hatte, mehr als über das Leben, an Bilder von Menschen, die auf fast jede nur denkbare Weise zu Tode gekommen waren, in Kriegen, bei Putschversuchen und Naturkatastrophen, und deren Schicksal jahrzehntelang den Stoff hergegeben hatte für all die Geschichten, die der Reporter Robert Kessler für gut zahlende Zeitschriften und Magazine geschrieben hatte. Ohne es zu wollen, spulte er im Geist den notorischen Kanon jener Fragen ab, die jedem Jungjournalisten als erstes beigebracht werden – die Fragen nach dem Wer-wie-was-wo-wann, die jedes Mal beantwortet werden müssen, wenn etwas Berichtenswertes entstehen soll.
Robert Kessler, sagte er stumm zu sich selbst, nach Lage der Dinge hast du es hier mit einer anderen Art von Geschichte zu tun, als du sie bisher je erlebt hast, mit einer völlig anderen.
Obschon er keinen Zweifel daran hatte, dass der Mann tot war, beugte er sich über ihn und befühlte den Hals, der noch warm war, aber keinerlei Anzeichen eines Pulsschlags erkennen ließ. Die Frau stand zitternd an die Wand neben der Küchentür gedrückt, knetete ihre Hände und stammelte vor sich hin:
„Oh Gott, was soll ich tun? Ich habe Angst, so furchtbare Angst. Bitte helfen Sie mir doch.”
„Jetzt beruhigen Sie sich doch erst mal”, sagte er wieder, mit einer Stimme, die seinen eigenen Ohren fremd war, und kam sich dabei wie ein Narr vor. „Und, bitte, ziehen Sie sich etwas an.”
Er konnte es nicht mehr ertragen, immerzu ihren nackten Unterleib ansehen zu müssen und die Brüste, die sich deutlich unter dem dünnen Hemd abzeichneten. Sie sammelte die Kleidungsstücke vom Boden auf, warf sie aber gleich wieder in eine Ecke und ging auf unsicheren Beinen in einen der übrigen drei Räume, die von der Diele abzweigten, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Er hörte sie unter leisem Wimmern an einem Schrank hantieren. Als sie wenig später wieder herauskam, trug sie eng sitzende Jeans, ein schwarzes T-Shirt und weiße Sneakers.
„Können wir uns irgendwo setzen?”, fragte er, bemüht, so normal wie möglich zu klingen. Sie öffnete die mittlere der Türen, schaltete das Licht an und führte ihn in eines der Wohnzimmer, das durch eine Flügeltür mit einem weiteren verbunden war. An den Wänden hingen einige großformatige, wild-bunte Gemälde. Die Einrichtung – ein Designer-Sofa, drei zerbrechlich wirkende Korbsessel, ein Glastisch sowie ein in die Wand eingelassener Flachbildschirmfernseher mit integrierter Musikanlage – wirkte teuer und war für seinen Geschmack eine Spur zu absichtsvoll minimalistisch gehalten. Auf dem Tisch standen zwei Gläser und eine halbvolle Rotweinflasche. Sie ließ sich in einen der Sessel fallen, stand aber sofort wieder auf und fragte ihn, ob er etwas trinken wolle. Ohne seine Antwort abzuwarten, verschwand sie im Nebenzimmer und kehrte mit einem frischen Glas zurück. Es war mehrere Jahre her, dass er zuletzt Alkohol zu sich genommen hatte, und er zögerte einen Moment. Dann füllte er das Glas, trank zwei tiefe Züge und ergab sich dem Gefühl, das vom Magen her in einer warmen Welle durch seinen Körper und seinen Kopf rieselte.
„Wer ist der Mann? Und weshalb haben Sie ihn umgebracht?”, fragte er. „Das haben Sie doch, oder?”
Statt etwas zu erwidern, kauerte sie sich mit angezogenen Beinen in ihren Sessel, vergrub das Gesicht in den Händen und brach in ein hemmungsloses Weinen aus.
„Bitte, Sie müssen...Sie müssen mir helfen”, stotterte sie schluchzend, “Sie müssen mir versprechen, dass Sie mir helfen! Bitte!”
„Wer ist der Mann?”, wiederholte er.
„Ein früherer...jemand, mit dem ich mal zusammen war, früher, eine ganze Zeit bevor ich geheiratet habe...Er hat mich....er wollte mich...Irgendwie musste ich mich doch wehren, ich meine, ich musste ihn doch davon abhalten, dass er mich....Aber ich wollte doch nicht, dass er stirbt...Es war ein schrecklicher Unfall, ein Unglück.”
Ihre Worte gingen beinahe in dem Schluchzen unter und waren kaum zu verstehen. Plötzlich sprang sie auf.
„Wo ist denn nur meine Handtasche? Ich brauche meine Handtasche. Oh Gott, ich glaube, sie ist in der Küche auf dem kleinen Tischchen. Aber ich kann doch jetzt nicht dort hineingehen.”
Er stand auf und durchquerte die Diele und stieg über den Toten hinweg, was nicht ganz einfach war. Als er ihr die Handtasche reichte, begann sie sofort mit hastigen Händen darin zu kramen und zog eine Schachtel Valium hervor. Sie drückte drei Tabletten aus der Palette, warf sie sich in den Mund, schüttete etwas Wein in eines der benutzten Gläser und spülte sie damit hinunter.
„Um Himmels willen, hoffentlich war das jetzt mein Glas und nicht seins”, sagte sie erschrocken, als sie es absetzte, und begann erneut zu weinen.
„Können Sie mir vielleicht, bitte, der Reihe nach erzählen, was eigentlich genau passiert ist?”, sagte er mit leisem Drängen und nahm sich den restlichen Wein.
„Okay, gut, okay, ich versuche es”, begann sie stockend. „Wo fange ich an? Also, er war ein alter Bekannter. Ich hatte ihn lange nicht gesehen. Er rief mich heute Nachmittag an und fragte, ob er am Abend bei mir vorbeischauen könne. Ich war ganz froh darüber, denn ich bin nicht gern allein, müssen Sie wissen. Und ich bin oft allein, weil mein Mann geschäftlich sehr viel unterwegs ist. Ich lade mir dann manchmal eine Freundin ein oder bin bei ihr, auch über Nacht. Ich hasse es, allein zu sein. Jedenfalls war ich ganz froh, als er heute anrief. Ich meine, wir hatten uns damals in Frieden getrennt, und was sprach schon dagegen, einen alten Bekannten oder Freund oder was weiß ich wiederzusehen? Das ist doch an sich nichts Schlimmes, oder?”
In ihrer Stimme war jetzt etwas sehr Junges, das ihn berührte. Sie schwieg eine Weile, als erwarte sie eine bestätigende, beschwichtigende Antwort, und schaute ihn dabei an, als nehme sie ihn jetzt überhaupt zum ersten Mal richtig wahr. Die Farbe ihrer Augen changierte im Lampenlicht zwischen Blau und Dunkelgrün. Er fragte sich, wie alt sie sein mochte und schätzte sie auf maximal dreißig. Und er fragte sich, was sie wohl über diesen Mann dachte, der ihr gegenüber saß und wesentlich älter war als sie; in vier Monaten würde er sechsundfünfzig werden. Er selbst hätte sich schwergetan mit einer Selbstbeschreibung, obwohl er schon so viele und so vieles beschrieben hatte. Soweit es nur die Äußerlichkeiten betraf, war es noch relativ einfach: Er war mittelgroß und schlank, dabei aber ziemlich kräftig und insgesamt in akzeptabler Form, weil er auf dergleichen achtete und mindestens zwei Mal die Woche ins Fitnessstudio ging, hatte kurzes graues Haar und ein schmales Gesicht mit tiefliegenden graublauen Augen, die manchmal etwas müde, meistens aber wach und neugierig blickten und er legte im Allgemeinen Wert auf seine Kleidung. An diesem Abend trug er schwarze Jeans, ein anthrazitfarbenes Polohemd und eine leichte Jacke aus dunklem Leinen und dazu weiße Turnschuhe, was einen gewissen Stilbruch darstellte; aber er hatte ihn sich gestattet, da es bei seiner einsamen, späten Wanderung durch die Straßen nicht so darauf ankam.
Seine Freundin Eva amüsierte sich bisweilen über seine Eitelkeit und nannte sie kurios angesichts der Tatsache, dass er doch schließlich in all den vielen Jahren, in denen er Gott weiß wo in der Welt unterwegs gewesen war, bestimmt nie Wert auf seine Kleidung gelegt habe. Vielleicht kompensiere er ja einen gewissen Nachholbedarf. Irgendwie passe das jedenfalls nicht richtig zu ihm, da er bekanntlich allem Materiellen wenig Bedeutung beimesse. Manchmal nannte sie ihn einen unverbesserlichen idealistischen Träumer.
Bei dem Gedanken an Eva wurde ihm unwohl. Was sie sagen würde, wenn sie ihn hier sitzen sähe, wollte er sich lieber gar nicht ausmalen.
„Das ist doch im Grunde nichts Schlimmes gewesen, oder?”, wiederholte die Frau im Sessel gegenüber. „Ich konnte doch nicht ahnen, wie das Ganze dann laufen würde.”
Er schüttelte den Kopf, sagte aber nichts. Ihre Stimme klang inzwischen um einiges gefasster, offenbar tat das Valium seine Wirkung. Sie schilderte, wie sie beide zunächst im Wohnzimmer gesessen und sich unterhalten hätten. Ganz normal und unverfänglich sei das gewesen. Irgendwann sei sie dann in die Küche gegangen, um eine Kleinigkeit zum Essen anzurichten.
„Und auf einmal stand er dann vor mir. Er hat mich gepackt. Ich habe versucht, mich loszureißen, aber er ist....er war...so viel stärker, Sie müssen ihn sich ja nur ansehen, ein großer, kräftiger Mann. Ich habe trotzdem versucht, mich zu wehren, aber in der Diele hat er mich wieder gepackt und er fing an, mir die Kleider vom Leib zu reißen. Irgendwie waren wir dann plötzlich wieder in der Küche, und er drückte mich gegen die Spüle. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte, vor lauter Angst, und irgendwie bekam ich dann dieses Messer zu fassen, das noch auf der Spüle lag, weil ich damit Tomaten geschnitten hatte. Wissen Sie, ich wollte Mozzarella mit Tomaten machen...”
Ihre Stimme brach, sie räusperte sich ein paarmal und fuhr fort:
„Und dann...irgendwo habe ich gehört oder gelesen, man müsse ihnen das Knie zwischen die Beine rammen, und das tat ich dann, und er trat einen Schritt zurück und krümmte sich so ein bisschen nach vorn, und da habe ich ihm das Messer...”
Abermals machte sie eine Pause.
„Er ging noch einen oder zwei Schritte, bis zur Tür, und dann brach er zusammen, er fiel auf den Rücken, es gab einen schrecklichen Rumms, und dann lag er nur noch da...”
Sie begann erneut in ihrer Handtasche zu kramen und holte eine Schachtel Zigaretten hervor. Dann fiel ihr ein, dass sie einen Aschenbecher und ein Feuerzeug brauchte und sie stand auf und ging nach nebenan, um beides zu holen. Er betrachtete ihre Bewegungen und hatte dabei das Bild ihres nackten Körpers vor Augen, den er vorhin gesehen hatte. Vorhin? Es kam ihm vor, als sei seither eine halbe Ewigkeit vergangen. Er hatte jedes Zeitgefühl verloren, aber ein Blick auf seine Uhr zeigte ihm, dass es gerade einmal zwanzig Minuten her war, seit sie taumelnd wie eine Somnambule am Gartentor erschienen war. Es war noch nicht einmal halb eins.
„Hier, möchten Sie auch?”, sagte sie und hielt ihm die Packung hin. Er nahm eine, obwohl er sich schon vor Jahren das Rauchen abgewöhnt hatte, zusammen mit dem Trinken. Aber kam es jetzt darauf noch an?
„Eigentlich rauche ich nicht. Frank, mein Mann, mag es nicht. Nur wenn er nicht da ist, genehmige ich mir hin und wieder mal eine”, erklärte sie ihm, so als sei das von Wichtigkeit. Die Art, wie sie die Zigarette hielt und den Rauch ausblies, wirkte tatsächlich nicht besonders routiniert.
„Und was nun?”, fragte er, wohl wissend, dass es eine eher rhetorische Frage war. Seit er den Toten gesehen hatte, war ihm im Grunde klar, worauf es hinauslaufen würde.
2.
Als Erstes zog er das Messer aus dem Toten. Dann durchsuchte er die Anzugtaschen. Der Frau trug er auf, einen Eimer mit Lauge zu füllen und ihm eine Plastiktüte zu besorgen. Zwischendurch fragte er sie, ob es vom Keller aus einen Durchgang zur Garage gebe, die auf Kellerniveau unter dem Haus lag und ob sie ein Auto da habe oder ob ihr Mann damit unterwegs sei. Sie sagte, ihr Mann besitze einen eigenen Wagen, ihrer stehe in der Garage und, ja, es gebe einen Durchgang.
Sie hatte ihn noch einmal angefleht, ihr „bitte, bitte” zu helfen und „bloß nicht, bitte bloß nicht” die Polizei zu rufen. Das würde sie einfach nicht aushalten, wenn sie sich vorstelle, was dann auf sie zukäme. Er hatte sie beruhigt, alles spreche dafür, dass sie in Notwehr gehandelt habe, ihr aber dann zusätzlich versichert, dass er die Polizei nicht informieren werde, nein, und das war ihm nicht einmal besonders schwergefallen.
Er wusste, dass er es nicht über sich gebracht hätte, sie der Polizei auszuliefern, gleich, wie glimpflich das auch hätte enden mögen, wobei er sich eingestehen musste, dass ihn seine tiefergehenden Beweggründe in dieser Hinsicht beunruhigten und irritierten. Normalerweise wusste er, warum er etwas tat. Hätte ihn jetzt jemand nach seinen Motiven für sein Tun gefragt, wäre ihm eine klare Antwort schwergefallen, abgesehen allenfalls davon, dass er die Polizei einfach nicht mochte. Auch wenn er ihre Existenz als Bürger zu akzeptieren hatte, gab es da eine Art instinktive Aversion.
Die Wurzeln dieser latenten Abneigung lagen vermutlich irgendwo in seinen ziemlich verwegenen, bewegten Jugendtagen, und auch darüber mokierte sich Eva bisweilen, wenn sie ihn einen „Gemütsanarchisten” und „ewigen antiautoritären Krypto-Revoluzzer” nannte, was ihn seinerseits amüsierte. Weniger amüsant waren hingegen gewisse Erfahrungen mit Vertretern der Staatsgewalt gewesen, die er im Lauf der Jahre nicht nur in Deutschland, aber auch hier, gemacht hatte und die ihn gelehrt hatten, allen amtlichen Autoritäten mit Misstrauen zu begegnen. Im Prinzip hatte er die Grenzen der Legalität stets beachtet, aber es hatte auch Situationen gegeben, beispielsweise in einigen afrikanischen Ländern, in denen er sie bewusst ignoriert hatte, um andere, aber auch sich selbst zu retten. „Wenn ich immer absolut rechtstreu gewesen wäre, hättest du mich wahrscheinlich nicht kennengelernt”, hatte er es gegenüber Eva einmal etwas theatralisch ausgedrückt.
Er hatte sich verschiedentlich auch schon mit Leichnamen zu beschäftigen gehabt, aber das war jedes Mal in einem doch völlig anderen Kontext geschehen, in irgendwie exotischen Situationen, die gleichsam aufgrund höherer Gewalt entstanden waren.
Die Beseitigung eines Toten aus der Wohnung einer ihm völlig fremden, attraktiven, offensichtlich kultivierten jungen Frau in einem der besseren Viertel Berlins bedeutete auch für den weitgereisten, welterfahrenen und in vielerlei Hinsicht versierten Journalisten Robert Kessler eine völlig neue Herausforderung – zumal es niemand anders als eben diese Frau gewesen war, die mittels eines Küchenmessers dafür gesorgt hatte, dass aus einem großen kräftigen Mann ein lebloses Etwas geworden war. Objektiv gesehen handelte es sich um einen Fall von vergleichsweise banaler Gewalt, wie sie in Polizeiberichten und Fernsehkrimis vorkam.
Wenn es darauf ankam, war er immer höchst pragmatisch vorgegangen und hatte eine auf manche Kollegen geradezu provokant wirkende Gelassenheit an den Tag gelegt. Dennoch konnte er nicht umhin, sich ein wenig über sich selbst zu wundern, wie abgeklärt, ja scheinbar fachmännisch er jetzt zu Werke ging, als er den Inhalt der Brieftasche inspizierte und die Taschen des Toten leerte. Er fand ein Handy und einen Schlüsselbund, der offensichtlich aus einem Haus- und einem Wohnungsschlüssel bestand, aber er fand keinen Autoschlüssel, was insofern wichtig war, als es bedeutete, dass nicht irgendwo in der Nähe der Wagen des Toten stehen konnte. Dafür stieß er auf einen Fahrschein der Berliner Verkehrsbetriebe, abgestempelt um 20.43 Uhr. In der Brieftasche befanden sich zwei Kredit- und mehrere Einkaufskarten sowie ein Fünfzigeuroschein, zwei Zwanziger und etwas Münzgeld. Und sie enthielt den Ausweis, demzufolge es sich bei dem Toten um Oliver Rensing handelte, geboren am 18. Oktober 1974 und wohnhaft an der Falkenseer Chaussee in Spandau.
„Oliver Rensing heißt du also”, murmelte er, „oder genauer gesagt: hießest du.” Zugleich ging ihm durch den Kopf, dass er immer noch nicht wusste, wie eigentlich die Frau hieß, die das Dasein dieses Oliver Rensing aus dem Präsens ins Imperfekt befördert hatte. Und ebenso wenig wusste sie ihrerseits, wer jener fremde Mann war, der sich da freundlicherweise bereitgefunden hatte, ihr diesen toten Oliver Rensing endgültig vom Hals zu schaffen. Genau so formulierte er es im Geiste, und die Situation kam ihm für einen kurzen Moment derart aberwitzig, ja surreal vor, dass er dachte: Gleich ist es so weit, gleich werde ich wach und bin erleichtert, weil ich das alles nur geträumt habe.
Doch die Frau hatte mittlerweile ganz real den Putzeimer und die Tüte herbeigeschafft und schaute ihm aus einigem Abstand zu. In ihren Augen lag immer noch Angst, aber es schien ein bisschen weniger geworden zu sein.
„Mir fällt gerade ein, dass wir uns einander noch gar nicht vorgestellt haben”, sagte er. „Vielleicht sollten wir das allmählich nachholen. Es sei denn, wir verständigen uns darauf, dass wir es dabei belassen, bei dieser Anonymität, meine ich. Vielleicht wäre das ja besser so.”
„Oh”, machte sie und kam näher, mit leichter Röte und einem Ausdruck von Verlegenheit im Gesicht. „Ich weiß auch nicht, also...”
Sie streckte ihm die Hand hin und er ergriff sie, ohne in dieser Sekunde daran zu denken, dass diese Hand vor wahrscheinlich nicht einmal einer Stunde ein Küchenmesser in die Brust eines Menschen gestoßen hatte. Dieser Gedanke kam ihm erst, als er ihre Hand wieder losließ, die sich zart, aber fest und trocken anfühlte, und er verdrängte ihn schnell wieder.
„Ich heiße Julia”, sagte sie mit einem entfernten Anklang unschuldiger Koketterie. „Julia Gerlach.”
Er nannte ihr seinen Namen und fuhr dann gleich fort:
„Wir müssen hier gründlich sauber machen. Seine Sachen sowie das Messer packen wir erst mal in die Tüte. Was wir damit machen, werden wir dann später sehen. Aber zuerst müssen wir ihn mal runter in die Garage bringen, in Ihren Wagen. Und dabei müssen Sie mir ein bisschen helfen. Vielleicht haben Sie ja auch irgendwo noch eine alte Decke oder so was.”
„Ich? Helfen? Oh Gott! Wieso denn? Wie denn?”, stotterte sie und wich zurück und wurde blass.
„Na los, Sie müssen schon mit anpacken. Allein schaffe ich das nicht. Wo geht's denn in den Keller? Machen Sie schon mal die Tür auf und das Licht an.”
Es war eine schmale, niedrige weiße Tür, die er bis dahin übersehen hatte, in der Wand rechts von Haustür, unter dem Treppenaufgang ins Obergeschoss.
Er zog den Toten über die Schwelle der Küchentür, bis er in der Mitte der Diele lag, und sagte ihr, sie solle ihn nun bei den Füßen nehmen und vorausgehen, während er von hinten den Oberkörper umschlang und ihn ein wenig anhob. Sie zögerte immer noch, und er forderte sie abermals auf.
„Nun machen Sie schon!”
„Ich...ich kann das nicht.”
„Sie müssen.”
Endlich überwand sie sich. Der Tote war schwer, noch etwas schwerer, als er erwartet hatte, und schon auf halber Höhe der engen Kellertreppe merkte er, wie ihm der Schweiß ausbrach. Die Frau namens Julia Gerlach bat ihn immer wieder um Pausen und stieß kleine verzweifelte Laute aus. Schließlich hatten sie ihn unten, in einem schmalen Gang, von dem mehrere Räume abgingen.
„Wo?”, fragte er.
Sie wies auf die Eisentür am Ende des Ganges.
„Holen Sie schon mal den Autoschlüssel, und denken Sie an die Decke”, sagte er. Unterdessen schleppte er den Toten bis zu der Tür, öffnete sie, schleifte ihn hindurch und tastete nach dem Lichtschalter. Schwer atmend lehnte er an der Wand, als sie mit einer grauen Decke zurückkehrte, von der ein muffiger Geruch ausging.
„Ist die richtig? Ich habe sie hinten zwischen einigen alten Sachen gefunden”, erklärte sie mit zitternder Stimme und eifrig, so als spiele das eine Rolle.
Der Wagen war ein silbergrauer Kombi, ein ziemlich neuer Dreier-BMW. Er ließ sie die Heckklappe aufmachen und Platz auf der Ladefläche schaffen, indem sie einiges Zeug, das dort lag, beiseite schob. Er selbst breitete die Decke aus. Dann befahl er ihr erneut, mit anzupacken, und sie wuchteten den Körper hinein und schlugen die Deckenenden über ihn.
3.
„Und was nun?”, fragte sie eine halbe Stunde später, als er den Wagen aus der Garage setzte und auf die Straße einbog, um schon nach wenigen Metern zu beschleunigen. Sie hatte gar nicht erst Anstalten gemacht, selbst fahren zu wollen und kauerte in ihrem Sitz.
Obschon es, wie nach den vielen heißen Tagen zuvor, wiederum eine warme Nacht war, hatte sie sich etwas übergezogen, eine kleine Jacke aus Leder, die deutlich zu teuer für diesen Anlass wirkte und knapp saß, was ihre Brust noch voller erschien ließ, als er sie von vorhin in Erinnerung hatte. Er musste ein paarmal dort hinsehen, obwohl er es eigentlich nicht wollte, und auch in ihr mädchenhaftes Gesicht, in dem Anspannung, Angst und Müdigkeit lagen. Sie hatte es sich inzwischen gewaschen, aber auf neues Make-up verzichtet.
„Versuchen Sie einfach, sich ein bisschen zu entspannen”, sagte er. Als sie auf der Potsdamer Chaussee waren, der großen Ausfallstraße in Richtung Südwesten, fragte er sie:
„Was meinen Sie, hat ihn eigentlich jemand gesehen, als er zu Ihnen kam?”
„Wieso, weshalb? Ist das wichtig? Könnte das...irgendwie...gefährlich sein?”, fragte sie erschrocken zurück. Dann überlegte sie kurz. „Nein, ich glaube nicht. Die Nachbarn auf der einen Seite, Burgmüllers, sind gar nicht da, die sind in Urlaub. Und die anderen, die Schöllers, kümmern sich praktisch überhaupt nicht um andere Leute. Aber das tun ja die meisten nicht dort in der Gegend. Wieso wollen Sie das wissen?”
„Ach, nur so, schon gut”.
Wenig später wollte er erneut etwas wissen.
„Das Messer – stammte das eigentlich aus solch einem Sortiment, steckte es in einem dieser Blöcke, die man komplett kaufen kann?”
„Das Messer, oh Gott”, sagte sie und zuckte zusammen. „Nein, so etwas habe ich nicht. Kein Block. Es hat vorher einfach nur in der Schublade gelegen.”
„Das ist gut.”
„Aber wieso?”
„Vergessen Sie's, denken Sie einfach nicht mehr daran.”
Die ganze Zeit arbeitete es in seinem Kopf, genau genommen schon seit dem Moment, als er sich erstmals über den Toten gebeugt hatte. Anfangs hatte er vorübergehend erwogen, ihn nach Spandau zu bringen, in die Nähe seiner Adresse. Aber er kannte sich dort nicht aus, wie die meisten Berliner, in deren Augen dieser Bezirk eine Art exterritoriales, nicht wirklich zur Hauptstadt gehörendes Gebiet war; und er wohnte ohnehin erst seit gut drei Jahren in dieser Stadt und war noch längst nicht überall gewesen.
Am besten würde es sein, in den Grunewald zu fahren. Er lief oder wanderte dort dann und wann und wusste, dass es befahrbare Wege gab, die ziemlich tief in den Wald hineinführten. Er war sich nur noch nicht ganz klar darüber, was genau sie mit dem Leichnam machen sollten – ihn einfach irgendwo ablegen oder versuchen, ihn zu verstecken.
Was sind das nur für Gedanken, schoss es ihm immer wieder durch den Kopf. Er erinnerte sich, wie er einmal im Sudan dabei gewesen war, als Männer, die sich selbst als Freiheitskämpfer bezeichneten, die Leichen mehrerer Soldaten hatten verschwinden lassen. Sie hatten sie mit Benzin überschüttet und anschließend die verkohlten Reste vergraben. Sein Bericht hierüber war, entgegen allen üblichen Gepflogenheiten, unter einem Pseudonym abgedruckt worden.
Auf der Straße war weit und breit kein anderes Fahrzeug zu sehen, als er in den Wald einbog. Er überlegte, ob es von Nutzen sein könne, den Toten auszuziehen und die Kleidung zu verbrennen, verwarf den Gedanken aber sofort. Wichtig war, all seine persönlichen Gegenstände zu beseitigen und Oliver Rensing – zumindest vorübergehend und am besten für möglichst lange Zeit – in eine namenlose männliche Leiche zu verwandeln. Gefunden werden würde sie ohnehin über kurz oder lang, das war gar nicht zu vermeiden, und irgendwann würde der Namenlose identifiziert werden. Auch dagegen ließ sich nichts machen. Am wichtigsten war, dass nichts, keinerlei Spur, kein noch so geringer Hinweis auf die Tatsache zurückblieb, dass Rensing an diesem Abend bei Julia Gerlach gewesen war. Deshalb musste er auch die Decke verschwinden lassen, mit der er hatte verhindern wollen, dass etwaige Blutspuren im Wagen zurückblieben. Und noch etwas fiel ihm ein.
„Sie müssen nachher, zu Hause, noch einmal gründlich putzen und alles, wirklich alles abwischen, was er angefasst haben könnte.”
Sie nickte ergeben.
Nach etwa einem Kilometer kamen sie an eine Stelle, wo ein kleinerer, nicht befahrbarer Weg abzweigte und, wie im Scheinwerferlicht zu erkennen, der Boden von einer besonders dicken Laubschicht bedeckt war. Auch einige abgebrochene Äste und Zweige lagen herum.
„So, dann wollen wir mal”, sagte er und stoppte.
Diesmal half sie ihm ohne weitere Aufforderung. Gemeinsam hievten sie den Toten aus dem Wagen, trugen ihn ein Stück und ließen ihn aus der Decke auf die Erde gleiten. Mit einem Ast schaufelte er einiges Laub zur Seite, sodass eine flache Mulde entstand. Sie rollten den Leichnam hinein und verteilten das Laub darüber. Zum Schluss legte er noch einige Zweige obenauf, rollte die Decke ein und warf sie hinten in den Wagen zu der Tüte.
Als er wieder einsteigen wollte, stand sie auf einmal vor ihm und ließ sich gegen ihn fallen. Sie drückte ihr Gesicht in seine Halsbeuge.
„Bitte einmal ganz fest halten, ganz fest”, flüsterte sie, und dann: „Danke, danke.”
„Danken Sie mir nicht zu früh”, sagte er, während sie sich voneinander lösten, und bereute es sofort angesichts ihres verängstigten Blicks.
Auf der Rückfahrt sprachen sie wenig. Er fuhr einige Umwege, möglichst weit weg vom Grunewald. An einer Baustelle, vor der ein übervoller Schuttcontainer am Straßenrand stand, hielt er an und stopfte die Decke zwischen die Masse aus Mörtelresten, Steinen, leeren Zementsäcken und verschmutzten Plastikplanen.
Als sie in Lichterfelde auf einer der Kanalbrücken waren, bremste er abermals, wartete, bis ein Auto fort war, das gerade vorbeikam, nahm das Handy und das Messer aus der Tüte und warf beides hinab in das dunkle träge Wasser. Den Fahrschein zerfetzte er, sodass die Schnipsel hinterherregneten. Den Schlüsselbund ließ er einige hundert Meter weiter in einen Gully fallen. Jetzt befand sich nur noch Oliver Rensings Brieftasche in der Tüte. Er zog sie heraus, schob sie in seine Jackentasche, zerknüllte die Tüte und steckte sie an einer Bushaltestelle in den Abfalleimer.
Sie hatte alles, was er tat, mit aufmerksamen, unsicheren Blicken verfolgt. Er selbst betrachtete sein Vorgehen als wahrscheinlich übertrieben akribisch. Doch wenn er sich schon auf all dies eingelassen hatte, wollte er auch ganz sicher gehen und keinen unnötigen Fehler machen.
„Was haben Sie denn mit der Brieftasche vor?”, fragte sie.
„Nur Geduld”, sagte er etwas schroff, weil sich in ihm gerade ein unbestimmtes Gefühl von Bitterkeit und Unbehagen regte, “das werden Sie dann schon noch sehen.”
Als sie wieder bei ihrem Haus ankamen, begann bereits das Morgendämmern mit ersten zaghaften Ansätzen den Himmel zu färben.
Sie weigerte sich, auszusteigen.
„Ich kann das nicht, ich kann jetzt nicht in dieses Haus”, schluchzte sie unvermittelt auf und klammerte sich an seinen Arm.
„Na, na, was soll denn das”, sagte er mit einem rauen Klang in der Stimme. „Es ist doch jetzt gut. Und Sie müssen doch sowieso wieder dorthin zurück. Es nützt überhaupt gar nichts, wenn Sie sich jetzt dagegen sperren.”
„Kann ich nicht mit zu Ihnen? Nur für diese paar Stunden, bis es richtig Tag ist?”
„Nein, tut mir leid, das geht nicht, auf keinen Fall”, antwortete er entschieden.
Sie gab plötzlich einen glucksenden Laut von sich, der wie eine Mischung aus Jammern und einem kleinen ratlosen Lacher klang und sagte leise:
„Irgendwie ist das alles doch völlig verrückt. Ich weiß überhaupt gar nicht, wer Sie sind, nur, dass Sie Robert Kessel heißen. Sind Sie eigentlich auch verheiratet?”
„Kessler”, verbesserte er sie. „Nein, bin ich nicht, aber ich lebe in einer festen Beziehung.”
Erst jetzt musste er wieder an Eva denken. Es war nur gut, dass sie zurzeit nicht da war, sondern aus beruflichen Gründen für einige Tage nach Köln gefahren war. Ob sie sonst jetzt bei ihm zu Hause gewesen wäre, war allerdings fraglich. Sie hatte ihre eigene Wohnung in Potsdam, wo sie bei einer Filmproduktionsfirma arbeitete, und häufiger als zweimal pro Woche blieb sie fast nie über Nacht bei ihm, zudem meist am Wochenende. Rein theoretisch wäre es also möglich gewesen, Julia Gerlach mit in seine Wohnung zu nehmen – wenn nicht die übrigen Hausbewohner gewesen wären.