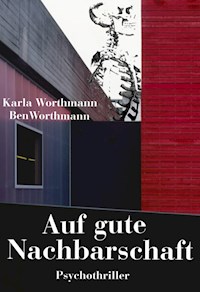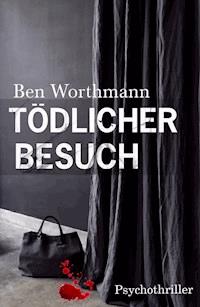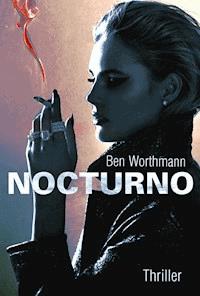
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Dies ist die Geschichte eines Mannes, dessen luxuriöses Leben binnen weniger Tage zerbricht - ein Drama über Begehren, Gewalt, Schuld und Verstrickung, mehr als ein üblicher Krimi. Max lebt in einer feinen Villa, umgibt sich mit kultivierten Bekannten, ist eitel und legt Wert darauf, Geist und Körper in Form zu halten. Doch der schöne Schein trügt. Während seine junge, reiche Frau für ein paar Tage verreist ist – angeblich, um ihrer verlassenen Freundin beizustehen –, gerät er im wahrsten Sinne auf Abwege und alsbald in eine Art realen Alptraum. Beklemmender Psychothriller von Ben Worthmann, dem mit "Die Frau am Tor" auf Anhieb ein Beststeller gelang. Weitere Werke des Autors: "In einer Nacht am Straßenrand", "Etwas ist immer" und "Leben für Fortgeschrittene" , "Das Grab der Lüge" und "Tödlicher Besuch".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ben Worthmann
Nocturno
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Impressum neobooks
1.
Er erwachte und stellte fest, dass er äußerst unbequem lag. Merkwürdig, dass er auf einem solch harten Untergrund überhaupt hatte schlafen können. Doch vielleicht hatte er ja gar nicht geschlafen, sondern war tot. Dunkel genug war es jedenfalls um ihn herum, um ihn auf solch einen Gedanken zu bringen. Aber konnte man als Toter noch denken? Eine schwierige Frage, viel zu schwierig, als dass er sie ausgerechnet jetzt hätte beantworten können. Wahrscheinlich war es auch eher so, dass er noch schlief und lediglich träumte, er sei erwacht; so etwas war ihm schon häufiger passiert.
Bevor er diese anstrengenden Überlegungen zu Ende bringen konnte, machte er weitere Entdeckungen: Über ihm war der Nachthimmel, mit einigen Sternen besetzt und stellenweise von Wolkenfetzen verhangen. Doch er konnte ihn nur mit dem linken Auge richtig sehen, da das rechte schmerzhaft geschwollen war. Auch seine Hände, mit denen er sich jetzt prüfend über das Gesicht fuhr, fühlten sich wund an, als er in dem Versuch, sich aufzurichten, den steinernen Boden abtastete. Als er aufrecht saß und instinktiv den Kopf schüttelte, um ihn klar zu bekommen, durchfuhr ihn ein dumpfer Schmerz am Hinterkopf und er ertastete eine Beule. Sofort befühlte er seine Oberschenkel, den Bauch, die Brust auf der Suche nach womöglich weiteren verborgenen Verletzungen, fand aber nichts. Erleichtert registrierte er, dass die Brieftasche an ihrem gewohnten Platz in der Innentasche des Jacketts war, ebenso die flache goldene Uhr an seinem linken Handgelenk. Sie zeigte auf halb eins.
Mit mechanischen Bewegungen klopfte er vermuteten Schmutz von seinen Jeans und dem dunklen Leinenjackett, ordnete unbeholfen das graue Seidenhemd, das halb aus der Hose hing und bis zur Brust geöffnet war, und spürte ein starkes Bedürfnis nach einer Zigarette. Mit seinen wehen Fingern begann er die Jackentaschen zu durchsuchen, stieß auf ein zerknittertes Päckchen und pulte eine von drei ramponierten Zigaretten heraus. Dann begann er nach seinem Feuerzeug zu suchen, fand aber nur seine Schlüssel. Das Feuerzeug fehlte, ein goldener Barren von der Größe einer halben Zigarettenschachtel, der angenehm schwer in der Hand lag. Er war vom selben Designer entworfen wie die Armbanduhr. Beides waren Geschenke, mit seinen Initialen versehen, MZ für Max Ziegler, Geschenke von Hanna. Der Gedanke daran überfiel ihn unvermittelt und verband sich mit einem unbestimmten, bitteren Gefühl, das aber schnell wieder verflog. Mehr als der Verlust des materiellen und ideellen Wertes, den das Feuerzeug darstellte, quälte ihn der erzwungene Verzicht auf die tröstende Zigarette.
Eines stand fest: Er musste hier weg, so schnell wie möglich, alleine schon um rauchen und etwas trinken zu können. Ein eiskalter Wodka war jetzt genau das, was er brauchte. Während er sich sitzend reckte, um die zum Aufstehen benötigte Spannung in seinen Körper zu bringen, und seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten, versuchte er herauszufinden, wo er war. In einiger Entfernung stand eine Straßenlaterne; dort, wo er saß, warfen lediglich die beleuchteten Hausnummern ihr fahles Licht. Sie gehörten zu Mietshäusern älterer Bauart, mit einstmals großbürgerlichen Wohnungen, die im Laufe der Zeit zerstückelt und auf deutlich bescheidenere Verhältnisse zugeschnitten worden waren. Er kannte solche Gegenden von langen, regelmäßigen Wanderungen durch die städtische Landschaft, für die er sich halbprofessionell, wie er es selbstironisch zu nennen pflegte, interessierte, wusste alles einzuordnen in die urbane Topographie, und wenn er auf Anhieb auch nicht ganz genau sagen konnte, wo er war, so doch, dass es sich um eine Gegend nicht weit von der neuen, prunkenden, funkelnden Hauptstadtmitte handeln musste, einen Ausläufer jener kargeren Regionen, die vielfach in abruptem Kulissenwechsel in die ausgeleuchteten Arenen des städtischen Treibens übergingen, genau wie umgekehrt.
Als er schließlich stand er, noch immer etwas benommen, machte er ein paar Schritte auf nicht ganz sicheren Beinen. Das Haus direkt vor ihm trug die Nummer 112, das nächste, neben einer Toreinfahrt zu einem der typischen Hinterhöfe, die 112 a, und indem er diese Informationen intuitiv speicherte, fiel ihm auch der Name der Straße wieder ein – Schledestraße. Er war in Kreuzberg. Als nächstes fiel ihm ein, dass er sich früher am Abend anderswo aufgehalten hatte, im Ostteil der Innenstadt, unter anderem in der Friedrichstraße, aber weiter reichte seine Erinnerung nicht.
Abermals tastete er nach den Zigaretten, bemerkte, dass er die eine immer noch unangezündet im Mund hatte, vermisste erneut das Feuerzeug, fluchte stumm, tat einige weitere Schritte und verharrte sofort wieder, als er auf dem Boden vor der Hausfront zwei dunkle Schatten erblickte. Im ersten Moment dachte er an Sperrmüll oder irgendwelche Lumpenbündel, aber dass das ein Irrtum war, sagte ihm ein unangenehmes, fröstelndes Gefühl, das ihm den Rücken hinauf kroch, während er langsam näher trat. Zugleich tauchten vor seinem inneren Auge Bruchstücke von Bildern auf. Es waren schemenhafte Szenen eines Kampfes, die ihm eine erste vage Ahnung davon gaben, woher seine Blessuren rührten.
Der Körper der Frau lag, den Kopf zur Hauswand hin, in leicht gekrümmter, halb seitlicher Haltung quer auf dem Gehweg. Er wusste, dass es die Frau war, noch bevor er näher heran getreten war, um sich zu ihr hinab zu beugen. Etwas schimmerte matt zwischen den dunklen Haaren – eine goldfarbene Spange. Er erinnerte sich plötzlich, wie sie ein paar Mal Lichtreflexe geworfen hatte, als er der Frau gefolgt war, vorhin, in den helleren Straßen. Das war aus einer Laune heraus geschehen, ohne benennbare Absicht. Etwas an ihrem Gang hatte seine Aufmerksamkeit geweckt. Sie hatte sich mit der beiläufig graziösen Geschmeidigkeit eines Menschen bewegt, der sich seiner Körperlichkeit bewusst ist, ohne dass es einstudiert wirkt. Ihr Gesicht hatte er nicht gesehen, nur die Rückenansicht ihrer schlanken, mittelgroßen Gestalt in einem kurzen Rock und einem weißen knappen Oberteil.
Sie lag dort wie im Schlaf. Soweit sich das im spärlichen Licht erkennen ließ, war sie relativ jung und auf eine eher alltägliche Art attraktiv, ähnlich wie viele junge Frauen, die einem auf der Straße, in Geschäften oder in Cafés und Restaurants begegneten. Das Oberteil war ein wenig verrutscht und gab ein Stück ihres flachen Bauchs frei, die kleine Jacke, die sie wegen der hartnäckigen Hitze dieses Sommerabends nur locker über die Schultern geworfen hatte, als er ihr gefolgt war, lag neben ihr, ebenso ihre Handtasche. Da er zunächst kein Anzeichen von Atmung erkennen konnte, beugte er sich noch näher zu ihrem Gesicht und meinte einen schwachen Duft von Parfum und Alkohol wahrzunehmen. Er konnte zwar nicht mit letzter Sicherheit beurteilen, ob sie tot war oder nur bewusstlos, doch irgendetwas sagte ihm, dass sie noch lebte. Das aber hieß, dass er etwas tun, dass er Hilfe herbeirufen musste – nur wie? Ein Handy hatte er, wie fast immer, nicht dabei, da er Handys hasste. Weit und breit war kein Mensch zu sehen, was aber mit Blick auf seine eigene, heikle, kaum erklärbare Situation letztlich nur von Vorteil war. Deshalb verwarf er auch sofort die Idee, im nächsten Haus irgendwo anzuklingeln. Er musste hier weg, dachte er erneut, aber vielleicht sollte er wenigstens die Frau in jene Position bringen, die in den Erste-Hilfe-Regeln empfohlen wurde – stabile Seitenlage hieß das wohl, soweit er wusste. Er wagte es jedoch nicht, sie anzufassen, vor allem aus Furcht, etwas falsch zu machen, aber nicht allein deswegen.
Sein Blick fiel auf den zweiten Schatten. Er musste sich überwinden, ein Stück näher heran zu gehen. Der Mann lag zur Straße hin auf dem Rücken, der Oberkörper steckte in einer mit Nieten beschlagenen Lederjacke, die Beine waren zu einem schmalen V gespreizt, die Spitzen der schweren Schnürstiefel zeigten nach oben. Der Kopf war nach hinten über die Bordsteinkante gekippt, ein kahler Schädel über einem breiten, fleischigen Gesicht, das einem jungen, kaum erwachsenen Mann gehörte. Aus dem rechten Mundwinkel zog sich ein Rinnsal von Blut, das wegen der Lage des Kopfes zum Ohr hin verlief und sich dort womöglich mit anderem Blut vermischt hatte, das aus dem Ohr stammte.
So wie er zu wissen meinte, dass die Frau lebte, so sicher war er, dass der Mann tot war, auch wenn ihm jede praktische Erfahrung für einen solchen Befund fehlte; den Anblick Toter, die auf solche Weise ums Leben gekommen waren, kannte er nur aus Filmen. Aber dieses Wissen reichte ihm vollauf. Der Schrecken darüber verursachte ihm ein leeres, flaues Gefühl in der Magengrube, so als habe ihn dort ein heftiger Faustschlag getroffen – ein Schlag jener Art, wie sie vorhin ausgetauscht worden sein mussten, als es passiert war.
Die Erinnerungsbilder wurden jetzt deutlicher. Er war der Frau gefolgt, über eine ziemlich lange Strecke, immer weiter nach Kreuzberg hinein, und er hatte sich dabei keinerlei Mühe gegeben, auf einen halbwegs diskreten Abstand zu achten, sondern sich ihr immer wieder bis auf fünfzehn, höchstens zwanzig Meter genähert. Er hatte sogar ziemlich bewusst den Reiz der ungewohnten Situation genossen und ein wenig darauf spekuliert, dass sie ihn womöglich bemerken und etwas zu ihm sagen würde. Wie er dann reagieren würde, so weit hatte er allerdings nicht gedacht. Dann, in der stillen, grauen, schäbigen Schledestraße, hatte dieses kleine, nicht ganz ernste, von vager Erotik gefärbte Spiel plötzlich ein böses Ende gefunden. Jemand war aus der Toreinfahrt geschossen gekommen und hatte sich über die Frau hergemacht. Und er, Max, war ihr, ohne eine Sekunde nachzudenken, sofort zur Hilfe geeilt und hatte sich auf den Angreifer gestürzt. Es war zu einem kurzen, heftigen Kampf gekommen, doch an die Einzelheiten des Verlaufs konnte er sich nicht erinnern, so sehr er sich bemühte. Er wusste nur noch, dass ihn eine rasende Wut gepackt hatte und er blindlings zugeschlagen hatte. Und noch etwas wusste er – dass da noch ein weiterer Mann beteiligt gewesen war, der sich sehr schnell entfernt hatte. Das Stakkato seiner hastigen Schritte klang ihm noch ihm Ohr, ebenso wie die Geräuschkulisse des Kampfes, das Schnauben und Stöhnen und Zusammenprallen von Knochen und Fleisch.
Und jetzt lagen hier ein Toter und eine verletzte, bewusstlose Frau. In was für eine Sache war er da nur hineingeraten! Sein Verhalten kam ihm so fremd und fern von allem vor, was seine Person und sein Leben ausmachte, dass er es einfach nicht glauben wollte.
Erneut schaute er auf seine Armbanduhr. Seit seinem Aufwachen waren gerade fünf Minuten vergangen, die ihm jedoch wie eine Ewigkeit vorkamen. Dann fiel ihm wieder das verschwundene Feuerzeug ein und er erinnerte sich, dass er es aus einem Reflex heraus in die rechte Faust genommen, um die Wucht seiner Hiebe zu verstärken, ganz wie ein geübter Schläger. Er spürte eine weitere Woge von Scham, Schwindel und Schwäche, gefolgt von der nüchternen Überlegung, dass das Feuerzeug sich irgendwo hier befinden und er es suchen musste. Schon um seine Zigarette endlich anzünden zu können, brauchte er Feuer. Ich könnte ja in der Handtasche der Frau nachzuschauen, ob dort Streichhölzer sind, dachte er – um sogleich dagegen zu halten, dass das so etwas wie Fledderei wäre. Er tat es dann aber doch und schämte sich dafür. Wer hätte je geahnt, dass er einmal heimlich die Handtasche einer Frau durchwühlen würde, noch dazu einer wildfremden? Obwohl – eine große Rolle spielte das nun auch nicht mehr.
Er fand, was er suchte, eine angebrochene Schachtel langer Filterzigaretten und ein Streichholzheftchen. Die Zigaretten ignorierte er und auch, in einem Anflug von Skrupeln, das, was sich sonst noch in der Tasche befand. Mit zitternden Fingern riss er ein Streichholz an, das aber zerbrach. Da nur noch zwei übrig blieben, war er beim nächsten vorsichtiger. Das winzige Feuer kam ihm vor wie ein tröstendes Licht, dankbar sog er den Tabakrauch in seine Lungen ein. Ein paar Sekunden zögerte er, dann steckte er das Streichholzheftchen in die rechte Tasche seiner Jeans und ging weg. Erst langsam, dann zügig, schließlich rennend ließ er die dunkle Straße hinter sich.
Er erreichte eine Kreuzung, bog in eine hellere, belebtere Straße ein und drückte sich, keuchend nach Atem ringend, in einen Hauseingang, als er von den Scheinwerfern eines Autos geblendet wurde. Eine Gruppe angetrunkener Jugendlicher kam ihm lärmend entgegen und er wechselte sofort die Straßenseite, hastete weiter. Erst als er in die nächste Straße eingebogen war, wo auf Fahrbahn und Gehwegen noch reger Betrieb herrschte, verlangsamte er sein Tempo und mischte sich unter die Passanten. Jetzt bin ich erst einmal in Sicherheit, dachte er, weit genug weg vom Tatort und unerkannt. Tatort – wie das klang! Erneut überfiel ihn das Bewusstsein, in welch eine aberwitzige, beklemmende Situation er geraten war. Wie sollte er dies nur jemandem plausibel erklären, seiner Frau, seinen Freunden? Ganz zu schweigen von der Polizei, die sich selbstverständlich für den Fall interessieren würde. Max Ziegler, Ehemann einer reichen, stadtbekannten Unternehmerin, wohnhaft in einer feudalen Wannsee-Villa, war jetzt ein Kriminalfall. Welch ein absurder Gedanke. Aber musste er es überhaupt jemandem erzählen? Konnte er nicht einfach alles vergessen und hinter sich lassen und so tun, als sei nichts geschehen? Sein kultiviertes, privilegiertes Leben weiter leben wie bisher?
Vor einem Schaufenster mit Damenbekleidung blieb er stehen, um sich zu inspizieren. Er erblickte sich in einer Kulisse von Schaufensterpuppen in bereits herbstlichen Mänteln und Kostümen und musste zweimal hinschauen, um erst die Konturen und dann die Details seines gläsern-schattigen Ichs auszumachen. Ganz so schlimm, wie er befürchtet hatte, war der Anblick wohl doch nicht. Die Blessur über dem Auge bestand aus einer geröteten Schwellung, die auf den ersten Blick nicht unbedingt als Folge einer Schlägerei zu erkennen war. Auch seine Garderobe wies keine spektakulären Schäden auf.
Doch als er sich eingehender untersuchte, stellte er fest, dass zwei Hemdknöpfe fehlten. Das war sehr unangenehm, denn es handelte sich nicht um irgendwelche Knöpfe, sondern um eine bestimmte Art von Perlmuttknöpfen, die ebenfalls seine Initialen trugen. Der Schneider, bei dem er auf Zureden Hannas meistens seine Garderobe anfertigen ließ, hatte großen Wert auf die Tatsache gelegt, dass es ganz besondere, unverwechselbare Knöpfe waren, kleine Kostbarkeiten hatte er sie genannt.
Max versuchte die Frage, welche Probleme dieser Verlust nach sich ziehen könnte, einstweilen beiseite zu schieben. Er betrachtete sein Spiegelbild. Da stand ein Mann Ende der vierzig, von mittelgroßer, ziemlich kräftiger Statur, dessen dunkelblondes Haar schon etwas schütter und an den Schläfen ziemlich grau war, ein Mann mit einem schmalen, ernsten, markanten Gesicht, auf dem der Ausdruck einer ständigen leichten Melancholie lag. Er wusste, dass er schon seit längerer Zeit und nicht erst seit diesem Abend müde aussah. Und plötzlich wusste er auch, dass er jetzt sofort etwas tun musste, um das akute Desaster wenigstens zu begrenzen, wie es sich für einen vernünftigen Menschen gehörte, statt sich der Illusion hinzugeben, die Probleme würden sich von selbst erledigen.
Ein paar Schritte weiter war ein Lokal, eines der vielen so genannten Cafés, die es in Berlin gab, in denen alles mögliche angeboten wurde, nur nicht Kuchen und Torte, und die bis in den Morgen geöffnet hatten und eigentlich nichts weiter als ganz normale Kneipen waren; von dort wollte er die Polizei anrufen – anonym, damit hätte er fürs erste seine Pflicht erfüllt –, nachdem er ein Glas getrunken hatte, um etwas zur Ruhe zu kommen. Vor der Tür drängten sich, wie überall neuerdings, die Raucher in Grüppchen, während drinnen nicht allzu viel Betrieb herrschte. Er setzte sich an einen Tisch in einer Ecke und überließ sich für einen Moment seiner Müdigkeit. Als die Bedienung kam, schreckte er hoch und bestellte einen doppelten Wodka. Er trank ihn ex, um sogleich einen weiteren zu verlangen.
2.
Die Kellnerin musterte ihn mit einem abschätzenden Blick, mit dem Frauen ihn häufiger ansahen. Sie war sehr jung und ziemlich hübsch und hatte ein Tattoo am linken Oberarm.
„Alles okay soweit?“ fragte sie.
Statt einer Antwort nickte er und brummte etwas, das wie ein „Ja, ja“ klingen sollte. Nachdem er auch den zweiten Wodka geleert und diesmal die kalt-wärmende Wohltat etwas ausgiebiger genossen hatte, begab er sich zur Toilette. Im Spiegel des Waschraums inspizierte er sich erneut – und spürte einen leisen Schock. Er sah doch schlimmer aus, als es eben noch im matten Schaufensterglas geschienen hatte.
Das Auge würde sich bald bunt färben. Sein Gesicht wirkte hohl und fahl. Auf dem Hemd befanden sich Blutspritzer. Er zog es aus und behielt nur das T-Shirt an, eine Aufmachung, die nach seinem und erst recht Hannas Geschmack normalerweise indiskutabel war. Mit Rücksicht auf gewisse Konventionen pflegte er sich damit zu begnügen, auf eher diskrete Weise stolz zu sein auf seinen trainierten Körper, dessen obere Hälfte sich jetzt unter dem engen Textil abzeichnete und für dessen Zustand er einiges an Zeit und Schweiß aufwandte, wenn auch nicht mit jener Konsequenz, die den Verzicht auf Zigaretten und die gar nicht so seltenen alkoholische Exzesse eingeschlossen hätte. Er glaubte das alles unter Kontrolle zu haben. Für jede Sünde verordnete er sich die angemessene Strafe in seinem Fitnessraum. Mit dem Hemd in der Hand starrte er in sein Gesicht und nannte sich stumm einen eitlen, gedankenlosen Narren. Dann hob er den Deckel des Abfalleimers unter dem Waschbecken, stopfte das Hemd hinein und zog sein Jackett über. Er spürte einen leichten Schwindel und lehnte sich kurz gegen die Wand.
An der Theke fragte er nach einem Telefon, und der Wirt, ein schwerer älterer Mann mit der eingefrorenen Miene eines Menschen, der viel gesehen hat, langte beiläufig und ohne seine Beschäftigung des Bierzapfens zu unterbrechen, nach unten, holte einen abgenutzten beigen Festnetzapparat mit Tasten hervor und schob ihn Max wortlos hin.
Er nahm ihn und ging so weit weg von der Theke, wie es die Schnurlänge zuließ. Im selben Augenblick, als er den Hörer abnahm, drängte sich die junge Serviererin von hinten an ihm vorbei und er legte wieder auf. Was wäre, wenn jemand hier mitbekäme, wie er sagen würde: „Ich möchte einen … Unfall melden … Ein Toter … und eine verletzte Frau. Mein Name? Der tut nichts zur Sache …“ – und dann einfach auflegte?
Er bestellte einen weiteren Wodka und ging zurück an seinen Platz, setzte sich aber doch nicht, sondern wandte sich zur Tür, um draußen zu rauchen. Da fiel ihm ein, dass er sich dringend neue Zigaretten und Feuer besorgen musste, und er ging abermals zur Theke. Die Kellnerin lud gerade Gläser auf ein Tablett. Mit schrägem Blick und einer kleinen Ironie in der Stimme fragte sie ihn, ob er ein Problem habe und sie ihm irgendwie helfen könne.
„Ein Problem? Sehe ich etwa so aus?“, brachte er hervor.
„Ehrlich gesagt, ja“, konstatierte sie.
Er drückte ihr Geld in die Hand und bat sie, ihm eine Schachtel von seiner Marke und Streichhölzer zu bringen, ging vor die Tür, ließ sich von jemandem Feuer für seine vorletzte, halb zerdrückte Zigarette geben, rauchte in hastigen Zügen und sagte sich, dass er endlich aufhören müsse, sich so konfus zu verhalten. Er schnippte die Kippe zu Boden, zertrat sie mit dem Absatz, ging wieder hinein, setzte sich an seinen Tisch, trank in kleinen Schlucken sein Glas aus, und versuchte seine Gedanken zu ordnen.
Es war ja überhaupt nicht sicher, dass es tatsächlich sein Schlag gewesen war, der den Mann getötet hatte. Vielleicht war er nur unglücklich gestürzt. Außerdem hatte es sich doch wohl eindeutig um eine Art Notwehrsituation gehandelt, in der es darum gegangen war, eine Frau vor einem brutalen Angreifer zu beschützen – wenn das kein ehrenwertes Motiv war. Er sah das jetzt alles wieder deutlich vor sich, jedoch in einem völlig anderen Licht. Wurde nicht allenthalben beklagt, dass die Gewalt auf den Straßen im öffentlichen Raum immer mehr überhand nehme und zu wenig dagegen unternommen werde? Ständig hörte und las man doch von Schlägern, die wehrlose Passanten traktierten, ohne dass diesen jemand zur Hilfe kam. Nun, er hatte nicht feige weg geschaut, wie die meisten, sondern sich mutig eingemischt und sogar einiges riskiert und dafür Verletzungen eingesteckt. Objektiv gesehen hätte er sich ohne weiteres als Held fühlen können, als jemand mit Zivilcourage. Zivilcourage, ja, das war es, er hatte Zivilcourage bewiesen.
Subjektiv sah die Sache jedoch erheblich anders aus. Das, was er getan hatte, passte ganz einfach nicht zu ihm. Was hatte ein Mann, der in einer der teuersten Gegenden der Stadt mit einer reichen Frau in einer repräsentativen Jugendstilvilla wohnte und dessen komfortables Leben sich zwischen Bücherwänden, Vernissagen, Konzertbesuchen und Theaterpremieren abspielte, sich nachts für irgendwelche fremden Frauen in dunklen Straßen zu schlagen? Ein Mann, der sich nicht nur sehr viel auf seine Kultiviertheit zugute hielt, sondern auch keine Gelegenheit ausließ, seine pazifistischen Prinzipien und seine Abscheu vor jeder Art von Gewalt zu propagieren, sodass es auf andere bisweilen schon leicht übertrieben anmutete? Und nun war ausgerechnet dieser Mann in einen Vorfall verwickelt, bei dem sogar jemand gewaltsam zu Tode gekommen war. Niemand in seinen Kreisen würde das verstehen, und am wenigsten Hanna.
Er sah sich in endlose Dispute mit ihr verstrickt, in denen sie ihn immer wieder fassungslos fragen würde, wieso um alles in der Welt er sich dazu habe hinreißen lassen können, jemanden tot zu schlagen. Genau so würde sie es ausdrücken. Hanna war in vielerlei Hinsicht großzügig, aber in dieser Hinsicht würde sie keine Gnade kennen, und alle guten Gründe, die der Polizei und der Justiz einleuchten mochten, würden in Hannas Augen nichts zählen. Immer wieder hatte sie ihm mehr oder minder offen zu verstehen gegeben, dass sie seinen physischen Ambitionen misstraute. Sie argwöhnte, dass es uneingestandene, rohe Absichten gebe hinter seinen Bemühungen, sich fit zu halten, vor allem hinter seinen Schlagübungen am Boxsack. „Übertriebene Körperlichkeit“, wie sie es nannte, war ihr grundsätzlich suspekt. Besonders verwerflich aber schien in ihren Augen zu sein, dass er sich seinen zweifelhaften Übungen auch noch in der Einsamkeit eines eigenen, höchst privaten, mit entsprechenden Geräten ausgestatteten Raums im Souterrain hingab. Wenn er wenigstens noch ein öffentliches Fitnessstudio aufgesucht hätte, wäre Hanna womöglich bereit gewesen, die Dinge in einem etwas milderen Licht zu sehen. Aber in letzter Zeit hatte er sich gelegentlich gefragt, ob bei ihrer diesbezüglichen Aversion nicht noch mehr und anderes im Spiel war. Es war Wochen her, dass sie miteinander geschlafen hatten. Es lief, wie man so sagte, schon seit geraumer Zeit nicht mehr gut mit ihnen beiden.
Der Gedanke, sie jetzt anzurufen, war ihm gar nicht in den Sinn gekommen. Die Tage, da sie einander Rechenschaft darüber abgelegt hatten, was der andere jeweils beabsichtigte oder tat, lagen weit zurück. Er wusste auch gar nicht, ob Hanna überhaupt zu Hause war. Sie hatten nur am Morgen ein paar Worte miteinander gewechselt. Es war eine geradezu absurde Vorstellung, ihr jetzt mitzuteilen, er sitze momentan in einem Lokal beim Wodka und denke verzweifelt darüber nach, wie er halbwegs heil aus einer höchst bedenklichen Zwangslage heraus kommen könne, in die er sich selbst hineinmanövriert hatte – und das durch ein Verhalten, das alle Vorurteile Hannas zu bestätigen schien. Der Gedanke, dass dies das Ende ihrer Ehe bedeuten könnte, war absolut realistisch, zumal die möglichen Bruchstellen ihrer Beziehung bereits in ihrer fragilen Konstruktion angelegt zu sein schienen.
Viele hatten seinerzeit, vor gut vier Jahren, nicht verstehen können, wie das denn wohl zusammenpassen sollte: Hanna, die junge, umschwärmte, geschäftstüchtige Erbin eines der größten und erfolgreichsten Bauunternehmen Berlins, und er, ein mittelloser, fünfzehn Jahre älterer Intellektueller, der außer seiner Bildung und seinem allgemein als präsentabel angesehenen Äußeren nichts vorzuweisen hatte, höchstens, wie er manchmal selbstironisch anzumerken pflegte, ein ausgeprägtes Talent zur materiellen Erfolglosigkeit. Aus eher bescheidenen Verhältnissen stammend, hatte er sich nach dem Studium, das er mit einer Promotion in Germanistik abgeschlossen hatte, all die Jahre mehr schlecht als recht als Autor von Zeitungs- und Magazinbeiträgen durchgeschlagen, sich auch an einem Roman versucht, der immer noch ungedruckt in irgendeiner Schublade lag, und sich im Lauf der Zeit schon damit abgefunden, dass ihm sowohl der Ehrgeiz als auch die Gabe fehlten, es im Leben noch sonderlich weit zu bringen.
Und dann war er Hanna begegnet, bei einer Ausstellung, von der sie sich sichtlich gelangweilt gefühlt hatte. Sie war es gewesen, die ihn angesprochen hatte. Danach war dann alles sehr schnell gegangen, fast etwas zu klischeehaft nach dem alten Muster der wechselseitigen Anziehungskraft von Gegensätzen, die sich vor allem im Sexuellen zeigte. Nach wenigen Tagen waren sie im Bett gelandet. Einige Monate später folgte dann schon die Hochzeit. Sie genossen den Ruf eines ungewöhnlichen und gerade deswegen interessanten Paars, das seine Attraktivität aus dem Kontrast zwischen seinem etwas scheuen, zerknitterten, nicht mehr ganz frischen virilen Charme und ihrer auf eine sehr solide, beinahe altmodische Weise hübschen Jugendlichkeit gewann. Dabei hatte sie, bei all ihrer konventionellen Coolness im Geschäftlichen, auch etwas Spielerisches an sich. Nichts hätte dies eindrücklicher demonstrieren können als ihr spontaner – und von einigen, womöglich auch von ihr selbst, später als ein wenig übereilt betrachteter – Entschluss, anlässlich der Eheschließung ihren traditionsreichen Elternnamen, Gruber, abzulegen und sich stattdessen fortan Ziegler zu nennen so wie er.
Später, als der erste Rausch verflogen war, hatte er gelegentlich gedacht, dass sich in dieser formalen Geste auch eine subtile Bestätigung ausdrückte für den Status, den er an ihrer Seite innehatte. In ihrer besitzergreifenden Großzügigkeit hatte sie ihm dieses kleine Entgegenkommen gewährt, um ihm umso mehr den Platz einer Trophäe, eines Dekorums für ihr saturiertes Dasein zuweisen zu können. Denn als genau das begann er sich in der Folgezeit mehr und mehr zu fühlen, was ja auch insofern nur zu berechtigt schien, als sie es war, die ihn aushielt. Er lebte von ihrem Geld und ihrem Reichtum. Und währenddessen lebten sie sich immer mehr auseinander.
So gut wie nichts, was er tat und womit er seine Zeit verbrachte, war Hanna recht. In den letzten Tagen hatte es jedes der seltenen Male, wenn sie aufeinandergetroffen waren, Streit gegeben. Er war bereits schlechter Stimmung gewesen, als er sich früher am Abend mit einigen Bekannten getroffen hatte, die Hanna ebenfalls nicht mochte, was allerdings auf Gegenseitigkeit beruhte. Wieland, Niklaus und Kohnen, mit denen er regelmäßig ausging und sich jeden Donnerstagabend zum Essen traf, hatten ihm mehr als einmal ohne Umschweife zu verstehen gegeben, dass er ihrer Ansicht nach – Geld und Wohlstand hin oder her – die falsche Frau geheiratet hatte. Das Essen war diesmal in jeder Hinsicht ein Reinfall gewesen. Kohnen, der große, wilde, erstaunlich teure Bilder malte, hatte in letzter Minute abgesagt, weil es Probleme mit der Vorbereitung einer Ausstellung gab. Die Unterhaltung mit Wieland und Niklaus hatte sich als ähnlich zäh erwiesen wie der enttäuschende Lammbraten. Wieder einmal ging es um Niklas und dessen Unfähigkeit, einen angemessen bezahlten Job als Feuilletonredakteur zu finden, was angesichts seiner Qualitäten trotz der wirtschaftlichen Misere der meisten Zeitungen möglich gewesen wäre, sofern er sich nicht derart hartnäckig gegen die Hilfsangebote Wielands gesträubt hätte. Wieland war früher als Verlagsmanager tätig gewesen und verfügte immer noch über beste Beziehungen, nachdem er sich, motiviert durch eine enorme Abfindung, frühzeitig zur Ruhe gesetzt hatte. Doch gegen Niklas' verqueren Stolz kam er, wie so oft schon, nicht an. Max hatte sich gelangweilt und sich später, nachdem sie auseinandergegangen waren, regelrecht deprimiert gefühlt. Und dann war er einfach losgegangen, ohne Ziel.
Wieder hatte er das Bild der Frau vor Augen, dann das, was plötzlich passiert war, sein eigenes, übertrieben hartes Agieren. Womöglich war in ihm allerlei aufgestaut gewesen, eine gehörige Portion an Ärger und Frustration, die sich in seinen Schlägen entladen hatte. Er bestellte noch einen Wodka, um diesen fatalen Gedanken hinunter zu spülen. Noch nie seit seinen Schulhofzeiten war er bisher je auf die Idee gekommen, sich zu schlagen, und das auch noch mit einer gewissen Befriedigung. Er merkte jetzt, dass der Alkohol Wirkung zeigte und ihn larmoyant machte. Aber er war noch nüchtern genug, um sich wieder an das Feuerzeug zu erinnern, an dieses verdammte goldene Ding, das er als Schlagverstärker umklammert hatte und das ihn, was noch schlimmer war, verraten konnte, weil es ein Indiz war. Er musste es auf jeden Fall finden und an sich bringen, und zwar sofort. Wenn er sich beeilte, war es anschließend immer noch früh genug, um die Polizei zu informieren.
Er bezahlte, gab ein viel zu hohes Trinkgeld, ohne die junge Kellnerin eines weiteren Blicks zu würdigen, und machte sich auf den Weg. Die ersten Meter ging er, dann fiel er in einen leichten Trab, schließlich rannte er, wie aufgeputscht durch den Alkohol und bald schweißnass und schwer atmend. Schon bog er in die dunkle Schledestraße ein, durchmaß eine leichte Kurve und hatte dann, gut hundert Meter entfernt, den Ort vor sich, an dem es geschehen war – den Tatort. Als er ihn erreicht hatte, stellte er zweierlei fest: Der tote Mann lag immer noch dort, wo er gelegen hatte. Aber die Frau war verschwunden.
Im ersten Moment glaubte er an eine Sinnestäuschung und fragte sich, ob er womöglich, verwirrt infolge seiner Bewusstlosigkeit und dann noch des Alkohols, nicht mehr imstande sei, die Wirklichkeit richtig wahrzunehmen. Doch Sekunden später sah er die Szene wieder deutlich vor sich. Es gab keinen Zweifel. Die Frau hatte dort gelegen, und jetzt lag sie dort nicht mehr.
Er hastete zurück und winkte an der übernächsten Kreuzung nach einem Taxi, von dem er sich nach Hause bringen ließ, hinunter an den südlichen Stadtrand, wo sich alles Städtische zwischen Wäldern und Wasserflächen verlor. Er hätte nichts dagegen gehabt, wenn die Fahrt noch weiter gegangen wäre, irgendwo hin, nur möglichst weit weg.
3.
Er fand sich auf dem Sofa im kleineren der beiden Wohnräume im Erdgeschoss wieder, den sie als Salon bezeichneten, und fühlte sich miserabel. Die Vorhänge vor den großen Flügeltüren zur Terrasse waren zugezogen, aber nicht ganz geschlossen, sondern ließen einen ziemlich breiten Spalt frei, durch den sich eine Lichtbahn bis zum Sofa erstreckte und genau auf ihn mündete, der sich in voller Kleidung dort hin gestreckt hatte, nicht einmal die Schuhe hatte er mehr abgestreift. Es war nicht viel Scharfsinn notwendig, um zu dem Schluss zu gelangen, dass er einen wenig vorteilhaften Anblick bot.
Während er sich mit schwerem Schädel und schmerzendem Gesicht mühsam aufsetzte, dachte er, was Hanna wohl sagen würde, wenn sie ihn hier so anträfe. Der nächste Gedanke war keineswegs schöner, denn er besagte, dass sie ihn in diesem desolaten Zustand bereits vorgefunden haben musste und längst aus dem Haus war, denn dem Stand der Sonne nach musste es kurz nach Mittag sein. Halb zwei, schätzte er, und ein Blick auf die dunkle schmale Standuhr – ein Erbstück von Hannas Urgroßvater, das ihm angesichts seiner immer noch präzisen Zeitangaben wie ein wahres Wunderwerk vorkam – zeigte ihm, dass er sich nur um knappe fünf Minuten geirrt hatte.
Wo Agnes bloß stecken mochte? Ihr freier Nachmittag und Abend war mittwochs, wenn Hanna in der Firma ihren Jour fix mit ihren Leuten hatte und ohnehin spät nach Hause am, während er sich meist mit seinen Freunden zum Essen und Trinken traf. Er traf sich mit ihnen auch an anderen Tagen, wie beispielsweise gestern, am Donnerstag. Aber der Mittwoch war der Tag, an dem Hanna und er ganz dezidiert ihre eigenen Wege gingen und einander so gut wie nie sahen. Das war auch früher schon so gewesen, als sie noch besser mit einander ausgekommen waren. Da sie getrennte Zimmer mit jeweils eigenem Bad hatten, kam es aber auch an anderen Tagen vor, dass sie einander gar nicht oder nur kurz begegneten. Wenn Hanna, die ihr Frühstück ohnehin allein einnahm, aus dem Haus ging, schlief er meistens noch.
Er spürte jenen hässlichen Geschmack im Mund, der zurück blieb, wenn er am Abend zuvor verschiedene Spirituosen durcheinander getrunken hatte, und fragte sich erneut, weshalb sich Agnes nicht um ihn kümmerte. Er brauchte dringend etwas zu essen, denn immerhin fühlte er sich nicht verkatert, nachdem er mehr als zehn Stunden geschlafen hatte.