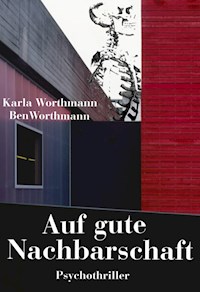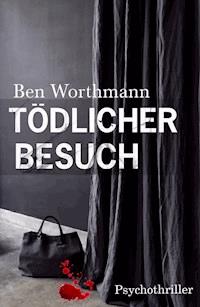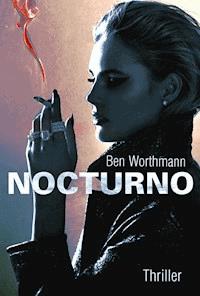Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Familientrilogie
- Sprache: Deutsch
*******Die etwas andere Geschichte der deutschen Einheit****** Nach Mauerfall und Wende ist nichts mehr so, wie es war. Auch bei den Worthmanns geht es wieder mal ziemlich turbulent zu. Mitte der Neunzigerjahre haben sie mit allerlei Komplikationen zu kämpfen - beruflichen und familiären, banalen und brisanten, hochpolitischen und sehr alltäglichen. Darüber berichtet das Familienoberhaupt gewohnt pointiert und selbstironisch und ohne Scheu vor teils verwegenen Gedankensprüngen. So entstand eine ungewöhnliche Mischung aus sehr menschlicher Komödie und Zeitgeschichte. Dieser jetzt erstmals erschienene heitere Familienroman ist der mittlere Teil einer Trilogie, bestehend ferner aus "Etwas ist immer" und "Leben für Fortgeschrittene". Ferner vom Autor im Handel: Die Psycho-Thriller "Die Frau am Tor", "Nocturno", "Das Grab der Lüge", "Tödlicher Besuch", "Auf gute Nachbarschaft" und "In einer Nacht am Straßenrand".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ben Worthmann
Meine Frau, der Osten und ich
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Impressum neobooks
1.
Es war eine Sommernacht, wie man sie sich nur wünschen kann, mondhell und durchsichtig, die Luft noch leicht und mild von der Sonne des Tags. Aber Annas Laune war alles andere als gut und meine, ehrlich gesagt, auch nicht - so schön hätte eine Sommernacht gar nicht sein können, um daran groß etwas zu ändern.
Wir standen im Stau auf der Autobahn Richtung Berlin, ob immer noch im Süden von Mecklenburg-Vorpommern oder bereits im Norden von Brandenburg, hätte sich wahrscheinlich feststellen lassen. Aber ob das eine Rolle spielte, war nicht so sicher. Einerseits war es gut war um jeden Meter, den wir zwischen uns und jenen Ort brachten, in dem wir etwas Ruhe und Entspannung zu finden gehofft hatten, was sich als Illusion erwiesen hatte. Andererseits gab es keinen Grund, dem bevorstehenden Wiedereintritt in die Bahnen des Alltags mit jener Erleichterung entgegenzusehen, die sich normaler Weise bei Menschen einstellt, die einen missglückten Urlaub endlich hinter sich gebracht haben.
Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl bei dieser Sache gehabt. Manchmal denke ich, dass es ein Fehler ist, seinen Intuitionen nicht stärker zu vertrauen, auch als Mann. Inzwischen sah es nämlich so aus, als hätten sich zu meinen Ahnungen die passenden Tatsachen hinzugesellt, und gerade das ist es ja, was Ahnungen so unangenehm machen kann: dass sie sich bisweilen bewahrheiten. Ich hatte Anlass, mich um meinen Job zu sorgen, sofern ich nicht irgend etwas missverstanden hatte. Aber so wie es geklungen hatte, war daran eigentlich nichts Missverständliches gewesen. Es war ein regelrechter Alarmruf gewesen. Ich musste schnellstens zurück nach Berlin, das stand außer Zweifel. Doch mittlerweile kam es mir so vor, als versuchten finstere Mächte mich daran zu hindern. Wenn mir vor kurzem jemand erzählt hätte, man könne einen ganzen Abend und die halbe Nacht damit zubringen, diese Strecke von weniger als dreihundert Kilometern zurückzulegen, wäre es mir bestimmt schwergefallen, ihn nicht für etwas verschroben zu halten. Und dieser Stau war genau das, was uns noch gefehlt hatte.
Ich suchte meine Notreserven an Nervenkraft zusammen und bemühte mich, Anna zu beruhigen, indem ich unsere Situation - sowohl die aktuelle als auch die mittelfristige -, ein bisschen herunterspielte. Im Grunde sei doch alles nicht so schlimm, sagte ich zu ihr, womöglich werde sich manches im Licht des nächsten Tags schon ganz anders darstellen. Und dass wir nun hier ein Stündchen auf der Autobahn parken müssten, sei zwar ärgerlich, aber nun einmal nicht zu ändern.
„Wie deine Mutter“, sagte Anna, „du bist genau wie deine Mutter, und je älter du wirst, um so größer wird die Ähnlichkeit“.
Was sie mit dem Vergleich „wie deine Mutter“ zum Ausdruck bringen wollte, war mir durchaus klar. Anna ist der Ansicht, dass mir viele Dinge zu wenig nahegehen. Sie empfindet es als einen Akt der Illoyalität ihr gegenüber, wenn ich mich nicht genügend aufrege, wenn sie selbst etwas als bedrohlich oder zumindest beunruhigend empfindet – wie beispielsweise nächtliche Verkehrsbehinderungen auf einer Autobahn infolge eines Unfalls, bei dem es wahrscheinlich nicht nur Blechschäden gegeben hat. Sie moniert meine Mentalität als Stoizismus, und alle meine Versuche, sie über das eigentliche Wesen dieser altgriechischen Denkschule aufzuklären, sind über die Jahre fruchtlos geblieben. Die Stoiker verfügten über die Kunst der Gelassenheit, Ataraxia, was etwas völlig anderes ist als das, was Anna in meiner Mutter verkörpert sieht. Im Grunde waren die Stoiker eine Art Buddhisten, nur dass die Buddhisten heute jeder kennt. Buddhismus liegt im Trend, und ich gebe gern zu, dass ich ihm durchaus einiges abgewinnen kann.
Manchmal träume ich davon, so weit zu sein, dass ich mit seiner Hilfe gewisser Situationen Herr werden kann, etwas solcher, in denen Anna auf dem Mütter-Thema herumreitet. Aber diesen Traum werde ich wohl noch lange träumen, so wie es aussieht. Interessanter Weise nützt es mir übrigens gar nichts, wenn ich - was selten geschieht - auch einmal etwas die Contenance verliere und mich weder stoisch noch buddhistisch gebe. Dann heißt es von Annas Seite sofort: „Wieso kannst denn nicht wenigstens du einmal die Ruhe bewahren? Nun nimm dich doch ein bisschen zusammen! Es reicht doch wohl, wenn ich mich aufrege“. Allzu häufig passiert es zum Glück nicht, dass ich mich so gehen. lasse, im Allgemeinen gelingt es mir relativ leicht, das Mutter-Thema einfach von der Tagesordnung abzusetzen. Doch dies war nicht mein Tag, die Nacht mit eingeschlossen, ich war alles in allem nicht weniger fertig als Anna. Es kam, wie es nicht hätte kommen dürfen - ich zahlte es ihr mit gleicher Münze heim.
„Guck dir doch dich und deine Mutter an, dann weisst du, wo die wirklichen Probleme liegen“ , entgegnete ich.
Annas Mutter ist auf übertriebene Weise ängstlich - übertrieben nicht nur nach den Maßstäben eines Schwiegersohns, dem angeblich der Makel übertriebener Unempfindlichkeit anhaftet. Annas Mutter macht sich schlichtweg mit allem verrückt, und Anna hat auch diese Neigung. Ich möchte nicht wissen, wie oft sie im Lauf unseres Lebens schon die Frage an mich gerichtet hat: „Meinst du, dass das gefährlich ist?“ Wobei es sich ebenso um einen Mückenstich wie um die Aids-Epidemie in Afrika oder ein Erdbeben in Guatemala oder auch um eine Glatteis-Warnung in Oberbayern handeln kann.
Außerdem hat Anna einen leichten Hang zur Klaustrophobie, der sich unter anderem daran zeigt, dass sie weder in Flugzeuge noch in Fahrstühle steigt. Allerdings steigt sie in Autos, obwohl sie wissen müsste, dass Autofahren gelegentlich mit Stau-Erfahrung verbunden ist - eine Situation, die auf Annas Gefährlichkeitsskala ebenfalls einen recht prominenten Rang einnimmt. Ihr diesbezügliches Verhalten ist, wie man ahnt, nicht frei von Widersprüchen. Wenn ich zu Anna sage „wie deine Mutter“, geschieht das üblicherweise in Notwehrsituationen, und ich habe dann meistens kein schlechtes Gewissen. In jener Nacht jedoch bereute ich es sofort, als ich sah, wie sie noch blasser wurde und sich in ihren Sitz kauerte, als wolle sie eins mit der Rückenlehne werden.
„Okay“, sagte ich, „vergiss es, es tut mir leid, wirklich. Lass uns jetzt bloß. nicht auch noch streiten.“
Aber ich wusste nicht, ob dieses Friedenssignal gebührend gewürdigt wurde. Das war ja auch alles ein bisschen viel gewesen in letzter Zeit. Man muss kein Defätist sein, um gelegentlich depressive Anwandlungen zu bekommen, wenn man so sieht, was innerhalb von ein paar Stunden passieren kann. Plötzlich kommt einem das Leben wie ein schnellwucherndes, bösartiges Unkraut vor, das nichts anderes im Sinn hat, als einem über den Kopf zu wachsen. Es gibt diese komprimierte Variante des Ketchup-Flaschen-Prinzips, jenes zweifelhaften Paradigmas, welches das menschliche Dasein nachhaltiger prägt als die meisten großen ideengeschichtlichen Entwürfe - erst kommt lange nichts und dann alles auf einmal. Doch es ist längst nicht immer von Segen, was da kommt, und wenn das Leben gerade einen schlechten Tag hat, kippt es einem die ganze Flasche über den Kopf, bevor man die kleinste Chance hat, in Deckung zu gehen. Wir standen im Stau auf der Autobahn in Ostdeutschland, und das
war, wie gesagt, genau jenes Quentchen zu viel. Ein Stau auf der Autobahn reicht unter normalen Bedingungen schon aus, um Anna stark zu beunruhigen, doch so wie die Dinge lagen, konnte man kaum von normalen Bedingungen sprechen.
Anna sagte, sie halte das nicht länger aus, sie wolle jetzt nach Hause, und zwar sofort, außerdem sei dieser Ölgeruch kaum zu ertragen. Ich sagte ihr, erstens sei die Sache mit dem Öl halb so schlimm, das wisse sie doch inzwischen, zweitens sei daran jetzt nichts zu ändern und drittens müsse sie sich noch etwas gedulden mit der Weiterfahrt. So wie sie da neben mir saß in dem kurzen weißen Kleid, das ihr, ohne dass sie es zu bemerken schien, bis über die halben Schenkel hochgerutscht war, mit ihrer blonden Mähne, in der trotz der nächtlichen Dunkelheit immer noch die Sonnenbrille steckte, sah sie aus wie die Sünde, trotz dieses Gesichtsausdrucks, der alles andere als sexy war oder vielleicht auch doch, trotz allem. Frauen sind das größte Rätsel der Natur. Je länger man sie kennt, desto so weniger weiß man über sie, auch wenn es sich um Frauen
in einem seit Jahren höchst vertrauten Singular handelt.
„Manchmal bist du ein richtiger Blödmann“, sagte Anna, allerdings ohne besondere Schärfe. Das klang angesichts der Verhältnisse schon fast wie eine Liebeserklärung. Man glaubt nicht, wie beruhigend ein Schimpfwort aus dem Mund einer Beziehungsperson klingen kann. Julius erklärte vom Rücksitz aus, keine Sekunde länger werde er sich dies hier anhören. Was er nur verbrochen habe, mit solchen Eltern geschlagen zu sein, er werde jetzt aussteigen und sich die Füße vertreten, um seine Ruhe vor uns zu haben. Er war knapp dreizehn, in jenem Alter also, da Kinder oft entdecken, dass sie schwer erziehbare Eltern haben.
„Untersteh dich!“, fuhr seine Mutter ihn an und ihre Stimme hatte genau den Unterton, der mich an ihre Mutter erinnerte, was ich aber wohlweislich für mich behielt. Dieses Mütter-Thema ist ein Kapitel für sich - wenn man mich fragt, so ungefähr das dunkelste in der Geschichte der menschlichen Zweierbeziehung. Es markiert den Kulminationspunkt in der Kunst des Ehestreits, aber ob es sich dabei tatsächlich um einen Höhepunkt oder nicht eher um den Tiefpunkt handelt, das ist noch die Frage. Jedenfalls kann einen so leicht nichts mehr erschüttern, wenn man ihn erst erreicht hat.
Dabei ist - um kein falsches Bild entstehen zu lassen - eine leibhaftige Schwiegermutter gar nicht das Problem. Kommt beispielsweise Annas Mutter zu Besuch, macht mir das wenig aus, sofern sie nicht länger als zehn Tage bleibt. Ich habe mir sogar angewöhnt, sie mit Küsschen und Umarmung zu begrüßen und zu verabschieden, und zwischendurch bin ich hin und wieder regelrecht freundlich zu ihr.
Mit meiner Mutter, Annas Schwiegermutter, verhält es sich umgekehrt ähnlich. Man sollte Anna nur sehen, wenn sie zu Besuch da ist - Anna ist dann die Herzlichkeit in Person. Kein Mensch würde beim Anblick von mir oder von Anna in Gesellschaft der jeweiligen Schwiegermutter auf den Gedanken kommen, dass man es hier gewissermaßen mit wandelnden Zeitbomben zu tun hat, metaphorisch gesehen, die im Zweifelsfall fähig sind, das Rosenbett der ehelichen Harmonie schlagartig in ein Schlachtfeld zu verwandeln. Wie gefährlich Schwiegermütter sein können, zeigt sich nämlich erst, wenn sie in sicherer Feme weilen - also grob geschätzt die meiste Zeit des Jahres. In ihrer Abwesenheit mutieren sie zur leibhaftigen Provokation, um nicht zu sagen, zu potenziellen Kriegsgründen.
Bei uns, bei Anna und bei mir, ist es in derartigen Konfliktsituationen so, dass der ursprüngliche Anlass sofort in den Hintergrund tritt, sobald die Mütter in Gefechtsstellung gebracht werden. Ein falsches Wort genügt - und schon nehmen die Dinge ihren Lauf. Der ursprüngliche Auslöser eines solchen Mütter-Gemetzels ist meistens so unbedeutend, dass kam ein vernünftiger Mensch auf die Idee käme, zwei leidlich gebildete, gesunde, an einander gewöhnte Bewohner der hochzivilisierten Regionen dieses Planeten könnten in der Lage sein, sich deswegen mehr als zwei oder vielleicht auch drei unfreundliche Worte an den Kopf zu werfen.
Mir fiel in diesem Zusammenhang manchmal Günter Schabowski ein, der vor ein paar Jahren mit einer einzigen Bemerkung die gesamte DDR exekutiert hatte. Ein falsches Wort zur rechten Zeit oder auch umgekehrt - und schon hatte man das größte Durcheinander. So wie im Sinne der Chaos-Theorie der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Taifun auslösen kann, vermag eine im Grunde unbedeutende Verhaltensweise meinerseits in Anna den Mütter-Orkan mit einer Macht zu entfesseln, die mich von einer Sekunde zur nächsten in Schwindel stürzt und mir jeden Glauben an den Sinn der menschlichen Existenz raubt.
Ich kann zum Beispiel aus Versehen gegen einen Putzeimer treten, den Anna vor Stunden mitten im Wohnzimmer stehengelassen hat, weil ihr zwischendurch eingefallen ist, dass sie noch irgendetwas anderes zu erledigen hat. Schon heißt es: „Wie deine Mutter, tolpatschig, stößt gegen alles, stolpert.“
Oder ich habe ausnahmsweise einmal vergessen, mich einer eher unangenehmen Pflicht wie der Abgabe der Steuererklärung fristgerecht zu unterziehen. Was muss mich mir anhören? „Wie deine Mutter - für das normale Leben nicht geeignet, immer alles beiseite schieben und die Augen zumachen und denken, es wird sich schon von selbst erledigen.“ Dabei hat Anna, ich schwöre es, noch nie in ihrem Leben eine Steuererklärung ausgefüllt, so wenig wie meine Mutter. Beide wüssten gar nicht, wie man so etwas macht.
Oder Anna findet, ich würde mich nicht energisch und häufig genug nach den Lernfortschritten unserer Söhne erkundigen. „Wie deine Mutter - die hat sich auch nie dafür interessiert, was du als sogenannter Student die ganze Zeit getrieben hast.“ Dabei kannte mich Anna damals, als ich Student war, noch gar nicht.
Am tollsten ist es, wenn sie mir vorwirft, ich würde den Geburtstag meiner Mutter vergessen. Zwar kann sie das schlecht mit dem Zusatz vergiften „wie deine Mutter“, aber es geht exakt in dieselbe Richtung. Zuweilen frage ich mich, wie es wohl wäre, wenn ich schon Wochen vor dem Geburtstag meiner Mutter anzufangen versuchte, mit Anna darüber zu beraten, was ich wohl diesmal meiner Mutter zum Geburtstag schenken solle. Vorstellen möchte ich es mir lieber nicht. Ein Ehemann, der seine Mutter verehrt, macht in jedem Fall etwas falsch. Einer, der sich nicht übermäßig viel Gedanken um seine Mutter macht, aber auch. Ein Ehemann, der seiner Schwiegermutter etwas reserviert gegenübersteht, hat ohnehin ein Problem. Und einer, der zu beide Schwiegermütter zum Teufel wünscht, kommt selbst in Teufels Küche. Seine Chancen, in dieser Angelegenheit überhaupt etwas richtig zu machen oder wenigstens halbwegs ungeschoren davonzukommen, sind beschämend gering.
„Für das, was wir an Streitereien dieser Art im Laufe der Jahre absolviert haben, hätten andere sich vermutlich schon mindestens ein dutzendmal scheiden lassen“, sagte ich einmal in einem lichten Moment zu Anna. Sie nickte nur und schaute mich dabei sehr freundlich an. Anna ist, wie bereits angedeutet, eine schöne, immer noch mädchenhafte Frau - auch nachdem sie drei Söhne zur Welt gebracht hat und über vierzig ist, ist sie das noch. Manchmal, wenn ich sie ansehe, werde ich noch genauso nervös wie vor zwanzig Jahren. Allein für so etwas muss man dankbar sein, das weiß ich zu schätzen, auch wenn mich bei ihrem Anblick gelegentlich die Mordlust packt. Um uns herum zerfielen die Ehen und sogenannten Langzeit- Beziehungen wie Papyrus unter den Fingern eines inkompetenten Archäologen. Das Verrückte ist, dass es mit den Jahren immer leichter zu werden scheint, einen sinnlosen Krieg vom Zaun zu brechen, obschon man eigentlich vermuten sollte, dass Eheleute im Lauf der Zeit ein wenig resistenter dagegen werden, dass sie allmählich die Kraft und die Lust daran verlieren, sich wegen Marginalien in die Haare zu geraten, aber weit gefehlt.
Ich habe mir auch nach dem Zusammenbruchs jenes utopischen Gedankengebäudes, in dem bis zum Jahr 1989 Gleichheit, Freiheit
und Brüderlichkeit und noch ein paar andere sympathische antikapitalistische Gespenster hausten, einen Rest von Glauben an die Lernfähigkeit des Menschen bewahrt. Offenbar bin ich ein bisschen naiv. Man darf wohl von der Lernfähigkeit nicht allzu viel erwarten, zumindest nicht, soweit sie sich auf die Friedensfähigkeit von Kleinstgruppen im Zweierformat bezieht. Je kleiner die Zahl der in Frage kommenden Menschen ist, desto kleiner wird womöglich die Lernfähigkeit - ganz im Gegensatz zu der verbreiteten These, dass es die Masse ist, die sich durch Dummheit auszeichnet. Zwei wissen kaum mehr als einer, und das ist so gut wie nichts. Das ist meine Erfahrung; und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie nicht allein gemacht habe.
Ganze Gesellschaften zu pädagogisieren ist ein Kinderspiel verglichen mit der Aufgabe, zwei Eheleute zu einem einigermaßen rationalen, kräftesparenden, konfliktvermeidenden Verhalten zu bringen, nicht einmal das Leben selbst schafft das. Paare in festen, langandauernden Beziehungen - und nur für sie kann ich sprechen - sind praktisch lernunfähig, und ihre Lernunfähigkeit steigt mit zunehmender Beziehungsdauer. Sie machen nicht nur immer wieder dieselben Fehler, sondern wenden einen Gutteil ihrer Zeit dafür auf, ständig neue Fehlermöglichkeiten zu ersinnen.
Vielleicht steckt dahinter eine Art von Masochismus, oder auch das Gegenteil davon, irgendeine eine besonders subtile Form von Hedonismus, was womöglich ein und dasselbe ist. Vielleicht sind die beiden Konfliktparteien einfach nur wild auf den Genuss, den es bereitet, jene Variante von Waffenstillstand auszuhandeln, die sie in ihrer Blauäugigkeit für Frieden halten. Vielleicht ist gerade dies das Elixier, das ihre Zweisamkeit am Leben erhält. Vielleicht kann eine Beziehung überhaupt nur dann sehr lange dauern, wenn die beiden Beteiligten sich ständig bemühen, Möglichkeiten für ihre Zerstörung zu erproben, nur um sich dann immer wieder zu dem Versuch durchzuringen, die Scherben anschließend so säuberlich zusammenzukitten, dass das Ganze wie neu aussieht. Auch Knochen, die einmal gebrochen und wieder zusammengewachsen sind, weisen ja angeblich in dieser Stelle eine erhöhte Festigkeit aus.
2.
Grillen zirpten, es roch nach frisch geschnittenen Wiesen - oder besser: Autobahn-Randstreifen - und der fast volle Mond schien dick und gelb durch das geöffnete Schiebedach unseres Volvo. Ich hatte von meiner väterlichen Amtsgewalt Gebrauch gemacht und Julius zu verstehen gegeben, dass es tatsächlich besser sei, nicht auszusteigen, seine Mutter habe in diesem Punkt völlig Recht, sagte ich. Die Lage entspannte sich daraufhin ein wenig. Ich schaltete das Radio an, und wie bestellt spielten sie gerade „Eternal Flame“ von den Bangles, ein Stück, bei dem ich wahrscheinlich immer zum Taschentuch greifen werde, auch mit siebenundachtzig noch, selbst wenn man mich einer bedenklichen Anfälligkeit für Kitsch zeihen wird.
Wir sahen durch unsere Autoscheiben Menschen hin und her huschen, aus einer Perspektive ähnlich jener der Fische im Aquarium. Man weiß nicht viel über die Gedankenwelt der Fische, aber was mich betraf, so fand ich die Darbietungen da draußen nicht übermäßig faszinierend. Die Menschen bewegten sich mit unbestimmter Geschäftigkeit, ohne erkennbares Ziel, sie liefen oder standen dort einfach so herum. Viel ist es nicht, was Menschen so einfällt, um Zeit totzuschlagen, wenn es auf der Autobahn nicht weitergeht oder überhaupt im Leben. Fast hätte mich der Anblick nervös gemacht. Herdentriebhaft gesteuerte motorische Unruhe, hätte man da sagen können. Oder irregeleiteter Erlebnishunger in einer Phase zwangsweise erzeugter Immobilität der Mobilgesellschaft.
Mir fallen zuweilen solche Sätze zur Erklärung eher banaler Situationen ein. Meistens verkneife ich es mir, sie auszusprechen, vor allem in Gegenwart von Anna. Sie hat ein Gespür dafür, wenn ich ins Theoretisieren zu geraten drohe, und sie zögert nicht, mir das zu sagen.
„Nun bleib mal ganz ruhig“, sagt sie dann. „Es ist nicht alles leitartikelfähig, was einem im Leben so widerfährt.“
Damit spielt sie auf meinen Beruf an, Journalist, und gewiss ist dies eine weise Einsicht. Wenn jemand von uns beiden den Boden etwas härter unter den Füßen hat, dann bin ich derjenige vermutlich nicht - trotz ihrer ganzen Ängstlichkeit ist Anna die handfestere, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Jetzt, angesichts dieser Szenen einer diffusen Umtriebigkeit größerer Scharen unserer Artgenossen, schwiegen wir beide, es war wohl vor allem wegen der Musik. Bei mir kam noch hinzu, dass ich gerade jetzt wieder an diesen Anruf denken musste, dessentwegen wir Hals über Kopf aufgebrochen waren mit dem vorläufigen Resultat, dass wir jetzt hier standen. Aber mich deprimierte auch der Anblick dieser Leute da vor unserem Ausguck. Anna meint ohnehin, ich sei ein wenig misanthropisch veranlagt, und nicht immer bin ich sicher, dass sie völlig falsch liegt. Tatsache ist, dass ich mich irgendwie im Gemütsbereich beschwert fühle, wenn ich größere Ansammlungen von Menschen sehe, die so aussehen, als gehörten sie eigentlich in die Fußgängerzone einer mittelgroßen deutschen Kleinstadt, egal ob die im Westen oder Osten gelegen ist.
Das hier waren Deutsche, so viel war klar. Es waren ältere Männer dabei mit Bäuchen, die über den Gürtel großzügig geschnittener Jeans ragten oder in beigefarbene Autofahrerhosen mit verstellbarem Bund gezwängt waren, auch jüngere Männer in bunten Sporthemden oder weißen T-Shirts und engen Jeans waren zu beobachten; und es waren füllige Frauen in Kleidern und Strickwesten zu sehen, die zu solchen Männern passten. Es gab auch einige junge schlanke Frauen in kurzen Röcken und knappen Tops, die den Nabel freiließen, was nicht immer so gut aussieht, wie es sich die entsprechende Person vorstellt, manchmal aber ausnahmsweise
doch. Man guckt als Mann ganz von selbst hin, ohne sich darüber klar zu sein, weshalb. Es ist dieser genetisch bedingte Jagdtrieb, niemand sollte sich hierüber Illusionen machen, gleichgültig, ob er lange verheiratet ist oder kurz oder gar nicht. Und mit Ästhetik hat das auch vergleichsweise wenig zu tun.
Ein paar Kinder sprangen dort auch herum, und ihre Mutter, die ein hautenges gelbes Stretchkleid trug, hatte eine entfernte Ähnlichkeit mit Patricia Arquette. Sie rief etwas, das wenig mütterlich klang, während ihr Mann - geblümtes Hemd, Bermuda-Shorts, leichter Bauchansatz - einen Sixpack aus dem Kofferraum seines Opel-Vectra hervorholte, sich auf die Leitplanke hockte, die erste Flasche köpfte und sich eine neue Zigarette anzündete, gerade nachdem er eine ausgetreten hatte. Es war kein schönes Bild.
Womöglich war der Gatte von Patricia Arquette noch vor ein paar Jahren bei der Nationalen Volksarmee gewesen. Vielleicht hatte er sogar irgendwo an der Grenze gestanden und auf Flüchtlinge gezielt. Oder er hatte als Stasi-Spitzel harmlose christliche Hausfrauen überwacht, die ihren Seitensprung dem Pfarrer beichteten - falls er nicht ostdeutsche Untergrundschriftsteller überwacht hatte, von denen es nach groben Schätzungen mindestens eine halbe Million gegeben haben musste. Vielleicht tat ich ihm auch Unrecht und er war ein ganz gewöhnlicher Heizungsmonteur, der sich unter Honecker genau so wenig für Politik interessiert hatte wie er es jetzt unter Kohl tat und der wie die meisten ostdeutschen Handwerker versucht hatte, die Mangelwirtschaft mit dem Minimum an Werkzeug auszutricksen, das einem im Arbeiter- und Bauernstaat zur Verfügung stand, mit Hammer und Sichel gewissermaßen,
obschon das eigentlich mehr zur Sowjetunion passte. Ich hoffte zu seinen Gunsten, dass er nie im Leben gebrüllt hatte „Wir sind das Volk“, aber ich bezweifelte, dass diese Hoffnung realistisch war.
Er hatte, wenn man es objektiv zu sehen versuchte, aber auch etwas neuerdings Gesamtdeutsches an sich - etwas von diesen Leuten, die einem ebenso im Supermarkt in Berlin-Steglitz wie in einer Videothek in Berlin-Lichtenberg begegnen können und bei deren Anblick man nie genau weiß, ob sie ein rotes oder braunes Parteibuch besitzen und ob sie in ihrem Wohnzimmer einen Kampfhund halten oder einen kastrierten Wellensittich. Klar war, dass er irgendwo und irgendwann mit seiner Frau diese Kinder gezeugt haben musste, und bei diesem Gedanken tat seine Frau mir ein bisschen leid. Als ich sie mir dann etwas genauer ansehen konnte, weil sie ein paar Schritte näher kam, erschien mir die Ähnlichkeit mit Patricia Arquette erheblich geringer, als ich zunächst vermutet hatte. Sie sah sogar ziemlich alltäglich aus, wahrscheinlich hatte sie es gar nicht besser verdient.
Manchmal hasse mich, wenn ich derartige Gedanken habe. Aber was soll man tun? Das Höchste, das der Menschen hat, ist sein Gehirn, aber zugleich ist es auch das Gemeinste.
Später, beim Anfahren, als das Licht der Scheinwerfer voll auf das Nummernschild fiel, musste ich dann noch feststellen, dass es sich nicht um einen Opel-Vectra aus Magdeburg handelte, wie ich anfänglich gedacht hatte, sondern um einen aus Mannheim.
Aber noch war es nicht so weit mit dem Weiterfahren, noch leuchtete vor uns in einiger Entfernung, genau in der sanften Kurve, wo auch die Blaulichter blinkten, etwas, das wie eine Lichtreklame von McDonald's aussah. Die Vorstellung, jetzt einen Hamburger zu essen, hatte ihren Reiz, bei allem Respekt vor den Geboten einer vernünftigen Ernährung, die ich im Allgemeinen beherzige, schon aus Eitelkeit, wegen der Figur. Man kann nicht immer nur vernünftig sein, und als Ehemann ist man es sowieso nicht. Leider hatte der Gedanke an den Hamburger den Nachteil, dass er gegenwärtig nicht zu verwirklichen war, jedenfalls nicht ohne den mehr oder minder kalten Ehefrieden auf leichtfertige Weise zu gefährden. Aussteigen und einfach die paar hundert Meter gehen, das wäre an sich eine vernünftige Überlegung gewesen, denn so wie das hier aussah, würde es noch eine Weile dauern. Doch Anna hatte entschieden, dass Aussteigen gefährlich sei, und ich war weit entfernt davon, diese Entscheidung jetzt wieder in Frage zu stellen.
Außerdem wäre es doch noch ein ganzes Stück bis zu dem Hamburger gewesen, wenn ich es genauer bedachte. Ich tröstete mich mit dem Befund, dass immerhin der Aufbau Ost schon weiter gediehen war, als es manche Skeptiker bisher hatten wahrhaben wollen, wobei ich mich selbst gar nicht ausnahm. Wo sich die blühenden Landschaften des Kanzlers Kohl tatsächlich befanden, wusste niemand, er selbst vermutlich auch nicht, aber immerhin, McDonald's hatte die ersten Autobahnraststätten erobert. Das war doch irgendwie ein Symbol der Hoffnung. Andererseits war genau an dieser Stelle der Unfall passiert, dessentwegen wir hier festsaßen. An Hamburger dachte da vom im Moment bestimmt niemand. Vielleicht waren Menschen zu Tode gekommen, mit dem McDonald's-Emblem als letztem Bild von dieser Welt vor Augen. Gerade zerschredderte ein Hubschrauber die Stille der Sommernacht.
„Emm-Zee-Doonalt“ - dieses seltsame Klanggebilde war in meiner Erinnerung abgespeichert, seit wir uns vor ein paar Jahren, kurz nach jener historischen Novembernacht, erstmals wieder auf die Schlossstraße in Steglitz gewagt hatten, eine der Haupteinkaufsstraßen von Berlin. McDonald's war offenbar das Erste gewesen, das auf den beigetretenen Lebensplänen stand, die plötzlich tausend- und millionenfach umgeworfen und neugeschrieben wurden.
Wir Einheimischen mussten uns den Weg durch Menschenmassen bahnen. Unsere Söhne behaupteten, man könne die Ossis an ihren Jeansanzügen und an den Turnschuhen erkennen, die zu wenig Streifen hätten, außerdem am Teint - zu wenig Vitamine, keine Solarien. Anna und ich, wir fanden das ein bisschen borniert. Aber dass die neuen Mitbürger irgendwie anders aussahen, entging auch uns nicht, genauso wenig wie dieser kollektive Trieb, Hamburger zu essen. McDonald's, das war für sie ein Inbegriff des neuen Lebens, der gastronomische Siegespreis für die sogenannte friedliche Revolution. Dass plattgehauene Buletten zwischen den Hälften einer Schrippe mit Ketchup und Salatblatt solch eine Bedeutung erlangen konnten - eigentlich war das auch ein bisschen traurig.
Unser jüngster Sohn schreckte mich aus meinen Gedanken auf. „Ein paar hundert Meter weiter, und wir könnten jetzt was Anständiges essen“, ließ sich Julius von der Rückbank vernehmen. Er hegte also ähnliche Überlegungen wie die Ostberliner damals - und ähnliche, wie sie mir vor ein paar Augenblicken durch den Kopf gegangen waren. Julius wollte zum Ausdruck bringen, für welch eine unglückliche Fügung er es hielt, dass wir uns zu dem Zeitpunkt, da der Unfall geschehen war, nicht weiter südlich, also näher an der McDonald's-Raststätte, befunden hatten.
Bevor Anna Julius zurechtweisen konnte, sagte ich: „Wir sollten froh sein, dass wir nicht näher daran waren. Ein paar Sekunden später oder ein paar Meter weiter - und es hätte sein können, dass wir auch dort hineingeraten wären. Also bitte, lass es gut sein, ja?“
Anna gönnte mir einen zustimmenden Blick von der Seite. Ich hatte kaum zu Ende gesprochen, als ein dunkler Kombi auf der gesperrten Gegenspur auftauchte, dort, wo vorhin die Rettungswagen entlang gerollt waren. Der Mann von Patricia Arquette, der gerade seine nächste Flasche geöffnet hatte, sagte etwas, und einige seiner Worte purzelten durch das offene Dach und die heruntergekurbelten Fenster zu uns herein, darunter eine Vokabel, die Anna noch ein Stück tiefer in ihren Sitz sacken ließ - Leichenwagen. Kurz danach kam der nächste anthrazitfarbene Wagen vorbei.
„Verdammt“, sagteAnna mit erstickter Stimme, „ich will hier weg!“
Ich sagte ihr, wenn sie bereits dabei seien, die Leichname wegzuschaffen, sei abzusehen, dass die Autobahn bald wieder frei werde. Ein nächtlicher Stau mit Leichentransporten - das war für Anna zu viel, das war mir durchaus klar. Ich fragte sie, ob sie noch eine rauchen wollte, und natürlich wollte sie, und ich bewunderte sie fast dafür, dass sie die endlosen Sekunden abwartete, bis ich sie angezündet hatte und ihr den zweiten Zug ließ.
Wir kamen aus dem Urlaub, aber wenn es etwas gab, das wir wirklich nötig gehabt hätten, dann war es Erholung.
3.
Urlaub an der ostdeutschen Ostseeküste - das war keine wirklich gute Idee gewesen. Aber ich hatte es irgendwie wissen wollen, trotz gewisser Warnungen. Dabei waren es keineswegs verbohrte, einigungskritische Westdeutsche gewesen, die diese Warnungen ausgesprochen hatten. Von denen gab und gibt es ja genug, und interessanter Weise trifft man darunter etliche, die noch vor einigen Jahren, als für alle Fälle vorgesorgt schien, nur nicht für den Mauerfall, regelmäßig ihre biederen Bekenntnisse zu dem im bundesdeutschen Grundgesetz verankerte Wiedereinigungsgebot abgelegt hatten, und zwar nicht zu leise, sondern mit deutlichem vernehmbarem konservativem Timbre. Doch als es dann ernst wurde damit, fanden sie das gar nicht mehr so witzig - etwa nach dem Motto: Mein Gott, die deutsche Einheit, so ernst haben wir das doch gar nicht gemeint, musste das denn wirklich sein?
Dieser Badeort ein paar Kilometer nordwestlich von Rostock rühmte sich einer gewissen Authentizität, und das nicht einmal zu Unrecht, schließlich hat die ganze Bäderkultur hier ihren Anfang genommen, und die Berliner waren die ersten gewesen, die von der neuen Errungenschaft Gebrauch machten. Auf der anderen Seite musste ein Begriff wie Authentizität im Osten Deutschlands immer noch nicht viel bedeuten. Authentisch war da vieles - einfach deswegen, weil es der DDR an Geld oder an Interesse oder auch an beidem gefehlt hatte, sich um die Erhaltung gewisser traditioneller Einrichtungen zu kümmern.
Der Strand zum Beispiel war zwar nicht völlig unbenutzbar, ließ aber doch zu wünschen übrig, weil einfach im Verhältnis zu dem Sand zu viele Steine herumlagen. Es gab auch Strandkörbe, und Anna, die ein besonderes Faible für diese Freiluftmöbel hat und sich dort besser auskennt als ich, behauptete sogar, sie seien ganz bequem, nur waren sie leider dauernd alle ausgebucht, weil es zu wenige gab. Das Wasser - nun ja, es war die Ostsee, aber im Unterschied zur westdeutschen Ostsee schien diese ostdeutsche Ostsee einen deutlich höheren Besatz mit Tang, Algen und Quallen aufzuweisen. Anna hatte hierzu nichts anzumerken, da sie es ohnehin ablehnt, im Meer zu baden. Julius meinte nur, dies sei nicht das, was er von Timmendorf gewohnt sei.
Wollte man essen gehen, war das so eine Sache. Man konnte Glück haben und auf einigermaßen bemühtes, leidlich kompetentes, gelegentlich sogar freundliches Bedienungspersonal treffen. Doch zu behaupten, der Dienstleistungsgedanke hätte sich hier bereits auf breiter Front durchgesetzt, wäre eine Übertreibung gewesen. Was dominierte, war jene gewisse Abwehrhaltung aus den Zeiten, da der Gast als der natürliche Feind des Kellners gegolten hatte. Die Preise allerdings, die bewegten sich ohne weiteres auf Timmendorfer Niveau, in dieser Beziehung war die Angleichung der Lebensverhältnisse vollauf gelungen.
Und dann gab es noch die Strandpromenade. Eine Strandpromenade sollte zur Erbauung und Entspannung der Urlaubsgäste dienen, sozusagen als eine kleine Aufmerksamkeit der örtlichen Verhältnisse an die Adresse derjenigen, die schließlich Geld mitbringen - denkt man. Hier allerdings verhielt es sich so, dass die Strandpromenade von jugendlichen Glatzköpfen als Rennstrecke benutzt wurde. Man konnte den Eindruck haben, dass sie mit ihren ost- und westdeutschen Kleinwagen beinahe rund um die Uhr auf- und abfuhren, wohl in der stillen Hoffnung, vielleicht doch einmal einen Touristen auf die Kühlerhaube nehmen zu können. Vermutlich waren sie frustriert, weil es in dieser Gegend nicht genügend Asylbewerber gab. Es gibt auch heute immer noch Menschen, denen solche Typen leid tun, weil es dort, wo einmal die DDR war, keine Jugendheime mehr gibt und zu wenig Arbeit und zu viele Videotheken und überhaupt einen Mangel an Lebenssinn. Ich fand und finde es schlicht ärgerlich, ansehen zu müssen, wie tief der Mensch sinken kann, viel mehr muss man dazu im Grunde nicht sagen.
Anna war jedenfalls nicht besonders begeistert von diesem Urlaubsort, Julius auch nicht, und was mich betraf, so mischte sich der Mangel an Begeisterung mit meinen Sorgen wegen meines Jobs und noch einigem anderen Ärger, so dass sich insgesamt nicht gerade die allerbeste Stimmung ergab. Mir fielen die Warnungen einiger Kollegen wieder ein, die aus dem Osten stammten und von denen es bereits eine Reihe bei jener Westberliner Zeitung gab, bei der ich als Leiter des Ressorts Innenpolitik beschäftigt war. Insbesondere ein älterer Reporter, ehemals bei führenden Publikationsorganen des Arbeiter- und Bauernstaates beschäftigt und neuerdings ein großer Verfechter des Projekts Vereinigtes Vaterland, hatte mich sorgenvoll beiseite genommen und mir dringend geraten, das Ganze zu überdenken. Es sei noch zu früh für solche Abenteuer, hatte er gemeint. Seine „Landsleute“, wie er sie nannte, seien noch nicht so weit, um „in urlaubsspezifischer Hinsicht“ allen westlichen Ansprüchen zu genügen.
Ich schlug seine Warnung in den Wind, obschon er im Grunde ein vertrauenswürdiger Mensch war, so vertrauenswürdig, wie jemand in diesem Metier sein kann. Ich duzte mich übrigens aus Prinzip mit allen, die aus dem Osten waren, ungeachtet der Hierarchie. Das war mir einfach ein Bedürfnis. Dieses ganze Kapitel deutsche Einheit hatte ich für mich längst abgehakt, das war eigentlich kein Thema mehr, es war so gekommen, wie es irgendwann hatte kommen müssen, auch wenn es keiner geglaubt hatte, aber ich fand es ganz in Ordnung. Und das hatte nichts mit dieser Renegatenhaltung zu tun, die groß in Mode war und ein paar Jahre später bekanntlich noch einmal zu höchster Blüte gelangen sollte.
1968 erledigen - das wurde rasch zum erklärten Lieblingssport der Nachgeborenen. Die sogenannten 89er machten sich überall breit, auch bei unserer Zeitung, und das einzig Bemerkenswerte an ihnen war, wenn man es unter soziologischen, ästhetischen und dramaturgischen Aspekten betrachtet, die Erkenntnis, dass junge Leute ziemlich alt aussehen können. Sie wollten oder konnten nicht verstehen, dass 68 vor allem eine große Fete gewesen war - es gab endlich die richtige Musik und die Mädchen waren nicht mehr so verklemmt.
Für manche mag die Chiffre 1968 mit Berlin verbunden sein, schon wegen der vielen Demonstrationen, die im Fernsehen gezeigt wurden. Doch selbst das ist ein Missverständnis. Für alle, die damals nicht in Berlin weilten - also für die meisten ebenso wie mich -, hatte 1968 mit Berlin wenig zu tun. Mir war damals Berlin nicht nur gleichgültig, es ging mir die Nerven. Diese dubiose Mischung aus Heinrich Zille und Luftbrücke, Stacheldraht und spießigem Ku'damm-Glamour, aus verlogenem Insulaner-Trotz und abgestandenen Erinnerungen an tote goldene Zwanzigerjahre, dieser ganze Preußen-Humbug, garniert mit Bratwurst und Plüschbären, all dieses pathologische Pathos mit Weißbier und Kreuzberger Müsli - das war für meine Begriffe einfach deprimierend. Meinethalben hätte Berlin nicht nur zwei-, sondern viergeteilt gewesen sein können.
Manchmal dachte ich, man sollte Berlin gegen Israel umtauschen, das wäre für alle Beteiligten die gerechte Strafe gewesen. Berlin in den Nahen Osten exportieren und dafür Israel mitten nach Deutschland verlegen - das hätte die Lösung vieler Probleme sein können, nur konnte man so etwas kaum jemandem erzählen, ohne schief angeguckt zu werden.
Doch als dann gut zwanzig Jahre später die bekannten Ereignisse eintraten, machte ich rasch meinen Frieden mit dieser Geschichte. Vielleicht war dies auch die diskrete Rache Berlins an mir. Jedenfalls, ich war schon dort, als die Mauer fiel - wenn auch weniger Berlins wegen, als hauptsächlich aus Karrieregründen, was aber nichts daran ändert, dass ich es völlig in Ordnung fand, als das große Ereignis passierte, und damit ist mein Konto aus ethischer Sicht im Grunde ausgeglichen. Es war einfach eine Frage der Gerechtigkeit, den Ostdeutschen nicht weiter vorzuenthalten, was die Westdeutschen unverdientermaßen bereits hatten. Man hätte ja ganz Deutschland nach dem Zweiten Wehkrieg auch abschaffen können, moralisch wäre das leicht zu begründen gewesen.
Das wirklich Problematische an den sogenannten 89ern war in meinen Augen, dass sie die Vorgängergeneration immer nur nach 68 fragten, das nagte an ihnen, dass sie nicht dabei gewesen waren, es war fast schon rührend. Wir 68er hatten unsere Väter immerhin nach Auschwitz gefragt, und dass wir dort nicht dabei gewesen waren, empfanden wir nun wahrlich nicht als Mangel. In gewisser Weise taten mir die 89er leid, sie litten offenbar unter einer biographischen Defizit-Neurose - das war die ganze Geschichte, aber helfen konnte ihnen letztlich keiner.
So begrüßenswert mir übrigens die Einigung erschien, so schwierig fand ich es anschließend, den nunmehr mit uns Vereinten durchweg mit Wohlwollen zu begegnen. Einige Bewohner des sogenannten Beitrittsgebiets waren, gelinde gesagt, eine Enttäuschung, sobald man sie erst in natura erlebt hatte. Zu den Privilegien derjenigen, die ihren Hauptwohnsitz in Berlin hatten, zählte es, diese Entdeckung etwas schneller zu machen als etwa die Bewohner von Mönchengladbach oder Kaiserslautern. Tief im Westen brauchten sie noch Jahre, um die Feinheiten der neuen föderalistischen Folklore mitzubekommen. Noch weniger als manche Ossis allerdings gefielen mir die Wessis, die die Ossis nicht mochten. Diesen Spruch, dass Deutschland ein schwieriges Vaterland ist, hätte sich gar nicht jemand anderes auszudenken brauchen - er hätte auch ohne weiteres von mir sein können. Ambivalenz, das ist das Wort, das es beschreibt, und unser Urlaub an der ostdeutschen Ostseeküste hatte in dieser Beziehung etwas Symptomatisches.
Es war wahrscheinlich klug von mir gewesen, diese Warnungen wohlmeinender Kollegen Anna gegenüber gar nicht zu erwähnen. Das ging mir jetzt durch den Kopf, während wir immer noch in diesem Stau standen und ich mich zu fragen begann, ob wir hier je wieder wegkommen würden, selbst mir das Ganze langsam etwas unheimlich. Andererseits hatte ich womöglich einen Fehler gemacht, als ich die Warnungen nicht beherzigte. Denn hätte ich das getan, wären wir nicht in diesen Ort nordwestlich von Rostock gefahren und hätten uns überhaupt viel Ärger erspart. Am besten wäre es gewesen, in diesem Jahr ganz auf einen Urlaub zu verzichten, zumindest zu der fraglichen Zeit, als sich bei unserer Zeitung die Dinge etwas unerfreulich entwickelten. Aber was richtig und falsch ist, weiß man ohnehin immer erst dann, wenn es zu spät ist, das ist die eigentliche Tragik der menschlichen Existenz.
Was mich angeht, so wäre ich am liebsten gleich am ersten Tag wieder abgereist, doch ich sagte nichts, ich schluckte es herunter. Männer machen das ja bekanntlich gern, sie teilen sich nicht mit, sondern fressen alles in sich hinein und leiden einsam und schweigend, weshalb sie auch früher sterben.
Anna und Julius hatten zwar anfangs ihre kritischen, teilweise abfälligen Bemerkungen gemacht, aber das gab sich, Anna wirkte nach verhältnismäßig kurzer Zeit zunehmend entspannt. Und Julius hatte offenbar beschlossen, dies hier als eine Art Abenteuerurlaub zu betrachten - was es ja in gewisser Weise auch war - , und ich konnte mir vorstellen, dass er bereits daran dachte, wie er sich in der Schule mit seinen Erlebnissen „in der Zone“ brüsten würde. Der Grund für diese positive Sicht der Dinge war in erster Linie in dem Umstand zu sehen, dass wir in einer ziemlich komfortablen Appartement-Anlage untergebracht waren, einer Art von Enklave, in der es sich aushalten ließ. In einem Seebad Urlaub zu machen, nur um sich möglichst vom Meer fernzuhalten und den Badeort selbst zu meiden - das kam mir zwar ein wenig schizophren vor, aber Anna und Julius sahen das weniger streng. Das hatte vor allem mit dem Swimmingpool zu tun, den es in der Anlage gab. Dort hielten sich ständig ein paar dreizehn-, vierzehnjährige Mädchen auf, womit für die Deckung des Grundbedarfs an Erlebnishunger erst einmal gesorgt war, soweit es unseren etwas frühreifen Sohn betraf. In Annas Fall lagen die Gründe dafür, die Dinge in milderem Licht zu sehen, auf einer ähnlichen Ebene, nämlich etwa auf Höhe des Beckenrandes. Es gab hier eine große Liegewiese, auf welcher zahlreiche Menschen anzutreffen waren, nicht nur die Eltern jener Mädchen, an denen unser Sohn sein Wohlgefallen fand. Das aber hieß: Anna hatte, trotz mancher Entbehrungen, etwas gefunden, das meiner Erfahrung nach auf ihrer Positiv-Liste weit oben rangiert, noch vor anderen zivilisatorischen Errungenschaften wie gepflegten Ostseestränden oder im Sinne ihrer Zweckbestimmung nutzbaren Strandpromenaden. Sie hatte Leute um sich herum, mit denen sie von morgens bis abends reden konnte. Anna redet gern, um nicht zu sagen, gelegentlich zu viel. Man könnte sie eine Virtuosin auf dem Gebiet der verbalen Kommunikation nennen - oder, neutral formuliert: Sie ist mit der Fähigkeit ausgestattet, Neugier und Mitteilungsdrang auf frappierende Weise in eine Balance zu bringen, die höchste Effizienz garantiert, falls ein Begriff wie Effizienz in diesem Zusammenhang angemessen ist. So gesehen war dies hier ein Dorado für sie.
Als ich Anna vor Jahren kennenlernte, stand sie als schüchterne blonde Elfe in einem der langweiligen Flure jenes Zeitungshauses, in dem wir beide Volontäre waren. Wir sollten hier zu brauchbaren Redakteuren ausgebildet werden, das war der prosaische Zweck unserer Anwesenheit in diesem Betrieb, doch Annas Anblick, der kam mir wie ein reines Wunder vor. Das hatte nichts mehr mit dem Leben eines Zeitungsvolontärs zu tun. Ich sah sie, und ihr Anblick weckte in mir sogleich diese archaischen Instinkte eines männlichen Beschützers hilfloser weiblicher Wesen.
Es gibt ja inzwischen diese Theorien von den genetisch codierten Reflexen. Vielleicht nahm ich in Sekundenbruchteilen auf, dass sie trotz ihrer Zierlichkeit relativ breite Beckenknochen hatte - günstige Reproduktionsvoraussetzungen also -, und dass ihre Haut glatt und rosig und ihre Lippen voll waren und ihr Haar fest und dicht und die Augen blau und klar, alles Signale der Vitalität. Ich dachte jedenfalls: Die oder keine, wobei „dachte“ es nicht ganz trifft. Da waren eher die Instinkte und die Emotionen am Werk, und außerdem die Intuition - lauter Mächte, gegen die wenig auszurichten ist.
Anna erzählte mir hinterher, bei ihr sei es völlig anders gewesen. Zuerst einmal hatte sie mich angeblich gar nicht zur Kenntnis genommen. Sie konnte sich nach unserem ersten Zusammentreffen kaum an mich erinnern, nach dem zweiten, auf irgendeiner Redaktionsparty, bei der ich mich ziemlich unverblümt an sie heranmachte, dann allerdings schon. Im Rückblick schilderte sie es dann etwa so: Ein heruntergekommener Späthippie sei ich gewesen, und wenn sie sich meiner nicht angenommen hätte, wäre ich gewiss vor Erreichen meines dreißigsten Jahrs in der Gosse geendet. Ich sei derjenige gewesen, sagte Anna, der an ihre mütterlichen Instinkte gerührt habe. Der Himmel weiß, wie so etwas zusammenpasst - ein altertümlicher Hippie-Beschützer und eine mütterliche Elfe, aber es passte, irgendwie. Ihre Freundinnen, lauter strenge Gutachterinnen, gaben uns beiden übrigens maximal drei bis vier Monate.
Nach ein paar Wochen hatte ich auf einer Fete erstmals erlebt, wozu meine blonde, etwas schüchterne Anna fähig war, wenn es darum ging, andere Menschen auszufragen und sie zugleich in Grund und Boden zu reden. Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen, was ich da alles mehr oder minder unfreiwillig mitbekam. Hemmungen kannte Anna offenkundig nicht, es war, milde gesagt, erstaunlich, wie viele Worte solch ein zarter, vermeintlich zurückhaltender Mensch weiblichen Geschlechts binnen verhältnismäßig kurzer Zeit von sich zu geben vermochte.
„Du quatscht sie zu und du quetscht sie aus, und du machst das beides zugleich“, sagte ich hinterher zu ihr, einigermaßen fassungslos. „So etwas ist, logisch gesehen, eigentlich gar nicht möglich.“
„Wie meinst du denn das?“, fragte sie unschuldsvoll und strahlte mich dabei aus ihren kornblumenblauen Augen an. „Willst du damit sagen, dass ich zuviel rede?“
Sie sagte das in dem Ton, in dem eine Frau erschrocken sagt: „Huch, was ist denn das, das ist ja eine Laufmasche“, und dazu fiel mir dann überhaupt nichts mehr ein. Ihr wiederum fiel dazu ein, dass ich nicht immer so stur sein solle. Ich musste später noch oft daran denken.
Das lag zu jener Zeit, da wir gemeinsam mit unserem jüngsten Sohn Urlaub nordwestlich von Rostock machten, fast zwei Jahrzehnte zurück. Mittlerweile hatten wir drei Söhne, von denen zwei, Max und Paul, mehr oder weniger erwachsen waren, und jene Beziehungsprophetinnen aus unserer Anfangszeit waren inzwischen immer noch frustrierte Singles oder mindestens einmal geschieden. Ich war, nachdem mir Anna jahrelang mit ihren Klagen wegen meines Mangels an Karriereehrgeiz in den Ohren gelegen hatte, Ressortleiter bei dieser Zeitung in Berlin, die dank der Einheit einen gewissen Bedeutungsaufschwung erfahren hatte, es ging uns nicht schlecht, die Kinder waren so gut geraten, wie drei Knaben eben geraten können. Anna war immer noch eine auffallend hübsche Frau, und ich, ich hatte mich auch einigermaßen gehalten oder versuchte es doch zumindest. Wir hatten eigentlich keinen Grund, uns zu beschweren - objektiv betrachtet und von meinen aktuellen Sorgen abgesehen.
Aber was heißt schon „objektiv gesehen“? Was letztlich zählt, ist das Subjektive. Vor Jahren hatten wir Nachbarn, die wir immer beneideten, weil sie ein eigenes großes Haus besaßen. Eines Tages erhängte sich der Mann, weil seine Firma pleite war, und wenig später schluckte seine Witwe, nach Annas Meinung eine resolute, selbstsichere, dazu noch attraktive Frau von Mitte dreißig, die letale Dosis Rattengift. Ihr Bruder starb im Sommer darauf an einem Stromstoß, als er beim Rasenmähen die Schnur durchschnitt.
Ich habe Anna gegenüber oft dieses Beispiel zitiert, wenn sie wieder einmal damit anfing, wie leicht bei anderen alles laufe. Ich fand, es war ein passendes Exempel, um den Unterschied zwischen subjektiv und objektiv zu illustrieren und außerdem die Irrelevanz des Materiellen.
„Fassaden“, sagte ich dann, „was sagen schon die Fassaden des Erfolgs? Wie es dahinter zugeht, weiß ohnehin keiner.“
Inzwischen fand ich allerdings, dass ich eigentlich längst stellvertretender Chefredakteur hätte sein sollen. Es stand mir einfach zu, so sah ich das, und wenn ich es jetzt nicht bald schaffte, würde es zu spät sein. Ich war Innenpolitik-Chef, was seit jeher eine gute Basis für den Sprung nach oben ist, und ich hatte mir einen gewissen Namen als Verfasser von Leitartikeln und Kommentaren gemacht, außerdem konnte ich fast zwanzig Jahre Berufserfahrung vorweisen - allerdings war ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob das viel zählte, neuerdings schienen es manche besonders schnell besonders weit zu bringen, die so gut wie keine Erfahrung hatten.
Vor allem machte ich mir seit einiger Zeit Sorgen um Amann, unseren Chefredakteur. Amann wäre der einzige gewesen, der mein Anliegen hätte befördern können. Ohne sein Wort konnte ich nicht sein Stellvertreter werden, logisch, das hatte gar nichts mit den spezifischen Bräuchen der Zeitungsbranche zu tun. Aber es sah so aus, als sitze Amann selbst nicht mehr ganz fest im Sattel, auch wenn es noch keine handfestes Indizien gab, aber dass er in letzter Zeit müde wirkte und noch etwas deutlicher desinteressiert als sonst, das war einfach nicht zu übersehen.
In den Verlagsleitungen diverser anderer Blätter schien eine Art Paranoia ausgebrochen zu sein. Wer würde es schaffen, „die Hauptstadtzeitung“ zu werden? Das war die große Frage. Sie redeten von nichts anderem, und die Art und Weise, wie sie das taten, war kaum geeignet, einen erfahrenen Journalisten irgend etwas Gutes ahnen zu lassen. Hier würden bald der eine oder andere Amoklauf und alle möglichen Blutbäder im Personalbereich fällig sein. Bei einem der Konkurrenzblätter hatten sie kürzlich einen Mittdreißiger als Verlagschef engagiert - also als den Mann an der Spitze des ganzen Unternehmens-, der vorher als Jungmanager eines Zigarettenkonzerns reüssiert und noch nie einen Zeitungsbetrieb von innen gesehen hatte. Das publizistische Credo, das er vor der versammelten Mannschaft ablegte, lautete: „Kohle machen!“ Und obschon es sich um unsere härteste Konkurrenz handelte und wahrlich kein Blatt von überragendem Niveau, sträubten sich mir die Haare, als ich davon hörte. Das Mitleid, das ich mit den Kollegen dort empfand, war indes nicht nur altruistischer, sondern gewissermaßen auch prophylaktischer Natur. Es konnte leicht sein, dass wir selbst über kurz oder lang zu Objekten des Kollegenmitleids wurden.