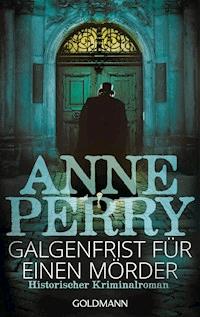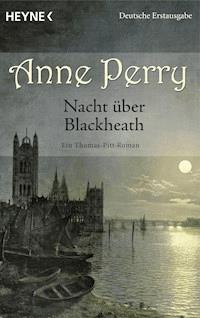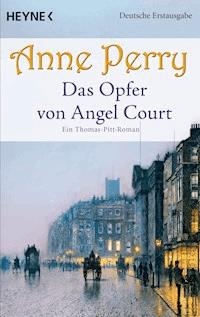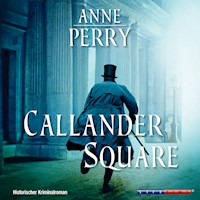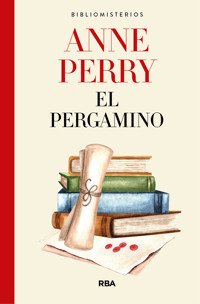7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Thomas & Charlotte-Pitt-Romane
- Sprache: Deutsch
Ein Inspektor-Pitt-Roman
Inspektor Pitt sitzt in der Falle. Während der Untersuchung zu einem Mordfall gerät er selbst unter Verdacht und wird verhaftet. Ehefrau Charlotte, die schon manches Geheimnis gelüftet hat, beginnt auf eigene Faust zu ermitteln, tatkräftig unterstützt von ihrer Schwester Emily.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Inspektor Pitt sitzt in der Falle. Während der Untersuchung zu einem Mordfall gerät er selbst unter Verdacht und wird verhaftet. Ehefrau Charlotte, die schon manches Geheimnis gelüftet hat, beginnt auf eigene Faust zu ermitteln, tatkräftig unterstützt von ihrer Schwester Emily.
Die Autorin
Anne Perry, 1938 in London geboren und in Neuseeland aufgewachsen, lebt und schreibt in Schottland.Ihre historischen Kriminalromane zeichnen ein lebnendiges Bild des spätviktorianischen London. Weltweit haben sich die Bücher von Anne Perry bereits über zehn Millionen Mal verkauft.
Inhaltsverzeichnis
Für Tante Ina, die die Großtante Vespasia zum Leben erweckt hat
1
»Hier ist das Polizeirevier, Sir«, sagte der Kutscher laut, noch ehe die Pferde anhielten. Seine Stimme klang belegt vor Widerwillen, denn er konnte Polizeiwachen nicht ausstehen. Daß diese hier im aristokratisch-eleganten Stadtgebiet von Mayfair lag, machte keinen Unterschied.
Pitt stieg aus, bezahlte den Mann, ging ein paar Steinstufen hinauf und durch die Tür.
»Ja, Sir?« fragte ihn der Wachtmeister hinter dem Schreibtisch uninteressiert.
»Ich bin Kommissar Pitt aus der Bow Street«, erklärte Thomas Pitt knapp. »Ich möchte mit Ihrem diensthabenden Vorgesetzten reden.«
Der Wachtmeister holte tief Luft und betrachtete Pitt kritisch, denn er entsprach nicht dem Bild, das sich der Wachtmeister von einem Polizeiinspektor machte — dafür war seine Kleidung zu lässig. Eigentlich wirkte sie sogar ungepflegt und schlampig mit den ausgebeulten Taschen voller Kram. Der Mann blamierte die Polizei. Er sah aus, als sei ihm eher eine Gartenschere als die eines Friseurs zu Leibe gerückt. Doch der Wachtmeister kannte Pitts Namen und sprach nun mit einigem Respekt.
»Ja, Sir. Das ist Kommissar Mowbray. Ich werde ihn informieren. Kann ich ihm sagen, worum es geht, Sir?«
Pitt lächelte kühl. »Nein, leider nicht. Es handelt sich um eine vertrauliche Angelegenheit.«
»In Ordnung, Sir.« Der Wachtmeister erhob sich gleichmütig und ging hinaus. Nach wenigen Minuten kehrte er zurück. »Bitte die zweite Tür links. Dort erwartet Sie Kommissar Mowbray.«
Mowbray war ein sehr dunkler Typ mit beginnender Glatze und einem intelligenten Gesicht. Er blickte Pitt ausgesprochen neugierig entgegen.
Thomas Pitt stellte sich vor und streckte die Hand aus.
»Ich habe von Ihnen gehört.« Mowbray ergriff die dargebotene Hand mit festem Druck. »Was kann ich für Sie tun?«
»Ich brauche die Unterlagen über einen Raub in Hanover Close vor drei Jahren — am siebzehnten Oktober 1884, um genau zu sein.«
Mowbrays Züge drückten bekümmertes Erstaunen aus. »Das war eine böse Sache. In dieser Gegend kommt es nicht oft vor, daß bei einem Einbruch ein Mord passiert. Abscheulich, wirklich abscheulich. Es kam nie etwas heraus.« Seine Augenbrauen hoben sich hoffnungsvoll. »Haben Sie eine Spur gefunden? Einen der gestohlenen Gegenstände?«
»Nein, gar nichts. Es tut mir leid«, sagte Pitt bedauernd. Er fühlte sich schuldig, weil er dem Mann seinen Fall wegnahm, und es ärgerte ihn, daß er die Gründe dieser späten und vermutlich überflüssigen Nachforschungen verschleiern mußte.
Pitt haßte die Art, wie er mit diesem Fall betraut worden war, der eigentlich Mowbrays Sache gewesen wäre. Doch weil es um den Ruf einer Frau ging, die einer einflußreichen Familie angehörte, und vor allem weil eventuell Landesverrat im Spiel war, hatte das Außenministerium seinen Einfluß geltend gemacht und Ballarat eingeschaltet, dem es die nötige Diskretion zutraute. Polizeichef Ballarat war ein Mann, der außerordentlich gut beurteilen konnte, was seine Vorgesetzten erwarteten, und dessen Ehrgeiz darin bestand, so hoch aufzusteigen, daß er gesellschaftliche Anerkennung finden würde. Er erkannte nicht, daß diejenigen, die er am meisten beeindrucken wollte, immer imstande waren, die Herkunft eines Mannes zu beurteilen, allein schon durch sein Auftreten und die Art, sich auszudrücken.
Pitt war der Sohn eines Wildhüters und auf einem weitläufigen Landsitz groß geworden. Er hatte die gleiche Erziehung genossen wie der Sohn des Hauses und sich ein Benehmen angeeignet, das vom Adel akzeptiert wurde. Zudem hatte er weit über seinem Stand geheiratet und Zutritt zur gesellschaftlichen Oberschicht gefunden, die den meisten gewöhnlichen Polizisten verschlossen war. Ballarat mochte Pitt nicht; er hielt ihn für anmaßend, doch er mußte zugeben, daß der Kommissar zweifellos der beste Mann für diese Ermittlungen war.
Mowbray sah Pitt leicht enttäuscht an, doch der Ausdruck verschwand gleich wieder. »Oh . . . Sie sprechen wohl am besten zuerst mit dem Polizisten Lowther; er fand die Leiche. Und natürlich können Sie die Berichte lesen, die wir damals geschrieben haben. Aber es ist nicht viel.« Er schüttelte den Kopf. »Wir haben uns sehr bemüht, aber es gab keine Zeugen, und von den gestohlenen Gegenständen tauchte nie einer auf. Wir dachten an die Möglichkeit eines hausinternen Verbrechens, doch die Befragung des gesamten Personals brachte nichts zutage.«
»Mir wird es wohl nicht besser ergehen«, meinte Pitt, und es klang wie eine indirekte Entschuldigung.
»Möchten Sie eine Tasse Tee, während ich Lowther rufen lasse?« fragte Mowbray. »Es ist ein scheußlicher Tag. Es würde mich nicht wundern, wenn es vor Weihnachten noch Schnee gäbe.«
Pitt nickte. »Danke, ich trinke gern einen Tee.«
Zehn Minuten später saß Pitt in einem anderen kleinen kalten Raum mit einer Gaslampe, die an der Wand über einem zerkratzten Holztisch zischelte. Ein dünner Stapel Papiere lag auf der Tischplatte, und Pitt gegenüber stand ein linkischer befangener Polizist, dessen Uniformknöpfe glänzten.
Pitt forderte ihn auf, sich zu setzen und zu entspannen.
»Ja, Sir«, erwiderte Lowther nervös. »An diesen Mord in Hanover Close kann ich mich gut erinnern. Was wollen Sie wissen?«
»Alles.« Pitt ergriff die Teekanne und füllte einen weißen Emailbecher, ohne zu fragen. Er reichte ihn Lowther, der ihn überrascht entgegennahm. »Danke, Sir.« Der Mann schluckte dankbar das heiße Getränk, dann begann er mit leiser Stimme. »Es war fünf Minuten nach drei Uhr morgens am siebzehnten Oktober vor etwas mehr als drei Jahren. Ich hatte damals Nachtdienst und kam an Hanover Close vorbei . . .«
»Wie oft?« unterbrach Pitt.
»Alle zwanzig Minuten, Sir. Regelmäßig.«
Pitt lächelte leicht. »Ich weiß, das ist die Vorschrift. Sind Sie sicher, daß Sie in jener Nacht nicht irgendwo aufgehalten worden sind?« Er gab Lowther bewußt die Chance, sich, falls nötig, herausreden zu können, ohne die Wahrheit zu vertuschen. »Gab es anderswo keine Probleme?«
»Nein, Sir.« Lowther sah ihn mit völlig arglosen blauen Augen an. »Manchmal werde ich aufgehalten, aber nicht in jener Nacht. Ich war fast auf die Minute pünktlich. Deshalb bemerkte ich auch gleich das zerbrochene Fenster in Nummer zwei, das zwanzig Minuten vorher noch ganz gewesen war. Seltsamerweise war es ein Fenster an der Vorderfront. Diebe bevorzugen gewöhnlich die Rückfront. Sie haben meist einen besonders mageren Burschen dabei, der sich durch die Gitterstäbe zwängt und von innen öffnet.«
Pitt nickte.
»Ich ging zur Tür von Nummer zwei und klopfte«, fuhr Lowther fort. »Ich mußte einen Höllenlärm veranstalten, ehe jemand herunterkam. Nach ungefähr fünf Minuten machte ein Diener die Tür auf. Er trug einen Mantel über dem Nachthemd und war total verschlafen. Ich erzählte ihm von dem zerbrochenen Fenster, und er war sehr erschrocken. Sofort führte er mich in das Zimmer an der Vorderseite — es war die Bibliothek.« Der Polizist atmete schwer, doch sein Blick heftete sich ruhig auf Pitts Gesicht. »Ich bemerkte gleich, daß etwas Schlimmes passiert war. Zwei schwere Stühle waren umgekippt, Bücher lagen verstreut auf dem Boden, das Wasser einer Karaffe hatte sich über den Tisch ergossen, und die Scherben der Fensterscheibe glitzerten im Licht.«
»Welches Licht?« fragte Pitt.
»Der Diener hatte die Gaslampen angedreht«, erklärte Lowther. »Er stand unter Schock, das könnte ich beschwören.«
»Was geschah dann?«
»Ich ging tiefer in den Raum hinein.« Die Züge des Polizisten verdüsterten sich bei der Erinnerung an das Geschehene. »Ich sah einen Mann auf dem Boden liegen, Sir, das Gesicht halb verdeckt, die Beine ein wenig angezogen, als sei er von hinten überrascht worden. Sein Kopf war blutverschmiert ...« Lowther berührte seine eigene rechte Schläfe am Haaransatz. »Dicht daneben lag ein großes Bronzepferd auf dem Teppich. Der Manntrug einen Morgenmantel über dem seidenen Nachthemd und Pantoffeln an den Füßen.
Ich trat zu ihm, um zu sehen, ob ich etwas für ihn tun könnte, doch im Grunde hielt ich ihn von Anfang an für tot. Der Diener, der wohl keine zwanzig Jahre alt war, ließ sich leichenblaß auf einen Sessel fallen. »Oh Gott«, stöhnte er. »Es ist Mister Robert! Arme Mrs. York!«
»Und der Mann war tot?« fragte Pitt.
»Ja, aber er war noch warm.«
»Was haben Sie dann gemacht?«
»Nun, zweifellos handelte es sich um Mord. Jemand mußte eingebrochen sein, denn die Glasscherben lagen alle im Zimmer, und der Fensterriegel war noch geschlossen. Der Einbrecher hatte sich nicht mit einer Verklebung aufgehalten . . .«
Pitt wußte, was Lowther meinte. Viele Einbruchsexperten benutzten den Trick, Papier über die Scheiben zu kleben, um die Scherben festzuhalten, während sie ein kreisrundes Loch in das Glas schneiden, durch das sie mit der Hand greifen und den Riegel öffnen können. Ein Profi verrichtete diese lautlose Tätigkeit in fünfzehn Sekunden.
»Ich fragte den Diener, ob ein Telefon im Haus sei«, fuhr Lowther fort. »Er bejahte, und ich rief das Revier an, um das Verbrechen zu melden. Dann kam der Butler herunter. Er identifizierte den Toten formell als Mr. Robert York, Sohn des Honorablen Piers York, des Hausherrn. Dieser war verreist, deshalb konnten wir nur die Mutter des Opfers, die ältere Mrs. York, informieren. Sie war sehr gefaßt und bewahrte ihre Würde.« Er seufzte bewundernd. »Daran erkennt man wahre Klasse. Die Dame war totenbleich und wirkte wie leblos, aber sie weinte nicht in unserer Gegenwart und stützte sich nur leicht auf ihre Zofe.«
Pitt kannte viele großartige Frauen, deren Erziehung sie gelehrt hatte, körperlichen Schmerz, Einsamkeit und schwere Verluste zu ertragen, ohne ihr Leid in der Öffentlichkeit zu zeigen. Sie vergossen ihre Tränen nur, wenn sie allein waren. Diese Frauen hatten ihre Ehemänner und Söhne in den Kampf geschickt, auf die Schlachtfelder von Waterloo und Balaklava, oder in den Hindukusch und zur Quelle des Blauen Nils, um sich dort niederzulassen und das Imperium zu verwalten. Viele der edlen Damen waren selbst in unbekannte Länder gereist, hatten schreckliche Entbehrungen auf sich genommen und vertraute Lebensumstände hinter sich gelassen. Pitt hielt Mrs. York für solch eine Frau.
Lowther sprach ruhig weiter, während er sich an die düstere und traurige Situation erinnerte. »Ich mußte nachfragen, ob etwas fehlte, und die Dame des Hauses prüfte langsam alle Gegenstände. Sie sagte, sie vermisse zwei silbergerahmte Miniaturporträts aus dem Jahr 1773, einen Kristallbriefbeschwerer mit Schnörkel- und Blumenverzierung, eine kleine Silberkanne und die Erstausgabe eines Buches von Jonathan Swift.«
»Wo wurde das Buch aufbewahrt?«
»Auf dem Bord zwischen den anderen Büchern, Mr. Pitt — und das bedeutet, daß der Dieb davon wußte. Mrs. York erklärte, der Einband habe sich nicht von den übrigen unterschieden.«
»Ah.« Thomas Pitt atmete langsam aus. Er wechselte das Thema. »War der Tote verheiratet?«
»O ja. Aber ich wollte seine arme Frau nicht wecken. Ich dachte, es sei besser, wenn ihre Familie ihr das Furchtbare mitteilen würde.«
Pitt konnte ihm das nicht übelnehmen. Die Angehörigen des Opfers zu informieren war eine der schwersten Aufgaben in einem Mordfall. Noch schwerer war es nur, die Gesichter derjenigen zu sehen, die den Täter liebten und begreifen mußten, wozu er fähig war.
»Gab es brauchbare Spuren?« fragte der Kommissar laut.
Lowther schüttelte den Kopf. »Nein, Sir, keine Fußabdrücke, keine Haare, nichts. Am nächsten Tag fragten wir alle Bediensteten im Haus, aber sie hatten nichts gehört. Allerdings schlafen sie oben unter dem Dach.«
»Haben Sie draußen etwas gefunden?«
Lowther schüttelte erneut den Kopf. »Nichts, Sir. Der Boden war steinhart gefroren. Nicht einmal ich habe Fußabdrücke hinterlassen, und ich wiege nicht wenig.«
»Irgendwelche Zeugen?«
»Nein, Mr. Pitt. Es hat sich niemand gemeldet. Wissen Sie, Hanover Close ist eine Sackgasse. Einer, der nicht da wohnt, hat überhaupt keinen Grund, dort herumzulaufen, vor allem nicht mitten in einer Winternacht. Und es ist auch keine Gegend für eine Hure.«
Pitt hatte kaum etwas anderes erwartet. Nun erkundigte er sich nach der letzten Möglichkeit. »Was ist mit den gestohlenen Gegenständen?«
Lowther schnitt eine Grimasse. »Nichts. Dabei haben wir uns sehr bemüht, weil es sich um Mord handelte.«
»Keine weiteren Informationen?«
»Nein, Mr. Pitt. Mr. Mowbray sprach mit der Familie. Vielleicht kann er Ihnen mehr sagen.«
»Ich werde ihn fragen. Vielen Dank.«
Lowther machte ein erstauntes Gesicht. »Ich danke Ihnen.«
Thomas Pitt fand Mowbray in seinem Büro.
»Haben Sie erfahren, was Sie wissen wollten? Lowther ist ein guter Polizist, sehr zuverlässig«, meinte der Inspektor.
Pitt setzte sich in die Nähe des Ofens und verfolgte weiter sein Thema. »Sie gingen nach der Mordnacht in das Haus?«
Mowbray runzelte die Stirn. »Ja. Ich hasse diese Aufgabe, mit den Leuten reden zu müssen, bevor sie ihren Schock überwunden haben. York selbst war nicht da, nur seine Frau und die Schwiegertochter, die Witwe des Toten . . .«
»Erzählen Sie mir von ihnen«, unterbrach Pitt. »Nicht nur die Tatsachen, auch Ihre persönlichen Eindrücke.«
Mowbray atmete tief durch und seufzte. »Die ältere Mrs. York war eine beachtenswerte Frau. Ich denke, sie muß früher einmal eine Schönheit gewesen sein, immer noch gutaussehend, sehr . . .«
Pitt wartete, er wollte Mowbrays eigene Worte hören.
»Sehr weiblich.« Der Inspektor war mit seiner Beschreibung nicht zufrieden. Er blinzelte. »Sanft wie . . . wie eine Blume im botanischen Garten. Wie eine Kamelie, blasse Farben, perfekte Form. Nicht so wild und unordentlich wie Feldblumen oder späte Rosen, die auseinanderfallen.«
Pitt mochte späte Rosen: Sie waren herrlich, üppig, doch das war eine Frage des Geschmacks. Mowbray fand sie vielleicht ein wenig vulgär.
»Und die Witwe?« fragte Thomas Pitt mit gleichmütiger Stimme. Er wollte kein besonderes Interesse bekunden.
Doch Mowbray war scharfsinnig. Er lächelte leicht. »Sie war totenblaß und sprach kaum ein Wort, so, als sei sie halb betäubt. Sie blickte uns nicht an, wie Lügner sich verhalten. Ich glaube, es war ihr egal, was wir von ihr dachten.«
Nun lächelte auch Pitt. »Also keine Kamelie?«
Ein Hauch freudlosen Humors zeigte sich in Mowbrays Augen. »Eine ganz andere Art Frau, viel . . . viel empfindsamer und verletzlicher. Vielleicht auch, weil sie jünger war. Aber ich hatte das Gefühl, daß sie nicht die innere Stärke ihrer Schwiegermutter besaß. Doch trotz des Schocks war sie eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe, groß und sehr schlank, wie eine Frühlingsblume, jedoch dunkel. Zerbrechlich, könnte man sagen, mit einem jener Gesichter, die man nicht vergißt, weil sie sich von den meisten anderen unterscheiden. Hohe Wangenknochen, zarter Körperbau.« Er schüttelte den Kopf ein wenig. »Ein Gesicht voller Gefühl.«
Pitt saß einen Moment still da und versuchte sich die Frau vorzustellen. Was fürchtete das Außenministerium wirklich — Mord, Landesverrat oder nur einen Skandal? Was war der wahre Grund dafür, daß Ballarat diesen Fall nun wieder aufrollen mußte? War es nur, um sicherzugehen, daß sich später nichts Schmutziges herausstellte, das einen Botschafter ruinieren konnte? Selbst bei diesem kurzen Gespräch hatte Pitt Achtung vor Mowbray gewonnen. Er war ein guter, professioneller Polizist. Wenn er glaubte, Veronica York sei durch den Schock betäubt gewesen, dann hätte Pitt vermutlich auch nichts anderes gedacht.
»Was sagte die Familie aus?«
»Die beiden Damen waren mit Freunden beim Essen gewesen. Sie waren ungefähr um elf Uhr nachts heimgekommen und gleich zu Bett gegangen«, erwiderte Mowbray. »Die Dienerschaft bestätigte das. Robert York war geschäftlich unterwegs gewesen. Er arbeitete im Außenministerium und hatte oft abends zu tun. Er kam häufig nach den Damen heim; sie wußten nicht, wann. Auch das Personal wußte es nicht. York hatte selbst bestimmt, daß niemand aufbleiben sollte.
Offenbar war er noch wach, als der Einbrecher erschien. Er muß die Treppe heruntergekommen sein, den Dieb in der Bibliothek überrascht haben und dann getötet worden sein.« Mowbray hielt inne. »Ich weiß nicht, warum. Ich meine, warum versteckte sich der Einbrecher nicht, oder, noch besser, warum verschwand er nicht wieder durch das Fenster? Der Totschlag war völlig überflüssig.«
»Was haben Sie schließlich gefolgert?«
Mowbray hob die Augenbrauen. »Ein ungelöster Fall.« Er zögerte ein paar Sekunden, als wolle er noch etwas hinzufügen.
Pitt nickte. »Ein seltsamer Fall. Der Täter weiß genau, daß Lowther alle zwanzig Minuten vorbeikommt, trotzdem benützt er statt der Rückseite des Hauses ein Fenster an der Vorderfront, das er nicht einmal beklebt, um den Lärm zu vermeiden. Er kennt die Erstausgabe von Swift, die nicht auffällig war, und greift den Hausherrn so brutal an, daß dieser stirbt.«
»Und er verkauft nichts von seiner Beute«, fügte Mowbray hinzu. »Sehr eigenartig. Ich überlegte schon, ob York den Eindringling persönlich kannte — irgendeinen Gentleman, der seine Freunde beraubte. Ich habe mich sehr diskret in dieser Richtung erkundigt und auch die Bekannten der jungen Mrs. York ein wenig unter die Lupe genommen. Da hat man mir von oben bedeutet, mich zurückzuhalten und den Kummer der Betroffenen nicht noch zu vermehren. Man hat mich nicht direkt aufgefordert, den Fall als ungelöst abzulegen — nicht so plump. Doch ich habe es begriffen, man muß mir nicht mit dem Zaunpfahl winken.«
So hatte Pitt es sich vorgestellt — er selbst hatte schon Ähnliches erlebt. Es bedeutete nicht unbedingt, daß die Drahtzieher schuldig waren, nur, daß sie der feinen Gesellschaft, dem Geld und der grenzenlosen Macht, die damit verbunden war, ihre Hochachtung erwiesen.
»Ich denke, ich sollte jetzt weitere Nachforschungen anstellen.« Pitt erhob sich zögernd. Draußen regnete es. Er sah, wie die Nässe in Streifen über das Fenster rann und die Schatten der Dächer und Giebel verzerrte. »Danke für Ihre Hilfe und für den Tee.«
»Ich beneide Sie nicht«, meinte Mowbray aufrichtig.
Pitt lächelte liebenswürdig. Er mochte den Mann, und es war ihm zuwider, dessen Schritte zurückzuverfolgen, als sei der Inspektor irgendwie unzulänglich. Verdammter Ballarat, verdammtes Außenministerium!
Auf der Straße stellte Pitt den Mantelkragen hoch, zog den Schal dichter um den Hals und senkte den Kopf gegen den Regen. Nach einer Weile rann ihm das Wasser über die Stirn. Er dachte darüber nach, was er gerade erfahren hatte. Was bezweckte das Außenministerium? Suchten sie die dezente Lösung eines Falles, der einen der ihrigen betraf? Robert Yorks Witwe war, wenn auch nicht formell, mit einem Julian Danver verlobt. Falls Danver einen Botschafterposten oder sogar Höheres anstrebte, durfte keinem Mitglied seiner Familie ein Makel anhaften, vor allem nicht seiner Frau. Oder hatte man bezüglich Robert Yorks Ermordung etwas Neues entdeckt, das auf Hochverrat hinwies und das Pitt enträtseln sollte? Ihm würde dann die Verantwortung zugeschoben werden für die Tragödie und den Skandal, die unweigerlich folgen und Karrieren zerstören würden.
Es war eine häßliche Aufgabe, und alles, was Mowbray berichtet hatte, machte die Sache noch häßlicher. Wer war die zweite Person in der Bibliothek gewesen, und was hatte sie dort gewollt?
Pitt wanderte vom Piccadilly durch die St. James und quer über die Mall, dann die Horse Guards’ Parade hinunter, vorbei an den kahlen Bäumen und dem windgepeitschten Gras des Parks, anschließend die Downing Street hinauf zur Whitehall und zum Außenministerium.
Er brauchte eine Viertelstunde, bis er schließlich zu der Abteilung vordrang, in der Robert York gearbeitet hatte. Dort begrüßte ihn ein distinguierter Herr in den späten Dreißigern mit schwarzem Haar und ebenso dunklen Augen, die sich jedoch bei Licht überraschend als leuchtend grau erwiesen. Er stellte sich als Felix Asherson vor und bot jede Hilfe an, die in seiner Macht stand.
»Danke, Sir. Wir haben uns den tragischen Tod von Mr. Robert York vor drei Jahren jetzt noch einmal vorgenommen.«
Asherson Gesicht drückte sofort Betroffenheit aus, wie man es bei den tadellosen Sitten, die im Außenministerium herrschten, erwarten konnte. »Haben Sie jemand festgenommen?«
Pitt ging das Thema indirekt an. »Nein, leider nicht, aber damals wurden einige Gegenstände gestohlen, und es erscheint möglich, daß der Dieb kein gewöhnlicher Einbrecher, sondern eine gebildete Person war, die etwas Bestimmtes suchte.«
Asherson wartete geduldig. »Tatsächlich? Haben Sie das damals nicht vermutet?«
»Doch, Sir. Aber von höherer Stelle . . .« Er hoffte, Ashersons diplomatische Schulung in Diskretion würde ihn davon abhalten, nach Namen zu fragen, »wurde mir aufgetragen, den Fall noch einmal zu durchleuchten.«
»Oh.« Ashersons Züge verschlossen sich kaum merkbar. »Wie können wir Ihnen helfen?«
Es war interessant, wie er den Plural benützte und sich dadurch zum Vertreter des Ministeriums machte, der sich nicht persönlich einmischte.
Pitt wählte seine Worte sorgfältig. »Nachdem der Täter die Bibliothek bevorzugte und nicht das Speisezimmer, in dem das Silber aufbewahrt wurde, liegt nahe, daß er vielleicht Dokumente suchte, vielleicht etwas, an dem Mr. York zu der Zeit arbeitete.«
Asherson blieb unverbindlich. »Tatsächlich?«
Pitt wartete.
Asherson atmete tief durch. »Das ist schon möglich, ich meine, er mag gehofft haben, etwas zu finden. Ist das jetzt noch wichtig? Das Geschehen liegt immerhin drei Jahre zurück.«
»Einen Mordfall geben wir niemals völlig auf«, erklärte Pitt höflich. Und doch hatten sie diesen nach sechs fruchtlosen Monaten begraben.
»Nein, nein, natürlich nicht«, meinte Asherson. »Wie kann das Außenministerium Ihnen helfen?«
Pitt beschloß, schonungslos offen zu sein. Er lächelte leicht und sah Asherson in die Augen. »Sind hier irgendwelche Informationen verlorengegangen, seit Mr. York bei Ihnen zu arbeiten anfing?«
Asherson zögerte. »Sie halten uns wohl für ziemlich unfähig, Kommissar! Wir pflegen Informationen nicht zu ›verlieren‹, dafür sind sie viel zu wichtig.«
»Wenn also eine Information unbefugte Stellen erreicht, wurde sie freiwillig abgegeben?« fragte Pitt unschuldig.
Asherson atmete langsam aus, um Zeit zu gewinnen. Im Moment verriet sein Gesicht deutliche Verwirrung. Er wußte nicht, worauf Pitt hinauswollte.
»Es gab eine Information...«, sagte Pitt sanft und so unbestimmt, daß es sowohl eine Frage als auch eine Feststellung sein konnte.
Asherson reagierte mit Unwissenheit. »Wirklich? Dann wurde der arme Robert vielleicht deshalb ermordet. Falls er Papiere nach Hause mitgenommen hat, und irgend jemand wußte das...« Er ließ den Satz unvollendet.
»Dann hätte Mr. York also jederzeit solche Papiere mitnehmen können? Oder wollen Sie andeuten, daß es eventuell nur einmal der Fall war und daß der Dieb ausgerechnet diese Nacht wählte?«
Es war eine absurde Idee, das wußten beide.
»Nein, natürlich nicht.« Asherson lächelte schwach. Er saß in der Klemme, doch falls er sich ärgerte, verbarg er es ausgezeichnet. »Ich weiß wirklich nicht, was damals geschah. Doch sollte Robert unzuverlässig gewesen sein oder die falschen Freunde gehabt haben, so ist das heute kaum mehr von Bedeutung. Der arme Mann ist tot, und die Information kann unsere Feinde nicht erreicht haben, sonst hätten wir längst die Folgen gespürt. Und das ist nicht der Fall, das kann ich Ihnen versichern. Wenn es tatsächlich solch einen Versuch gegeben hat, dann schlug er fehl. Können Sie das Andenken des Mannes nicht in Frieden lassen, ganz zu schweigen von seiner Familie?«
Pitt erhob sich. »Danke, Mr. Asherson. Sie waren sehr offen. Guten Tag, Sir.« Er ließ den unsicher dreinblickenden Asherson in der Mitte des leuchtend blauen türkischen Teppichs einfach stehen.
Als er in der eisigen Dämmerung wieder in der Bow Street angelangt war, stieg Thomas Pitt die Stufen zu Ballarats Büro hinauf und klopfte an die Tür. Gleich darauf wurde er hereingebeten.
Ballarat stand vor dem Feuer und verdeckte mit seinem Körper die Flammen. Sein Dienstraum unterschied sich von dem der einfachen Streifenpolizisten. Der große Schreibtisch war mit grünem Leder bezogen, der Stuhl dahinter gepolstert und bequem schwenkbar. In einem steinernen Aschenbecher lag ein Zigarrenstummel. Ballarat war mittelgroß, untersetzt und ein wenig kurzbeinig. Doch sein üppiger Backenbart wirkte tadellos gestutzt, und der Mann duftete nach Kölnisch Wasser. Seine Kleidung war untadelig gepflegt, von den glänzenden ochsenblutfarbenen Stiefeln bis zur passenden Krawatte und dem steifen weißen Kragen. Der Polizeichef bildete einen krassen Gegensatz zu dem schlampigen Kommissar mit dem zerdrückten Mantel und dem handgestrickten Schal, der den weichen Hemdkragen halb verdeckte.
»Nun?« sagte Ballarat reizbar. »Schließen Sie die Tür, Mann! Ich möchte nicht, daß das halbe Revier lauscht. Die Angelegenheit ist vertraulich, wie Sie bereits wissen. Also, was haben Sie erfahren?«
»Sehr wenig«, erwiderte Pitt. »Damals wurde gründlich recherchiert.«
»Das weiß ich, zum Teufel! Ich habe die Berichte über den Fall gelesen.« Ballarat schob die Fäuste tiefer in die Hosentaschen und wippte auf den Fußsohlen vor und zurück. »War es ein zufälliger Einbruch, irgendein Amateur, der erwischt wurde und in Panik geriet? Ich bin sicher, daß das Geschehnis nichts mit dem Außenministerium zu tun hat. Ich erfuhr von höchster Stelle . . .« Er wiederholte die Worte und ließ sie auf der Zunge zergehen. »... von höchster Stelle, daß unsere Feinde keine Kenntnis von Yorks Tätigkeit haben.«
»Eher hat ein verschuldeter Freund von York den Diebstahl begangen«, meinte Pitt unverblümt und sah den Ausdruck von Mißfallen in Ballarats Gesicht. »Er wußte, wo die Erstausgabe von Swift stand.«
»Er bekam interne Hilfe«, sagte Ballarat sofort, »durch Bestechung eines Dieners oder einer weiblichen Angestellten.«
»Möglich, angenommen, eine Bedienstete konnte eine Erstausgabe erkennen. Denn der Honorable Piers York diskutierte wohl kaum den Wert seiner Bücher mit dem Hauspersonal.«
Ballarat wollte sich schon über den sarkastischen Ton beschweren, doch dann ließ er es bleiben. »Nun, falls der Täter ein Bekannter Yorks war, müssen Sie bei der Befragung verdammt vorsichtig sein, Pitt! Wir sind da mit einer sehr heiklen Aufgabe betraut worden. Ein unbedachtes Wort, und Sie können einen guten Ruf vernichten, von Ihrer eigenen Karriere ganz zu schweigen.« Er wirkte zunehmend ungemütlicher, und sein Gesicht lief rot an. »Das einzige, was das Außenministerium von uns wünscht, ist festzustellen, daß Mrs. Yorks Haltung absolut integer war. Es ist nicht Ihre Aufgabe, den Namen eines toten Mannes zu beschmutzen, eines ehrenhaften Mannes, der seiner Königin und seinem Vaterland treu diente.«
»Aus dem Außenministerium sind Informationen verschwunden«, erklärte Pitt mit erhobener Stimme, »und der Einbruch im York-Haus verlangt viel mehr Aufklärung, als bisher geleistet wurde.«
»Dann kümmern Sie sich darum, Mann!« sagte Ballarat unfreundlich. »Finden Sie heraus, welcher der Freunde es war, oder, noch besser, beweisen Sie, daß es überhaupt kein Bekannter gewesen ist. Belegen Sie, daß Veronica Yorks Charakter über jeden, auch den geringsten, Zweifel erhaben ist, dann wird man uns allen dankbar sein.«
Pitt öffnete den Mund, um zu widersprechen, doch dann sah er in Ballarats schwarzen Augen, daß das zwecklos war. Er schluckte seinen Zorn hinunter. »Ja, Sir.«
Die kalte Luft und der Regen, der ihm in das heiße Gesicht peitschte, beruhigten ihn ein wenig. Passanten rempelten ihn an, er hörte Pferdekarren über das Pflaster rattern und sah beleuchtete Schaufenster. Gaslampen brannten in den Straßen, und in Kohlenpfannen geröstete Kastanien dufteten. Pitt hörte, wie jemand ein Weihnachtslied sang, und seine Umgebung nahm ihn gefangen. Er stellte sich die Gesichter seiner Kinder am Weihnachtsmorgen vor. Sie waren nun alt genug, um aufgeregt zu sein; Daniel fragte schon jeden Abend, ob morgen Weihnachten sei, und die sechsjährige Jemima erklärte ihm mit der Überlegenheit einer älteren Schwester, daß er noch warten müsse. Thomas Pitt lächelte. Er hatte für Daniel eine hölzerne Eisenbahn geschnitzt, mit einer Lokomotive und sechs Wagen. Für Jemima hatte er eine Puppe gekauft, und Charlotte nähte winzige Kleider, Unterröcke und ein hübsches Häubchen für diese Puppe. Kürzlich hatte er bemerkt, daß seine Frau ihr Nähzeug schnell unter einem Kissen versteckte, als er unerwartet heimkam, und ihn mit viel zu unschuldiger Miene anblickte.
Sein Lächeln vertiefte sich. Er wußte, daß sie etwas für ihn machte. Über das Geschenk, das er für sie ausgewählt hatte, freute er sich besonders — eine hohe rosafarbene Alabastervase, einfach und perfekt in der Form. Für dieses schöne Stück hatte er sieben Wochen gespart. Das einzige Problem bedeutete Emily, Charlottes verwitwete Schwester. Sie hatte aus Liebe geheiratet. Ihr Mann George war adelig und sehr reich gewesen. Nach dem Schock über den Verlust im letzten Sommer war es selbstverständlich, daß sie und ihr fünfjähriger Sohn Edward Weihnachten mit Charlottes Familie verbringen würden.
Doch was sollte Pitt mit seinen geringen finanziellen Mitteln für sie kaufen, das ihr gefallen würde?
Er hatte dieses Problem noch nicht gelöst, als er zu Hause ankam. Als erstes hängte er seinen nassen Mantel auf, zog die Stiefel aus und ging auf Socken durch den Korridor.
Dort lief ihm Jemima mit heißen Wangen und leuchtenden Augen entgegen. »Papa, ist es noch nicht Weihnachten?«
»Nein, noch nicht!« Er hob sie hoch und drückte sie an sich.
»Bist du sicher?«
»Ja, mein Liebling, ich bin sicher.« Er trug sie in die Küche und stellte sie auf den Boden. Gracie, das Dienstmädchen, beschäftigte sich im oberen Stockwerk mit Daniel. Charlotte war allein und gerade dabei, den Weihnachtskuchen aus dem Ofen zu holen. Eine Locke fiel ihr in die Stirn. Sie lächelte Thomas zu. »Gibt es einen interessanten Fall?«
»Nein, nur einen alten, der zu nichts führen wird.« Er küßte sie zuerst einmal, dann öfter mit wachsender Zärtlichkeit.
»Nichts?« fragte sie erneut.
»Nichts, nur eine Formalität.«
2
Anfangs gab sich Charlotte mit Thomas’ kurzer Auskunft zufrieden, weil die Weihnachtsvorbereitungen sie voll in Anspruch nahmen. Zu jeder anderen Zeit wäre sie viel wißbegieriger und auch hartnäckiger gewesen. In der Vergangenheit hatte sie sich intensiv mit einigen von Thomas’ spektakulärsten und tragischsten Fällen befaßt, teils aus Neugierde, teils auch aus Wut über irgendein Geschehnis. Erst letzten Sommer war der Mann ihrer Schwester Emily ermordet worden, und Emily war die Hauptverdächtige gewesen. George hatte ein kurzes, aber heftiges Liebesverhältnis mit Sybilla March gehabt, und Emily war die einzige, die wußte, daß es in der Nacht vor seinem Tod ein Ende gefunden hatte. Wer sollte ihr Glauben schenken, nachdem der Augenschein gegen sie sprach? Zumal Emily bei ihren Bemühungen, Georges Aufmerksamkeit zurückzugewinnen, mit Jack Radley geflirtet und damit selbst den Eindruck erweckt hatte, in eine romantische Affäre verstrickt zu sein.
Charlotte war nie so verängstigt gewesen wie zu dieser Zeit, und nie zuvor hatte sie wahre Tragik so hautnah gespürt. Als ihre ältere Schwester Sarah gestorben war, hatte das einen plötzlichen, herben Verlust bedeutet, doch es war ein rein zufälliges Unglück gewesen, das jedem hätte zustoßen können. Georges Tod war etwas anderes; eine innere Entfremdung war ihm vorausgegangen. Emilys Gefühle der Sicherheit und Liebe waren durch Georges Untreue zerstört und alle Gemeinsamkeiten mit einem Schatten des Zweifels belegt worden. Welchen Defekt wies Emily auf, wieviel Leere steckte in dem Vertrauen, das sie so tief empfunden hatte, daß George einer anderen Frau mit solcher Leidenschaft verfallen konnte? Die Versöhnung danach war so kurz, so zerbrechlich und so geheim gewesen, daß niemand davon gewußt hatte. Und am nächsten Morgen war George tot.
Im Gegensatz zu Sarahs Tod hatte es kein Mitgefühl und keine Rücksichtnahme von seiten der Freunde gegeben, eher Argwohn und sogar Haß. Alter Groll und Mißverständnisse wurden aufgerührt, Schuldzuweisungen kursierten, und jeder fürchtete, der Fall könnte eigene Geheimnisse und Verfehlungen ans Licht der Öffentlichkeit zerren.
Das war nun sechs Monate her, und Emily hatte sich von dem Schock erholt. Sie wurde wieder von der Gesellschaft akzeptiert, und die Leute überschlugen sich in dem Bemühen, ihr früheres Benehmen wiedergutzumachen. Dennoch wurde erwartet, daß Witwen ihre Trauer zeigten, vor allem solche, deren Männer aus alten vornehmen Adelsfamilien stammten wie die Ashworths. Die Tatsache, daß Emily noch keine dreißig war, entband sie keinesfalls von der Pflicht, daheim zu bleiben, nur Verwandte zu empfangen und ununterbrochen Schwarz zu tragen. Sie durfte keine gesellschaftlichen Aufgaben übernehmen, die in irgendeiner Weise angenehm oder vergnüglich gewesen wären, und sie mußte jederzeit eine ernste Miene zur Schau stellen.
Emily fand das beinahe unerträglich. Zunächst, als Georges Mörder gefunden und der Fall abgeschlossen war, hatte sie sich mit Edward aufs Land begeben, um allein zu sein und dem Jungen über den Verlust hinwegzuhelfen. Im Herbst war sie in die Stadt zurückgekehrt, doch alle Zusammenkünfte, Opern, Bälle und Abendgesellschaften waren tabu für sie. Die Freunde, die sie besuchten, benahmen sich todernst bis zur Albernheit, niemand erzählte ihr den neuesten Klatsch oder plauderte mit ihr über Mode, weil diese Themen für eine trauernde Witwe zu oberflächlich waren. Emily empfand die Zeit zu Hause, die sie mit Briefeschreiben, Klavierspielen und Sticken verbrachte, als haarsträubend und frustrierend.
Natürlich hatte Charlotte ihre Schwester und Edward zu Weihnachten eingeladen, und für den Jungen würde das Spielen mit anderen Kindern das schönste Geschenk sein.
Doch was war nach Weihnachten? Emily würde wieder in ihre Villa zurückkehren und sich wie vorher langweilen.
Sosehr Charlotte ihre Kinder und ihr Heim liebte, empfand auch sie die familiäre Trauerzeit mit dem dazugehörigen Hausarrest allmählich als belastend. Deshalb lag ihr besonders daran, an Thomas’ neuem Fall teilzunehmen und ein wenig Ablenkung darin zu finden.
Am folgenden Abend näherte sich Charlotte dem Thema ihres Anliegens etwas sorgfältiger. Sie saßen nach dem Abendessen vor dem Kamin im Wohnzimmer. Die Kinder waren längst im Bett. Charlotte stickte Schmetterlingsornamente für den Christbaum.
»Thomas«, begann sie ungezwungen, »wenn dein gegenwärtiger Fall wirklich so unwichtig ist, könntest du ihn dann über Weihnachten nicht ruhen lassen?« Sie schaute nicht auf, sondern richtete den Blick auf ihre feine Handarbeit.
»Ich...« Er zögerte. »Ich denke, es könnte mehr dahinter sein, als ich zuerst vermutete.«
Charlotte unterdrückte ihre Neugier mit großer Anstrengung. »Oh, wieso?«
»Ein nächtlicher Einbruch, der kaum zu verstehen ist.«
»Oh.« Diesmal brauchte sie ihre Interesselosigkeit nicht zu heucheln. Einbrüche waren unpersönlich, der Verlust von Besitztümern berührte sie wenig. »Was wurde gestohlen?«
»Zwei Miniaturbilder, eine Vase, ein Briefbeschwerer und eine Erstausgabe.«
»Was ist daran so schwer zu verstehen?« Sie blickte auf und sah, wie er lächelte. »Thomas!« Sofort wußte sie, daß er noch eine geheimnisvolle Information zurückhielt.
»Der Sohn des Hauses überraschte den Dieb und wurde getötet.« Er betrachtete sie und amüsierte sich über ihren Versuch, gleichmütig zu erscheinen. »Und die gestohlenen Gegenstände tauchten niemals auf.«
»Und?« Ohne es zu merken, hatte sie ihr Nähzeug fallen lassen. »Thomas!«
Er machte es sich in seinem Stuhl bequem, schlug die Beine übereinander und erzählte ihr, was er wußte. Er vergaß auch nicht zu erwähnen, was Ballarat gesagt hatte. Charlotte nahm ihre Näharbeit wieder auf. »Was willst du tun?«
»Den Diebstahl verfolgen, soweit ich kann«, erwiderte er.
»Was für eine Frau ist die Witwe?« fragte Charlotte. Sie wollte mehr erfahren. Vielleicht konnte sie Emily etwas Interessantes erzählen.
»Ich weiß es nicht. Ich konnte sie bisher noch nicht aufsuchen, ohne ihren Verdacht zu erwecken, und das ist das letzte, was das Außenministerium möchte. Übrigens, du hast Jack Radley schon lange nicht mehr erwähnt. Hat Emily noch Kontakt zu ihm?«
Diese Angelegenheit lag Charlottes Herz viel näher, und sie war bereit, dafür Thomas’ unbefriedigenden Fall sausen zu lassen. Jack Radley, der Emily anfangs nur dazu gedient hatte, George eifersüchtig zu machen, hatte sich als verläßlicher Freund entpuppt; er war lange nicht so oberflächlich und egoistisch wie sein Ruf. Er besaß kein Geld und keine aussichtsreiche Position; deshalb lag der Gedanke nahe, daß er Emily wegen des Reichtums, den sie von George geerbt hatte, hofierte. Sein Erfolg bei Frauen war bekannt. Kurze Zeit hatte er unter dem Verdacht gestanden, George ermordet zu haben, um Emily später zu heiraten und an ihr Vermögen heranzukommen.
Doch seine Unschuld hatte sich bald herausgestellt. Dennoch war er keineswegs der Freier, den sich die Gesellschaft — zu gegebener Zeit — für Emily gewünscht hätte. Ihre Mutter wäre entsetzt gewesen.
Allerdings störte das Charlotte wenig. Die Empörung der Leute konnte nicht schlimmer sein als bei ihrer eigenen Hochzeit mit einem Polizisten. Jack Radley war trotz seiner Mittellosigkeit ein Gentleman. Polizisten galten kaum mehr als Gerichtsdiener und Rattenfänger. Aber war Jack Radley wahrer Liebe fähig? Die Annahme, jeder Mensch könne lieben, wenn er dem richtigen Partner begegnete, war ein romantischer Trugschluß. Viele suchen nur das Herkömmliche — ein Heim, eine gesellschaftliche Stellung, Kinder, die weitere Familie. Sie wollen ihre Gedanken und Mußestunden nicht teilen, ihr Innerstes nicht bloßlegen, ihre Träume nicht verraten, um unverwundbar zu bleiben. Sie gehen kein Risiko ein. Sie bieten keine Großzügigkeit der Seele, nur Sicherheit. Diese Menschen sind unfähig zu geben, weil sie die Kosten scheuen. Ungeachtet seines Charmes, seiner Intelligenz und liebenswürdigen Art — falls Jack Radley zu diesen gehörte, würde er Emily letzten Endes nur Leid bringen. Und das wollte Charlotte um jeden Preis verhindern.
»Charlotte?« Thomas Pitt unterbrach ihre Gedanken ein wenig ungeduldig. Auch ihm war Emilys Wohlergehen wichtig, denn er mochte seine Schwägerin sehr.
»Ich glaube schon«, sagte Charlotte schnell. »Wir haben wegen der Weihnachtsvorbereitungen kaum über ihn gesprochen. Emily bringt eine Gans und Fleischpasteten mit.«
Er streckte die Füße zum Feuer hin aus. »Ich meine, wenn du schon Detektiv spielen willst, solltest du dein Beurteilungsvermögen lieber an Jack Radley ausprobieren, als Spekulationen über Mrs. York anzustellen.«
Sie erwiderte nichts. Er hatte zweifellos recht, und obwohl er sehr sanft gesprochen hatte, war ihr seine Bemerkung fast wie ein Befehl vorgekommen. Trotz seiner bequemen Haltung und lässigen Art war Thomas Pitt bekümmert.
Charlotte jedoch hatte die Absicht, beide Anliegen zu kombinieren.
Sie legte sich einen Plan zurecht, der bereits fertig war, als Emily am nächsten Morgen kurz nach elf Uhr zu Besuch kam. Sie stürmte sofort in die Küche, umschmeichelt von einem eleganten schwarzen Mantel mit schwarzem Fuchsbesatz bis zum Kinn; ihr helles Haar kringelte sich unter einem schwungvollen schwarzen Hut. Einen Augenblick lang war Charlotte neidisch — der teure Mantel sah so unbeschreiblich schick aus. Dann erinnerte sie sich daran, warum ihre Schwester Schwarz trug, und schämte sich. Abgesehen von den roten Flecken auf den Wangen, die der eisige Wind verursacht hatte, war Emily blaß und hatte tiefe dunkle Ringe unter den Augen. Man brauchte Charlotte nicht zu sagen, daß ihre Schwester rastlos war und zu wenig schlief. Langeweile ist durchaus nicht das schlimmste von allen Übeln, doch sie bringt eine Art von Entkräftung mit sich. Weihnachten würde rasch vorbei sein, und was wollte Emily danach anfangen?
»Möchtest du eine Tasse Tee?« fragte Charlotte und wandte sich dem Ofen zu, ohne eine Antwort abzuwarten. »Warst du schon einmal in Hanover Close?«
Emily zog den Mantel aus und setzte sich an den Küchentisch. Ihr Kleid war ebenfalls hochelegant, doch sie füllte es nicht mehr an allen Stellen aus wie früher.
»Nein, aber ich weiß, wo es ist. Warum?« Charlotte erwähnte gleich den interessantesten Punkt. »Dort ist ein Mord passiert.«
»In Hanover Close?« Plötzlich war Emily höchst aufmerksam. »Gütiger Himmel! Das ist eine total exklusive Gegend — nur bester Geschmack und eine Menge Geld. Wer ist tot?«
»Robert York. Er arbeitete im Außenministerium.«
Normalerweise las eine Dame von Emilys Stand überhaupt keine Zeitung, höchstens die Gesellschafts- und Hofnachrichten. Doch im Gegensatz zu ihrem Vater war George in diesen Dingen sehr nachsichtig gewesen, solange Emily die Aktualitäten nicht mit anderen Leuten besprach. Außerdem tat sie nach seinem Tod natürlich das, was ihr gefiel.
Charlotte stellte die Teekanne, ein Sahnekännchen und zwei ihrer besten Tassen auf den Tisch. »Es geschah vor drei Jahren«, sagte sie möglichst gelassen. »Thomas wurde jetzt gebeten, den Fall wieder aufzurollen, weil die Witwe erneut einen Mann aus dem Außenministerium heiraten will.«
Emily wurde munter. »Ist sie schon verlobt? Davon habe ich nichts gehört, obwohl ich die Gesellschaftsseiten immer lese. Das ist der einzige Weg für mich, irgend etwas zu erfahren. Niemand erzählt mir Neuigkeiten, so, als dürfte man mich nicht mehr an die Beziehungen zwischen Mann und Frau erinnern.« Unbewußt ballte sie die Fäuste.
Charlotte bemerkte es. »Das ist der Punkt«, meinte sie rasch. »Thomas soll Nachforschungen anstellen, ob sie die angemessene Partnerin für Mr. Danver ist, einen Mann, der einmal eine wichtige Rolle spielen wird.«
»Kann man denn an ihrer Integrität zweifeln?« fragte Emily erstaunt. »Bitte schenk den Tee ein, ich bin so ausgetrocknet wie die Sahara. Hat die Frau einen guten Ruf? Ich wünschte, ich wüßte mehr. Ich bin so abgeschnitten von allen, als hätte ich die Lepra. Die Hälfte meiner Bekannten geht mir aus dem Weg, die andere Hälfte sitzt feierlich in meinem Salon und flüstert, als läge ich im Sterben.«
Charlotte schüttelte den Kopf. »Leider weiß ich auch nicht mehr — nur, daß das Verbrechen ungeklärt blieb.« Sie schob ihrer Schwester die Tasse mit dem duftenden Getränk hin und schnitt einen frischen Ingwerkuchen an. »Es ist eine seltsame Geschichte.« Und sie erzählte Emily alles, was Thomas ihr berichtet hatte.
»Sehr seltsam«, stimmte Emily schließlich zu. »Ich überlege, ob sie einen Liebhaber hatte und ein Streit stattfand. Vermutlich möchte das Außenministerium das wissen, aber man scheut sich, es direkt zu sagen, denn wenn Mr. Danver das erführe, gäbe es einen fürchterlichen Stunk. Zudem würde es ihm sehr schaden — er könnte diesen Schandfleck nie mehr ganz tilgen.«
»Ebensowenig wie sie. Wenn es nicht stimmen würde, geschähe den beiden himmelschreiendes Unrecht. Ich weiß nur nicht, wie Thomas es anstellen will, etwas herauszufinden. Ein Polizist kann wohl kaum die feinen Bekannten der Dame ausfragen.«
Emily lächelte. »Meine liebe Charlotte, du brauchst nicht mit dem Zaunpfahl zu winken! Selbstverständlich werden wir uns der Sache annehmen. Wir haben lange genug zu Hause gesessen. Wir werden Veronica Yorks untadeligen Ruf beweisen oder ihn gänzlich ruinieren. Wo fangen wir an?«
Charlotte hatte die Schwierigkeiten schon durchdacht. Emily konnte sich in der Gesellschaft nicht mehr so bewegen wie zu Lebzeiten ihres Mannes, und Charlotte, als Ehefrau eines Polizisten, hatte weder das Geld für passende Garderobe noch den Freundeskreis, an den sie sich wenden konnte. Es blieb nur noch Georges Großtante Vespasia, die verstehen und helfen würde, aber sie war schon über Achtzig und hatte sich seit Georges Tod von den meisten Aktivitäten ferngehalten. Sie widmete sich vielfach sozialen Aufgaben und glaubte, daß der Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit durch Gesetzesreformen gewonnen werden könnte. Zur Zeit bemühte sie sich um Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in Fabriken, die Kinder beschäftigten, vor allem Kinder unter zehn Jahren.
Charlotte schenkte sich noch einmal Tee ein und trank einen Schluck. »Stehst du noch mit Jack Radley in Verbindung?« fragte sie unschuldig, als hätte das mit dem Thema Veronica York zu tun.
Emily nahm sich noch ein Stück Ingwerkuchen. »Er besucht mich ab und zu. Meinst du, er sollte uns unterstützen?«
»Vielleicht könnte er uns helfen, ein... ein Treffen zu vereinbaren. «
»Nicht uns.« Emily rümpfte die Nase. »Dir.«
Charlotte nickte. »Ich weiß, daß ich es diesmal machen muß. Und du könntest mich anweisen! Ich werde jede Information, die ich ergattern kann, sammeln, und wir beide werden dann herausfinden, welche Bedeutung dahintersteckt.«
Emily wollte nicht warten, bis Jack Radley sich meldete. Er machte aus seiner Bewunderung kein Hehl. Emily zweifelte nicht an seinem Interesse, jedoch an dessen Motiven. Verehrte er sie um ihrer selbst willen oder weil sie Georges Witwe war, mit Georges Position und Georges Geld? Sie genoß seine Gesellschaft sehr, trotz ihres Verdachtes, und das wunderte sie. Aber wie nahe sind sich Sympathie und Liebe?
Als Emily George geheiratet hatte, war er der große Fang auf dem Heiratsmarkt gewesen. Sie hatte seine Fehler wohl erkannt, wegen der guten Partie, die sie gemacht hatte, jedoch großzügig darüber hinweggesehen. Und er hatte all ihre Hoffnungen erfüllt und ihre Schwächen niemals kritisiert. Was als perfektes gegenseitiges Verstehen begonnen hatte, entwickelte sich zu einer warmen Beziehung. Ihr erster Eindruck von ihm war der des hübschen unbekümmerten Lord George Ashworth, des idealen Ehemannes, gewesen. Im Lauf der Zeit waren ihre Gefühle für George zu einer zärtlichen und treuen Liebe herangereift, da sie erkannt hatte, daß er tüchtig im Sport und in Finanzangelegenheiten, charmant in Gesellschaft, charakterlich ohne jede Falschheit oder Raffinesse war. Emily hatte immer genug Klugheit besessen, ihn nicht merken zu lassen, daß sie wahrscheinlich intelligenter und auch mutiger war als er. Auch besaß sie weniger Toleranz und Großzügigkeit im Urteil. George konnte aufbrausend sein, doch immer nur vorübergehend. Er hatte die Schwächen seines Standes ebenso wie die der anderen gesellschaftlichen Gruppen ignoriert. Das brachte Emily nicht fertig. Ungerechtigkeit machte sie wütend, jetzt noch mehr als in ihrer Jugendzeit. Im Laufe der Jahre wurde sie Charlotte immer ähnlicher, die stets eigensinnig, schnell verärgert und kämpferisch gewesen war, wenn sie etwas für falsch hielt, obwohl sie in ihrer Reaktion auch manchmal weit über das Ziel hinausschoß. Emily war immer etwas sensibler gewesen — jedenfalls bisher.
Nun setzte sie sich hin und schrieb einen Brief an Jack Radley, in dem sie ihn bat, sie baldmöglichst zu besuchen. Sobald das Schreiben versiegelt war, schickte sie einen Diener damit weg.
Radleys Antwort kam befriedigend rasch. Er erschien am frühen Abend zu der Stunde, da Emily sich in glücklicheren Zeiten für ein großes Abendessen, einen Ball oder das Theater umgezogen hätte. Nun saß sie vor dem Feuer und las das Buch »Dr. Jekyll und Mr. Heyde« von Robert Louis Stevenson, das im Vorjahr herausgekommen war.
Jack Radley betrat das Zimmer sofort, nachdem das Stubenmädchen ihn angekündigt hatte. Er war lässig gekleidet, doch seine tadellos geschnittene Hose und die perfekt sitzende Jacke verrieten einen hervorragenden Schneider. Emily blickte ihm jedoch in die bemerkenswert schönen Augen, die Besorgnis ausdrückten.
»Emily, geht es dir gut?« fragte er und betrachtete sie forschend. »Dein Brief klang dringend. Ist etwas passiert?«
Sie kam sich ein wenig dümmlich vor. »Es tut mir leid, wenn ich mein Schreiben mißverständlich formuliert habe. Es geht mir sehr gut, danke. Aber ich langweile mich furchtbar, und Charlotte hat ein Geheimnis entdeckt.« Es hatte keinen Sinn, ihn anzulügen.
Seine Züge entspannten sich zu einem Lächeln, und er nahm ihr gegenüber Platz auf einem Stuhl. »Ein Geheimnis?«
Sie versuchte, ihrer Stimme einen unbekümmerten Klang zu geben, denn sie erkannte plötzlich, daß er vielleicht dachte, sie habe einen Vorwand gesucht, um ihn zu rufen. »Einen alten Mord, hinter dem möglicherweise ein Skandal steckt, der eine unschuldige Frau ruinieren und ihr die Chance nehmen könnte, den Mann zu heiraten, den sie liebt.«
Er sah verblüfft aus. »Aber was kannst du tun? Und wie kann ich helfen?«
»Natürlich kann die Polizei einige Fakten entdecken«, erklärte sie. »Aber sie vermag sich nicht so einzumischen wie wir, denn die Angelegenheit muß völlig diskret behandelt werden.« Sie merkte entzückt, daß sie sein Interesse geweckt hatte. »Und niemand wird vor der Polizei so frei reden wie vor uns.«
»Aber wie sollen wir es anstellen, diese Leute zu beobachten?« meinte er ernst. »Du hast mir nicht gesagt, um wen es sich handelt, aber davon abgesehen, Emily, du kannst dich noch nicht wieder in der Gesellschaft blicken lassen.« Seine Züge verschlossen sich, und für einen kurzen Moment glaubte sie Mitleid darin zu entdecken. Von jemand anderem hätte sie Mitleid vielleicht akzeptiert, aber von Jack schmerzte es wider Erwarten.
»Ich weiß, daß ich das nicht kann«, erklärte sie heftig. »Aber Charlotte könnte, wenn du ihr helfen würdest.«
Er lächelte matt. »Ich habe ein großes Talent, Bekanntschaften zu machen. Wer sind die Leute?«
Sie sah ihn an und dachte, wie hübsch seine Wimpern sein Gesicht beschatteten. Wie viele andere Frauen hatten das wohl auch schon festgestellt? Emily rief sich zur Ordnung. Was waren das für dumme Gedanken? Charlotte hatte recht — sie brauchte eine Beschäftigung, ehe sie völlig überschnappte.
»Der Ermordete war Robert York«, sagte sie forsch. »Die Witwe ist Veronica York und wohnt in Hanover Close.« Sie hielt inne, denn er lächelte breit.
»Kein Problem, ich habe sie gekannt, ich . . .« Er zögerte und war offenbar unsicher, wie indiskret er sich zeigen durfte.
Emily spürte einen untypischen Stich der Eifersucht. Sie wußte, daß das äußerst albern war, denn sie kannte Jacks Ruf. Überdies hatte sie sich niemals einer Selbsttäuschung hingegeben. Sie wußte genau, daß Männer an sich selbst ganz andere Maßstäbe anlegten als an Frauen. Männer achteten nur darauf, sich nicht direkt erwischen zu lassen — was gemutmaßt wurde, war unwichtig. Allen realistischen Menschen waren diese Tatsachen bekannt. Nur mit Scheuklappen konnte man sich seelischen Frieden erkaufen. Allerdings entwickelte Emily einen zunehmenden Widerwillen diesen Gegebenheiten gegenüber.
»War deine Bekanntschaft derart, daß du sie problemlos erneuern kannst?« fragte sie spitz.
Er machte ein langes Gesicht. »Selbstverständlich.«
Sie senkte den Blick, um ihre Gefühle zu verbergen. »Würdest du das dann tun — mit Charlotte?«
»Natürlich«, erwiderte er langsam. »Aber wird das Pitt recht sein? Und ich kann sie nicht als Polizistenfrau vorstellen, da müssen wir uns etwas einfallen lassen.«
»Thomas braucht es nicht zu wissen. Sie kann zuerst hierherkommen, sich ein Kleid von mir leihen und als . . . als deine Cousine vom Land auftreten, so daß du sie ohne weiteres ohne Anstandsdame mitnehmen kannst.«
»Wird sie damit einverstanden sein?«
»O ja«, antwortete Emily bestimmt. »Das wird sie ohne Zweifel.«
Zwei Tage später saß Charlotte hübsch gekleidet in einer eleganten Kutsche neben Jack Radley. Er hatte sich gleich nach seinem Besuch bei Emily im York-Haus angemeldet und fragen lassen, ob er seine Cousine, Miß Elizabeth Barnaby, vorstellen dürfe. Sie habe ihre kranke Tante auf dem Land lange gepflegt und benötige nach deren Genesung ein wenig Ablenkung.
Die Antwort war kurz, aber höflich und positiv ausgefallen.
Charlotte zog die Decke fester um ihre Knie. Es war bitter kalt in der Kutsche, und draußen regnete es in Strömen. Die Lederpolster fühlten sich feucht an, und Charlotte fror. Emilys Kleid war schön und passend für den Anlaß. Ihr Mädchen hatte es über dem Busen weiter gemacht und die Ärmel ein Stück verlängert, und es war ein Modell, wie es eine junge gediegene Frau vom Land wohl tragen mochte.
Die Kutsche hielt an. Charlotte warf Jack Radley einen raschen Blick zu und schluckte. Plötzlich kam ihr zu Bewußtsein, wie unbesonnen ihr Handeln war. Wenn Thomas davon gewußt hätte, wäre er wütend gewesen. Die Möglichkeit, entdeckt zu werden, lag nahe. Wie leicht könnte Charlotte sich versprechen, einen entscheidenden Fehler begehen oder auch jemand treffen, der sie von früher her kannte, als sie noch in diesen Kreisen verkehrte.
Jack half ihr beim Aussteigen, und sie duckte sich vor dem peitschenden Regen, der sie wie mit eiskalten Nadeln traf. Jetzt konnte sie Jack nicht einfach sagen, sie habe ihr Vorhaben geändert. Sie wog ihre innere Warnung und die Vorstellung von Thomas’ Zorn gegen die prickelnde Aufregung ab, die sie bei der Diskussion des Planes mit Emily verspürt hatte.