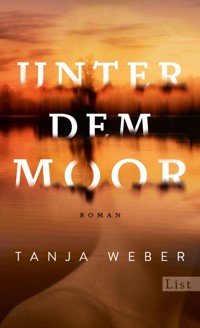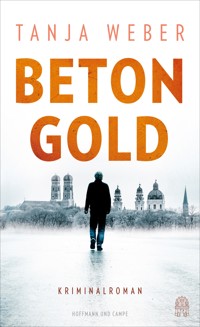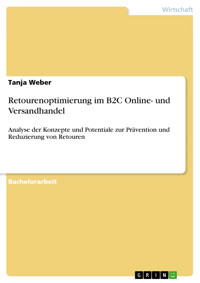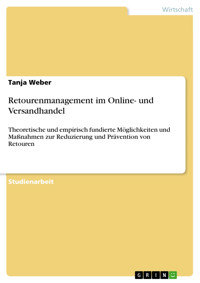6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Familiengeheimnis, das Generationen überdauert - eine fesselnde Reise in die Vergangenheit Die 38-jährige Kunsthistorikerin Elsa erhält einen ungewöhnlichen Auftrag: Sie soll einem Diebstahl nachgehen, bei dem es sich um ein Gemälde handelt, das seit Generationen im Besitz ihrer Familie war. Der Familienlegende nach stellt es Elsas Urgroßmutter Anneli Gensheim dar, doch Elsas Vater hatte das Bild vor Jahren an ein Auktionshaus verkauft. Bei der Suche nach dem verschwundenen Kunstwerk taucht Elsa immer tiefer in ihre eigene geheimnisvolle Familiengeschichte ein. Auf ihrer Spurensuche deckt die Kunsthistorikerin nicht nur die wahre Identität der Frau auf dem Gemälde auf, sondern entdeckt auch, wer ihre Urgroßmutter Anneli wirklich war. Die Frauen meiner Familie von Tanja Weber ist ein fesselnder Generationenroman, der von der Nazizeit bis in die Gegenwart reicht. Eine berührende Geschichte über Familiengeheimnisse, eine besondere Vater-Tochter-Beziehung und die Macht der Liebe, die Generationen überdauert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Tanja Weber
Die Frauen meiner Familie
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die 38-jährige Elsa ist Kunsthistorikerin und soll einem Diebstahl nachgehen. Es ist ein ganz besonderer Auftrag, denn es handelt sich um ein Gemälde, das Elsas Familie seit Generationen gehörte und der Familienlegende nach ihre Urgroßmutter Anneli Gensheim darstellt. Elsas Vater hatte das Gemälde jedoch vor einigen Jahren an ein Auktionshaus veräußert. Auf der Suche nach dem verschwundenen Bild taucht die Kunsthistorikerin immer tiefer in ihre eigene geheimnisvolle Familiengeschichte ein und entdeckt so nicht nur die wahre Identität der Frau auf dem Gemälde, sondern auch, wer ihre Urgroßmutter Anneli wirklich war …
Inhaltsübersicht
Zitat
I
München-Schwabing im Jahr 1982, [...]
München-Schwabing, Giselastraße, im November [...]
München-Maxvorstadt, ein Büro in [...]
München-Schwabing im August 1912, [...]
Zitat
II
Wernigerode im Harz, September [...]
München, Marstallplatz, am Nachmittag [...]
Justizpalast München, Prielmayerstraße, Montag, [...]
München-Schwabing, Feilitzschstraße, August 1914
Zitat
III
München-Isarvorstadt, Theresienwiese, 2. Oktober [...]
München-Altstadt, 10. März 1933
Pasing, 15. September 1934
München-Schwabing, Mandlstraße, Anfang November [...]
München-Schwabing, in der Nacht [...]
Epilog
München-Schwabing, Feilitzschstraße, 10. November, [...]
Nachwort
Die Kunst blüht, die Kunst ist an der Herrschaft, die Kunst streckt ihr rosenumwundenes Zepter über die Stadt hin und lächelt. Eine allseitige, respektvolle Anteilnahme an ihrem Gedeihen, eine allseitige, fleißige und hingebungsvolle Übung und Propaganda in ihrem Dienste, ein treuherziger Kultus der Linie, des Schmuckes, der Form, der Sinne, der Schönheit obwaltet … München leuchtete.
Thomas Mann, Gladius Dei
I
München-Schwabing im Jahr 1982, eine weiträumige Altbauwohnung am Englischen Garten
Wenn Elsa erwachte, war das Erste, was sie sah, die Frau. Sie musste ihr direkt in die Augen blicken. Ganz gleich ob sie auf der Seite lag oder auf dem Rücken, ihre Augen wurden, kaum hatten sie sich geöffnet, magisch von ihr angezogen.
Manchmal dachte Elsa, dass sie nicht einschlafen konnte, weil sie wusste, dass da die Frau war. Diese bunte, schräge Frau mit den grünen Flecken auf den Wangen und den kohlschwarz umrandeten Augen. Sie dachte, dass die Frau sie beobachtete.
Wie alt mochte die Frau sein? So alt wie Elsas Mutter? Oder eher wie ihre Oma? Sie war seltsam gekleidet, die bunte Frau. Eine weiße Bluse war ihr über beide Schultern gerutscht, und sie versuchte mit einer Hand, jede weitere Entblößung zu verhindern. Dabei lächelte sie. Ihre Haare waren ein schwarzer Haufen, türmten sich dunkel drohend auf dem Kopf. Die Augen saßen nicht wie bei normalen Menschen einfach nebeneinander, sondern schräg und in unterschiedlicher Höhe. Deshalb sah es ein bisschen so aus, als würde die Frau schielen. Eine richtige Nase hatte sie auch nicht, nur zwei Löcher. Und ebendiese bunte Farbe – Flecken im Gesicht.
Elsa fand, dass sie schon besser malen konnte. Sie war sieben, und mit sieben malte man den Leuten keine gelben, roten und grünen Flecken ins Gesicht. Auch eine Nase gelang ihr besser, sie hatte geübt. Meistens zeichnete sie mit dem Bleistift den Schwung der Nase vor, ebenso den Umriss der Augen. Erst wenn sie ganz zufrieden damit war, begann sie, das Gesicht auszumalen. Das hatte der Mensch, der das Bild mit der Frau gemalt hat, wohl nicht getan. Er hatte einfach drauflosgekleckst. Oder ob ein Kind die Frau gemalt hat? Warum hing das Bild dann aber in einem großen Goldrahmen? Ihre Mutter pinnte die Bilder, die Elsa malte, einfach mit Stecknadeln an die Wand, auch die allerschönsten. Nie käme sie auf die Idee, ein Bild von ihr oder ihrem Bruder Arto in einem Goldrahmen an die Wand zu hängen. Obwohl, dachte Elsa, Artos Bilder sind es auch nicht wert. Er war älter als sie, aber er malte Menschen noch immer als Strichmännchen.
Seit Elsa regelmäßig ihre Großeltern besuchte, musste sie mit dem Bild in einem Zimmer schlafen. Am Anfang hatte sie sich vor dem Bild gegruselt, aber jetzt war es besser. Es wurde von Besuch zu Besuch freundlicher, das Bild. Und jetzt, wo sie schon seit zwei Jahren regelmäßig nach München zu Oma und Opa kam, glaubte sie zu erkennen, wie die bunte Frau sie anlächelte. Manchmal jedenfalls.
Elsa begann, die Frau zu mögen.
Leise klopfte es an die Tür. Gleichzeitig wurde die Klinke heruntergedrückt, und ihre Oma Regine kam herein. Wie jeden Morgen mit einem Glas Orangensaft auf einem kleinen Porzellanteller mit bunten Blüten. Auf jeder Blüte lag ein Gummibärchen, farblich sortiert, so wie Elsa es mochte. Erst wenn sie alle Gummibärchen aufgegessen hatte, musste sie aufstehen und zum Frühstück kommen. Dann gab es Toast mit Honig. Der Honig war in einem Plastikbären. Elsa war begeistert von dem Bären, sie aß viel zu viel Toast bei Oma und Opa, weil sie es liebte, den Honig aus dem Bauch des Bären zu drücken. Nach dem ersten Besuch vor zwei Jahren hatte Oma ihr den Honigbären geschenkt. Aber als Elsa ihn zu Hause stolz gezeigt hatte, hatte Ricarda, ihre Mutter, nur die Augen verdreht und gesagt, dass im Plastik Giftstoffe seien. Also aß Elsa nur bei Oma und Opa den Honig aus dem Bären. Außerdem gab es hier Toast, nicht das selbstgebackene Brot wie zu Hause. Und Elsa durfte Oma und Opa sagen, sie musste ihre Großeltern nicht beim Vornamen nennen wie ihre Mutter, die niemals Mama hieß, sondern Ricarda.
»Guten Morgen, mein Goldschatz.« Oma strich ihr über das Haar. Sie stellte den kleinen Porzellanteller auf das Nachttischchen, dann setzte sie sich zu Elsa auf das Bett. »Hast du gut geschlafen?«
Elsa schnappte sich ein Gummibärchen und nickte. »Wer hat das Bild gemalt, Oma?« Sie zeigte auf die bunte Frau.
Oma blickte auf das Bild und lächelte sanft. »Wie der Maler heißt, weiß ich nicht, aber ich weiß, wer das auf dem Bild ist.«
»Die bunte Frau?« Elsa war überrascht. Das sollte eine Frau aus Fleisch und Blut gewesen sein?
»Ja.« Oma guckte noch immer das Bild an. »Das ist deine Uroma Anneli. Die Mutter von deinem Opa.«
Elsa betrachtete die Frau nun genauer. Aber sie stellte keine Ähnlichkeit fest, weder mit ihrem Opa noch mit sich selbst. So sah einfach kein normaler Mensch aus.
»Warum ist sie so hässlich?«
Jetzt lachte ihre Oma und stand auf. Sie ging näher an das Bild heran. »Damals hat man so gemalt. Das nennt man Expressionismus. Deine Uroma war noch ganz jung. Sie kannte den Maler bestimmt. Er hat sie nicht so gemalt, wie sie aussah, wie jedermann sie sah. Sondern so, wie seine Gefühle für sie waren. Mon amour heißt das Bild. Meine Liebe.«
Elsa sagte nichts. Sie hatte nicht verstanden, was Oma meinte. Aber sie war völlig fasziniert davon, dass sie mit der Person auf dem Bild verwandt sein sollte.
»Das hier war ihr Zimmer.« Ihre Großmutter drehte sich einmal langsam um die eigene Achse. »Die Wohnung hat ihr gehört. Und als sie ganz alt und krank war, sind Opa und ich hier eingezogen und haben sie gepflegt. In diesem Zimmer hat sie gelebt. Jetzt ist es das Gästezimmer.« Sie lachte wieder. »Aber du bist unser einziger Gast, also ist es ein bisschen dein Zimmer.« Sie ging zur Tür. »Und jetzt schnell, wir wollen doch heute auf die Wiesn.«
Die Wiesn! Elsa beeilte sich, den Saft und die Gummibärchen hinunterzuschlingen, während sie aus dem Nachthemd schlüpfte und sich rasch anzog. Das karierte Sommerkleid sah ein wenig wie ein Dirndl aus, die Großeltern hatten es ihr gestern beim Schlichting gekauft. Dazu die neuen Strümpfe. Weiße Kniestrümpfe mit Lochmuster. Elsa war wahnsinnig stolz auf diese besonderen Strümpfe. Kein Mädchen in der Kommune hatte etwas so Schönes.
Als Elsa fertig angezogen war, stopfte sie die letzten drei Gummibärchen in den Mund und verließ das Zimmer. In der Tür drehte sie sich noch einmal um, sah zu der bunten Frau auf dem Bild.
»Tschüss, Oma«, sagte sie. »Uroma.«
Dann schloss sie die Tür und ging.
München-Schwabing, Giselastraße, im November 1912
Der junge Maler Rudolf Newjatev war im Schaffensrausch. Seine Wangen glühten, er riss sich das ohnehin dünne Hemd, das ihm am mageren Oberkörper schlackerte, noch weiter auf. Die Farbe spritzte nur so von seiner Palette: karmesinrot, ockergelb, tannengrün. Für die Augen. Ihre Augen.
Darüber ein wenig schwarzer Schatten, die Haare, der lange Hals, die Schultern so rund …
Er warf einen Blick über die Staffelei. Da saß sie und lachte ihn an. Sie.
Haarsträhnen fielen aus dem Knoten auf ihre nackten Schultern herab. Sie trug ihr dünnes Hemdchen wie eine Königin ihre Robe. Stolz streckte sie den Rücken durch, ihre vollen Brüste nach vorne.
Er liebte sie! Newjatev hatte seine Muse gefunden. Im Café Stefanie, drei Monate war es her. Gleich als sie hereingekommen war, hatte er sie bemerkt, durch die Schwaden von Zigaretten und den Dunst der trinkenden, schwitzenden Menschen. Er hatte sie gesehen und sogleich den einen glühenden, den unbedingten Wunsch gehabt: das Mädchen zu malen.
Er konnte seinen Blick nicht von ihr lassen, er sprach sie an, sie war Leidenschaft und Unschuld gleichermaßen. Hier in Schwabing tobte das Leben in den unzähligen Kneipen und Cafés, hier trafen sich die Künstler und Journalisten, Verschwörer und Weltverbesserer. Pläne wurden geschmiedet – für eine bessere Welt, für ein Ende der Monarchie oder aber nur für den Zeitvertreib.
Es wurde geredet und getrunken, die Frauen waren modern, sie tranken Wein und rauchten, wollten das Wahlrecht und trugen Kleider ohne Korsett, Schwabing war ein wildes Pflaster.
Und das Mädchen staunte. Sie war hungrig nach diesem Leben. Als der junge Maler, der obendrein noch gut aussah, sie ansprach, fragte, ob sie ihm Modell stehen wolle, da zögerte sie nicht lange.
Seit dem Abend im Café Stefanie waren sie unzertrennlich. Die junge Frau hatte den Ihren nicht gesagt, dass sie nicht mehr wiederkommen würde. Hatte ihre Habseligkeiten gepackt und war noch am gleichen Abend zu Rudolf in das Dachatelier gezogen. Es war ein wenig kalt und zugig dort oben, aber sie hatten sich, sie wärmten einander.
Er malte sie, sie liebten sich, er sorgte für sie.
Es kamen andere, Kollegen von Rudolf, Maler auch sie. Bereitwillig stand das Mädchen Modell, immer lachte sie, das Leben konnte so leicht sein.
Sie fragte nicht, woher ihr Geliebter das Geld für Essen, Trinken und Zigaretten hatte, für das Holz im Ofen und die Farben, die er so großzügig über die Leinwände verteilte.
Sie waren füreinander geschaffen, sie und Rudolf.
Hier und heute Abend gelang es dem Künstler, seine wilde Liebe auf die Leinwand zu bannen. Seit Wochen kannte er kein anderes Motiv als nur sie: liegend, im Porträt, von hinten, schlafend. In Rötel, Kohle, Aquarell und Öl.
Aber heute, das spürte Rudolf, floss seine Leidenschaft direkt auf die Leinwand. Er entzündete sie, er spürte seine Liebe wie Lava durch die Finger rinnen.
Als er fertig war, setzte er den Schlussakkord und schrieb »Mon amour, 1912« mit Bleistift auf die Rückseite.
Es war die Erfüllung. Sein Opus magnum. Der Höhepunkt ihrer Liebe.
Von nun an ging es abwärts.
München-Maxvorstadt, ein Büro in der Brienner Straße im Sommer 2014
Elsa starrte auf das Bild. Ihre Augen saugten sich fest an den grüngelben Wangen, dem roten, ach so roten Mund und den schrägen schwarz-grünen Augen ihrer Großmutter. Urgroßmutter. Die Reproduktion war deutlich blasser als das Original, aber dennoch war sie beim Durchscrollen sofort daran hängengeblieben. An Mon amour. An ihrer Urgroßmutter. An Anneli Gensheim.
Sie nahm die Lesebrille ab, schloss die Augen, drückte die Fingerspitzen auf die Nasenwurzel. Diesen festsitzenden Schmerz zwischen den Augen wurde sie schon seit Wochen nicht mehr los. Vielleicht kamen die Schmerzen von der Brille. Vielleicht, vielleicht.
Sie setzte die Brille wieder auf, eine dunkelrandige Rodenstock, ein Modell, dessen Anschaffungspreis in keinem Verhältnis zu seiner Bedeutung für sie stand. Elsa hätte sich ebenso gut ein einfaches Nulltarifgestell kaufen können, denn sie wollte nicht wahrhaben, dass sie in einem Alter war, in dem sie auf eine Lesebrille nicht länger verzichten konnte. Ein preisgünstiges, weniger extravagantes Gestell hätte sie herunterspielen können. Nicht so dieses. Es war zu präsent. Aber Hajo war dabei gewesen, er hatte es ihr förmlich aufgezwungen. Er liebte die Strenge, die ihr das Horngestell verlieh.
Elsa hatte nicht widersprochen, sondern sich überreden lassen, und nun verschwand das ungeliebte Brillenmodell häufiger unter den Papierstapeln auf ihrem Schreibtisch, als dass es auf ihrer Nase saß.
Sie kniff die Augen zusammen und schob sich näher an den Bildschirm. Mon amour, 1912, ein Gemälde des Malers Rudolf Newjatev war gestohlen worden. Gemeinsam mit zwei anderen Expressionisten aus einer Antwerpener Galerie, in der es gezeigt wurde.
Elsa öffnete das Dossier, das an alle Mitarbeiter ihrer Abteilung gerichtet war. Frau Dr. Elsa Hannapel arbeitete als Kunsthistorikerin in der für bildende Kunst zuständigen Sparte eines großen Versicherungsunternehmens.
Hastig überflog sie die zusammengestellten Informationen. Es waren nicht allzu viele, das Übliche, wenn es sich um Werke handelte, die in ihrem Wert im unteren Bereich lagen: eine knappe Auflistung des Galeristen über die Eckdaten der gestohlenen Werke, ein Bericht der Polizei, die den Raub am nächsten Tag aufgenommen hatte, sowie eine erste Einschätzung der Zweigstelle in Köln, bei der die Meldung zuerst eingegangen war.
Entstehung 1912, das ging bereits aus dem Titel hervor. Der Maler, Rudolf Newjatev, sagte Elsa zunächst nicht viel. In ihrer Familie hatte es stets geheißen, der Maler sei unbekannt, vermutlich ein Verehrer ihrer Urgroßmutter. Jetzt fiel ihr ein, dass Newjatev als Satellit der Gruppe Blauer Reiter vor gut fünfzehn Jahren wiederentdeckt worden war. Sie hatte das, damals in London, nur am Rande mitbekommen. Expressionismus war nicht ihre Epoche. Ihre Spezialität waren die deutschen Maler des frühen 15. Jahrhunderts. Und dass dieser junge Expressionist, der seine Wiederauferstehung feierte, der Schöpfer des vertrauten Bildes war, war ihr noch weniger in den Sinn gekommen.
Besitzer des Werkes war Deinhard Manker, ein Sammler aus Düsseldorf. Elsa kannte Manker, er war es auch, der die gestohlenen Werke, die alle drei aus seinem Besitz stammten, bei ihrem Unternehmen versichert hatte. Ein bedeutender und seriöser Kunstmäzen, dessen Sammlung vorrangig deutsche Werke von der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges umfasste. Beckmann und Kirchner waren seine Spezialgebiete, Elsa hatte bereits mit ihm, beziehungsweise seinem Assistenten, zu tun gehabt.
Dass er der Besitzer eines Werkes war, das ihren Großeltern gehört hatte, überraschte sie.
Noch mehr aber überraschte Elsa, dass sie das Bild, das sie die gesamte Kindheit über begleitet hatte, aus den Augen verloren hatte. Wie konnte es sein, dass sie es vergessen hatte? Die bunte Frau. Allein die Erinnerung daran verursachte bei Elsa einen Druck in der Brust und ein enges Gefühl im Hals. Heimweh. Vielleicht Scham. Die Wohnung ihrer Großeltern – sie war über ihre gesamte Kindheit hinweg der wichtigste Zufluchtsort für sie gewesen: die weichen Teppiche auf dem gebohnerten Parkett. Der weiße Lack, der in dicken Schichten die hohen Altbautüren und Fenster überzog. Er glänzte wie poliert, ebenso wie die ziselierten schweren Messinggriffe. In der Wohnung war es immer warm, Elsa durfte in Strümpfen laufen, nur im Winter bekam sie kleine Pantoffeln. Es roch nach Liebe und Fürsorglichkeit, Elsa erinnerte sich an die warmen, aber trocken-faltigen Hände ihrer Großeltern, wenn diese ihr über die Wange streichelten oder beim Spaziergang ihre Hand nahmen. Alles war dort, in der Mandlstraße, so ganz anders als das Leben, das Elsa mit ihrer Mutter und ihrem Bruder am Chiemsee führte.
An die ersten vier Jahre in Frankfurt hatte Elsa keine Erinnerung, aber auch da hatten sie in einer Wohngemeinschaft gelebt. In einer Stadtwohnung allerdings, nicht auf dem dunklen, feuchten Bauernhof, den die Sannyasins, zu denen auch Ricarda gehörte, gekauft hatten.
Rückblickend empfand Elsa das Leben dort als eine einzige Entbehrung. Dachte sie zurück, fielen ihr klamme Feuchtigkeit und Frieren ein. Ihr fiel der beißende Geruch der Allesbrenner ein, denen mehr dunkler Rauch als Wärme entwich. Die Arbeit im Gemüsegarten, wenn sie die Schnecken absammeln und mit der Schere zerschneiden musste. Und ja, eigentlich war es auch als kleines Mädchen immer nur das gewesen: ein Gefühl von Mangel, Härte, Kargheit.
Es war kein Leben in Schönheit gewesen.
Wenn Elsa sich heute mit ihrem Bruder Arto über ihre Kindheit unterhielt, war es, als wären sie getrennt voneinander aufgewachsen. Arto, zwei Jahre älter als Elsa, erinnerte sich an die wilde Freiheit auf dem Land. Daran, dass es keinen Zaun und keine Grenze gab, an die vielen Tiere auf dem Hof, daran, dass er nie kontrolliert wurde. Es war Elsa dann, als hätte sie das so nie erlebt. Die schönsten und stärksten ihrer Erinnerungen stammten aus den Ferien und den Wochenenden bei ihren Großeltern.
Regine und Julius Schuster waren die Eltern ihres Vaters Lutz. Er wohnte damals noch in Frankfurt, und sie sah ihn fast nie. Dafür sorgte Ricarda, aber auch Lutz zeigte an seiner Tochter kein Interesse. Umso heftiger hatten seine Eltern ihre Enkelin ins Herz geschlossen. Wann immer Elsa nicht zur Schule gehen musste, durfte sie die Großeltern in Schwabing besuchen. Die Jugendstilvilla, in der sich die weiträumige Wohnung befand, war Elsas Paradies. Sie hatte eines der acht Zimmer ganz für sich allein. Das Bett darin war groß und alt, aus schwerem schwarzem Holz mit kunstvoll geschnitzten Verzierungen, die Elsa mit dem Finger nachzeichnete, wenn sie nicht schlafen konnte. Das Bett stand an der Wand, deren Fenster auf den Englischen Garten hinausging. Nachts hörte sie die Käuzchen schreien, tags sah sie die Eichhörnchen von Baum zu Baum springen. An der Wand, die dem Kopfende gegenüber lag, hing das Bild. Als kleines Kind hatte sie es groß gefunden, je älter sie aber wurde, desto mehr schrumpfte es in ihren Augen. Heute schätzte Elsa das Bild auf fünfzig mal fünfzig Zentimeter, ohne den schweren Goldrahmen, der vielleicht zehn Zentimeter stark war. Sie war mit dem Bild ihrer Urgroßmutter aufgewacht und zu Bett gegangen. Anneli Gensheim, der auch das Bett gehört hatte, in dem Elsa schlief. Kaum ein anderer Gegenstand in der geliebten Wohnung ihrer Großeltern war ihr so vertraut wie dieses Gemälde.
Dennoch hatte sie so viele Jahre nicht mehr daran gedacht.
Elsa schämte sich.
Jetzt flackerte es in Pixeln auf dem Bildschirm vor ihr. Das Bild hatte ohne ihr Wissen eine Reise gemacht, den Besitzer gewechselt, und nun war es verschollen. Elsa fühlte sich, als hätte sie ihre Aufsichtspflicht verletzt.
Sie stand auf und ging hinüber zu Marion.
Marion drehte sich nicht einmal um, als Elsa ihr Büro betrat. Das tat sie nie. Sie war stets angestrengt beschäftigt, zu beschäftigt, um sich ihren Mitarbeitern zuzuwenden. Stattdessen fragte sie. »Was?«
Elsa antwortete in den Rücken der weißen Bluse hinein, die über dem gebeugten Rücken Marions spannte. »Diese Antwerpen-Sache …«
Ihre Chefin klickte mit der Maus schnell hintereinander verschiedene Fenster auf ihrem Bildschirm durch, bevor sie antwortete. Mit dem Blick am Monitor. »Musst du nicht machen. Kann Frank übernehmen.«
»Nein. Es interessiert mich.«
Marion zuckte mit den Schultern. Elsa lehnte sich an den Türrahmen. Sie überlegte, ob sie etwas hinzufügen sollte. Dass es ihr Bild war. Eigentlich. Und scheinbar doch nicht. Aber während sie im Kopf die Sätze, die sie möglicherweise sagen könnte, zurechtlegte, wusste sie, dass es zu kompliziert war. Zu persönlich. Es würde Marion nicht interessieren.
Diese drehte sich auf dem Stuhl herum, musterte Elsa. Dabei zog sie die kaum vorhandenen Augenbrauen zusammen. »Ist noch was?«
Elsa lächelte. »Nein. Ich mach das dann. Antwerpen.«
Marion nickte, drehte sich aber nicht zurück. Und Elsa stand wie festgenagelt an der Tür.
Obwohl Marion schroff war, schroff, weil sie immer effektiv sein wollte, nicht aus Ignoranz oder Desinteresse, waren sie sich nahe. Sie teilten eine Leidenschaft – die Leidenschaft für Kunstgeschichte. Elsa hatte keine Geheimnisse vor Marion, die Frage hatte sich nie gestellt, sie hätte sich ihr jetzt gerne anvertraut, aber im Moment war sie zu verwirrt. Sie konnte den Vorgang Mon amour nicht einordnen. Sie wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte.
Seit zehn Jahren arbeitete Elsa bei der Versicherung, seit zehn Jahren mit Marion als Vorgesetzter. Es war ausgemachte Sache, vor allem von Marion aus, dass Elsa einmal ihre Position einnehmen würde. Marion war um einiges älter, aber sie hatte Elsa, die sich damals nach der Promotion beworben hatte, immer als ebenbürtig behandelt. Hatte ihr von Anfang an klargemacht, dass sie Nüchternheit und Akribie schätzte, und das genau war es, was Elsa glaubte mitzubringen.
Ihre Arbeit war rational, systematisch. Sie suchte, sie grub und wühlte, verglich Dokumente, recherchierte in Archiven, ordnete zu. Kataloge, Quittungen, Transportlisten, Zeitungsberichte, Fotografien. Das war Elsas Gebiet. Sie hatte Erfolgserlebnisse, wenn es ihr gelang, ein längst verloren geglaubtes Werk aufzuspüren. Sie war glücklich, wenn sie ein gestohlenes Kunstwerk wieder seinem Besitzer übergeben konnte. Sie bekam Lob und einen Bonus. Sie war mit Feuereifer bei der Sache, sie konnte manchmal nicht aufhören, wenn der Jagdtrieb sie gepackt hatte, saß bis spät in die Nacht, nahm die Arbeit mit nach Hause.
Aber niemals hatte sie sich von Emotionen leiten lassen. Sie war Wissenschaftlerin. Und sie spürte, dass sie jetzt, was das Bild der bunten Frau betraf, aus der Bahn geworfen wurde. Das war ihr Bild. Ganz gleich wer es wann gekauft hatte, wem es auf dem Papier gehörte, Mon amour durfte nicht verlorengehen. Es war ihre Aufgabe, das Bild, das ein Teil von ihr war, zu finden.
Marion drehte sich wieder zu ihrem Bildschirm, Elsa trat den Rückzug an. Sie druckte sich im Büro das Dossier aus, fuhr den Computer runter und legte Frank, der immer als Erster Feierabend machte, einen gelben Klebezettel auf den Tisch, dass sie Antwerpen übernehmen würde. Dann steckte sie die Unterlagen in ihre Tasche, klopfte bei Marion an den Türstock zum Zeichen, dass sie ging, und verließ das Büro.
Im Hof sperrte sie ihr Fahrrad ab. Als sie sich vornüberbeugte, spürte sie, dass sich die drückenden Schmerzen hinter der Schädeldecke verstärkt hatten. Sie richtete sich auf, um Luft zu holen, ihr wurde daraufhin kurz schwarz vor den Augen. Elsa blieb einige Sekunden auf ihr Fahrrad gestützt stehen, atmete durch die Nase. Sieben, acht Atemzüge lang versuchte sie, sich zu konzentrieren, erst als sie sich stabil genug fühlte, schob sie ihr Hollandrad aus dem Hof.
Sie lief, das Rad schiebend, bis zum Karolinenplatz, ihre Gedanken kreisten stetig um das Bild. Noch nie zuvor war sie so machtvoll in die eigene Vergangenheit geworfen worden. Alles in ihrem Leben war nach vorne gerichtet. Es war immer vorwärtsgegangen im Leben der Frau Dr. Elsa Hannapel. Aber jetzt war das Bild, ihr Familienbild, das ihr so viel bedeutet hatte, vielleicht in den Händen irgendwelcher osteuropäischer Hehlerbanden, aus dem Rahmen geschnitten und sicher nicht fachgerecht transportiert auf dem Weg durch die Schwarzmärkte der Kunst. Es würde irgendwo, in irgendeiner unbekannten Sammlung verschwinden.
An der Kreuzung Barer Straße fühlte sich Elsa kräftig genug, um aufs Rad zu steigen und sich in den Strom der Fahrradfahrer einzureihen. Sie liebte ihren Arbeitsweg – jedenfalls sobald sie das von den Nazibauten dominierte Areal hinter sich gelassen hatte – die Kunstroute, die sie zunächst zur Linken am Museum für ägyptische Kunst vorbeiführte, dann der Reihe nach an der Pinakothek der Moderne, dahinter versteckt das Museum Brandhorst, dann folgten die Alte Pinakothek und die Neue. Hier war ihr München ganz nahe, sie hatte sich schon als Studentin in dem Gebiet zwischen Königsplatz, Universität und Englischem Garten am wohlsten gefühlt. Die Stadt öffnete sich ganz weit, das Museumsquartier, die Ludwigstraße, der Hofgarten – es war ihr, als atmete die Stadt an diesen Orten. Weit war sie und groß und ganz Geschichte.
Elsa hatte sich stets wie erhaben gefühlt, wenn sie die Treppen zur Staatsbibliothek erklomm oder am Odeonsplatz im Café in der Sonne saß. Sie hatte nie verstanden, wie Hajo, ihr Lebensgefährte, der in Potsdam lebte, München als eng und provinziell empfinden konnte.
Heute aber hatte Elsa kein Auge für die Schönheit der Architektur, sie verzichtete auch darauf, die Barer Straße zu verlassen und einen Schlenker zum Neubau der Hochschule für Film und Fernsehen zu machen. Sie hielt auch nicht am Supermarkt, um sich für den Abend einzudecken, Elsa dachte gar nicht darüber nach, ob sie zu Hause etwas zu essen hatte. Sie dachte nur daran, dass sie Lutz anrufen musste. Ihren Vater. Er hatte Mon amour damals geerbt, als zuerst Julius und später auch Regine gestorben waren.
Elsa hätte bereits im Büro zum Hörer greifen können, das wäre das Naheliegende gewesen. Aber ihr Verhältnis zu ihrem Vater war nicht so. Sie musste sich konzentrieren, wenn sie mit ihm sprach. Das war der Grund, warum sie ihn so selten anrief. Er dagegen, der augenscheinlich kein Problem hatte, mit ihr zu telefonieren, rief sie nie an. Warum auch? Er hatte Freundinnen, die so alt wie seine Tochter waren, nein, mittlerweile jünger als seine Tochter, und mit denen ihn mehr verband.
»Du meine Güte, Elsa«, sagte Lutz eine halbe Stunde später. »Ich hab’s vertickt. Mach doch kein Drama draus.«
Kein Drama. Elsa biss sich auf die Lippe, um nicht zu schreien. Diese betonte Lässigkeit im Ton, in der Wortwahl, Lutz schaffte es immer, sie aus der Reserve zu locken. Sie hatte es doch vorher gewusst. Es war richtig gewesen, ihn nicht sofort, als sie das Dossier im Büro erhalten hatte, anzurufen. Elsa hatte sich auf den Anruf vorbereiten müssen, gerade weil sie im Vorhinein gewusst hatte, was er sagen würde. Hatte sich zusätzlich ein Glas Chardonnay eingeschenkt, die Hälfte davon hastig heruntergestürzt, bevor sie seine Nummer in Südfrankreich wählte. Ebenfalls erwartungsgemäß war eines der jungen Dinger an den Apparat gegangen, mit süßlichem »Allo?!«. Als Elsa schroff nach ihrem Vater gefragt hatte, hatte sie hören können, wie die Freundin ihres Vaters, deren Namen sie selbstverständlich nicht kannte, die ohne Zweifel sehr zierliche Hand über den Hörer gelegt und in überraschtem Tonfall »Ta fille« geflüstert hatte.
Ich hab’s vertickt. Diese gespielte Sorglosigkeit, dieses »Ich-hänge-nicht-wie-du-an-den-Dingen«, dieses Verbot jeglicher Sentimentalität von Seiten ihres Vaters – Elsa hätte sofort wieder auflegen müssen, um ihr Seelenheil zu wahren. Stattdessen trank sie einen weiteren Schluck Wein.
»Trinkst du?« Lutz klang amüsiert.
»Warum?« Elsa bemühte sich, angriffslustig zu sein, um endlich einmal die Oberhand in einem Gespräch mit ihrem Vater zu behalten. »Warum hast du es verkauft?« Ein weinerlicher Ton schlich sich ein. Verdammt!
»Weil ich das Geld brauchte.« Lutz blieb nüchtern. »Weil ein Freund es haben wollte. Meine Güte, der alte Schinken.«
»Deinhard Manker? Ist ein Freund von dir?«
»Freund. Was ist schon ein Freund?« Wieder dieser belustigte Ton. Lutz war immer darauf bedacht, über den Dingen zu stehen. Vielleicht tat er das auch. »Wir kennen uns. Wir haben uns bei einer dieser Partys getroffen. Er hat ein Haus irgendwo bei Nizza.«
»Und dann habt ihr euch unterhalten, und dir ist eingefallen, ich kann ihm ja das Bild andrehen? War es so?«
Lutz lachte. »So ungefähr.«
Es war Zeit, das Gespräch unverzüglich zu beenden. Aber Elsa konnte einfach nicht aufhören. Sie wollte Lutz verletzen, ihn konfrontieren, ihm ein schlechtes Gewissen machen, obwohl sie wusste, dass nichts, was sie sagte, ihren Vater wirklich traf.
»Es gehört in unsere Familie! Deine Oma ist darauf. Du kannst es doch nicht einfach …!«
»Ich hab sie kaum gekannt«, unterbrach Lutz sie ungehalten.
Elsa spürte, dass ihn die Lust, sich weiterhin mit ihr zu unterhalten, verlassen hatte. Sein Amüsement kippte in Genervtheit.
»Du weißt, ich bin nicht sentimental, und selbst wenn ich es wäre, habe ich eine Summe dafür bekommen, die jegliches nostalgische Gefühl im Keim erstickt hätte.«
Elsa stand auf ihrem Balkon. Sie sah über die Dächer Schwabings, hier aus dem vierten Stock des prächtigen Bürgerhauses in der Agnesstraße. Sie richtete den Blick zum Englischen Garten, ungefähr dahin, wo die Wohnung ihrer Großeltern gewesen war. Ihr Blick war verschwommen, ihr kamen die Tränen. Sie war neununddreißig, doch noch immer konnte ihr Vater sie mit wenigen scharfen Worten zum Weinen bringen.
»Jetzt ist es weg. Gestohlen. Das wollte ich dir sagen.«
Sie legte auf.
Es gab keinen Trost in der Wohnung. Niemand, der sie in den Arm nahm. Nicht einmal ein Tier, das sie streicheln konnte. Ein weiteres Telefonat, und sei es auch nur, um sich von Hajo trösten zu lassen, würde sie jetzt nicht verkraften. Elsa kippte den Rest Weißwein in den Lavendel, der so herrlich auf ihrem Balkon blühte und Gott sei Dank pflegeleicht war. Sie zog sich ihre Sportklamotten über. Sie war aufgewühlt. Noch war es hell, und sie würde eine Runde im Englischen Garten drehen und sich abreagieren. Danach heiß duschen und mit Hajo sprechen. Sie war sicher, sich dadurch wieder in den Griff zu bekommen.
Konzentriert trabte sie durch die sommerstaubigen Straßen Schwabings, bis sie den Rand des Englischen Gartens erreicht hatte. Aber anstatt über den kleinen Seitenarm der Isar ins satte Grün einzutauchen, bog sie links in die Mandlstraße ab. Nach wenigen Metern erreichte sie den ihr so vertrauten Bau.
Elsa blickte zu der Wohnung im zweiten Stock hoch. Sie sah das Fenster des ehemaligen Gästezimmers, aus dem sie so oft in den Park geschaut hatte. Jetzt hingen dort gemusterte Vorhänge, und an den Scheiben klebten bunte Figuren. Offenbar ein Kinderzimmer. Elsa war erleichtert. Ein anderes Kind würde in diesem Zimmer groß werden, vielleicht ebenso glückliche Tage erleben wie sie damals. Wenigstens war in dieser Wohnung keine Agentur oder Kanzlei untergebracht. Kaum jemand konnte sich noch ein normales Leben in einer dieser Prachtvillen Schwabings leisten.
Sie nahm sich vor, in den nächsten Tagen bei den Leuten, die nun dort wohnten, zu klingeln. Vielleicht konnte sie einen Blick in die Wohnung werfen.
Elsa drehte um, lief weiter in den Park. Sie schlug die nördliche Richtung ein, dorthin, wo der Englische Garten etwas weniger belebt war. Sie erinnerte sich daran, wann sie die Wohnung ihrer Großeltern das letzte Mal gesehen hatte. Julius, der Großvater, war bereits gestorben, und ihre Großmutter Regine wollte nicht mehr allein in den riesigen Räumen wohnen bleiben. Sie hatten sie ins Marienstift gebracht, eine luxuriöse Seniorenwohnanlage mit angeschlossener Pflege.
Mit schlechtem Gewissen dachte Elsa daran, dass sie Regine danach nur wenige Male gesehen hatte. Sie selbst hatte ihren Magister in der Tasche gehabt und war anschließend zum Praktikum nach London gegangen. Sie hatte Regine nur noch drei-, viermal im Altenheim besucht. Zu sehr war Elsa mit sich selbst beschäftigt gewesen.
Lutz hatte damals die Wohnung aufgelöst und Elsa und Arto großzügig eingeladen, sich zu nehmen, was noch in der Wohnung verblieben war. Wenn sie sich heute daran erinnerte, stieg Groll in ihr hoch. Elsa legte ein wenig an Tempo zu, um sich abzureagieren. Selbstverständlich hatte Lutz bereits alles abgegrast, was schön und wertvoll war. Als sie mit Arto in die Wohnung gekommen war, hatte es dort schrecklich ausgesehen. Ein paar abgetretene Teppiche, wenige antike Möbel, die vermutlich nicht wertvoll genug für Lutz waren, und jede Menge Nippes.
Das schwere Bett der Urgroßmutter war noch da gewesen, Elsa hatte es unbedingt haben wollen, aber nicht gewusst, wo sie es unterbringen sollte. Also war es dort geblieben. Was war damit passiert? Arto, der damals bereits als Schreiner selbständig arbeitete, hatte einige wenige Stühle und eine Kommode mitgenommen, sie selbst eine Kiste mit Fotos und Dokumenten, die Taschenuhren von Julius, einen reizenden Gründerzeitspiegel und etwas Rubinschmuck von Regine. Aber es war ihr wie Leichenfledderei vorgekommen.
Das Bild Mon amour war nicht mehr in der Wohnung gewesen.
Das Erste, was Elsa am nächsten Tag unternahm, war, das Bild, ihr Bild, und natürlich auch die anderen zwei gestohlenen Werke in ein weltweites Suchregister für verschwundene Kunstwerke zu stellen. Damit war das Gemälde als vermisst registriert, und jeder seriöse Kunsthändler, Auktionator oder Museumsmitarbeiter würde melden, sobald ihm das Werk angeboten wurde. Bei privaten Sammlern würde das nicht helfen. In der Regel – das war auch der Polizei vor Ort, die den Diebstahl aufgenommen hatte, klar – gingen die Diebe nicht sehr sensibel, aber effektiv vor und brachten die Diebesbeute so schnell wie möglich außer Landes, ja außerhalb der Grenzen Europas, um sie dem Zugriff von Interpol zu entziehen. Es gab im internationalen Bereich Task-Forces, die auf den Diebstahl von Kunstwerken spezialisiert waren, zum Beispiel bei Scotland Yard. Kunstraub war nach Waffenhandel und Drogengeschäften eines der lukrativsten Verbrechen. Demgegenüber stand die geringe Aufklärungsquote von zehn Prozent. Kunstraub lohnte sich und war verhältnismäßig simpel.
So war es wohl auch in Antwerpen gewesen. Natürlich gab es Sicherungen sowie eine moderne Alarmanlage, aber die Diebe hatten so rasch gearbeitet, dass sie mit ihrer Beute verschwunden waren, bevor die Polizei eintraf. Die Gemälde wurden mit den Rahmen entwendet, die Bilder noch während der Flucht aus den Rahmen geschnitten, zusammengerollt und dem nächsten Mittelsmann übergeben.
Elsa telefonierte mit dem Galeristen in Antwerpen, aber dessen Verzweiflung hielt sich in Grenzen. Die Bilder waren versichert gewesen, der Diebstahl hätte jeden treffen können, so fürchtete der Mann weder um finanzielle Einbußen noch um seine Reputation. Er bedauerte das Vorgefallene, und Elsa nahm es hin wie die Kondolenz zum Tod eines entfernten Verwandten.
Ihre nächste Anlaufstelle war Deinhard Manker, der Sammler und Besitzer. Nachdem Lutz gestern am Telefon nicht willens gewesen war, genauer über den Verkauf des Werkes Auskunft zu geben, erhoffte sie sich von dem Mäzen Aufschluss über den Weg des Bildes – bevor es gestohlen wurde.
Ihrem Arbeitgeber gegenüber, der Versicherung, hatte Elsa ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. Die Ausgleichszahlung an Deinhard Manker war ein Kollateralschaden, der durch die hohen Prämien, die dieser für eine Menge anderer bei ihnen versicherter Werke zahlte, abgefedert war.
Während Elsa den Vormittag mit Telefonaten und Papierkram verbrachte, wurde sie traurig und bitter. Bilder verschwanden. Das war alltäglich. Hunderte, Tausende Gemälde und Skulpturen standen auf den internationalen Vermisstenlisten. Natürlich hatte sie oft darüber nachgedacht, welche Schicksale mit den Werken verbunden waren. Dass viele Familien während der Naziherrschaft enteignet worden waren und persönliche Sammlungen unwiederbringlich verloren hatten, war überaus tragisch. Weitaus tragischer noch war aber die Auslöschung dieser Familien selbst.
Jetzt aber, da es um ein Bild aus ihrer eigenen Familie ging, ein Bild, auf dem jemand abgebildet war, aus dessen direkter Linie sie stammte, spürte Elsa selbst den großen persönlichen Verlust, der damit einherging. Ein Stück ihrer Vergangenheit war verschwunden, und sie würde alles dransetzen, diese Lücke in ihrer Geschichte zu schließen.
»Selbstverständlich können Sie uns jederzeit besuchen, Herr Manker erwartet Sie.« Die Stimme des persönlichen Assistenten war warm und verbindlich.
»Ich wäre entweder Freitagabend oder Samstag in der Nähe.« Elsa hoffte, dass Marion im Büro nebenan sie nicht hörte. »Passt das?«
Sie hörte, wie der Assistent herumklickte, vermutlich im elektronischen Kalender. »Samstag um zwölf passt hervorragend. Möchten Sie mit Herrn Manker essen?«
»Wunderbar.« Elsa trug sich den Termin in ihrem Smartphone ein und beendete dann das Gespräch. Sie würde also am Wochenende in Richtung Niedersachsen fahren. Dem Assistenten gegenüber hatte sie sich als Mitarbeiterin der Versicherung vorgestellt und behauptet, dass sie als solche einige Dinge mit dem Sammler bezüglich der verschwundenen Werke persönlich klären wollte. Das war weder wahr noch üblich, keine Versicherung der Welt schickte ihre Kunsthistoriker als Detektive los, um verschwundene Kunstwerke zu suchen, das gab es nur in Hollywood. Aber der Assistent schien das nicht zu wissen, und Deinhard Manker selbst war es vermutlich egal. Er würde ihr auf seinem Schloss, das er von einem berühmten deutschen Maler höchstpersönlich übernommen hatte, ein, zwei kostbare Stunden schenken und sich in seiner Sammlung sonnen.
Elsa kannte diese Typen des Kunstbetriebs sehr gut. Manker war Jahrgang 46, ungefähr so alt wie ihr Vater Lutz. Ebenso wie dieser gehörte Manker zur Spezies Ex-Linker, jetzt Toskanafraktion. Nur dass Manker kein studierter Intellektueller war wie Lutz, sondern von ganz unten kam. Daher rührten der hemdsärmelige Umgangston, die fragwürdigen Manieren, die der schwerreiche Mäzen längst hätte ablegen können, aber die er vor sich hertrug wie eine Auszeichnung, und der Hang zum Protz. Neben Kunstwerken sammelte Deinhard Manker Oldtimer und junge Frauen – auch darin ihrem Vater nicht unähnlich.
Trotzdem war Elsas Laune glänzend, als sie sich tags darauf um sechs Uhr morgens in den Wagen setzte, den sie so kurzfristig noch beim Car-Sharing reservieren konnte. Die Sonne war gerade über der Leopoldstraße aufgegangen, die Stadt befand sich im trägen Dämmerschlaf. Die Luft war frisch, es roch nach der Feuchtigkeit, die von Isar und Englischem Garten herüberwaberte und den frühen Herbst ankündigte. Trotzdem sollte es heute im Lauf des Tages heiß werden.
Elsa stellte den Thermobecher mit ihrem Kaffee in den Getränkehalter, ließ beide Fensterscheiben ganz herunter und legte eine CD ein.
Während sie sich stadtauswärts bewegte und schließlich auf die A9 in Richtung Nürnberg einfädelte, fragte sie sich, wie es sein konnte, dass niemand in ihrer Familie gewusst hatte, wer das Bild ihrer Urgroßmutter gemalt hatte – inklusive ihrer selbst. Es musste doch eine Signatur gegeben haben. Warum hatte niemand jemals das Bild umgedreht und nachgesehen? Wollte ihre Urgroßmutter am Ende nicht, dass jemand von ihr und ihrer Verbindung zu dem Maler wusste? Das Bild war von 1912, Anneli war also neunzehn Jahre alt gewesen, als sie Rudolf Newjatev Modell saß. Das war noch, bevor sie ihren späteren Ehemann und Vater ihrer Kinder kennengelernt hatte. Elsa fand es aufregend, dass ein vielleicht nicht berühmter, aber doch mittlerweile bekannter Maler eine direkte Verwandte porträtiert hatte. Dass die beiden sich gekannt hatten. Vielleicht eine Affäre gehabt hatten. In München, noch vor dem Ersten Weltkrieg.
Die altmädchenhafte Stimme Inga Humpes sang von Begegnungen, die flüchtig waren, von Momenten, die sich nicht festhalten ließen, und flirrender Hitze in den Straßen Berlins, während Elsas kleiner Wagen durch die Hügel der Holledau rollte. Das war weit entfernt von den Gedanken, die Elsa umtrieben, deshalb schaltete sie die Musik ab. Sie konzentrierte sich auf den Verkehr, während sie überlegte, was sie von Anneli, ihrer Urgroßmutter, wusste. Nichts. Fast nichts. Sie war Reporterin gewesen, eine moderne und emanzipierte Frau. Ihr Mann, ein Sozialdemokrat, war im Lager von Sachsenhausen ermordet worden. Der gemeinsame Sohn Julius war dagegen laut Elsas Vater ein Nazi gewesen. Lutz hatte sich immer von seinen Eltern distanziert, lauthals. In den frühen Siebzigern veröffentlichte er Artikel, in denen er offen und mit vollem Namen über die Nazivergangenheit seines Vaters geschrieben hatte. Das war vor Elsas Geburt gewesen. Danach hatte Lutz einfach nur gerne geerbt.
Elsa hätte ihren Großvater nach Anneli fragen können, als sie alt genug gewesen war, sich dafür zu interessieren. Aber da war Julius’ Gehirn nicht mehr in Ordnung gewesen, er war verwirrt gewesen. Regine, die Großmutter, sprach ebenfalls nicht gerne von der Zeit zwischen den Kriegen. Alles, was Elsa über ihre Vorfahren in Erfahrung bringen konnte, musste sie entweder von Lutz erfahren oder selbst herausfinden. Sie entschied sich für das Letztere.
Vor Hildesheim verließ sie die Autobahn nach wenigen Stunden unspektakulärer Fahrt, die sie mit Staumeldungen und einem übersüßen Donut von McCafé verbracht hatte, und fuhr durch das platte Land. Ein Land, das ebenso wenig Charakter hatte wie das dialektfreie Deutsch, das man hier sprach.
Elsa war einmal in Hannover im Theater gewesen. Eine Freundin, die dort Schauspiel studierte, hatte sie eingeladen, die Inszenierung sollte später zum Theatertreffen nach Berlin reisen. Das Spektakulärste an dem Abend aber war gewesen, als Elsa auf dem nächtlichen Bahnhof auf ihren Zug gewartet hatte und zusah, wie sich ein Junkie auf der vermüllten Grünanlage an den Gleisen einen Schuss in den Penis setzte.
Sie war nie wieder nach Hannover zurückgekehrt.
Das Schloss, das Deinhard Manker bewohnte, lag unweit der Bundesstraße auf einem der wenigen Hügel. Eine für den Durchgangsverkehr gesperrte Straße führte zum Anwesen, das einer der Besitzer im Tudorstil hatte umbauen lassen.
An dem postmodernen Metalltor klingelte Elsa, ein rotes Licht leuchtete auf, und eine metallene Stimme fragte nach ihrer Identität. Elsa gab Antwort, und noch bevor sie nach ihrem Personalausweis kramen konnte, um diesen in die Kamera zu halten, öffnete sich das Tor langsam nach beiden Seiten. Sie rollte behutsam hindurch.
Über die Kiesauffahrt kam ihr ein schlaksiger junger Mann mit engen, einen Tick zu kurzen Hosen, ordentlich gestutztem Vollbart und einer schwarzen Brille entgegen.
»Frau Hannapel.« An seiner Stimme erkannte sie den Assistenten, mit dem sie den Termin vereinbart hatte. »Herr Manker hat noch zu tun. Ich nehme mich Ihrer an.«
Natürlich. Auf diese Weise würde sie die umfangreiche Sammlung zu sehen bekommen. Manker selbst musste es nicht auf sich nehmen, sie persönlich zu führen, so sah es nach Understatement aus, nicht nach Protz. Letztendlich kam es auf dasselbe raus.
Elsa nickte höflich und stieg aus dem Auto. Die Sammlung interessierte sie wenig. Sie wusste, was Manker besaß. Und sie war nicht deswegen gekommen.
Eine gute Stunde später, sie saß bestens versorgt mit einem Glas Mineralwasser auf der Terrasse, kam der Sammler höchstpersönlich auf sie zu und gab den Zerknirschten. Er küsste ihr die Hand, hielt das für formvollendet, Elsa jedoch für schmierig. Dann nahm er ihr gegenüber Platz und musterte sie.
Weil es ihr unangenehm war, auf diese Weise taxiert zu werden, nahm sich Elsa heraus, auch Deinhard Manker ungeniert ins Visier zu nehmen.
Er gefiel ihr so wenig wie sie ihm.
Der Sammler war braun gebrannt. Er hatte schütteres Haar, das er in italienischem Stil länger trug, so dass ihm die Haare im Nacken in den Kragen des weißen Hemdes fielen. Er bemerkte ihren Blick auf seine Halbglatze und reagierte instinktiv mit beidhändigem Zurückstreichen seiner wenigen Haare auf dem Oberkopf. Seine Hände waren manikürt, die Fingernägel glänzten. Elsa musste lächeln. Manker war bekannt dafür, dass er sich stets rauh gab und seine Herkunft aus dem Arbeitermilieu unterstrich, die polierten Nägel erzählten jedoch eine andere Geschichte. »Ich musste noch ein paar Telefonate machen.« Er krempelte sich die weiten Ärmel des zerknitterten Baumwollhemds hoch. Seine Unterarme waren dicht behaart, die Haut darunter ebenfalls gebräunt. »Unter anderem mit Stefan Dressler.« Er machte eine Pause und lächelte sie jetzt direkt an. Sehr provokativ.
Dressler war einer der Vorstände ihrer Versicherung. Manker wusste demnach, dass sie nicht im Auftrag ihres Arbeitsgebers hier sein konnte. Aber Elsa ließ sich nicht in die Ecke drängen. Es widerstrebte ihr, dass Manker ihr seine Macht auf diese Weise demonstrierte.
»Ich bin privat hier.«
Überrascht zog er eine Augenbraue nach oben. »Privat?«
»Ich weiß, das hätte ich Ihrem Assistenten sagen können. Aber dann hätten Sie mich vielleicht nicht empfangen.«
Das schien ihn zu amüsieren. Er lächelte wieder, aber dieses Mal lächelten seine Augen mit. Er beugte sich vorneüber. Eine junge Frau kam auf die Terrasse, sie trug zwei Teller, von denen sie einen vor Elsa, einen vor Manker stellte. Sie wünschte guten Appetit und verschwand wieder.
»Nein, ich hätte Sie nicht empfangen.« Manker schien jedoch nicht erbost darüber zu sein, dass Elsa sich den Termin bei ihm unter falschen Bedingungen erschlichen hatte. »Aber jetzt sind Sie mir was schuldig.«
Er stützte sich mit einem Ellbogen auf den Tisch und begann zu essen. Mit der Gabel in der Rechten. Elsa sah ihm zu. In der Regel verdarben ihr schlechte Tischmanieren den Appetit. Aber auf dem Teller lagen mehrere Scheiben gebratene Blutwurst mit einem Apfel-Kartoffel-Püree. Nach dem zuckrigen Donut und zwei großen Kaffee war Elsa ein wenig mulmig, und ihr lief das Wasser im Mund zusammen. Sie würde Mankers schlechte Essmanieren einfach ignorieren.
»Es ist so. Das Bild, Mon amour, hat meiner Familie gehört. Sie haben es meinem Vater abgekauft. Lutz Schuster.«
Manker hörte kurz auf zu kauen, nahm einen Schluck Wasser und nickte.
»Verstehe. Ja, okay. Und deshalb sind Sie hier?«
Die Blutwurst war großartig. Elsa musste sich beherrschen, langsam zu essen. Sie sah von der Terrasse hinunter in die niedersächsische Ebene. Unten im Tal floss die Nette. Sie hätte gerne ein kaltes Pils gehabt. Sich nach dem Essen hingelegt und dann den Heimweg angetreten. Im Moment fühlte es sich wie Urlaub an. Nur Manker hätte ein anderer sein dürfen.
»Das Bild gehörte meinen Großeltern. Es hieß, die Mutter meines Großvaters sei darauf abgebildet. Niemand in meiner Familie wusste, dass es von Newjatev war. Oder niemand hat darüber gesprochen.«
Manker schüttelte den Kopf und gestikulierte mit der Gabel. »Lutz wusste sehr wohl, von wem das Bild war. Sonst hätte er es wohl kaum verschachert.«
Verschachert, vertickt. Elsa gefiel nicht, wie die Männer über den Handel mit dem Bild sprachen.
»Wie ist er an Sie herangetreten?«
»Gar nicht. Das war Achenberg.«
»Achenberg sitzt.«
Manker zuckte mit den Schultern. Helmut Achenberg war bekannt in der Düsseldorfer Kunstszene. Er hatte Deals zwischen Sammlern, Künstlern, Museen vermittelt. Er war mit den ganz Großen der Kunstwelt auf Du und Du. Dann wurde er wegen Steuerhinterziehung verurteilt, und plötzlich wollten sie alle nichts mehr mit ihm zu tun haben.
»Ich wusste nicht, dass mein Vater Achenberg kennt.«
»Sie scheinen überhaupt nicht so viel zu wissen. Sie wissen nicht, von wem das Bild ist, Sie wissen nicht, dass ich es besitze. Sie sind nicht besonders eng mit Lutz?«
Jetzt war es Elsa, die mit den Schultern zuckte. »Achenberg kommt also zu Ihnen und sagt: Da hat jemand einen Newjatev, hast du Interesse?«
»So ungefähr. Das war bei einer Party. In Nizza. Ich war gerade wieder unten.«
Elsa musste an sich halten, nicht mit den Augen zu rollen. Warum hatten Menschen, denen man ihren Status und Vermögen so direkt ansah, es nötig, damit anzugeben?
»Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Paar Tage später bin ich mit Achenberg dann zu Ihrem Vater und hab mir das Bild angesehen. Der Preis war okay, also hab ich zugeschlagen.«
»Sie haben meinen Vater über den Tisch gezogen?«
Er lachte einmal laut auf. »Das kann man gar nicht, nein. Aber ich kann aus einem teuren Bild ein noch wertvolleres machen. Einfach, weil ich es besitze. Das adelt ein Kunstwerk. Ihr Vater kann das nicht.«
»Woher wussten Sie, dass es echt ist?« Mit der letzten Scheibe Blutwurst wischte Elsa den Teller leer. Sie hätte noch eine zweite Portion essen können.
»Ich habe ein Gutachten in Auftrag gegeben.«
»Und die Papiere? Gab es Unterlagen, Dokumente, Stempel, irgendwas?«
Manker lehnte sich jetzt zurück, verschränkte die Arme und schloss die Augen, als würde er nachdenken. Auch sein Teller war leer.
»Nein. Es gab nichts. Deshalb habe ich den Gutachter beauftragt.«
Er öffnete die Augen und sah sie direkt an. Sein Blick war offen, ein bisschen verwundert.
»Ihr Vater hatte nicht einmal eine gute Geschichte auf Lager.«
Elsa begegnete seinem Blick direkt. Sie wusste, was das bedeutete. Kein Bild kam aus dem Nichts. Es sei denn, es hatte eine undurchsichtige Vergangenheit.
An der ersten Raststätte auf dem Rückweg tankte Elsa. Sie kaufte eine Dose Cola aus der Kühltruhe und Mitbringsel für Artos drei Söhne. Die Tankstelle hielt eine reichhaltige Auswahl geschmackloser Stofftiere, Anhänger und grellbunter Plastik-Gimmicks bereit. In solchen Momenten war sie froh, dass sie keine Kinder hatte. Elsa stand so lange ratlos vor dem Angebot, dass der Mann hinter der Kasse begann, sie aus den Augenwinkeln zu beobachten. Schließlich entschied sie sich für drei Donald-Duck-Comics, damit konnte sie nichts falsch machen, denn die las im Zweifelsfall ihr Bruder selbst.
Elsa hatte sich entschieden, nicht wieder nach Hause zu fahren, sondern eine Nacht bei Arto und seiner Familie zu bleiben. Sie besuchte ihren Bruder selten genug, und dieser kam fast nie in die Stadt. Heute wollte sie nicht alleine sein.
Elsa lenkte ihren kleinen Wagen auf den trostlosen Parkplatz hinter der Raststätte. Reflexhaft scannte sie den Platz nach einem ausgesetzten Tier. Als kleines Mädchen hatte sie sich immer danach gesehnt, ein Tier retten zu können. Sie hatte sich vorgestellt, wie sie aus dem Auto stieg und am hölzernen Bein der Raststättensitzgruppe ein einsamer Hund saß, der sie mit großen Augen flehend ansah. Sie würde auf ihn zurennen, ihn in ihre Arme schließen, die Nase in seinem Fell vergraben und ihn mit nach Hause nehmen. Fortan würden sie glücklich bis an ihr Lebensende zusammen sein, Elsa und ihr Hund.
Die Familie machte sich natürlich lustig darüber. Aber Elsa hatte die Hoffnung nie aufgegeben, auch jetzt noch, mit Ende dreißig, konnte sie nicht anders, als ebendiesen Phantasiehund ihrer Kindheit auf jedem Rastplatz zu erwarten. Heute allerdings würde Elsa das Tier im Tierheim abliefern.
Sie lehnte sich an die Kühlerhaube des Kleinwagens und öffnete die Dose Cola. Elsa konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt ein Getränk aus der Dose getrunken hatte. Hajo und sie tranken ausschließlich Wein. Eine Ausnahme machten sie im Biergarten. Natürlich.
Der Besuch bei Deinhard Manker hatte einen schalen Geschmack bei ihr zurückgelassen. Das Gespreizte des Kunstsammlers, die exquisite Atmosphäre, die Erhabenheit seiner Sammlung konnten Elsa nicht darüber hinwegtäuschen, dass Manker ein Mensch war, dem der Wert eines Bildes über den Inhalt ging. Alles, was ein Werk über seinen Wiederverkaufspreis hinaus erzählte, war zweitrangig. Die geckenhafte Attitüde, mit der er stolz verkündet hatte, ein Bild werde geadelt durch seinen Besitz, hatte Elsa Übelkeit verursacht.
Das und die bittere Erkenntnis, dass die bunte Frau, das Bild ihrer Urgroßmutter, möglicherweise zweifelhafter Herkunft war. Die Frage, wie das Bild in ihre Familie gelangt war, beschäftigte Elsa beinahe noch mehr als sein gegenwärtiger Aufenthaltsort. Das Gemälde würde im Moment durch die Kanäle des Kunstschwarzmarkts geschleust, und es würde kaum möglich sein, es zum jetzigen Zeitpunkt ausfindig zu machen. Das war es fast nie, wie Elsa aus zehnjähriger Erfahrung bei ihrer Versicherung wusste. Bei Kunstraub musste man geduldig sein. Irgendwann würde irgendwer irgendwo Mon amour anbieten. Und dann, das war die Hoffnung, würde es der Käufer mit den Registern abgleichen und melden.
Aber dass Manker bedenkenlos ein Bild gekauft hatte, das keinerlei Nachweispapiere besaß, dass Lutz, der zwar von Kunst nicht viel verstand, aber doch so viel wusste, dass zu einem Werk auch ein Herkunftsnachweis gehörte, es ohne selbigen »vertickt« hatte, befremdete Elsa. Andererseits: Wenn Rudolf Newjatev mit ihrer Urgroßmutter Anneli eine persönliche Beziehung verband, vielleicht sogar eine Liebschaft, dann hatte er ihr das Bild wohl einfach geschenkt. Anneli hatte diese Erinnerung an die Wand gehängt und nur mehr als das betrachtet. Nicht als Kunstwerk, das einen gewissen Wert besaß.
Aber das Misstrauen blieb. Und dieses Misstrauen rührte aus dem, was Elsa tagtäglich in ihrem Job begegnete: Lügen.
Wenn es darum ging, Besitz zu verteidigen, etwas wieder zu erlangen oder zu behalten, logen die meisten Menschen. Ganz gleich ob es um ein Spielzeug, ein Kunstwerk, eine Immobilie oder Landbesitz ging – wer einmal etwas in den Händen hielt, was ihm gefiel, gab es selten freiwillig wieder her. Stattdessen wurde die Wahrheit zurechtgebogen, das Begehrte als Eigentum ausgegeben und Tatsachen verdrängt. Elsa erlebte es jeden Tag aufs Neue. Staatliche Museen, die Raubkunst nicht nur in ihren Archiven lagerten, sondern ohne schlechtes Gewissen ausstellten, Sammler und Privatleute, die Kunstwerke aus Enteignungen horteten, aber auf Verjährung pochten. Gerade Menschen, die während des Zweiten Weltkriegs um ihren gesamten Besitz gebracht wurden, Familien, die ausgelöscht wurden und deren Nachfahren verzweifelt versuchten, das eine oder andere Stück aus Familienbesitz wieder zu erlangen, standen unter hohem Beweisdruck. Sie waren gezwungen, den Kauf und Besitz nachzuweisen, durch Belege und Fotos. Aber diese waren größtenteils verbrannt, zerstört, nicht wieder auffindbar.
Wenn die Herkunft eines Kunstwerkes, sei es ein Gemälde oder eine Skulptur, nicht nachweisbar war oder Lücken in der Provenienz aufwies, so rief das bei allen, die mit der Materie befasst waren, größtes Misstrauen hervor.
Obwohl der Besitz des Bildes Mon amour in Elsas Familie eine einfache und naheliegende Erklärung hatte, würde sie nicht eher ruhen, bevor ebendies klar bewiesen war. Nur der Hauch eines Verdachts, dass dieses Bild nicht legal in den Besitz der Familie gelangt war, würde Elsa nicht mehr schlafen lassen.
»Ihr hattet einen Newjatev und wusstet es nicht?« Hajo lachte leise.
Elsa hatte ihren Lebensgefährten vom Parkplatz aus angerufen, in der einen Hand das Handy, in der anderen die Dose Cola. Wenn Hajo das sehen könnte! Sie nahm einen weiteren Schluck. Kaltes Etwas mit Metall.
Prof. Dr. Hajo Siebert war seit fünf Jahren ihr Partner. Freund, Geliebter, Lebensgefährte. Sie hatten sich bei einem Seminar über die »Semantik der Backsteingotik im südlichen Lettland« kennengelernt. Hajo war schon damals am Institut für Denkmalpflege in Potsdam angestellt. Als Dozent, wenig später wurde er habilitiert. Elsa hatte seinem Vortrag mit professionellem Interesse gelauscht. Er hatte frei gesprochen, die Fakten der trockenen Materie klar gegliedert und hatte sich nicht in Fußnoten und Abschweifungen verloren. Später hatten sie sich in der Lobby des Seminarhotels, eines ehemaligen FDJ-Heims, getroffen, und sie hatte ihm ein ernst gemeintes Kompliment gemacht. Nach langer Fachsimpelei über Backsteingotik waren sie in die Bar umgezogen und schließlich in ihrem Zimmer gelandet.
Er hatte ihr unmittelbar nach dem Sex, der der Kennenlernphase entsprechend flüchtig war, von seinen zwei Kindern und der gescheiterten Ehe erzählt. Elsa hatte folglich nicht die Absicht gehabt, ihn wieder zu treffen. Aber irgendwie waren sie aneinander hängengeblieben, Hajo hatte sich tatsächlich scheiden lassen, und nun führten sie seit einigen Jahren eine friedvolle Fernbeziehung. Ob er ihr treu war, spielte für Elsa keine Rolle. Sie hatte ihre Freiheit und fühlte sich dennoch geborgen. Nie käme sie auf die Idee, eine weitere Beziehung oder Affäre neben Hajo zu haben. Sie war perfekt eingerichtet in ihrem Leben.
»Meine Oma hat gesagt, sie wisse nicht, wer der Maler sei.« Elsa drückte eine Delle in das weiche Metall der Coladose. »Und ich habe mich als Kind doch nicht dafür interessiert. Vielleicht hätte ich es ahnen können, wenn ich eine Abbildung des Gemäldes irgendwo gesehen hätte. Aber das habe ich nicht.«