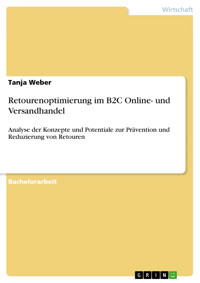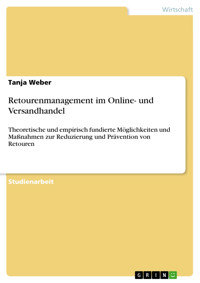6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die schillernde Welt des Zirkus inspirierte Tanja Weber zu einem facettenreichen Roman über das Leben auf der Flucht – das große Thema unserer Zeit Als Elly Simon 1916 geboren wird, ist ihr zukünftiger Berufsweg vorgezeichnet: Sie ist die Tochter eines Zauberers und einer Hochseilakrobatin. Als sogenannte Schlangenfrau lässt sie die Zuschauer begeistert staunen. Als sie den waghalsigen Tigerdompteur Hans kennenlernt, scheint ihr Glück vollkommen, doch das Jahr 1936 bricht an, und ihr Mann ist Jude: Die beiden müssen fliehen. Ihre Flucht führt sie um die halbe Welt, ein Schicksal, das sie mit John Mbete teilt, der Elly viele Jahrzehnte später in einem Berliner Heim pflegt und der vor Krieg und Verfolgung aus Somalia geflohen ist. John und Elly, zwei Menschen, die auf ganz unterschiedliche Art ihre Heimat und ihre Familie verloren haben, nähern sich vorsichtig an – und werden für einen kurzen Moment einander Familie. Bis das Schicksal sie wieder auseinanderreißt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Tanja Weber
Mein Herz ist ein wilder Tiger
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die schillernde Welt des Zirkus inspirierte Tanja Weber zu einem facettenreichen Roman über das Leben auf der Flucht – das große Thema unserer Zeit
Als Elly Simon 1916 geboren wird, ist ihr zukünftiger Berufsweg vorgezeichnet: Sie ist die Tochter eines Zauberers und einer Hochseilakrobatin. Als sogenannte Schlangenfrau lässt sie die Zuschauer begeistert staunen. Als sie den waghalsigen Tigerdompteur Hans kennenlernt, scheint ihr Glück vollkommen, doch das Jahr 1936 bricht an, und ihr Mann ist Jude: Die beiden müssen fliehen.
Ihre Flucht führt sie um die halbe Welt, ein Schicksal, das sie mit John Mbete teilt, der Elly viele Jahrzehnte später in einem Berliner Heim pflegt und der vor Krieg und Verfolgung aus Somalia geflohen ist. John und Elly, zwei Menschen, die auf ganz unterschiedliche Art ihre Heimat und ihre Familie verloren haben, nähern sich vorsichtig an – und werden für einen kurzen Moment einander Familie.
Inhaltsübersicht
Vorspann
Berlin 1918
JOHN
ELLY
JOHN
ELLY
KIRSTEN
JOHN
ELLY
JOHN
KIRSTEN
JOHN
ELLY
JOHN
ELLY
KIRSTEN
ELLY
JOHN
KIRSTEN
ELLY
JOHN
»Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?«
»Niemand!«
»Wenn er aber kommt?«
»Dann laufen wir davon!«
(Dt. Kinderspiel)
Time rolls on, ain't no good to sit alone
Time rolls on and so we traveled on
Never did I imagine what a dawn could be
Till I opened my eyes to see it was welcoming me
(Yusuf Islam, Welcome home)
Berlin 1918
»Hereinspaziert, hereinspaziert!«, kreischte der Clown, während er auf dem Pony um das Rund der Manege galoppierte. Ein kleiner Mann, ein Gnom gar, dessen viel zu großer Kopf auf einem verwachsenen Körper saß. Das Haar wild toupiert, ein winzig-keckes Hütchen darin, wirkte der Schreihals gleichermaßen furchterregend und lächerlich.
Sein Pony jagte in wilder Hatz durch den schmalen Gang zwischen Manegen-Begrenzung und den ersten Sitzreihen. Zuschauer drängten sensationslüstern auf ihre Plätze zurück, mit ihnen strömte kalte Berliner Winterluft ins Zirkusrund.
Die Pause war beendet. Unter den Geruch nach billigem Parfüm, feuchter Wolle, Schweiß und den Holzspänen der Arena mischten sich Bratwurstschwaden und Zigarettenqualm, Bierdunst und der süße Duft von Zuckerwatte.
Das Gebrüll des reitenden Clowns, »hereinspaziert, hereinspaziert!«, wurde vom Gequäke einer Trompete unterbrochen, die ein zweiter Spaßmacher, doppelt so groß, malträtierte, während er in der Manege Purzelbäume schlug. Luigi und Zagarollo waren die italienischen Pausenclowns des Zirkus Busch, sie sollten die Menge animieren, sich so schnell wie möglich wieder auf die Plätze zu begeben, der zweite Teil der Vorstellung würde in Kürze beginnen.
Aber das Publikum hatte kaum Augen für die wilden kleinen Männer. Es starrte auf das große Holzgestell, das die Bühnenarbeiter in der Pause inmitten der Arena aufgebaut hatten. Eine fragile, aber dennoch imposante Konstruktion.
Todesartistik!
Waghalsige Akrobaten!
Einmaliges Kunststück auf Rädern!
Ein Ritt durch die Todesspirale!
Das hatten die Plakate des Zirkus in der ganzen Stadt verkündet. Als hätte in diesen Jahren der Tod nicht schon genug gewütet, als hätte er nicht Hunger, Elend und Verderben über die Familien gebracht, kratzten die Berliner, vornehmlich die aus dem armen Norden, aus Pankow, aus dem Wedding und Reinickendorf, ihre letzten Groschen zusammen, um das zu sehen: zwei Menschen in Todesgefahr.
»Hereinspaziert, hereinspaziert!« – und sie kamen in Scharen. Kinder, Alte, leichte Mädchen, Soldaten auf Heimaturlaub, am Arm die Liebste, auf den vordersten Logenplätzen die besser situierten Bürger. Manchem stockte jetzt, beim Anblick der alles überragenden Konstruktion, der Atem. Von dort würden sie sich herabstürzen?
Steil ging es von den beiden Plattformen, die nun, nur wenige Meter unter der Zirkuskuppel, auf wackeligen Holztürmen aufgebaut waren, hinab. Sechzig Grad betrug die Neigung, die Zirkusdirektorin wurde es nicht müde, damit zu prahlen. Sechzig Grad abwärts auf einer Bahn, die aus Holzlatten gezimmert war. So schmal wie möglich, gerade so, dass die zwei Räder, auf denen sich die Artisten in der Mitte begegneten, einander passieren konnten.
Doch nicht genug damit, dass sich Lotta und Jean Pignot todesmutig auf ihren Drahteseln in die Tiefe stürzten, die schmale Bahn entlangrasten, aufeinander zu, aneinander vorbei – nein, die hölzerne Bahn bog sich in der Mitte der Manege zu einem großen Looping. Kopfüber würden die Artisten am höchsten Punkt des Runds mit rasender Geschwindigkeit fahren, ungesichert, gehalten nur von der Fliehkraft. Hier würden sie sich begegnen, Lenker an Lenker, Lotta in einer weißen Spitzenbluse und schwarzer enger Hose, Reiterstiefeln und kunstvoll geflochtenem Haar. Jean, ihr französischer Ehemann, formvollendet im Frack, auf dem Kopf ein Zylinder, den ein Gummiband daran hinderte, ihm bei der Todesnummer vom Kopf zu fallen.
Nachdem die Artisten den Looping durchfahren, die Begegnung überstanden hatten, rasten sie auf einem kleinen Abzweig ins Publikum, durch die Gänge zwischen den Logen hindurch, passierten ein Loch im Vorhang, das aufmerksame Helfer für sie offen hielten, und verschwanden kurz außerhalb des Sichtfelds der Zuschauer. Bis sie gleich darauf von entgegengesetzten Seiten in die Manege stürmten, sich an den Händen fassten und glücklich den donnernden Applaus der Menge entgegennahmen.
Aber noch war es nicht so weit. Noch drängelten sich die Zuschauer auf die Plätze und bestaunten das hölzerne Gerüst.
Die Kapelle nahm auf der Empore Platz, bereit, die waghalsige Nummer der Pignots mit dramatischem Trommelwirbel und abschließendem Tusch zu begleiten.
Der Kapellmeister kannte den Ablauf der Nummer bis ins Detail. Seit Wochen begleitete er die rasante Abfahrt mit seinen Leuten musikalisch, er kannte das kollektive Luftanhalten, sobald sich die Radakrobaten von ihren Podesten gestürzt hatten, das hohe Kreischen der Frauen und das ekstatische Brüllen der Männer, wenn Lotta und Jean nur wenige Millimeter voneinander getrennt – ein Lenker touchierte um ein Haar den des Entgegenkommenden – durch den Looping stürzten. Auf die Sekunde genau gab er das Kommando zum Finale furioso, sobald die Todesakrobaten den Samtvorhang auch nur berührt hatten, und begleitete ihren Triumphzug durch die Manege mit wildem Crescendo.
Obwohl der Kapellmeister die Nummer der beiden nun wohl an die hundert Mal gesehen und untermalt hatte, blieb ihm, ebenso wie seinen Männern, jedes Mal aufs Neue schier das Herz stehen, wenn er dem Ehepaar bei seinem Kunststück zusah.
Nicht anders erging es den Kollegen und der Direktorin Paula Busch. Aus den Kulissen heraus verfolgten sie die Todesakrobatik der beiden.
Dabei war der Zirkus Busch, wie auch seine großen Konkurrenten Renz und Schumann, Sarrasani in Dresden, Krone in München, Hagenbeck in Hamburg und all die vielen fahrenden Zirkusse in diesem und in anderen Ländern, nicht arm an Attraktionen: Frauen, die in einen Käfig mit Raubtieren traten und Löwen den Kopf ins Maul legten. Trapezkünstler, die in schwindelnder Höhe durch die Luft flogen. Magier, die Zuschauer guillotinierten und Jungfrauen durchlöcherten. Dressurreiter, die mit dreißig geschmückten Gäulen gleichzeitig durch die Manege galoppierten.
Aber nichts faszinierte so sehr wie die Todesakrobaten. Menschliche Kanonenkugeln, Artisten als lebende Fackeln am Trapez, Hochseilkünstler, die in schwindelnder Höhe über ein schmales Seil liefen, nur mit einer Balancestange in der Hand, Frauen und Männer, die sich mit Automobilen, auf Rädern und abenteuerlichsten Konstruktionen aus großer Höhe herabstürzten, sich überrollten, auf Scheiben schnallten und durch die Luft katapultieren ließen, übten von jeher die größte Faszination aus.
Das Spiel mit dem Tod war die beste Ablenkung vom Leben.
Von all dem bekamen Lotta und Jean nur wenig mit. Sie wussten wohl, dass die Menge draußen, im großen Bau des Zirkus Busch, brodelte, kochte, bald rhythmisch zu klatschen beginnen würde. Aber noch saßen sie gemeinsam in der Garderobe, Lotta mit der Tochter Elly auf den Knien. Sie beobachtete ihren Mann, seine eleganten Bewegungen, mit denen er den tiefschwarzen Schnurrbart pomadierte und die Enden nach oben zwirbelte. Jean bemerkte, dass seine Frau ihn anlächelte, sie saß hinter ihm, und durch den Garderobenspiegel, umrahmt von Glühbirnen, sah er ihr zartes Lächeln. Er zwinkerte ihr zu.
»Bereit?«
Sie nickte. Dann setzte sie Elly auf den Boden der Garderobe, wo ein kleiner weißer Pudel lag und schlief. Mit dem Pudel würde Lotta gegen Ende der Vorstellung erneut auftreten, in anderem Kostüm, unter anderem Namen. Jean hatte bereits einen Auftritt vor der Pause gehabt, als der Magier Laszlo Thoma. Diesen Namen hatte Paula Busch vorgeschlagen, der ungarische Einschlag würde in den deutschen Ohren eher Anklang finden als ein französischer. Der Franzose war schließlich der Erzfeind. Jeder Stoß ein Franzos’.
Eine Überlegung, die bei der Todesfahrt der beiden Pignots wiederum keine Rolle spielte. Es kümmerte das Publikum wenig, wer sich da in Lebensgefahr brachte, die Sensationsgier ging vor.
Jean gab seiner Tochter, die sich nur noch für den Pudel interessierte, den sie aus dem Schlaf geholt hatte und der nun dankbar ihre klebrigen Fingerchen ableckte, einen Kuss auf den Scheitel, bevor er seine Frau umfasste. Sie spuckten sich drei Mal über die linke Schulter, begleitet von einem »Toi, toi, toi«, ein festes Ritual.
Hand in Hand liefen sie zum Künstlereingang des runden Baus. Unzählige Lichtgirlanden strahlten um das steinerne Rund. Gegenüber, auf der anderen Seite der Spree, ahnte man die korinthischen Säulen der Neuen Nationalgalerie, in einiger Entfernung, hinter der Monbijou-Brücke, strahlten Schloss und Dom. Im Dunkeln lagen ebenfalls das Pergamonmuseum, das Alte Museum und die vielen Lastkähne, die still in diesem Seitenarm des Stadtstroms vor sich hindümpelten. Allenfalls eine kleine Laterne sah man, von den seichten Wellen des Wassers sanft hin- und hergeschaukelt, die Wäschestücke, die eine Schiffersfrau an Deck auf die Leine gehängt und in der klirrenden Winternacht einzuholen vergessen hatte.
Überall herrschte Krieg, aber nicht im Mikrokosmos des Zirkus. Hier war es warm, laut, bunt. Hier arbeiteten Menschen ungeachtet ihrer Herkunft ohne Argwohn miteinander. Hier sah man Menschen, Tiere, Sensationen!
Drei Stunden ohne Verwundete und Hungernde, Tote und Trauernde.
Stattdessen Staunen. Lachen. Den Atem anhalten.
Lotta und Jean Pignot, die nun jeder für sich, angestrahlt von Punktscheinwerfern, auf einer Trapezschaukel stehend, zu ihrer jeweiligen Plattform hochgezogen wurden, waren Teil des Amüsements, und sie waren darauf sehr stolz.
In der Mitte der Manege, dort, wo der Looping hoch aufragte, stand Paula Busch höchst selbst, auch sie durch einen einsamen Scheinwerfer ausgeleuchtet, und machte die Ansage für ihre Todesakrobaten.
Der Kapellmeister ließ den Toreador-Marsch aus der Oper Carmen spielen, ein Gassenhauer, den er auch vor der Raubtiernummer einsetzte oder vor einer der monumentalen Pantomimen. Jetzt riss er seinen Arm hoch. Augenblicklich verstummte die Kapelle. Der Scheinwerfer, der die Zirkusdirektorin ins rechte Licht gesetzt hatte, wurde ausgeblendet. Die Artisten hatten ihre Plattformen erreicht. Einen Arm in die Höhe gestreckt, einen am Lenkrad ihrer Rennräder, blickten sie stolz hinab ins Auditorium. Sie konnten ihre Zuschauer im Dunklen nicht sehen, spürten aber sehr wohl, dass jeder der über tausend nun atemlos zu ihnen blickte.
Erneut gab der Kapellmeister ein Zeichen, woraufhin ein leiser Trommelwirbel ertönte, der das Signal für den Beginn des Todesspektakels gab.
Nun wurde die hölzerne Bahn – die schräge Abfahrt, der Looping, das Ende der Strecke – hell ausgeleuchtet. Synchron schwangen sich Herr und Frau Pignot auf ihre Räder und sahen zu ihrem Partner hinüber. Der Kapellmeister zählte bis fünf, dann ließ er den Arm mit dem Taktstock herabsausen, der Mann an der Trommel unterbrach den leisen Wirbel für einen lauten Paukenschlag. Lotta und Jean stießen sich ab und stürzten kopfüber auf die hölzerne Bahn. Kollektives Aufseufzen erfüllte die Zirkuskuppel.
Die Artisten rasten mit maximaler Geschwindigkeit in den Looping, standen kopfüber, rasten aufeinander zu, aneinander vorbei – als ihre Lenker sich berührten, verhakten und Lotta, noch bevor sie begriff, was geschah, in die Augen ihres Mannes sah. Dunkelschwarz und voller Todesahnung.
Ein gellender Schrei zerriss die Stille, keiner würde später mehr sagen können, wer geschrien hatte, doch die Zirkusdirektorin wusste, dass sie es gewesen war, die als Erste, noch vor ihren Todesakrobaten, gesehen hatte, dass dies das Ende war.
Bleischwer stürzte das Knäuel aus zwei Fahrrädern, Lotta und Jean Pignot vom höchsten Punkt des Looping. Krachte auf den Boden der hölzernen Konstruktion. Kippte herunter in die Sägespäne der Arena, nur wenige Zentimeter von den Füßen der Direktorin entfernt.
Es war die Minute, in der Elly Pignot, zwei Jahre alt und in das Spiel mit einem kleinen Pudel vertieft, zur Waise wurde.
JOHN
Der rote Feuerball stieg über dem Häusermeer im Osten Schönebergs empor, als er die Kreuzung Bundesallee/Badensche Straße erreichte. Rot zeigte auch die Ampel, John bremste. Mit der rechten Hand hielt er sich am Ampelmast fest. »Nette Familie will im Kiez bleiben! Vierzimmerwohnung gesucht!« stand auf einem Zettel, »Suchst du Jesus Christus?« auf einem anderen. Sogar eine Handynummer hatte Jesus Christus auf vergilbtem Papier hinterlassen.
John suchte den Heiland nicht. Er hatte ihn längst gefunden. Er war ihm auf dornenreichem Weg gefolgt, und es fühlte sich noch immer an wie Erlösung.
Gelb, grün, John trat in die Pedale. Vom zweiten in den dritten Gang. Er überholte den Typen im Liegefahrrad, in dessen Windschatten er sich seit der Kleiststraße befand, und freute sich über sein schnelles Fahrrad. Es war ein wunderbares Herkules-Rad mit drei Gängen. Bestimmt fünfzehn, zwanzig Jahre alt. Eine »alte Mühle«, so hatte Klaus gesagt, als er ihm das Fahrrad überließ. John Mbete aber war dankbar gewesen und war es noch, alte Mühle hin oder her. Er hatte das Rad in der Selbsthilfewerkstatt von Klaus über Tage und Wochen hergerichtet. Es einmal komplett auseinandergenommen, gereinigt – sogar das Kugellager –, repariert, ersetzt und geflickt, wo es nötig war. Der Lack am Rahmen war an vielen Stellen abgestoßen, aber Klaus hatte ihm einen Stift in fast dem gleichen Aubergine-Ton geschenkt, in dem der Rahmen lackiert war.
Das war noch vor John Mbetes Anstellung gewesen. Bevor er die Ausbildung angefangen hatte. Ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als die Anerkennung durch war und er eine Arbeitserlaubnis bekommen hatte. Dafür stand das Fahrrad: für sein neues Leben.
Ein Leben in Deutschland.
Resolutes Klingeln, damit der Rechtsabbieger ihn bemerkte. Noch zehn Minuten bis zum Arbeitsbeginn, John legte einen Zahn zu. In fünf Minuten würde er die Bergstraße erreichen, das Fahrrad absperren und seine Schicht beginnen.
Die Luft war frisch, es war Ende September. In den letzten Tagen hatte die Sonne alles gegeben, aber morgens um Viertel nach fünf, wenn John aufbrach, schmeckte die Luft bereits nach Metall. Auf den ersten Metern brannte es im Hals, weil er so schnell fuhr, den Sauerstoff tief in seine Lungen sog. Berlin war seine Stadt am frühen Morgen. Kalt und ruhig, die Luft so klar, wie sie am späteren Tag nie wieder sein würde. Seine Strecke führte ihn die Perleberger hinunter, durch den Tierpark, im Nebel winkten ihm die Silhouetten von Goethe und Schiller zu.
Das war Deutschland.
Dritter, zweiter, erster Gang. Am Ziel. John Mbete schaltete gewissenhaft, so als sei er Fahranfänger in einem neuen Auto. Geschmeidig bremste er vor dem Fahrradständer ab und schob das Herkules auf den freien Platz. Seinen Platz. Es hatte Wochen gedauert, bis er begriffen hatte, dass man sein Rad nicht einfach irgendwo hinstellen sollte. Seine Kollegen hatten feste Plätze, sie stellten ihre Räder jeden Tag auf den gleichen, ihren Stammplatz.
Das gab es nicht dort, wo er herkam. Aber jetzt, so viele Jahre des Lernens später, fand John Mbete es schön, dass auch er einen Stammplatz hatte.
»Einhunderteins?«
John staunte. Sie hatten eine neue Bewohnerin bekommen, die laut Unterlagen 1916 geboren worden war. Über hundert Jahre, das war selten und ihm in Deutschland noch nicht begegnet. Gut, auch in seiner Heimat nicht. Aber früher, in anderer Zeit, das wusste er aus den Erzählungen seiner Eltern, wurden die Ältesten sehr, sehr alt. So alt, dass niemand mehr die Jahre zu zählen vermochte.
Heute, in diesen Zeiten aber, erlebten die Menschen in seiner Heimat nicht einmal ihr dreißigstes Lebensjahr. Manche starben mit zwei. Wie sein Sohn. Oder mit zwanzig. Wie seine Frau.
Amina.
John Mbete schloss die Kladde mit den Unterlagen, die Sarah ihm gegeben hatte, und machte sich auf den Weg zu seiner ersten Runde. Er begann mit seiner Schicht um sechs. Es sei denn, er übernahm die Nachtschicht, dann fing sein Arbeitstag am Abend an.
Seit drei Jahren arbeitete John Mbete, dreißig Jahre alt, geflohen aus Somalia, im Seniorenstift an der Bergstraße.
Seit drei Jahren galt er als verlässlicher Mitarbeiter, angenehmer Kollege und liebevoller Betreuer.
Seit drei Jahren schrie Frau Schuster aus Zimmer 026 jedes Mal gellend, wenn er ihr Zimmer betrat.
Seit drei Jahren nannte Herr Tonndorf ihn »Sarotti-Mohr«.
Im ersten Stock angekommen, klopfte John an die Türen, wartete aber nicht ab, bis er hereingerufen wurde. Die alten Menschen in den Zimmern hörten ihn nicht. Oder sie hörten ihn und hatten vergessen, dass sie auf sein höfliches Klopfen antworten sollten. Wenn sie ihn doch hereinbaten, waren die Stimmen zu schwach, um durch die Tür zu dringen. Also öffnete John im gleichen Atemzug, in dem er geklopft hatte, und trat ein.
Was ihn dann erwartete, war immer gleich. Verbrauchte Luft, Dämmerlicht, das durch die Vorhangritzen troff. Einsamkeit. Vergebliches Warten auf ein Leben, das gewesen war.
Mit wenigen energischen Schritten durchmaß er das Zimmer bis zum Fenster. Während John Mbete die Vorhänge zur Seite schob, mit einer extra Portion Energie ein Fenster öffnete, wünschte er fröhlich guten Morgen. Die offensive Freundlichkeit war seine beste Waffe. Seine einzige.
Er hatte viele alte Leute kommen und sterben sehen. Aber die Hälfte war schon im Heim gewesen, als er angefangen hatte, dort zu arbeiten. Und es gab sie noch.
Die meisten Alten bekamen einen Schreck, wenn er das Zimmer betrat. Fast einen Meter neunzig. Schwarz wie die Nacht. Einige hatten sich vor ihm versteckt. Manche wollten sich nicht anfassen lassen. Und Frau Schuster schrie.
»Die sind in der Hitlerzeit aufgewachsen«, hatte der Heimleiter zu ihm gesagt. »Mach dir nichts draus, die gewöhnen sich schon dran.«
Aber John wusste, dass das nicht stimmte. Keiner der Alten gewöhnte sich je an ihn. Zwar störten sich nicht alle an seiner schwarzen Haut, es hatte in der Zeit, in der er hier arbeitete, durchaus auch Menschen gegeben, die sich freuten, einen Farbigen zu sehen. Einen Schwarzen, einen Neger. Er hatte Geschichten gehört von Amerikanern, die Kaugummi verschenkt hatten, Zigaretten und Seidenstrümpfe. Verstanden hatte er die Geschichten nicht. Nicht, was sie mit ihm zu tun haben sollten. Einem Ingenieur, der aus Somalia geflüchtet war und zufällig eine ähnliche Hautfarbe hatte wie manche GIs. Aber das hatte John für sich behalten, er hatte freundlich gelacht.
John Mbete lachte immer freundlich, er wusste, dass es den Deutschen die Angst vor ihm nahm. Und es machte ihn selbst wieder froh.
Die meisten der alten Menschen aber fügten sich in ihr Schicksal. Es blieb ihnen auch nichts anderes übrig, sie waren ja nicht aus freien Stücken im Pflegeheim. Ihre Kinder hatten sie abgeliefert, und nun dämmerten sie in ihren Zimmern dem Tod entgegen. Und ließen sich von einem Neger waschen, die Haare kämmen, die Fußnägel schneiden.
Manchmal, wenn der enge Zeitplan es zuließ, spielte John mit seinen Schützlingen. Backgammon, Dame oder Halma. Brettspiele hatte er schon mit seinen Eltern gespielt und natürlich mit Amina. Mit seinen Freunden, in der Gasse vor ihrer Hütte. Er hatte ein Backgammonbrett aus einer alten Palette zusammengezimmert. Geklebt, geschliffen und lackiert. Die Steine selbst geschnitzt aus dem Holz der Schirmakazie.
Ein schönes Brett. Es war verschwunden, vielleicht verbrannt, vielleicht hatte ein anderer es gefunden und spielte darauf, John hoffte es. Er hatte sich darauf gefreut, seinem Sohn Backgammon beizubringen, mit ihm an dem Brett zu sitzen, dem Brett, das er nur zu dem Zweck gemacht hatte: dass er es einmal seinem Sohn würde vermachen können. Der wäre stolz gewesen, er hätte mit der Hand über das Brett gestrichen und gesagt: Das hat mein Vater für mich gemacht. Es ist alt, das Brett, so wie mein Vater, und wir haben viele Jahre darauf gespielt.
Aber es hatte diese Jahre nicht gegeben. Nicht für das Brett. Und nicht für seinen Sohn. Nur John hatte überlebt.
Er kniff die Augen zusammen und klopfte an die Tür der neuen Bewohnerin. Trat ein, durchschritt den Raum.
Hörte eine Stimme.
John hielt inne und drehte sich zum Bett. Als Erstes sah er ihre Hand, dann den weißen Schopf. Er trat an das Bett und lächelte.
»Hereinspaziert, hereinspaziert!«, sagte die kleine Person mit zittriger Stimme. Sie winkte ihm noch immer mit einer Hand zu, winkte ihn zu sich.
»Guten Morgen, ich bin John.« Er nahm ihre Hand.
Sie hielt ihn fest. Knochen wie ein Vogelskelett. Zarte, dünne Haut. Zerbrechlich und voller Kraft.
John mochte die Haut alter Menschen. Sie war kostbar wie Pergament. Zart und leicht zu verletzen. Trocken und kühl. Ihm war, als schwitzten alte Menschen nicht mehr. Nicht nur die Europäer, auch die Alten in Somalia, soweit er sich erinnern konnte, hatten diese trockene Haut gehabt.
Einmal hatte er ein Weihnachtsgeschenk von einer alten Dame aus dem Seniorenstift bekommen. Im ersten Jahr seiner Anstellung. Es war eine Packung Pralinen, in hauchzartes Papier eingewickelt. »Seidenpapier«, hatte ihm die Dame erklärt. John Mbete hatte das Papier glattgestrichen und aufgehoben. Er hatte vorher noch nie Seidenpapier gefühlt, aber jetzt wusste er: Es war der Haut alter Menschen ganz ähnlich.
»Ein schwarzes Gesicht«, sagte die kleine Person im Bett jetzt, »wie schön.«
John setzte sich an den Bettrand. Sie hielt noch immer seine Hand. »Und wie heißen Sie?«
»Elly Simon«, sagte die Frau und reckte sich ein bisschen.
»Frau Simon.« John schüttelte ihre Hand und löste sich sanft aus ihrem Griff. Er betrachtete sie.
Sie sah nicht aus, als hätte sie ein Jahrhundert hinter sich gebracht. Sie war zierlich, aber erstaunlich muskulös. Ihre weißen Haare waren kurz geschnitten und legten sich wie Vogelfedern um ihren Kopf. Die Augen waren blau und hellwach. Nicht trüb wie bei den meisten Menschen, die hier lebten. Hell war auch ihre Haut und von unzähligen feinen Fältchen durchzogen, wie ein kunstvolles Spinnennetz.
Jetzt fasste sie nach seinem Gesicht. Instinktiv zuckte John Mbete zurück, aber dann begriff er, dass sie ihn nur berühren wollte. Zart legten sich ihre Finger an seine hohen Wangenknochen, ihr Handballen ruhte warm auf seiner Haut.
John war versucht, die Augen zu schließen, die unvermutete Berührung traf ihn wie ein Schlag. Wie lange war es her, dass ihn jemand so zart, so liebevoll berührt hatte?
Amina.
Viele Jahre. In einer anderen Welt.
Jetzt regte sich jemand hinter ihm. Es war Frau Schwarzbach, die Frau, mit der sich Elly Simon das Zimmer teilte. Frau Schwarzbach war sehr krank. Sie war nur noch selten bei klarem Verstand und verbrachte die meiste Zeit im Bett. John gab sich Mühe mit ihr, wusch sie, zog ihr den Morgenmantel an und setzte sie in einen Sessel, den er ans Balkonfenster schob. Von dort hatte man einen Blick in die kleine Parkanlage des Stifts. Vögel hüpften umher, mit Glück sah man Eichhörnchen die Kastanien hochflitzen, und man konnte die anderen Bewohner des Heims beobachten, die sich wie uralte Schildkröten durch das Grün bewegten. Im Rollstuhl, von einer Pflegekraft geschoben, langsam tippelnd am Arm von Angehörigen, einen Rollator vor sich herschiebend.
Kein vergnüglicher Ausblick, aber besser als der Blick auf die dem Bett gegenüberliegende Wand.
Nicht jeder Pfleger machte es so wie John. Aylin fand, das brachte nichts mehr bei Frau Schwarzbach, die bekäme doch nichts mehr mit. Aber John freute sich, wenn ein Sonnenstrahl auf das Gesicht der alten Frau fiel.
»Ein schönes, schwarzes Gesicht«, sagte Elly Simon jetzt.
Ihre Hand sank zurück auf die Bettdecke, die alte Dame lächelte versonnen, als träumte sie.
John betrachtete sie und spürte, wie er mit einem Mal müde wurde. Die warme Luft im Zimmer, die Dunkelheit, vor allem aber die Ruhe und Gelassenheit, die von der Frau vor ihm ausgingen, lähmten ihn. Er musste sich ermahnen, zu seiner Arbeit zurückzukehren. In seinem Rücken rumorte Frau Schwarzbach, viele Zimmer und noch mehr Menschen warteten heute wie jeden Morgen auf ihn, die alten Menschen in den Zimmern warteten darauf, dass er käme, um sie zu wecken, mit ihnen zu sprechen, das Frühstück und ihre Medizin zu bringen. Er schüttelte sich, stand auf und öffnete endlich die schweren Vorhänge. Morgenlicht drang aus dem Park ins Zimmer, durch das nun geöffnete Fenster hörte man die Vögel zwitschern.
Der Tag begann, John Mbete, und es würde ein guter Tag werden!
Der Tag wurde ein guter Tag, weil es ein Tag in Frieden war. John beschloss, dem Herrgott dafür zu danken, und kaufte auf dem Rückweg am späten Nachmittag etwas zu essen ein. Am Abend wollte er kochen und hoffte, dass sie gemeinsam friedlich zusammensitzen und sein Essen genießen und von ihrem Tag erzählen konnten, ohne sich zu streiten.
Streit gab es oft in ihrer Männer-WG, und immer war es John, der ihn schlichtete. In jungen Jahren war er wahrlich kein friedfertiger Mensch gewesen. Wie oft hatte er seinem Vater Schande gemacht und sich geprügelt. Hatte Alkohol getrunken, und wenn ihm einer blöd kam, hatte er zugeschlagen, ohne zu zögern. Aber dann war die Gewalt von außen in ihr Dorf gekommen, und die Schläge, die John ausgeteilt hatte, waren nichts im Vergleich zu dem, was er einstecken musste.
Wenn er eines in den Jahren der Hölle gelernt hatte, dann war es, dass Gewalt immer mit Gewalt beantwortet wurde. Er hatte es geschafft, aus der Spirale auszubrechen, er wollte friedfertig bleiben. Keine Schläge mehr austeilen. Keinen Streit beginnen.
Bis auf … John schüttelte den Gedanken ab. Er wollte nicht mehr daran denken. Dass er rückfällig geworden war. Aber das war eine Notsituation gewesen, sagte er sich, wenn der Gedanke daran kam.
Keinen Streit zu beginnen war mühsam, zumindest mit Ajmal. Ajmal war voller Wut. Wenn sie am Abend zusammen vor dem Fernseher saßen, Ajmal, Tesfai und er, dann kam es häufig zum Streit. Wer bestimmte, welches Programm sie sahen? Tesfai, der Eritreer, war jung, er liebte amerikanische Serien. Aber für Ajmal, den Afghanen, waren diese kaum zu ertragen: Freizügige Frauen, Witze über Sex, alle tranken ständig Alkohol. Ajmal dagegen wollte Sendungen sehen, mit deren Hilfe er noch besser Deutsch lernen konnte. Er belehrte Tesfai ständig und ermahnte ihn, sich mehr anzustrengen, Deutsch zu lernen. Ajmal sah gerne »Wer wird Millionär?« oder Ratesendungen für Kinder. Wenn er die richtige Antwort wusste, ballte er die Fäuste und reckte sie nach oben, er war der Sieger!
John dagegen liebte Dokumentationen. Über Tiere, Landschaften, Völker. Es berührte ihn tief, den Zug des Monarchfalters nachzuvollziehen oder zuzusehen, wie Wildgänse den Himalaja überquerten. Er war stets so gebannt, dass er nicht merkte, wenn ihm Tränen über die Wangen liefen. Erst wenn sich die anderen beiden über ihn lustig machten. Weil John sich nicht als Schwächling beschimpfen lassen wollte, verzichtete er auf die Dokus, solange die anderen da waren. War er aber alleine in der Wohnung, schaltete er so lange durch die Kanäle, bis er eine geeignete Sendung fand. Die ihn alles vergessen ließ. Seine Augen schweiften über die Tundra, tauchten ab ins Barrier Reef und erklommen die steilen Hänge der peruanischen Anden.
Sein Herz aber reiste nach Afrika.
Ihr Kompromiss beim Fernsehprogramm waren Nachrichten. Allerdings regte sich Ajmal manchmal über die Syrer auf, die nach Deutschland flüchteten. Tesfai und John wechselten dann Blicke. Sie wussten, wann sie umschalten mussten. Manchmal regte sich Ajmal so auf, dass er einen Schuh auf den Fernseher warf.
John verstand Ajmal, aber es strengte ihn an, mit ihm zusammenzuwohnen. Ajmal hatte für die Deutschen übersetzt, in Kundus. Als die Taliban nach dem Abzug der Deutschen wieder vorrückten, war Ajmals Leben bedroht. Er tauchte unter mit seiner Familie. Endlich traf der Bescheid ein, dass er in Deutschland Bleiberecht bekam. Erleichtert war die Familie aufgebrochen. Ajmal, seine Frau und die vier Kinder. Aber am Flughafen hatte man nur ihn gehen lassen. Seitdem hoffte Ajmal, dass seine Frau, sein Sohn und die drei Töchter nachkommen durften. Er verfluchte sich, dass er ohne sie geflogen war. Schimpfte sich einen Verräter und Feigling. Jeden Tag war er drauf und dran, in seine Heimat zurückzukehren. Aber dann erreichten ihn die Nachrichten. Von Freunden, von Verwandten. Geflohen, verfolgt, verprügelt, verhaftet, gefoltert, getötet. Und Ajmal verschob die Rückkehr. Auf den nächsten Tag, die nächste Woche. Währenddessen beteuerte seine Frau, es ginge ihr gut. Auch den Kindern. Aber Ajmal wusste, alle wussten es, dass dem nicht so war. Die Töchter durften keine Schule besuchen. Seine Frau ging verschleiert auf die Straße, sie, die als Ärztin im Krankenhaus gearbeitet hatte, schlug die Zeit damit tot, Essen zu organisieren und einen Unterschlupf.
Wie gesagt, John verstand Ajmal. Es war in Afghanistan nicht sehr anders als in seiner Heimat. Nur dass er keinen Sohn mehr hatte und keine Frau. Er hatte drei Schwestern und seinen Vater.
Trotzdem nervte der Afghane ihn.
Mit vollen Tüten erklomm er die vier Treppen zu der kleinen Wohnung, die sie sich teilten. Wie oft träumte John davon, dass er die Wohnung mit seiner Familie bewohnen würde. Die Tür öffnete und seine Kinder ihm fröhlich entgegenflogen.
Als er jetzt den Schlüssel ins Schloss steckte, wurde die Tür von innen geöffnet. Tesfai grinste ihm entgegen. Immerhin ein freundliches Gesicht. John hob die Tüte mit den Einkäufen hoch: »I will cook tonight«, sagte er. Der Junge klatschte in die Hände und klopfte John auf die Schulter. Sie verständigten sich radebrechend auf Englisch. John sprach fast fließend, aber Tesfai beherrschte nur das Nötigste. Ajmal wiederum verweigerte sich dem Englisch. Er sprach ausschließlich deutsch mit seinen beiden afrikanischen Mitbewohnern, er wollte sie erziehen. Und mit seinen Deutsch-Kenntnissen prahlen, unterstellte Tesfai.
In der kleinen Küche packte John seine Einkäufe aus. Er wollte Gewürzreis kochen, dazu gegrilltes Gemüse und eine scharfe Sauce. Auf den Reis konnten sie sich alle einigen, ihre nationalen Küchen waren unterschiedlich, so viel hatten sie schon herausgefunden. Und natürlich vollkommen anders als das deutsche Essen. John war kein großer Freund der deutschen Küche. Kartoffeln, Kartoffeln und Kartoffeln. Kaum Gewürze. Aber er mochte italienisches Essen. Schmeckte ihm sehr, manchmal versuchte er, Nudeln mit Sauce zu kochen, oder er kaufte sich irgendwo eine Pizza. Meistens aber kochten sie in ihrer Wohnung, auch weil es billiger war. Jeder hier hatte schon einmal gekocht. Männer, die für andere Männer am Herd standen. Auch das war neu für sie gewesen. John hatte sich Rezepte von seinen Schwestern schicken lassen. Als er in Deutschland ankam, wusste er nicht einmal, wie man Reis kochte. Seine drei Schwestern waren mit dem Vater in Somalia geblieben, weit weg von Mogadischu. Sie schrieben sich täglich, hielten ständig Kontakt. John schickte jeden Monat Geld, die Schwester schickten ihm Tipps. Wie man einen Knopf annähte. Wie man ein Hühnchen zerlegte. Oder wie man Reis kochte.
»Du good cook«, lobte Tesfai ihn, während er zusah, wie John den Lauch in schmale Röllchen schnitt und Karotten schälte. Zur Belohnung gab John dem Jungen eine Dose Cola.
»Guter Koch heißt das. Du bist ein guter Koch.« Tesfai nickte nur, beschäftigte sich lieber mit der Cola.
John war der Einzige in der Zweckgemeinschaft, der es sich leisten konnte, einkaufen zu gehen. Ajmal hatte weder Arbeit noch eine Erlaubnis. Er war lediglich geduldet. Tesfai hatte zwar die Anerkennung, aber bevor er eine Ausbildung beginnen konnte, musste er Deutsch lernen. Er absolvierte im Moment ein Praktikum bei einem Bäcker, ohne Geld dafür zu bekommen. Das, was er von der Behörde bekam, schickte er sofort nach Hause. Wie Ajmal, wie John. Einmal im Monat pilgerten sie zu Western Union. Danach wurde gespart. Tesfai wurde bei seinem Praktikum wenigstens durchgefüttert, sein Chef spendierte eine warme Mahlzeit am Tag. Ajmal ging ab und zu in die Suppenküche, auch wenn er es nicht zugab.
Um neun Uhr stellte John den gewürzten Reis auf den Tisch, dazu das Gemüse und die Sauce. Er trank ein großes Glas warme Milch mit Kardamom, Tesfai nuckelte noch immer an der Cola herum. Ajmal war nicht aufgetaucht. Er hatte einen Cousin hier in Berlin und blieb oft bis spät in die Nacht bei diesem. Er fühlte sich wohler dort, bei seiner Familie, als mit diesen beiden Afrikanern. Das war diesen beiden Afrikanern nur recht. Kein Streit. Keine Schuhe, die flogen.
Auf dem Bildschirm liefen die Simpsons. John kannte die Serie noch aus Somalia. Im Internetcafé in Mogadischu waren den ganzen Tag amerikanische Serien gelaufen. Bis der Fernseher im Kugelhagel explodierte.
Er konnte es noch immer sehen. Sah auf den Bildschirm, und vor seinem geistigen Auge explodierte dieser erneut. Der ohrenbetäubende Lärm der Maschinengewehrsalven. Die Explosion. Das Feuer über der Bar, dort, wo der Fernseher hing. Millionen winziger Glassplitter, die in einem Schauer über ihnen allen, die im Internetcafé waren, niedergingen wie Eisregen. Als Amina später versucht hatte, ihm die Haare zu waschen, waren ihre Hände voller Schnittwunden gewesen, ihre Haut hatte geblutet, und das Wasser, das ihm aus den Haaren troff, war rosafarben gewesen.
John kniff die Augen zusammen, um die Bilder zu verscheuchen. Er wollte an den guten Tag zurückdenken. Einen Strich auf seiner inneren Liste machen: schon wieder ein schöner Tag in deinem Leben, John Mbete!
Er brauchte nur ein Bild, an dem er sich festhalten konnte. Heute war dieses Bild Elly Simon, die Hundertjährige. Ihre Hand auf seiner Wange. »Ein schönes schwarzes Gesicht!«
Als er nach dem Mittagessen wieder in ihr Zimmer gekommen war, um sich mit ihr zu unterhalten, sie vielleicht zu einem Spaziergang in den Garten mitzunehmen, hatte sie geschlafen. Aber John hatte gesehen, dass sie sich Fotos auf ihre Kommode gestellt hatte. Eines zeigte einen Mann mit weißem Haar. Er trug einen hellblauen engen Anzug, der über und über mit glitzernden Steinen bestickt war. Es war eine Farbfotografie aus den siebziger Jahren, tippte John, auf jeden Fall lange vor seiner Geburt. Das schloss er aus dem Schnitt des Anzugs und der Frisur des Mannes. Das Besondere aber war nicht der Mann auf dem Bild. Der Grund, warum Johns Blick als Erstes auf dieses Bild gefallen war, waren die Tiger. Fünf Tiger umrahmten den Mann, zwei auf jeder Seite und einer zu seinen Füßen. Der Mann – John schätzte ihn auf etwa sechzig Jahre – lächelte völlig entspannt, eine Hand hatte er sanft auf den Kopf des Tigers neben ihm gelegt.
»Las Vegas.« Elly Simon war wach geworden. Sie sah nun auch auf die Fotografie. »Mein Mann. Hans.«
»War er Dompteur?« John hatte auf das Bild gezeigt.
Die Augen der alten Frau hatten sich auf ihn gerichtet. Strahlten vor Stolz. Elly Simon hatte genickt. »Waren Sie schon einmal im Zirkus, Herr John?«
Er schwieg.
»Der Zirkus«, hatte sie gesagt, »der Zirkus war mein Leben.«
ELLY
Der Pudel mochte das neue Spiel nicht. Bellend sprang er um den kleinen Blechwagen herum, der sich mühsam über die Holzbretter schob und ab und zu ein feines Dampfwölkchen ausstieß. Der vordere der beiden Blechclowns, die auf dem Dampfwagen saßen, wurde vom Zusammenspiel mehrerer Zahnräder langsam in die Höhe gehoben und schlug, hatte er den höchsten Punkt erreicht, mit einem winzigen Hämmerchen auf eine Glocke. Ein hohes Pling, dann setzte sich das Blechmännchen gehorsam auf seinen Sitz zurück, und weiter ging die holprige Fahrt.
Elly schob den störenden Pudel sanft mit ihrer Kinderhand zur Seite, damit dieser den Wagen aus bunt bemaltem Blech mit den beiden Clowns darauf nicht aufhielt. Der stoppte nun am Bein des Garderobentisches. Mit einem empörten Schnaufen stieß der kleine Schornstein ein Rauchwölkchen aus, die Zahnräder wurden langsamer und immer langsamer, der Mechanismus stellte seine Arbeit ein, und der vordere Clown blieb, mit dem Hinterteil auf halber Höhe, in der Luft hängen.
Mit einem Satz war Elly auf den Füßen und fiel zuerst Luigi, dann Zagarollo in die Arme, dankbar für das wunderbare Geschenk.
»Tanti auguri, kleine Fee«, murmelte Zagarollo, der ältere der beiden echten Clowns, liebevoll und drückte das Mädchen. Luigi, Zagarollos Sohn, warf die Achtjährige hoch in die Luft. So wie er es immer schon getan hatte, und erst recht, seit die Eltern der kleinen Kollegin gestorben waren.
»Wir müssen raus«, mahnte er und gab Elly einen Klaps auf den geflickten Hosenboden. Das Mädchen setzte sich den löchrigen Hut mit den Blumen aufs Haar, pustete hastig die acht Kerzen ihres Geburtstagskuchens aus und folgte ihren Kollegen auf dem Weg in die Manege. Der Pudel legte sich leise knurrend vor das winzige Blechgefährt und überwachte es mit Argusaugen.
Um in die Manege zu gelangen, mussten sie den Platz hinter dem Zirkusbau überqueren. Über dem sommerlichen Berlin ging ein Wolkenbruch nieder, und die drei – zwei große Clowns und die halbe Portion in ihrer Mitte – zogen die Köpfe zwischen die Schultern und rannten, so schnell die Clownsschuhe es ihnen erlaubten, auf den Hintereingang des Zirkus Busch zu.
Vor der geöffneten Tür standen einige Kollegen, Bühnenarbeiter, der Zauberer Titus Magnussen, der im bürgerlichen Leben Walter Handschuch hieß, sowie zwei der schönen ungarischen Artistinnen und rauchten. Als sie die Clowns mit Elly an der Hand erblickten, riefen sie dem Mädchen Geburtstagsgrüße zu, und Magnussen zog einen Strauß Seidenblumen aus dem Ärmel seines Fracks. Elly warf glücklich lachend den Kopf in den Nacken. Sie hatte keine Zeit für einen Plausch, die Kapelle spielte bereits den Marsch, zu dem Paula Buschs Schimmel die letzten Runden drehten. Das Publikum klatschte rhythmisch, es war Zeit für Ellys Nummer.
Die Achtjährige ließ die warmen Hände von Luigi und Zagarollo los und stürzte durch den roten Samtvorhang in die Manege. Obwohl die Scheinwerfer blendeten und sie, aus dem Dunklen kommend, im ersten Moment nichts sehen konnte, musste sie sich ihren Weg durch die galoppierenden Pferde hindurch bahnen und in die Mitte der Manege rennen. Die schweren Tiere ließen den Boden erzittern, sie schnaubten, und ihr heißer Atem streifte das Gesicht des Kindes. Einige Schritte rannte Elly an der Seite der galoppierenden Tiere, bis sie zwischen Adrian und Princess eine Lücke fand, durch die sie schlüpfen konnte. Sobald sie das Innere des Runds erreicht hatte, gab der Kapellmeister das Signal, die Musik abzubrechen. Die Pferde fielen zunächst in Trab, dann in Schritt, und Paula Busch, die gestrenge Zirkusdirektorin, knallte einmal mit der Peitsche und richtete dann ihre Aufmerksamkeit auf das Kind in seiner viel zu großen, zerlumpten Hose, die nur von den bunten Hosenträgern an dem schmalen Körper gehalten wurde. Elly stolperte über ihre überdimensionierten Schuhe, hielt mit beiden Händen die Hutkrempe fest und jammerte übertrieben.
»Wo ist meine Mama? Und mein Papa?«
Paula Busch antwortete mit den Worten, die sie selbst ins Skript geschrieben hatte: »Kind! Wie kommst du hier in die Manege?«
»Ich habe mich verlaufen und meine Eltern verloren!«
»Nun, wie heißen deine Eltern denn?«
»Meine Mama heißt Luigi und hat eine rote Nase. Mein Papa ist der Papa von Luigi und hat auch eine rote Nase«, antwortete Elly programmgemäß in quengeligem Ton. Das Publikum johlte.
»Du willst mich wohl verschaukeln, freches Gör«, antwortete die Zirkusdirektorin von ihrem hohen Ross herunter. »Marsch, hinaus aus der Manege, hier haben Kinder nichts verloren!«
Wie verabredet rannte Elly nun einmal hierhin, einmal dorthin, prallte an der Mauer der Pferdekörper zurück, immer begleitet vom Lachen der Zuschauer, bis sie schließlich auf allen Vieren unter einem der Schimmel hindurchkrabbelte und sich auf die Umrundung der Manege setzte. Paula Busch ließ ihre Pferde mit wenigen Kommandos und Peitschenknallen hochsteigen und nahm dann huldvoll den Applaus der Menge entgegen. Während sie, begleitet von den Klängen des Marsches, mit ihrer Menagerie das Rund verließ, rannte Elly durch die Zuschauerreihen und suchte vermeintlich nach ihren »Eltern«.