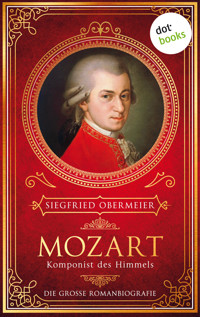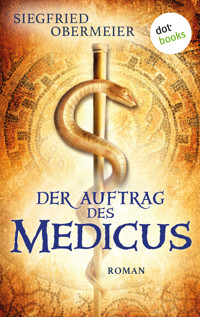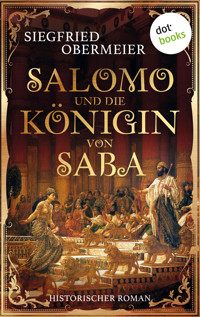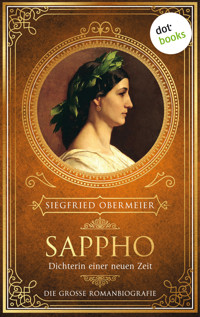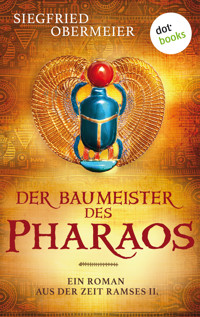4,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom Kriegshelden zum Tyrannenmörder: Das historische Epos »Die freien Söhne Roms« von Siegfried Obermeier jetzt als eBook bei dotbooks. Rom im Jahr 37. Die Größe und Macht des römischen Imperiums ist auf dem Rücken der Centurios gebaut: Zu ihnen gehören auch Chaerea, ein Prätorianer, der für seine besondere Tapferkeit im Kampf bekannt ist, und der Patrizier Sabinus, der sich von seinem hohen Erbe losgesagt hat, um seinem Land zu dienen. Im Schmelztiegel zahlloser Schlachten werden die beiden zu engen Freunden – und zu gerühmten Helden. Doch das ändert sich, als mit Caligula ein Despot den Kaiserthron besteigt. Seinen grausamen Launen unterworfen, müssen die Soldaten schreckliche Aufträge ausführen – und sind bald beim Volk verhasst und vom Senat gefürchtet. Chaerea und Sabinus erkennen, dass dem Tyrannen Einhalt geboten werden muss. Und so schmieden die beiden Männer einen Plan, der den Lauf der Geschichte für immer verändern wird … Mitreißend und auf wahren Begebenheiten beruhend erzählt Siegfried Obermeier die Geschichte der Helden, die Rom von der Geißel des wahnsinnigen Caligula befreiten! Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde historische Roman »Die freien Söhne Roms« von Siegfried Obermeier wird Fans der Bestsellerautoren John Maddox Roberts und Bernard Cornwell begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1052
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom im Jahr 37. Die Größe und Macht des römischen Imperiums ist auf dem Rücken der Centurios gebaut: Zu ihnen gehören auch Chaerea, ein Prätorianer, der für seine besondere Tapferkeit im Kampf bekannt ist, und der Patrizier Sabinus, der sich von seinem hohen Erbe losgesagt hat, um seinem Land zu dienen. Im Schmelztiegel zahlloser Schlachten werden die beiden zu engen Freunden – und zu gerühmten Helden. Doch das ändert sich, als mit Caligula ein Despot den Kaiserthron besteigt. Seinen grausamen Launen unterworfen, müssen die Soldaten schreckliche Aufträge ausführen – und sind bald beim Volk verhasst und vom Senat gefürchtet. Chaerea und Sabinus erkennen, dass dem Tyrannen Einhalt geboten werden muss. Und so schmieden die beiden Männer einen Plan, der den Lauf der Geschichte für immer verändern wird …
Mitreißend und auf wahren Begebenheiten beruhend erzählt Siegfried Obermeier die Geschichte der Helden, die Rom von der Geißel des wahnsinnigen Caligula befreiten!
Über den Autor:
Siegfried Obermeier (1936–2011) war ein preisgekrönter Roman- und Sachbuchautor, der über Jahrzehnte zu den erfolgreichsten deutschen Autoren historischer Romane zählte. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte Siegfried Obermeier die historischen Romane »Der Baumeister des Pharaos«, »Der Botschafter des Kaisers«, »Blut und Gloria: Das spanische Jahrhundert«, »Die Kaiserin von Rom«, »Salomo und die Königin von Saba« und »Das Spiel der Kurtisanen« sowie die großen Romanbiographien »Sappho, Dichterin einer neuen Zeit« und »Mozart, Komponist des Himmels«. Weitere Titel sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2022
Dieses Buch erschien bereits 1990 unter dem Titel »Caligula« bei edition meyster.
Copyright © der Originalausgabe 1990 edition meyster in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Michael Rosskothen, FXQuadro
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-935-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die freien Söhne Roms« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Siegfried Obermeier
Die freien Söhne Roms
Ein Roman aus der Zeit Caligulas
dotbooks.
Prolog
Eine Stunde nach Mitternacht braute sich über den Sabinerbergen ein Gewitter zusammen. Die letzten Septembertage waren ungewöhnlich heiß gewesen und lasteten auf Rom wie ein glühendes Dach. In dieser Nacht aber fegte ein Wind vom Adriatischen Meer übers Land, trieb regenschwere Wolken zusammen, die nun an den Bergen hängenblieben, bis heftige Sturmböen sie ins Tibertal jagten. Das ferne Grollen näherte sich, die Blitze beleckten mit feurigen Zungen den Mons Pincius, der Donner krachte ohrenbetäubend.
Der Kaiser erwachte jäh. Er hatte erst um Mitternacht ins Bett gefunden, war betrunken eingeschlafen, doch jetzt, beim grellen Schein der Blitze und dem Donnergepolter war er sofort hellwach. Gegen seine Gewitterfurcht war er machtlos, da konnte er sich zehnmal sagen, daß er hier in seinem Palast auf dem Palatinus sicher sei wie im Olymp und selbst wenn der Blitz ins Dach fuhr, gab es ringsum genügend Tempel und Paläste, wohin er sich hätte flüchten können.
Er hatte sich aufgerichtet und klammerte sich zitternd an die seidene Bettdecke.
»Wache!« kreischte er mit sich überschlagender Stimme.
Die Tür flog auf und zwei Prätorianer salutierten.
»Wollte nur sehen, ob ihr vor dem Unwetter weggelaufen seid«, versuchte der Kaiser zu scherzen.
»Aber Imperator ...«
»Ist ja gut! Raus mit euch!«
Das waren die einzigen, denen er noch traute. Er fühlte geradezu, wie sich in den Kreisen des Senats die Verschwörungen zusammenbrauten, spürte den Haß, der ihn umgab, durch das speichelleckerische Gebaren, mit dem sie ihm begegneten. Lemuren! Masken, hinter denen der Mord lauerte. Zu Dutzenden hatte er sie hinrichten lassen, hatte Verschwörungen im Keim erstickt, hatte foltern und töten lassen, hatte die Steinbrüche mit ihnen bevölkert, doch sie wuchsen nach wie die Köpfe der Hydra. Was sollte er nur tun? Und er dachte wie so oft: Hätte Rom nur einen einzigen Hals, er würde nicht zögern, ihn durchhauen zu lassen. Aber in diesem Rom, dieser faulen stinkenden Frucht am Baum des Reichs gab es viele Hälse, viele Köpfe – Köpfe, in denen er oft – mit Hilfe der Götter – die finsteren Gedanken lesen konnte, die allesamt nur darauf gerichtet waren, ihn zu vernichten, ihn, den göttlichen Augustus und Imperator Gaius Julius Caesar Germanicus, den Zwilling Jupiters, den Herrn der Welt, den sie respektlos, aber aus alter Gewohnheit Caligula nannten – das Stiefelchen. Und er ließ es geschehen, denn die Zeit, da dieser Kosename entstanden war, hielt er für seine glücklichste. In den langen Nächten, wenn der Schlaf vor ihm floh wie vor einem Aussätzigen, versuchte er sich mit Bildern aus der Vergangenheit zu trösten und zu beruhigen. Niemand konnte ihm diese Erinnerungen nehmen, sie waren sein köstlichster Schatz, eine warme behagliche Höhle, in die er sich zurückzog, in der er sich für wenige Stunden geborgen und sicher fühlte.
Ah, jetzt setzte der Regen ein und das Gewitter begann sich zu entfernen. Er ließ sich in die Kissen zurücksinken und sofort tauchten die vertrauten Bilder aus der Vergangenheit auf. Sie reichten lange zurück, bis in sein drittes Lebensjahr. Da war sein Vater Germanicus als Oberbefehlshaber in Germanien gewesen und hatte in zwei Schlachten den Cheruskerfürsten Arminius besiegt, hatte die Ehre der römischen Waffen wieder hergestellt. Und er, der Dreijährige war mit dabei gewesen, er und seine Geschwister. Da hatte es sich irgendwann ergeben, daß der kleine Gaius auch solche Stiefel wollte, wie sie die römischen Offiziere trugen und der Vater – immer zum Scherzen aufgelegt – ließ ihm welche anfertigen. Die sahen genauso aus, wie die Stiefel der Legaten und Tribunen, doch sie waren winzig – gerade richtig für einen Dreijährigen. Da lachten die Legionäre, wenn er durchs Feldlager marschierte, mit seinen herrlichen kostbaren Stiefeln hin- und herstapfte, damit sie es ja nur alle sehen konnten.
»Schaut, da kommt unser Stiefelchen«, riefen die Soldaten, »das ist schon ein richtiger kleiner Legionär!«
Der Vater ließ ihn gewähren, denn er war stolz auf diesen Sohn, in dem er schon den künftigen Heerführer sah.
Caligula lächelte und dachte: ich habe dich nicht enttäuscht, mein Vater, denn nicht nur Heerführer bin ich geworden, sondern Kaiser. Ja, Kaiser und Gott, Zuchtrute der Senatoren, allmächtig, unsterblich, einmalig, begnadet ...
Jetzt hielt es ihn nicht mehr im Bett. Wie so oft, hatten ihn die Gedanken an seine Göttlichkeit froh und heiter gemacht, ihn zu irgendwelchen Taten beflügelt. Und jetzt wollte er tanzen – vor Freude tanzen. Er sprang aus dem Bett und klatschte. Sofort kamen die Prätorianer herein, doch er befahl:
»Nicht euch brauche ich jetzt. Weckt die Musiker! Ich will Flöten und Trommeln haben!«
Und er brauchte ein Publikum! Sein vorzügliches Gedächtnis hatte viele Namen gespeichert und gleich fielen ihm drei Männer ein – ehemalige Konsuln – die seinen Tanz immer mit besonderem Beifall bedacht hatten. Er befahl, sie zu holen. Unterdessen kleidete er sich in aller Eile an, mit Tunica und orientalischem Fransenmantel, auch die mit Glöckchen besetzten Fußklappern legte er an. Die verschlafenen Musiker blickten erstaunt, doch Caligula fuhr sie an: »Glotzt nicht wie geköpfte Hühner! Spielt auf zum ägyptischen Tempeltanz, ihr wißt schon, was ich meine.«
Er intonisierte den Takt und lief voraus in den Audienzsaal. Dort begann er zu proben, hüpfte herum, stampfte mit den nackten Füßen, um die Glöckchen laut klingen zu lassen. Ja, das war es! Er fand den richtigen Takt und freute sich. Ein wahrer Göttertanz! Jetzt erschienen auch die drei Patrizier, übernächtig und zitternd vor Angst. Caligula ließ für sie Sessel aufstellen, gab den Musikern ein Zeichen und begann zu tanzen, hingegeben zum Ton der Flöten und der Trommeln. Links herum, rechts herum, schnelle Drehung, zwei Takte ausgesetzt, die Arme erhoben und wieder von vorne, bis ihm der Atem stockte und er stehenblieb. Die Patrizier klatschten.
»Ein göttlicher Tanz, Imperator! Ergebenen Dank, daß du uns daran teilnehmen ließest – ein Genuß, den man sich häufiger wünschte.«
Der göttliche Kaiser verharrte in Schweigen und schweigend tanzte er davon. Die drei Männer atmeten auf. Diesmal hatten sie die kaiserliche Laune überlebt ...
Zufrieden und herrlich müde stieg Caligula wieder in sein Bett. Sein Onkel und Adoptivvater, der verewigte Kaiser Tiberius hatte ihn wohl unterschätzt. Er, Caligula, hatte es nicht nötig, sich auf einer Insel zu verstecken, er blieb hier in Rom und trotzte ihnen allen, denn er las ihre Gedanken, er verkehrte mit den Göttern als ein Gleicher und er würde ewig leben – ewig, ewig, ewig.
Von dieser Nacht an hatte Kaiser Caligula noch drei Monate und sechsundzwanzig Tage zu leben.
Kapitel 1
Cassius Chaerea stammte aus der Gegend von Praeneste, der durch ihren Fortuna-Tempel weithin berühmten Stadt. Seine Eltern waren Pachtbauern und gehörten zur Clientel des Großgrundbesitzers Cassius Babulus, dessen Namen sie – wie üblich – dem ihren hinzugefügt hatten. Chaerea konnte sich erinnern, wie sein Vater sagte: »Das ist gewiß eine Ehre, aber auch eine Last. Zwar sind wir freie Menschen und römische Bürger, aber im Grund führen wir ein Sklavendasein. Uns bliebe nur eine Wahl: wir geben den Pachthof auf, gehen nach Rom, schlagen uns zur Plebs und lassen uns vom Kaiser ernähren. Da gehöre ich schon lieber zur Gefolgschaft des Babulus, auch wenn wir uns für diesen – diesen Herrn den Rücken krumm arbeiten.«
Chaerea war damals etwa fünfzehn Jahre alt und machte sich seine Gedanken. Er war der Zweitgeborene und wußte nicht recht, was er wollte. Eines aber war sicher: er wollte kein Pachtbauer werden und sich an einen Boden binden, der einem anderen gehörte. Da hatte sein Vater schon recht, denn das hieß frei und doch ein Sklave sein. Außerdem stand es seinem älteren Bruder zu, den Hof zu übernehmen.
»Da bleibt dir nur eines«, riet ihm der Vater, »du gehst zur Truppe. Leute unseres Standes bringen es zwar in der Regel nur bis zum Centurio, aber das ist schließlich auch etwas. Als Veteran kriegst du ein Stück Land, kannst dir ein paar Sklaven kaufen und bist dein eigener Herr.«
»Wenn’s überhaupt dazu kommt ...«
»Freilich mußt du auch Glück haben. Zu allem braucht man Glück. Aber schließlich bist du im Bannkreis der Göttin Fortuna geboren. Ehe du dich in Rom einschreiben läßt, pilgerst du nach Praeneste und bringst der Göttin ein Opfer dar.«
Chaerea folgte dem Rat seines Vaters, und bisher war ihm die Glücksgöttin sehr gnädig gesinnt. Mit knapp zwanzig war er schon Centurio und hatte die besten Aussichten, noch höher zu steigen. Das kam so.
Nach dem Tod des Kaisers Augustus brach bei den rheinischen Legionen eine Meuterei aus. Inzwischen war bekannt geworden, daß Tiberius, der Adoptivsohn des großen Augustus, die Nachfolge antreten würde, doch die Legionäre waren der Meinung, ihr geliebter Germanicus, zur Zeit Oberbefehlshaber der rheinischen Legionen, wäre dafür weitaus geeigneter. Sie meinten es gut, die braven und einfältigen Burschen, und ihre Vorgesetzten wußten das. Doch das wichtigste im Heer war die Wahrung der Disziplin und dagegen hatte alles andere zurückzustehen. Wer aber hatte die Ordnung wiederherzustellen? Das blieb – wie alles Unangenehme – an den Centurionen hängen, und sie waren auch zunächst die Zielscheibe der Meuterei. Die Soldaten rotteten sich bei Morgengrauen zusammen und stürzten mit gezückten Schwertern auf die Centurionenzelte los.
Chaerea hatte das kommen sehen und trat ihnen gepanzert und gerüstet entgegen. Seine hohe athletische Gestalt wirkte einschüchternd, aber die Leute waren wie von Sinnen und fielen ihn an wie ein Rudel Wölfe. Mit wuchtigen Schwertstreichen tötete er einen und verwundete etliche andere, ehe er sich losreißen konnte. Er diente damals bei der XXI. Legion und die hatte, wie man später feststellte, einundfünfzig von ihren sechzig Centurionen verloren. Die wütende Meute hieb sie in Stücke und warf die verstümmelten Körper in den Rhein. Chaerea schlug sich zum Zelt des Tribunen durch, dessen syrische Leibwache loyal blieb. Dort erstattete er Bericht und wurde gleich an Ort und Stelle für seinen Mut belobigt.
Es dauerte noch mehrere Tage, bis sich die Lage beruhigt hatte. Ein Dutzend der Anführer wurde unverzüglich hingerichtet und damit war die Meuterei beendet, aber der Wunsch der Truppe, ihren Germanicus als Kaiser zu sehen, blieb weiterhin bestehen. Die Soldaten sandten eine Abordnung zum Feldherrn und bestürmten ihn, Tiberius zu stürzen und selber den Thron zu besteigen. Germanicus aber blieb fest. Er hätte mit Hilfe der rheinischen Legionen nach Rom marschieren und dort die Herrschaft übernehmen können, doch der göttliche Augustus hatte bestimmt, daß er erst nach dem Tod des Tiberius – der ihn adoptiert hatte – für eine Nachfolge vorgesehen sei. Und daran hielt er sich. Das änderte aber wenig an seiner Beliebtheit, denn die Legionäre rechneten ihm seine Treue hoch an, obwohl er damit ihren Absichten entgegentrat. Das war für manchen Nichtsoldaten schwer zu verstehen, aber der Begriff Fides (Treue) nahm bei der Truppe den höchsten Rang ein und wurde deshalb auch als Göttin personifiziert und verehrt. Cassius Chaerea jedenfalls verstand es und hätte sich für Germanicus eine Hand abschlagen lassen.
Einige Wochen nach der Meuterei wurde Chaerea auf Betreiben seines Tribuns eine Auszeichnung für Tapferkeit verliehen. Julius Caesar Germanicus nahm solche Ehrungen – wenn er in der Nähe war – gerne selber vor, denn er liebte den unmittelbaren Kontakt mit seinen Leuten. Und darum liebten sie ihn.
Germanicus empfing die zur Auszeichnung vorgesehenen Männer am Eingang seines Feldherrnzeltes. An der Hand hielt er den vierjährigen Caligula, ein munteres Bürschchen mit frechem Gesicht, das den Soldaten Gesichter schnitt und ihnen die Zunge herausstreckte. Dafür gehörte ihm der Hintern versohlt, dachte Chaerea, aber die Leibwache des Germanicus feixte. Sie fanden offenbar alles lustig, was dieser kleine Teufel ausheckte. Germanicus aber mußte es bemerkt haben, blickte auf seinen Sohn, zog ihn am Ohr und schubste ihn ins Zelt zurück. Dann schritt er die Reihen ab, sprach mit jedem der Männer einige Worte und hing ihm die Auszeichnung um. Chaerea erhielt die silberne Virtus-Münze, auf der die Personifikation der Tapferkeit als behelmte Frau erscheint, die ihren Fuß auf einen Harnisch setzt.
Das männlich schöne Gesicht des Germanicus wirkte auf den ersten Blick mit dem weichen Mund und den träumerischen Augen wenig soldatisch. Doch dieser Anblick täuschte. Germanicus besaß einen eisernen Willen, bewies in gefährlichen Situationen Mut und Entschlossenheit, aber es gab auch eine andere Seite seines Wesens. Er schrieb gelehrte Abhandlungen, dichtete in griechischer Sprache und besaß einen Ruf als glänzender Redner.
»Du bist noch sehr jung, Centurio. Woher kommst du?«
»Aus Praeneste, Feldherr.«
Germanicus lächelte: »Dann ist Fortuna auf deiner Seite. Gehe weiter auf diesem Weg, und du wirst nicht Centurio bleiben.«
»Vielleicht wird er sogar Kaiser«, rief der kleine Caligula, der sich aus dem Zelt geschlichen hatte und kicherte.
Germanicus verabreichte ihm eine leichte Ohrfeige. »Aus dir wird jedenfalls keiner, da kannst du sicher sein. Geh’ sofort ins Zelt zurück!«
Heulend und sich die Backe reibend lief der Kleine zurück. Die Männer schmunzelten.
In den Monaten darauf begannen die Feldzüge gegen die Marser und Chatter. Bei dieser Gelegenheit besuchte Germanicus den Ort, wo der Cheruskerfürst Arminius sieben Jahre zuvor den römischen Feldherrn Varus besiegt hatte. Danach hielt er eine kurze Rede an seine Soldaten.
»Diese Schande sitzt nach wie vor wie ein häßlicher Flecken auf dem römischen Ehrenschild. Drei Legionen wurden damals vernichtet, und nun ist es unsere Aufgabe, diese Schmach abzuwaschen und Arminius mit seinen Kriegern von der Erde zu tilgen.«
Das war nun leichter gesagt als getan, aber schließlich hoch im Norden, auf dem Idistavisofeld wurde Arminius gestellt und besiegt, doch er selber konnte entkommen. Daraufhin war Kaiser Tiberius so vernünftig, diesen Teil Germaniens aufzugeben. Das kalte, unwirtliche Land mit seinen langen Wintern und seiner aufsässigen, kaum zu bändigenden Bevölkerung brachte Rom auf die Dauer keinen Gewinn. Seine Entscheidung wurde auch dadurch beschleunigt, daß die römische Transportflotte in der Nordsee durch einen Herbststurm fast vollständig zugrunde ging. Germanicus wurde als Oberbefehlshaber der Rheinarmee abberufen und in den Osten des Reiches versetzt.
Cassius Chaerea stieg in den folgenden Jahren zum Centurio erster Klasse auf, diente weiter in Germanien und Gallien und sah den Feldherrn Germanicus niemals wieder. Aber er konnte ihn nicht vergessen, schon weil sich sein Sohn Caligula später ganz anders entwickelte, und es sich erwies, daß er nicht das geringste vom Wesen seines Vaters geerbt hatte.
Nach der Neuordnung der Länder Armenien und Kappadozien trat Germanicus eine Studienreise nach Ägypten an, für die er sich – wie es Vorschrift gewesen wäre – keine kaiserliche Erlaubnis einholte. Ägypten nämlich war seit Augustus kaiserlicher Privatbesitz und stand als Kornkammer des Reiches unter der persönlichen Verwaltung des Princeps. Da dort ein politischer Umsturz für Rom von großer Gefahr gewesen wäre, mußten Ritter, Senatoren oder Mitglieder des Herrscherhauses sich vom Kaiser selbst die Besuchserlaubnis einholen.
Germanicus tat es nicht, und niemand weiß, warum. Vielleicht war es, weil er als Privatmann reiste und sich so von den Vorschriften für Staatsmänner nicht betroffen fühlte. Sein siebenjähriger Sohn Caligula durfte ihn nach Alexandria begleiten, der lauten volkreichen Stadt – nicht viel kleiner als Rom – doch von Ägypten, vom alten dreitausendjährigen Ägypten war hier nichts zu spüren. Alexander der Große hatte die Stadt aus strategischen Gründen – wie so viele andere – gegründet, und die Dynastie der Ptolemäer hatte hier dreihundert Jahre lang geherrscht – »bis Rom«, so erklärte Germanicus seinem Sohn, »die Königin Kleopatra besiegte und selber die Herrschaft über Ägypten antrat.«
Sie machten einen Höflichkeitsbesuch beim römischen Präfekten, der das Land für den Kaiser verwaltete und nur ihm allein verantwortlich war. Am Ende des belanglosen Gesprächs stellte der Präfekt die vorsichtige Frage: »Edler Caesar Germanicus, ich nehme doch an, du hast deinen Vater, den Imperator Tiberius, von deiner Reise unterrichtet?«
»Hätte ich es tun sollen?« fragte Germanicus harmlos.
Der Präfekt räusperte sich verlegen: »Nun, Caesar, du kennst sicher die Vorschriften. Ritter, Senatoren und Mitglieder des Kaiserhauses sollten ...«
»Ach was!« unterbrach ihn Germanicus. »Ich bin kein Senator und ziehe nicht als kaiserlicher Prinz durchs Land, sondern als einfacher Privatmann, der sich weiterbilden will. Meine Truppen sind in Syrien geblieben, ich reise nur mit meinem Sohn und einigen Dienern. Nicht der Rede wert! Wenn es deine Pflicht erheischt, so melde meine Reise nach Rom – ich bitte dich sogar darum. Nach meiner Rückkehr werde ich mich vor dem Kaiser selber verantworten.«
Einige Tage später trat Germanicus vom Nilhafen Kanopus die Fahrt nach dem Süden an. Doch zuvor besuchte er mit seinem Sohn die Sema, das Grab des großen Alexander im Zentrum der Stadt. Rings um das Königsgrab hatten die Ptolemäer ihre Grüfte angelegt, doch Germanicus winkte ab, als der Führer ihm die Sarkophage dieser griechischen Könige zeigen wollte.
»Nein, mein Freund, die Gräber dieser Griechen bedeuten mir nichts. Wir wollen Alexander die Ehre erweisen und nur ihm allein.«
Der mazedonische König und Eroberer der Welt lag einbalsamiert in einem goldenen Sarg, dessen Deckel aus dünnen Kristallplatten gefertigt war. Ehrfurchtsvoll traten sie näher. Caligula faßte nach des Vaters Hand und ließ sie nicht mehr los solange sie sich in dem stickigen, von Fackeln erhellten Raum befanden. Durch das trübe Kristall war das Antlitz des toten Königs nur undeutlich zu erkennen, doch das schwärzlich verfärbte, eingefallene Gesicht strahlte eine magische Würde aus. Seinen Körper bedeckte ein goldener Brustpanzer, Unterleib und Füße waren mit einem Purpurtuch verhüllt.
Germanicus legte als Opfergabe einen goldenen Lorbeerkranz vor dem Sarg nieder. Er beugte sich zu Caligula hinab und flüsterte: »Die Ägypter haben ihn zu einem Gott gemacht, die Griechen haben ihn verehrt, die ganze Welt hat ihn angebetet. Bedenke aber auch, daß alles vergänglich ist. Der große Alexander ist tot und ruht hier für ewige Zeiten in seinem Sarg, und die meisten der von ihm eroberten Länder gehören jetzt zum römischen Weltreich – auch Griechenland und Ägypten.«
Caligula aber gefiel der goldene Brustpanzer mit seinen schönen Bildern so sehr, daß er seinen Vater fragte : »Wenn jetzt alles Rom gehört, was damals König Alexander besaß, dann gehört sein goldener Panzer auch uns. Kannst du ihn nicht fortnehmen?«
Germanicus blickte auf seinen Sohn und sah die Habgier in den Augen des Jungen funkeln. Kindergeschwätz, dachte er, doch diese Frage enttäuschte und empörte ihn.
»Das ist Lästerung, Gaius, so denkt kein edler Mann. Doch du bist noch ein kleiner Junge, und so wollen wir deine Worte vergessen.«
Caligula aber vergaß den schönen goldgetriebenen Panzer nicht.
Auf einem Nilschiff fuhren sie nach Memphis, der einstigen Hauptstadt des alten Ägypten, doch seit Alexandria gewachsen und gar Millionenstadt geworden war, begann Memphis zu schrumpfen und zu verfallen. Die meisten der einstmals so prächtigen Tempel und Paläste lagen in Trümmern, doch der große Ptah-Tempel stand noch aufrecht, und der Kult um den Apis-Stier wurde noch immer gepflegt. Sie besuchten das Gehege mit dem heiligen Stier, der als die »lebende Seele« des Schöpfergottes Ptah galt und noch immer von vielen Gläubigen verehrt wurde.
»Ein Gott soll das sein?« fragte Caligula enttäuscht und deutete grinsend auf den schwarzen Stier mit den weißen Flecken.
»Man soll sich nicht über die Religion anderer Völker lustigmachen, mein Sohn. Der Apis-Stier wurde schon verehrt, tausend Jahre ehe Rom entstand. Jedes Volk hat seine Götter und es ziemt sich nicht, über fremde Glaubensnormen zu spotten.«
Von Memphis fuhren sie auf einer Nilbarke weiter nach Theben, das auch lange Haupt- und Residenzstadt der ägyptischen Könige war. Sie ließen sich von einem Priester durch die weitläufigen Tempelanlagen führen, und immer wieder fiel dabei der Name des Königs Ramses.
»Sie waren Götter, die Könige des alten Ägypten«, erklärte der Priester. »Heilige Wesen, unantastbar, hoch über den Menschen stehend. Sie heirateten meist ihre Schwestern, um das göttliche Blut nicht zu verunreinigen. Ihr Wort war Gesetz, weder das Volk noch ein Senat beschnitten ihre Macht. Ihre Titel waren ›Vollkommener Gott und Sohn der Sonne‹, und wer sie berührte, wurde sofort hingerichtet.«
Caligula war zu klein, um alles zu verstehen, doch es hinterließ in ihm einen tiefen Eindruck. Ehe die Hitze des Sommers einsetzte, verließen sie Ägypten und reisten zurück nach Syrien, wo sich die übrige Familie aufhielt. Dort gab es Schwierigkeiten mit dem Statthalter Calpurnius Piso, der auf Germanicus eifersüchtig war und viele seiner Verfügungen hintertrieben und aufgehoben hatte. Bald waren die beiden Männer so tödlich verfeindet, daß sie einander aus dem Weg gingen. Da reiste Piso plötzlich ab, und Caesar Germanicus wurde unmittelbar danach schwer krank. Die Ärzte konnten die Ursache nicht herausfinden, doch Germanicus behauptete, Piso habe ihm ein lange wirkendes Gift verabreicht und sei danach – um nicht verdächtigt zu werden – abgereist. Agrippina, seine Gemahlin, glaubte es jedenfalls.
Im Oktober starb Julius Caesar Germanicus mit Schaum vor dem Mund und seltsamen Flecken am ganzen Körper. Als man nach der Verbrennung die Asche einsammelte, fand man sein Herz unversehrt zwischen den verkohlten Gebeinen. Da wiegten die Ärzte ihre klugen Köpfe und gaben der Witwe zu verstehen, daß ein solches Phänomen manchmal bei an Gift Verstorbenen auftrete. Es hätte dieses Hinweises nicht bedurft, die rachsüchtige Agrippina klagte Piso sofort nach ihrer Rückkehr des Mordes an ihrem Gatten an. Während des Prozeßverlaufs nahm Piso sich das Leben, andere sagen, Tiberius habe ihn – ehe der Fall sich ausweiten konnte – beseitigen lassen.
Mit des Vaters Tod ging die glückliche Kindheit des Gaius Caligula zu Ende. Von nun an lebte er mit seinen Geschwistern – zwei Brüdern und drei Schwestern – im Haus der Mutter, doch es war ein gedrücktes freudloses Dasein. Agrippina war herrschsüchtig und von jähem Zorn, im übrigen lebte sie ganz ihrer Rache, die auch nach Pisos Tod nicht gestillt war. Sie hielt Piso ohnehin nur für ein Werkzeug des Kaisers Tiberius, in dem sie den wahren Schuldigen am Tod ihres Mannes sah. Sie sprach diesen Verdacht ganz unverblümt aus, als wolle sie den Langmut ihres kaiserlichen Schwiegervaters auf die Probe stellen.
Eines aber konnte man ihr nicht vorwerfen, nämlich, daß sie die Erziehung ihrer Söhne vernachläßigte. Die besten Hauslehrer wurden bemüht, um die Knaben in Geschichte, Geographie, Recht, Staatskunde und Literatur auszubilden.
Caligula lernte leicht und schnell und besaß ein fabelhaftes Gedächtnis, das er aber nur nutzte, wenn es ihm angemessen erschien. Einige Monate verpflichtete Agrippina einen Lehrer für Stilistik und Rhetorik. Seine Brüder langweilten sich bei diesen Lektionen, aber Caligula hing mit funkelnden Augen an den Lippen des Magisters und konnte bald die wichtigsten Reden des Cicero auswendig hersagen. Und nicht nur das – er bemühte sich, die Redekunst des berühmten Staatsmannes kritisch zu durchleuchten. Am liebsten war ihm Ciceros Rede für Marcus Rufus Caelius. Da entspannte sich der Fünfzehnjährige, wenn er lachend zu seinem Lehrer bemerkte: »Allein, wie Cicero seine Rede beginnt, ist bewunderswert. Wenn er gleich zu Anfang die Anklage zu einer winzigen Nichtigkeit herabredet und die Richter bedauert, daß sie wegen einer solchen Lächerlichkeit hier sitzen müssen, trotz der Festtage und während andere feiern. Das nimmt dem Fall von vorneherein die Schärfe, macht die Ankläger zu Hampelmännern, die verantwortungslos und eigensüchtig handeln. Dabei ging es immerhin um den Vorwurf einer Beteiligung an der Verschwörung des Catalina.«
Der Lehrer hob warnend die Hände: »Nun, ganz so ist es nicht, mein junger Freund. Freilich war es Ciceros Absicht, die Tat des Caelius zu verkleinern, ja sogar, sie zu einer verzeihlichen Jugendsünde herabzumildern. Aber bitte vergiß nicht, daß es sich bei den Richtern um alte erfahrene Männer handelte, die sich von geschickten Advokaten nicht so leicht betören ließen.« Caligula schlug mit der Hand auf die Buchrolle: »Und doch hat er sie betört, hat ihr Urteil beeinflußt. Die Richter sprachen Caelius frei, während alle Welt wußte, daß er ein Nichtsnutz war, ein Ehebrecher und von geradezu sträflichem politischen Leichtsinn. Mir gibt das zu denken. Caelius’ Charakter war allen wohlbekannt, und einem Redner wie Cicero gelingt es, ihn reinzuwaschen, einen Freispruch zu erwirken. Mir scheint, verehrter Magister, die Redekunst ist eine Waffe, schärfer als jedes Schwert, gefährlicher als jedes Gift, wirksamer als jede Medizin.«
»Da muß ich dir recht geben, Gaius, das hast du richtig erkannt. Ein geschickter Redner kann zum Mörder an Unschuldigen werden, kann Schuldige rehabilitieren, er selber wäre dann allerdings moralisch zu verurteilen, denn es wäre seine Aufgabe, der Unschuld beizustehen und die Schuld ans Licht zu bringen.« Caligulas starre Augen glitzerten. Hatte er gehört, was sein Lehrer anmerkte?
Nach einer Weile sagte er leise und mit abgewandtem Gesicht. »Moral? Was ist schon Moral? Am Ende zählt nur Stärke und ein geschickter Redner kann stärker sein als eine Legion.«
»Diese Bemerkung war zynisch, Gaius, und klingt häßlich aus dem Mund eines Knaben.«
Caligula lächelte spöttisch: »Klingt sie weniger häßlich aus dem Mund eines Erwachsenen?«
Den Lehrer fröstelte es. Hilflos sagte er: »Deine – deine Brüder würden so etwas – niemals – niemals ...«
Caligula winkte gelassen ab. »Meine Brüder sind Dummköpfe. Hast du das noch nicht bemerkt, verehrter Magister?«
Kapitel 2
Vipsania Agrippina befahl ihren Sohn Caligula zu einer Unterredung. Sie bat niemals und befahl immer.
Caligula war jetzt sechzehn Jahre alt; er konnte schmeicheln, loben, sich verstellen, doch er offenbarte niemanden gegenüber seine wahren Wünsche. Der hochaufgeschossene Junge wirkte mit seinen dünnen, stark behaarten Beinen und dem bleichen ältlichen Gesicht nicht gerade anziehend. Seine tiefliegenden, keine Regung verratenden Augen sahen alles, doch nichts spiegelte sich in ihnen, nichts drang in sie ein.
Agrippina saß am Fenster und las in einem Schreiben, das sie weglegte, als ihr Sohn eintrat. Ihr herrisches Gesicht mit den angriffslustig funkelnden Augen, dem schmalen trotzigen Mund und der schön geformten, kühn geschwungenen Nase wirkte alterlos. Sie hatte das dreißigste Lebensjahr schon um einiges überschritten, aber niemand sah es ihr an; auch nicht, daß sie neun Kinder geboren hatte.
»Die Götter mögen dich schützen ...«, murmelte Caligula zur Begrüßung.
»Die Götter, die Götter! Besser, man nimmt sein Schicksal selber in die Hand. Was hat es die Götter geschert, als Calpurnius Piso im Auftrag des Kaisers deinen Vater vergiftete? Einen Mann in der Blüte seiner Jahre, beliebter beim Volk als es dieser alte Lustmolch auf Capri jemals war. Er haßt unsere Familie, Gaius, er würde uns alle am liebsten umbringen – mich, dich und deine Geschwister. Was unternimmt er denn dagegen, daß sein Günstling Sejanus deine Brüder Nero und Drusus mit seiner Rachsucht verfolgt? Nichts! Nichts!«
»Vielleicht weiß er gar nichts davon«, meinte Caligula.
»Er will nichts davon wissen, läßt Sejanus freie Hand. Aber nun ergibt sich eine Gelegenheit, ihn aufzuklären. Er will dich wieder einmal sehen, seinen geliebten Großneffen. Hüte dich vor seinen Ränken! Capri ist eine Schlangengrube. Tiberius hat es mit dem Blut seiner Widersacher getränkt wie einen Schwamm. Das alte Scheusal wird heuer siebzig, und ich bete täglich, er möge doch endlich in den Orcus fahren.«
Caligula ließ sich nicht hinreißen.
»Er scheint noch recht gesund zu sein. Irgendeinen Kaiser braucht das Land. Sein einziger Sohn ist tot, die Enkel noch unmündig. Sejanus schielt nach dem Thron, aber es wäre unklug, ihn spüren zu lassen, daß wir es merken. Abwarten, Mutter, abwarten.«
»Dein Abwarten wird dich eines Tages den Kopf kosten, mein Lieber. Dich, als Jüngsten, hat Sejanus noch nicht auf seiner schwarzen Liste, aber er behält dich im Auge.«
Caligula lächelte düster. »Ich ihn auch, Mutter, ihn und einige andere ...«
»Wenn ich nur wüßte, was du wirklich denkst.«
»Ich möchte vorerst nur am Leben bleiben, weiter nichts.«
»Feigling! Hätte ich mein Leben höher gestellt als meine Rache an Piso, so würde dieser feige Mörder heute noch herumlaufen. Du machst deinem Vater keine Ehre, mein Sohn.«
Caligula wandte sich ab. Er fürchtete, sein Gesicht könnte der Mutter verraten, wie sehr ihn dieser Vorwurf traf. Leise sagte er: »Man muß am Leben bleiben, um Rache nehmen zu können, und man muß schlau und geduldig sein. Mit Tiberius ist nicht zu spaßen. Das solltest du bedenken, Mutter, ehe du mich einen Feigling nennst.«
Seit über einem Jahr lebte der Kaiser ganz auf Capri, wo er sich im äußersten Nordosten der Insel, in luftiger Höhe, die prächtige Villa Jovis errichtet hatte. Hier schlug nun das Herz des römischen Reiches, hier liefen die Fäden zusammen – wenn auch nicht mehr alle.
Einen Teil davon hielt Lucius Aelius Sejanus in Händen, der Günstling des Kaisers. Als beinahe allmächtiger Prätorianerpräfekt führte er in Rom alle Befehle des Kaisers aus, während ein machtloser und ständig gedemütigter Senat vor ihm zitterte und ihm zugleich schamlos schmeichelte. Offene Gegner gab es keine mehr – zu viele hatten schon ihren Kopf verloren.
Lange und gründlich wurden Agrippina und Caligula auf Waffen oder andere verdächtige Gegenstände untersucht.
»Laß die Finger von mir!« fauchte Agrippina den Prätorianer an, »der Kaiser wird sich doch nicht vor einer Frau fürchten? Dient ihr einem Mann oder einer Memme?«
Der Prätorianer zog es vor, auf solche Bemerkungen nicht einzugehen.
Der Kaiser empfing sie in dem ovalen Peristyl, einem Wunderwerk der Architekten. Die Säulen waren aus verschiedenen kostbaren Marmorsorten gefertigt, ein Baldachin aus blauer Seide überspannte einen Teil des Hofes, darunter stand ein Tisch aus Ebenholz mit Elfenbeinintarsien.
Caligula hatte seinen Großonkel über ein halbes Jahr nicht mehr gesehen und fand ihn stark gealtert. Wie fast alle männlichen Mitglieder des julisch-claudischen Hauses war Tiberius von hoher Gestalt, doch er ging stark gebeugt, und sein fast kahler Kopf zitterte leicht. Die in seinem Gesicht seit Jahren auftretenden Geschwüre waren mit Pflastern verklebt, was ihm ein groteskes Aussehen verlieh, denn sein Gesicht war von edlem Schnitt, mit großen Augen und einer schöngeformten Nase über einem Mund mit tief herabgezogenen Winkeln.
Flüchtig begrüßte er Agrippina und wandte sich dann an Caligula.
»Du bist schon wieder gewachsen, Gaius. Du wirst das oft hören, aber ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Was spricht man in Rom von mir? Liebt das Volk seinen Kaiser, wie es sich gehört?«
Caligula ging nicht auf den Spott ein.
»Das Volk entbehrt dich, Herr. Du würdest ihm eine besondere Freude bereiten, wenn du öfter nach Rom kämst. Die Leute reden von nichts anderem ...«
Agrippina mischte sich in das Gespräch.
»Außerdem sind wir es leid, von Sejanus geknüppelt zu werden, der sich freilich immer auf deine Befehle beruft. Er verfolgt meine Söhne Nero und Drusus; ich weiß kaum noch, wie ich mich dagegen wehren soll.«
Der Kaiser runzelte die Stirn, was ihm wegen der Pflaster schwer gelang. »Nero und Drusus sind erwachsene Männer, sie werden sich selber zu wehren wissen, doch ich nehme an, daß du wieder einmal übertreibst. Ich kann mich auf Sejanus verlassen, er würde es nicht wagen, sich an Mitgliedern unserer Familie zu vergreifen – ohne ausdrücklichen Befehl.«
»Den du ihm natürlich nicht erteilt hast ...«
»Nein!« sagte Tiberius scharf, »ich habe ihm nichts dergleichen befohlen. Bist du gekommen, um mit mir Streit zu suchen, Agrippina?«
Sie ließ sich nicht aus der Ruhe bringen: »Sejanus schleicht in Rom herum wie ein beutegieriger Wolf und verübt seine Schandtaten in deinem Namen, Tiberius. Täglich schadet er deinem Ansehen mehr, der ganze Senat umschmeichelt ihn, als säße er auf dem Cäsarenthron und nicht du. Es wäre klug, ihn von zuverlässigen Leuten überwachen zu lassen – Tag und Nacht.«
»Das tue ich ohnehin!«
Agrippina lachte hart und spöttisch: »Freilich tust du das, aber er kauft sich diese Leute – einen nach dem anderen.«
Caligula hatte dem Gespräch mit verschlossenem Gesicht zugehört.
Tiberius wandte sich an ihn. »Was ist deine Meinung dazu, Gaius?«
»Ich trage noch die Knabentoga, Erlauchter, da steht mir keine Meinung zu. Mir hat Sejanus bis jetzt nichts getan.«
»Feigling!« zischte Agrippina.
»Du nennst deinen Sohn einen Feigling, weil er die Wahrheit spricht?«
»Die Wahrheit – die Wahrheit! Er sagt nur, was du hören willst. Gehe nach Rom, und du wirst die Wahrheit mit eigenen Augen sehen.«
»Rom ekelt mich an, und ich werde hierbleiben. Du aber hüte deine Zunge, Töchterchen, in jedem deiner Worte steckt eine Majestätsbeleidigung. Genug davon! Ich will nichts mehr von Rom und Sejanus hören.«
Er klatschte in die Hände: »Tragt jetzt die Speisen auf!«
Die Tafel des Tiberius war nicht üppig, ihm lag nicht viel am Essen. Es gab gebratenen Fasan, eine Muräne in Senfsauce und Ofellos Ostienses, eine Art Ragout in Pfeffertunke. Agrippina nahm nur von den Speisen, die der Kaiser aß, mied den Wein und trank nur das Wasser, mit dem Tiberius seinen Falerner verdünnte. Danach wurden Früchte gereicht, Äpfel, Trauben und mit Honig übergossene Melonenschnitten. Der Kaiser verschmähte das Obst, doch er bot es Agrippina an.
»Ich habe das Obst nur deinetwegen servieren lassen, weil ich weiß, daß du es schätzst. Warum nimmst du nichts davon?«
»Es bekommt mir zur Zeit nicht, außerdem bin ich satt.«
Da griff Caligula nach einem Apfel.
»Laß das! Auch du verträgst kein Obst. Von diesen unreifen Äpfeln bekommst du nur Magenschmerzen.
Tiberius sah seine Schwiegertochter mit einem seltsamen Blick an: »Du wirst doch nicht glauben ...«
»Ich glaube gar nichts, Tiberius, außer, daß dein Obst uns nicht bekommt.«
Tiberius lehnte sich zurück und lachte leise. Er wirkte entspannt und vergnügt, was bei ihm sehr selten zu beobachten war.
»Jetzt weiß ich wenigstens, wofür du mich hältst. Du hast in Rom schon einmal einen solchen Verdacht geäußert. Ich hielt es damals für einen Scherz – jetzt bin ich klüger. Ich lerne auch als Siebzigjähriger gerne noch etwas dazu.«
Er stand auf und berührte Caligula am Arm: »Gehen wir ein paar Schritte, ich möchte mich mit dir noch ein wenig unterhalten.«
Agrippina ließ der Kaiser sitzen, als sei sie nicht mehr vorhanden. Als sie außer Hörweite waren, fragte ihn Tiberius: »Ist an dem, was deine Mutter behauptet, etwas dran? Ich weiß natürlich, daß ich nicht alles erfahre, was in Rom geschieht, aber daß Sejanus mich hintergeht, kann ich mir nicht denken.«
Caligula überlegte sich seine Antwort sehr genau: »Er hintergeht dich gewiß nicht, Herr, aber vielleicht legt er seine Machtbefugnisse zu weit aus. Mutter mag schon recht haben, wenn sie sagt, daß die Menschen ihm zu sehr schmeicheln. Nicht jeder verdient das Vertrauen, das man in ihn setzt – ich sage das nur ganz allgemein.«
»Du darfst nicht glauben, daß ich ihm ganz traue. Ich traue keinem! Was ein Mensch sagt und was er denkt, ist oft zweierlei. Aber deine Mutter geht in allem zu weit. Seit dein Vater tot ist, kann man mit ihr nur mehr schwer auskommen. Doch Schluß damit! Ich möchte dir jetzt die schöne Aussicht zeigen, die man von hier oben hat.«
Während sie eine ganz schmale marmorne Wendeltreppe hinaufstiegen, dachte Caligula: Ganz Rom würde sich freuen, wenn er endlich stürbe, doch solange Sejanus an der Macht ist, muß er am Leben bleiben. Zuerst Sejanus – dann er!
Lucius Aelius Sejanus hatte seit einigen Jahren nur ein einziges Ziel im Auge: Er wollte Kaiser werden, doch der Griff nach der Macht wurde ihm durch die Fruchtbarkeit der julisch-claudischen Familie erschwert. Es mußten so viele Menschen aus dem Weg geräumt werden, um dieses Ziel zu erreichen, daß er oft nahe daran war, aufzugeben. Doch der Wille zur Macht war in ihm so stark ausgeprägt, daß er immer wieder einen Weg – oder Umwege – fand, sich diesem Ziel zu nähern, Schritt um Schritt über Leichen hinweg.
Das stärkste Hindernis war Julius Caesar Drusus gewesen, der leibliche Sohn des Tiberius und sein unbestrittener Thronfolger. Als Drusus vom Kaiser die tribunische Gewalt erhielt, mußte Sejanus handeln.
Er machte sich an Claudia heran, die Gemahlin des Prinzen, und zog sie behutsam in seine Kreise. Seine eigene Frau Apicata stand ihm dabei im Weg – er jagte sie samt ihren zwei Kindern davon.
Die Macht hat ihren Preis, und niemand wußte das besser als Sejanus. Er war immer bereit, diesen Preis zu zahlen, denn am Ende stand das Ziel: Lucius Aelius Sejanus Imperator Augustus. In Gedanken kostete er seinen künftigen Namen aus und er fühlte sich durchaus imstande, das julisch-claudische Kaiserhaus abzulösen, denn er war Vetter, Bruder und Neffe von Konsuln, war mit den erlauchtesten altrömischen Familien verwandt. Er hatte das vierzigste Lebensjahr schon überschritten, doch er fühlte sich stark und gesund, allen Anforderungen gewachsen. Tiberius war schließlich schon sechsundfünfzig Jahre alt gewesen, als er den Kaiserthron bestiegen hatte.
Claudia war eine dumme Gans, aber er dankte den Göttern, daß sie es war. Sie fiel auf seine schamlosen Schmeicheleien herein, um so mehr, als sich Drusus immer stärker zum Säufer und Hurenbock entwickelte und sie sich vernachläßigt fühlte. Auch Kaiser können sich ihre Söhne nicht aussuchen, dachte er zufrieden und es dauerte nicht lange, da stieg er in Claudias Bett. Das war kein besonderes Vergnügen. Zuerst spielte sie die Verschämte und Unnahbare, aber dann brachte er sie auf Touren, das Dummchen, und sie quiekte und stöhnte wie eine Sau unter dem Eber.
Dieser Drusus, das Kaisersöhnchen. Freilich, als Soldat im Feld hat er seinen Mann gestanden, hat den Helden gespielt. Aber einer Stadt wie Rom war er nicht gewachsen, da brauchte es andere Qualitäten. Sejanus rieb sich die Wange. Das hatte er dem Burschen nie vergessen. Drusus übte damals gerade sein zweites Konsulat aus und geriet mit Sejanus wegen Claudia in Streit.
»Ich verbiete es dir in Zukunft, daß du bei den Symposien meine Frau anstarrst wie ein Schuljunge seine erste Liebe. Ihr zwinkert euch zu und tut, als seid ihr ein Liebespaar. Ich bin Konsul, Sejanus, und möchte nicht ins Gerede kommen, außerdem sind wir beide verheiratet.«
Sejanus feixte: »Schön, daß du dich daran erinnerst. Gibt es noch eine Frau in Rom, mit der du nicht geschlafen hast?«
Drusus trat mit drohender Miene auf ihn zu: »Willst du Streit? Oder soll das nur eine Ablenkung sein, damit ich euer Liebesgetändel vergesse? Ohne meinen Vater wärst du ein Nichts, Sejanus, weniger als ein Nichts!«
»Und du wärst nicht Konsul, Drusus, sondern bestenfalls Fischverkäufer oder Schankwirt in der Subura mitten im Hurenviertel.«
Da hatte Drusus ihm eine Ohrfeige verpaßt, die Sejanus noch immer auf der Wange brannte. Daraufhin spielte er Claudia den in tiefer Leidenschaft entbrannten vor, lauerte ihr bei jeder Gelegenheit auf und sagte, er würde sie auf der Stelle heiraten, wenn sie frei wäre.
»Du selbst bist ja auch noch verheiratet. Apicata hat dir drei Kinder geboren und wird ihren Platz nicht freiwillig räumen.«
»Das laß nur meine Sorge sein. Meine Liebe zur dir wird alle Schwierigkeiten überwinden. Unser großes Problem ist Drusus, dein Mann. Er kann sich aus Standesrücksichten nicht scheiden lassen, selbst wenn er wollte. Außerdem würde es ihm der Kaiser verbieten.«
Ihrem dummen Gesicht war anzusehen, wie angestrengt sie nachdachte.
Sejanus half nach: »Ich bin der zweite Mann im Staat, und Tiberius ist alt. Wenn er stirbt und Drusus nicht mehr lebt – nur angenommen! – und ich mit der Frau des Thronfolgers verheiratet bin ...«
Kaiserin sein! blitzte es durch das eitle Köpfchen der Claudia, erste Frau im Reich – Augusta! Sie atmete schneller. Und dieser Sejanus wäre an sie gefesselt, ein Leben lang, denn ihr hätte er – zum Teil wenigstens – den Thron zu verdanken, außerdem läßt sich ein Kaiser nicht scheiden. Was hatte sie denn von Drusus? Seit der Geburt von Julia mied er ihr Bett, und die römischen Lebedamen reichten ihn weiter, von einem Schlafzimmer ins andere. Sie blickte Sejanus an:
»Es müßte wie Selbstmord aussehen ...«
Sejanus schüttelte den Kopf. So dumm konnte nur Claudia sein: »Nein, meine Liebe, das nun gerade nicht. Dein Mann hat keinen Grund, sich umzubringen. Aber er ist ein Fresser und Säufer. Ein verdorbener Fisch, ein Pilzgericht, eine schlechte Auster – das wäre eher glaubhaft.«
Da Claudia sich nun einmal für diesen Weg entschlossen hatte, handelte sie schnell. Der ihr hörige Arzt und Freigelassene Eudemus braute ein Gift, das nach und nach verabreicht, äußerlich das Bild einer zehrenden Krankheit vermittelte. Der Praegustator (Vorkoster) des Drusus wurde bestochen und eingeweiht; der Thronfolger erkrankte, doch niemand nahm es sehr ernst, auch der Kaiser nicht. Er lebte damals noch in Rom, ging täglich in die Kurie und schien sich weiter keine Sorgen zu machen. Doch die »Krankheit« nahm ihren beabsichtigten tödlichen Verlauf.
Sejanus war seinem Ziel ein gutes Stück nähergekommen. Von Claudia begann er sich langsam zurückzuziehen. Sie war nur ein Werkzeug gewesen, und das mußte er jetzt loswerden. Freilich war er zu klug, sie das spüren zu lassen. Voll Zuversicht sprach er von Heirat und einer glanzvollen Zukunft. Er sandte Tiberius einen Brief und bat ihn um die Hand der Claudia. Er wußte genau, wie der Kaiser reagieren würde. Tiberius antwortete in einem langen freundschaftlichen Brief, der mit vielen Worten nur eines sagte: Laß die Finger von Claudia, denn ich habe andere Pläne mit dir und ihr.
Von da an änderte sich das Verhalten des Sejanus Claudia gegenüber. Er behandelte sie schroff und gleichgültig, und sie schlich dauernd mit verheultem Gesicht herum. Aber das fiel nicht auf, man schrieb es ihrer Trauer um Drusus zu. Sie drohte Sejanus, den Mordanschlag aufzudecken, doch der grinste nur und fuhr mit dem Finger über ihren Hals.
»Wäre schade um das schöne Köpfchen, mein Kind. Schließlich bist du erst Fünfunddreißig. Für mich ein wenig zu alt – das mußt du einsehen – aber zum Sterben zu jung.«
Was sollte sie machen, sie hing am Leben und mußte nun zähneknirschend mitansehen, wie Sejanus um ihre Tochter Julia warb. Sie war die Enkelin des Kaisers. Sejanus wollte sich möglichst nahe an den Thron heranheiraten. Doch da gab es wieder ein Hindernis: Auch Julia war seit drei Jahren verehelicht, und zwar mit Nero Caesar, dem Sohn der Germanicus.
Die Söhne des Germanicus! Sejanus wußte, daß er an ihnen nicht vorbeikam. Caligula war noch ein Junge, den konnte er vorerst vergessen, aber die beiden anderen, vor allem Julias Mann. Doch war es unmöglich, sein Verfolgungswerk unter den Augen des Kaisers fortzusetzen. Der alte Mann stand einfach im Weg, so lange er in Rom weilte. Es fiel dann Sejanus nicht einmal so schwer, Kaiser Tiberius von den Vorteilen einer entfernteren Residenz zu überzeugen.
Er kannte die Insel Capri seit langem, denn Kaiser Augustus hatte sich dort in seiner Sommervilla sehr gerne aufgehalten und Tiberius häufig eingeladen. Der Gedanke wurde ihm immer sympatischer. Er hatte dieses Rom satt bis obenhin. Er mochte die Menschen nicht, und sie mochten ihn nicht. Auf Capri würde er sich mit einigen Freunden umgeben, etwa seinem Lehrer Thrasyllus, den er überaus schätzte, und der Rom ebensowenig mochte. Wenn er an diesen Hofklüngel dachte, an die Kurie, an die Senatoren, an seine zahlreichen Verwandten, die immer etwas wollten. Sejanus hatte recht! Er konnte es zumindest einmal versuchen.
Kaiser Tiberius siedelte im dreizehnten Jahr seiner Regierung nach Capri über und ließ Rom in den Händen des Sejanus, dem er vertraute, wie keinem anderen Menschen. So hatte der Präfekt freie Bahn und machte sich nun daran, die Söhne der Agrippina und des verstorbenen Germanicus zu beseitigen.
Daß Tiberius dieser Familie nicht gewogen war, wußte Sejanus längst, und so ging er daran, zuerst den Menschen zu vernichten, den der Kaiser am wenigsten mochte – Vipsania Agrippina, die rach- und herrschsüchtige Mutter von Nero Caesar, Drusus dem Jüngeren und Caligula.
Aus Capri erhielt er den Hinweis, er möge verfahren nach Belieben, da diese Frau ihn, den Kaiser, ohnehin für einen Giftmischer hielt. Tiberius hatte Agrippinas Verhalten bei jenem Mahl weder vergessen noch verziehen.
Sejanus war trunken von seinen Erfolgen. Er selber blieb freilich im Hintergrund, gab sich niemals eine Blöße. Alles geschah auf den Befehl des Kaisers, alles ging rechtens zu.
Um den Vorwurf einer Willkür zu entkräften, sammelte Sejanus »Beweise« gegen Agrippina. Er ließ sie und ihre beiden älteren Söhne Tag und Nacht beobachten, führte Buch über jedes ihrer Worte, das man ihm hinterbrachte. So hatte sie angeblich die Absicht geäußert, sich mit ihren Kindern in den Schutz der Rheinarmee zu begeben, wo ihr verstorbener Gatte noch in hohem Ansehen stand. Auch solle sie erwogen haben, an einem belebten Tag auf das Forum zu gehen, um dort Volk und Senat um Hilfe anzuflehen. Wer die stolze Agrippina kannte, wußte genau, daß sie lieber hocherhobenen Hauptes zur Hinrichtung gegangen wäre, als sich so zu demütigen. Ihre Freunde aber versuchte Sejanus in Angst zu versetzen. Er ließ das Gerücht ausstreuen, eine Anklage wegen Hochverrat werde gegen Agrippina erwogen, so daß die Schreckhaften und die Vorsichtigen ihren Umgang mieden. So stand die stolze, leidenschaftliche und unbedachte Agrippina am Ende ganz allein. Caligula berief sich auf seine Knabentoga, und die beiden erwachsenen Söhne waren ihr keine Hilfe. Der eher sanfte Nero war so verunsichert, daß er nicht mehr wußte, was er sagen oder denken, wie er sich verhalten sollte. Drusus, der weder seine Brüder noch seine Mutter mochte, war von wildem unbeherrschtem Sinn, und Sejanus wartete nur darauf, daß er sich eine Blöße gab.
Im Fall der Agrippina aber hielt er die Zeit für gekommen. Der Senat erhob gegen sie Anklage wegen Majestätsverbrechen, wobei unter anderem der Punkt genannt wurde, sie habe Tiberius der Giftmischerei bezichtigt. Als diese Vorwürfe bekannt wurden, rottete sich das Volk auf dem Forum zusammen, umstellte die Kurie mit Heilrufen auf den Kaiser und ließ durch Sprecher den Senat wissen, man glaube, der Kaiser sei durch falsche Anschuldigungen getäuscht worden. Jetzt handelte Sejanus schnell.
Er ließ Agrippina durch seine Prätorianer festnehmen. Sie stieß dabei schlimme Schmähungen gegen den Kaiser aus und wehrte sich wie eine Wildkatze. Dabei wurde sie übel zugerichtet und verlor ein Auge, aber das hatte sie sich selber zuzuschreiben, wie Sejanus meinte.
Caligula hatte die Prätorianer kommen sehen und sich schnell durch die Hintertür verdrückt. Er hatte sich schon gewundert, daß Sejanus – oder Tiberius – so lange mit der Verhaftung zögerten. Damit wollte er nichts zu tun haben; für seine späteren Pläne wäre Agrippina nur hinderlich gewesen – auch wenn sie seine Mutter war.
Da er nun schon einmal dabei war, machte Sejanus reinen Tisch. Wenige Tage später ließ er Nero, Agrippinas ältesten Sohn, festnehmen und Drusus unter Hausarrest stellen.
Caligula aber tat das einzig richtige: Er floh aus dem verwaisten Haus in die Arme seiner Urgroßmutter Livia, die als Witwe des vergöttlichten Kaisers Augustus hohe Verehrung genoß und weder vor Sejanus noch vor ihrem Adoptivsohn Tiberius den geringsten Respekt hatte. Sie näherte sich dem neunzigsten Lebensjahr, doch sie nahm an allem wachen Anteil, mischte sich aber kaum noch in die Staatsgeschäfte. Sie mißbilligte die Verfolgung der Agrippina und ihrer Söhne, tat aber nichts, um sie zu schützen. Doch als Caligula in ihrem Haus Asyl suchte, gewährte sie es ihm bereitwillig und gab ihm mit ihrer zittrigen Greisinnenstimme den Rat:
»Bleibe hier, bis die Gefahr vorüber ist, und dann geh zu Tiberius nach Capri. Dort allein bist du in Sicherheit, solange der Kaiser diesen Sejanus deckt. Auch er wird stürzen, und ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Doch er muß fallen, ehe Tiberius stirbt – hörst du! Sonst sehe ich düstere Tage für Rom heraufziehen.«
Caligula gab Livia recht, tausendmal recht. Seit er vernünftig denken konnte, hatte er ihr Urteil geschätzt und bewundert, ja, sie als eine Art Pythia gesehen, deren Orakel – wenn auch manchmal verschleiert – doch immer die Wahrheit enthielten. Von dieser Frau war immer etwas zu lernen.
»Aber wie stellst du dir das vor, erlauchte Livia, – Sejanus zu stürzen? Da müßte man ja halb Rom zum Richtblock führen, ehe man ihn zu fassen bekäme. Es sind nicht nur Schmeichler, die ihn umgeben – viele verehren ihn wirklich. Für sie ist Tiberius nur ein düsterer Schatten, der über Rom liegt und der mit Hilfe des Sejanus bald weichen wird.«
Das zerknitterte Gesicht der Uralten blieb ohne Regung. Nur die jung gebliebenen Augen verrieten den wachen ungetrübten Geist in diesem greisenhaften Körper.
»So sieht es aus, ja, aber Rom ist nicht das Reich. Die Prokuratoren und Legaten in den Provinzen sind fast ohne Ausnahme stolze loyale Staatsdiener und haben nichts übrig für Usurpatoren, genauso wenig wie die Präfekten und Tribunen der Legionen. Dagegen sind die römischen Prätorianer ein Nichts, eine winzige Stadtarmee, die schnell hinweggefegt sein wird. Sejanus meint: Habe ich die Stadt Rom auf meiner Seite, fällt mir das andere von selber in den Schoß. Aber es ist genau umgekehrt; Octavian hat das niemals vergessen. Er wäre kaum unser erlauchter Augustus geworden, hätte er nicht zuvor seine Gegner in den Provinzen besiegt und die Beute dem Senat zu Füßen gelegt. Dann – erst dann fällt dir Rom in den Schoß. Sejanus mag schlau, mutig und entschlossen sein, aber er ist dennoch ein Dummkopf, weil er die Realität nicht sieht. Er stammt eben nur aus kleinem Provinzadel, ist unfähig, die wirklichen Zusammenhänge zu erkennen und wird scheitern, Gaius, glaube mir. Das ist so sicher, wie der morgige Sonnenaufgang.«
»Aber was ist, wenn er sich noch zwei, drei oder fünf Jahre hält?«
Caligula war nicht sicher, ob die faltige Grimasse auf Livias Gesicht ein Lächeln bedeutete.
»Was wäre gewesen, wenn Antonius meinen Octavian besiegt hätte? Das durfte nicht sein und konnte nicht sein, weil sich Octavian zu jener Zeit schon so viel Legitimität erworben hatte, gegen die Antonius nicht mehr ankam. Er saß mit seiner Kleopatra auf dem ägyptischen Thron und hatte sich damit gegen Rom entschieden. Bei Sejanus ist das nicht so offensichtlich, aber wenn er versucht, sich wie eine Made in unsere Familie hineinzufressen, so unterhöhlt er die Legitimität und ist ein Verräter an Rom. Ich hoffe nur eines und bete dafür zu den Göttern, sie mögen mich so lange leben lassen, bis Sejanus gestürzt und sein Verrat aufgedeckt ist.«
Caligula küßte der Uralten ehrerbietig die Hand und sagte: »Ich teile deinen Wunsch, erlauchte Livia.« Und er dachte: mein Wunsch ist es, daß ich euch beide überlebe und je mehr Sejanus von meiner Familie aus dem Weg schafft, um so mehr schmutzige Arbeit wird er mir ersparen, um so schneller komme ich an die Macht.
In Rom war der Prozeß gegen Agrippina eröffnet worden, und schon nach kurzer Verhandlung stand das Urteil fest: lebenslange Verbannung auf die wüste Insel Pandateria weit draußen im Tyrrhenischen Meer. Wenig später wurde ihr erstgeborener Sohn Nero Caesar mit demselben Urteil bedacht. Ihn schickte man auf die Pontinischen Inseln. Den wilden und anmaßenden Drusus aber nahm sich Sejanus persönlich vor. Er ließ ihn einige Monate in Frieden, machte ihm sogar Hoffnungen auf eine Teilung der Macht, bis der unbeherrschte Drusus sich eine Blöße gab und daraufhin sofort auf dem Palatinus eingekerkert wurde. Sejanus war nun seinem Ziel einen wesentlichen Schritt näher gekommen. Julia, die Frau des verbannten Nero, war nun für ihn frei geworden, und sie als leibliche Enkelin des Kaisers war sein eigentliches Ziel, und diesmal wollte er den Kaiser nicht um Erlaubnis fragen.
Er umwarb das Mädchen heftig, doch es hätte einer solchen Anstrengung gar nicht bedurft. Die Zweiundzwanzigjährige war ihres langweiligen Gatten längst müde geworden und verehrte den schlauen und mächtigen Sejanus im Stillen. Sie war mit einer heimlichen Verlobung einverstanden, denn noch waren nicht alle Gegner ausgeschaltet.
Flüchtig kam es Sejanus in den Sinn, daß Caligula, Agrippinas jüngster Sohn, noch frei herumlief. Aber der ist ja noch ein Kind, dachte er, und somit vorerst keine Gefahr. Dieser falsche Schluß sollte sich für Sejanus als verhängnisvoll erweisen.
Caligula aber folgte dem Rat seiner Urgroßmutter und begab sich in die Obhut seines Großonkels Tiberius, der rechtlich durch die Adoption des Germanicus sein Großvater war.
Kapitel 3
Cornelius Sabinus entstammte dem patrizischen Zweig einer altrömischen Familie, die auf eine stattliche Reihe von Konsuln, Senatoren und Feldherrn zurückblicken konnte – eine Reihe, die weit in die republikanische Zeit zurückreichte. Die Cornelier hatten sich im Lauf der Jahrhunderte vielfach verzweigt, in Neben- und Hauptlinien, in ärmere und reichere. Sein Vater, Cornelius Celsus, entstammte einer weniger bedeutenden Linie, die seit Generationen weder Konsuln noch Feldherren, sondern Gutsbesitzer, Gelehrte und Dichter hervorgebracht hatte.
Celsus lebte so lange seinen Studien, bis das väterliche Erbe aufgebraucht war. Wie aber sollte man als Schriftsteller und Gelehrter zu Geld kommen? Mit eigenen Veröffentlichungen? Das war ihm zu unsicher, und so wurde er Buchhändler und Verleger. Er ging dabei nicht den üblichen Weg mit gekauften Schreibsklaven, die sehr teuer waren, auch ernährt und untergebracht werden mußten. Er beschäftigte als Kopisten alte, in Not geratene Lehrer, Schüler, die sich etwas dazuverdienen mußten, oder unterbezahlte Sekretäre, die für ihre Familien ein Zubrot brauchten. Die mußte er nicht kleiden und nähren, und am Feierabend gingen sie nach Hause. Im Gegensatz zu manchen Sklaven waren sie durchwegs fleißig, weil sie die gutbezahlte Beschäftigung nicht verlieren wollten. So beschäftigte Celsus je nach Auftragslage sechzig bis hundert Kopisten. Auf eigenes Risiko verlegte er nur Gängiges wie Platon, Vergil, Ovid, Catull und Cicero, oder er gab einen Zyklus von griechischen Sagen heraus, die er dem Imperator Tiberius widmete. Jeder wußte, daß dies des Kaisers Lieblingslektüre war, und wie sehr er sich dafür einsetzte, daß sie unters Volk kam. Manchmal verlegte er auch lebende Autoren wie Lucius Annaeus Seneca, der neben philosophischen Abhandlungen auch schon zwei Dramen veröffentlicht hatte.
Auf diese Weise gelang es Cornelius Celsus in wenigen Jahren ein ansehnliches Vermögen zu sammeln, so daß sein einziger Sohn Sabinus im Reichtum aufwuchs. Er schien es darauf anzulegen, in allem das Gegenteil von seinem Vater zu tun. Celsus war kaum jemals über die Mauern Roms hinausgekommen; sein Sohn riß zum ersten Mal mit vierzehn Jahren aus, doch er kam nur bis Ostia. Celsus schätzte ein behagliches Gelehrtenleben mit regelmäßigen Mahlzeiten, einem überschaubaren Tagesablauf und möglichst wenig Veränderung. Schon eine umgestellte Truhe oder ein neues Möbel konnten ihn zur Verzweiflung bringen, während sein Sohn die ständige Abwechslung liebte. Mehr aus Bequemlichkeit war Celsus ein treuer Ehemann, während Sabinus als Zwölfjähriger eine ältliche Wäscherin verführte, die vor Erstaunen kaum wußte, was ihr geschah. Von da an war er hinter jedem Rock her und besaß als Achtzehnjähriger schon eine Erfahrung, die andere im ganzen Leben nicht sammeln können.
»Von wem er das nur hat«, fragten sich seine Eltern und schauten sich kopfschüttelnd an.
»Von mir nicht!« sagte Celsus fest und meinte: »Da gab es einen Onkel, Crispus, er war ein Bruder meines Vaters, der trieb es genauso schlimm. Mit zwanzig ging er nach Hispania, wir haben nie wieder etwas von ihm gehört.«
Sabinus wuchs zu einem ansehnlichen Burschen heran. Er war schlank, sehnig, mittelgroß und hatte das kastanienfarbene Haar und die blauen Augen seiner Mutter geerbt. Bei ihm hatte dieses Blau eine beunruhigende Intensität angenommen. An seinem schmachtenden Lächeln blieben die Frauen hängen wie Wespen am Honig, und jede glaubte, dieser strahlend blaue, hingerissene Blick gelte nur ihr – ihr allein. Aber das Gegenteil war der Fall. Dieser Blick galt allen Frauen, in Rom, in Italien, in den Provinzen – allen Frauen auf der ganzen Welt.
Sabinus wuchs in einer Welt des Geistes auf. Schriftsteller, Dichter und Gelehrte gingen im Haus seines Vaters ein und aus, die Gespräche drehten sich um Literatur, Wissenschaft und Kunst. Sabinus, der ein enormes Gedächtnis besaß, wußte nicht nur über Frauen eine ganze Menge, sondern er wäre imstande gewesen, über die Literatur des augusteischen Zeitalters einen dreistündigen Vortrag zu halten. Doch das war die Welt seines Vaters, und er gab vor, daß sie ihn zutiefst langweile. Das stimmte freilich nicht ganz, und im Kreise seiner Freunde prahlte er gelegentlich mit seinen Kenntnissen. Aber zu Hause tat er, als gehe ihn das alles nichts an. Da sprach er dann mit Vorliebe von den Pferderennen im Circus Maximus und konnte die Sieger der Blauen, Grünen, Weißen und Roten der letzten drei Jahre aufzählen.
Nun war Sabinus Neunzehn geworden, trug die Toga Virilis (Männertoga) und wußte noch immer nicht, was er wollte. Er lebte in den Tag hinein, half, wenn er Lust hatte, seinem Vater beim Verschnüren der Buchrollen, und war der Augapfel seiner Mutter Valeria, die seine Schwächen zwar nicht übersah, aber auf die leichte Schulter nahm.
»Er muß sich die Hörner abstoßen«, meinte sie nachsichtig, »und soll nur seine Jugend genießen. Auch ihm wird später ein schärferer Wind um die Ohren blasen.«
Heute morgen aber war Sabinus aufgestanden, ausnahmsweise ausgeschlafen, und nahm sich vor, einen nützlichen Tag zu verbringen. Er wollte seinem Vater – er liebte diesen großzügigen, zerstreuten und nachsichtigen Menschen – eine Freude machen, und so erschien er in der zweiten Morgenstunde bei dem erstaunten Cornelius Celsus und bat, ihm eine Arbeit anzuweisen.
»Du weißt ja, Vater, daß ich fast alles kann: Papier zusammenkleben, die Frontes (erste und letzte Seite) beschneiden, mit Bimsstein glätten; wie unser Catull im ersten Carmen so schön sagt: arida modo pumice expolitum; (... das der trockene Bimsstein just geglättet...) und dann das ganze auf den Umbilicus (Holzstab) wickeln. Habe ich etwas vergessen?«
Celsus lächelte. Er nahm das sprunghafte Wesen seines Sohnes als von den Göttern gegeben hin und sah in jedem von Sabinus seltenen Arbeitsanfällen – freiwillig noch dazu! – einen Ansatz zum Besseren, eine Hoffnung fürs Erwachsenwerden.
»Ja, mein Sohn – das Wichtigste. An der Spitze des Umbilicus muß der Index angebracht werden, denn sonst ist das Buch ohne Titel und könnte in einer Bibliothek nur schwer gefunden werden.«
Sabinus schlug sich in gespielter Verzweiflung an die Stirn, daß es klatschte. »Bei den neun Musen – denen wir unser Brot verdanken – der Titel! Das wäre freilich schon schlimm, wenn unser eitler Seneca eine Bibliothek aufsucht und unter dem Buchstaben ›S‹ nichts findet, weil der nachlässige Sohn seines Verlegers den Index vergessen hat.«
Sein Vater wartete geduldig ab: »Wenn dein theoretischer Prolog zur Arbeit jetzt beendet ist, darfst du mit der Praxis beginnen.« Sabinus blitzte ihn mit seinen blauen Augen an.
»Ich bin unmöglich, verzeih mir, Vater. Die Götter haben dich mit einem nutzlosen Sohn geschlagen.«
»Wer weiß ...«, meinte Celsus hoffnungsvoll und schob seinem Sohn einen Stapel Papierbögen hin.
Sabinus fing sofort mit der Arbeit an und summte dabei vor sich hin. Doch lange konnte er den Mund nicht halten.
»Vater, warum verwenden wir nicht häufiger die Codices membranei (gebundene Bücher), da sie sich doch als praktisch erwiesen haben? Es läßt sich wesentlich mehr Text unterbringen, man kann die Seiten bequem umblättern, anstatt die Schriftrolle mit zwei Händen zu halten, und außerdem ...«