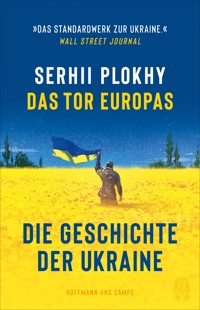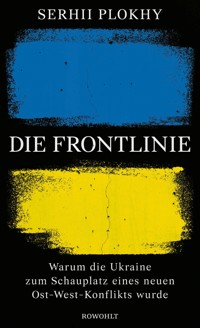
23,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In «Die Frontlinie» analysiert der Historiker Serhii Plokhy die entscheidenden Entwicklungen in der Geschichte der Ukraine und ihrer Beziehung zu Russland und dem Westen. Russlands Angriffskrieg kommt nicht aus dem Nichts. Die Begründung des Krieges und das dahinterstehende Narrativ greifen auf jahrhundertealte Großmachtansprüche Russlands zurück, die es in der Vergangenheit immer wieder gestellt hat. In kenntnisreichen Essays zeigt er, wie viel umfassender sich der gegenwärtige Konflikt verstehen lässt, wenn man die historischen Wurzeln kennt und die Region in ihrer Vielschichtigkeit erfassen kann. Das ist so erhellend wie erschreckend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Serhii Plokhy
Die Frontlinie
Warum die Ukraine zum Schauplatz eines neuen Ost-West-Konflikts wurde
Über dieses Buch
In «Die Frontlinie» analysiert der Historiker Serhii Plokhy die entscheidenden Entwicklungen in der Geschichte der Ukraine und ihrer Beziehung zu Russland und dem Westen. Russlands Angriffskrieg kommt nicht aus dem Nichts. Die Begründung des Krieges und das dahinterstehende Narrativ greift auf jahrhundertealte Großmachtansprüche Russlands zurück, die es in der Vergangenheit immer wieder gestellt hat. In kenntnisreichen Essays zeigt er, wie viel umfassender sich der gegenwärtige Konflikt verstehen lässt, wenn man die historischen Wurzeln kennt und die Region in ihrer Vielschichtigkeit erfassen kann. Das ist so erhellend wie erschreckend.
Vita
Serhii Plokhy ist Mychajlo-Hruschewskyj-Professor für ukrainische Geschichte an der Harvard Universität und Direktor des Harvard Ukrainian Research Institute. Plokhy ist Autor zahlreicher Bücher, darunter «The Last Empire», für das er den Lionel-Gelber-Preis gewonnen hat, und «Chernobyl», das mit dem Baillie-Gifford-Preis ausgezeichnet wurde. Er lebt in den USA.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel «The Frontline» bei Harvard University Press, Cambridge,USA
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2022
Copyright der deutschen Erstausgabe © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«The Frontline» Copyright © 2021 by the President and Fellows of Harvard College.
All rights reserved
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Tuomas A. Lehtinen/Getty Images; iStock
ISBN 978-3-644-01573-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Danksagung
Anmerkung zur Transkription
Vorwort
Kapitel 1 Quo vadis, ukrainische Geschichte?
Die ukrainische Geschichte neu denken
Die Zukunft der Vergangenheit
Auf dem Weg zu einem neuen Narrativ?
Teil I Kosakenstamm
Kapitel 2 Die Ukraine erscheint auf der Landkarte Europas
Die Fürsten
Ukraine
Kapitel 3 Russland und Ukraine: Gab es 1654 eine Wiedervereinigung?
Die Ursprünge
Das religiöse Schisma
Die orthodoxe Allianz
Zusammen und getrennt in Perejaslaw
Kapitel 4 Hadjatsch 1658: Die Ursprünge eines Mythos
Kapitel 5 Die Rückkehr Iwan Masepas
Das Rätsel
Voltaire lesen
Masepa sprechen lassen
Zwischen Zar und Nation
Teil II Das rote Jahrhundert
Kapitel 6 Wie russisch war die Russische Revolution?
Kapitel 7 Durch Hunger töten
Kapitel 8 Die Vermessung der Großen Hungersnot
Wo starben sie?
Kollektivierung
Der Ausbruch der Hungersnot
Beschaffungsquoten
Getreidebeschlagnahmung
Kredite für die Toten
Jenseits der Vegetationszone
Kapitel 9 Der Ruf des Blutes
Das geopolitische Kreuzworträtsel
Sowjetische Propaganda
Die Meinungsforscher vom NKWD
Das Nationalitätenargument
Kapitel 10 Der Kampf um Osteuropa
Kapitel 11 Der amerikanische Traum
Teil III Abschied vom Imperium
Kapitel 12 Der Zusammenbruch der Sowjetunion
Kapitel 13 Tschornobyl
Kapitel 14 Die Wahrheit in unserer Zeit
Karten
Kapitel 15 Das Imperium schlägt zurück
Kapitel 16 Als Stalin seinen Kopf verlor
Der postsowjetische Held
Der Kriegsherr
Stalin gegen Bandera
Das Dilemma der Liberalen
Die Rückkehr des Tyrannen
Der Krieg, der nicht enden wollte
Kapitel 17 Goodbye, Lenin!
Lenin stürzt
Interaktive Kartierung
Die Geopolitik der Erinnerung
Die Revolte des Zentrums
Das Zentrum gibt den Ton an
Der König ist tot
Die Aufholjagd
Teil IV Europäische Horizonte
Kapitel 18 Die russische Frage
Kapitel 19 Das Streben nach Europa
Kapitel 20 Das Neue Osteuropa
Kapitel 21 Den Kontinent neu denken
Der Reiz Mitteleuropas
Der Schatten von Mitteleuropa
Anhang
Anmerkungen
Register
Danksagung
Äußerst dankbar bin ich denen, die den größten Beitrag zum Erscheinen dieser Sammlung geleistet haben. Oleh Kotsyuba hat mich überzeugt, das Buch in Zusammenarbeit mit meinem Heimatinstitut, dem Harvard Ukrainian Research Institute (HURI), zu veröffentlichen. Meine Kollegen im redaktionellen Beirat des HURI, Michael S. Flier und George G. Grabowicz, unterstützten die Idee und steuerten wertvolle Ratschläge zur Verbesserung des Manuskripts bei. Myroslaw Jurkewitsch redigierte neue Kapitel und vereinheitlichte die redaktionellen Aspekte der bereits veröffentlichten. Kostyantyn Bondarenko erstellte die in diesem Band verwendeten Karten. Mit Unterstützung von Michelle Viise begleitete Oleh Kotsyuba das Buch durch den gesamten Redaktions- und Herstellungsprozess. Schließlich danke ich den Redakteuren der jeweiligen Publikationen, in denen die hier enthaltenen Texte erstmals erschienen, für die Erlaubnis zur Veröffentlichung in dieser Sammlung. Ich allein bin verantwortlich für etwaige Mängel, von denen es hoffentlich nicht allzu viele gibt.
Anmerkung zur Transkription
Im Text dieses Sammelbands kommt eine praktische Transkription zur Anwendung, um ukrainische und andere ostslawische Personennamen und Toponyme zu transkribieren. Dieses System spart das Weichheitszeichen (ь) aus (also beispielsweise Hruschewskyj statt Hruschews’kyj). Davon ausgenommen ist die Transkription von Personennamen, in denen das Weichheitszeichen die weiche Aussprache eines Konsonanten vor einem Vokal anzeigt, wofür ein «j» verwendet wird (also Chwyljowyj statt Chwyl’owyj). Des Weiteren erscheinen bekannte Personennamen wie Jelzin, Juschtschenko und Janukowytsch gemäß den in deutschsprachigen Texten verbreiteten Schreibweisen, wohingegen sich die Schreibweise mehrerer anderer Namen lebender Autoren nach deren jeweiliger Präferenz richtet. In den bibliografischen Angaben wird das vollständige englische Library-of-Congress-System (ohne Ligaturen) verwendet. Toponyme werden für gewöhnlich aus der Sprache des Landes transkribiert, in denen die bewussten Orte derzeit liegen. Personennamen werden grundsätzlich in einer Form entsprechend der kulturellen Tradition wiedergegeben, der die jeweilige Person angehörte. Der von den Slawen bis 1918 verwendete julianische Kalender lag zeitlich hinter dem in Polen-Litauen und Westeuropa verwendeten gregorianischen Kalender zurück (um zehn Tage im 16. und 17. und um elf Tage im 18. Jahrhundert).
Vorwort
Am 24. Februar 2022 erwachte die Welt in einer neuen Realität. Im Morgengrauen begann Russland mit einem Luftangriff auf Kyjiw und andere Städte einen Krieg gegen den souveränen Staat Ukraine. Gemessen an seiner Reichweite, an der Zahl der beteiligten Truppen, der Masse der militärischen und zivilen Todesopfer wie auch der Flüchtlinge infolge der Angriffe, hat sich dieser neue Kriegsschauplatz schnell zum größten und tödlichsten Militärkonflikt entwickelt, den Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt hat.
Der russisch-ukrainische Krieg begann 2014 mit der russischen Annexion der Krim, wurde aber von der internationalen Gemeinschaft weitgehend ignoriert. Nun ist es jedoch unmöglich, weiterhin die Augen davor zu verschließen. Die Zerstörung Mariupols, dem Erdboden gleichgemacht von russischen Bomben und Raketen, die viele Zivilisten in der erbitterten Widerstand leistenden Hafenstadt getötet haben, hat auch mit dem magischen Denken aufgeräumt, dem viele westliche Politiker und die breite Öffentlichkeit jahrelang verfallen sind: Wenn man nur lange genug die Augen verschließt vor der russischen Aggression gegen die Ukraine, würde sie von ganz allein aufhören. Der Glaube daran, dass Appeasement-Politik funktioniert, mag weitgehend verschwunden sein, aber die Frage, was den Krieg verursacht hat, bleibt unbeantwortet.
Bislang hat sich die internationale Aufmerksamkeit überwiegend auf das vom Aggressor, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, selbst verbreitete Narrativ konzentriert. Diese Darstellung behauptet zu Unrecht, die Aggression gegen die Ukraine sei eine Reaktion auf die Erweiterung der NATO auf Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Aber Putins eigene Äußerungen und Schriften vor der erneuten Invasion deuten darauf hin, dass der wahre Grund und die eigentliche Rechtfertigung für seine Aggression gegen die Ukraine – deren Bemühungen um einen NATO-Beitritt vom Bündnis schon lange vor diesem Angriff abgewürgt wurden – in der Geschichte wurzeln, besonders in einer bestimmten Version russischer Geschichte und ihrer Beziehung zur Ukraine, die Wladimir Putin und ein Teil der politischen Elite Russlands übernommen haben.
Mehr als einmal hat Putin nachweislich erklärt, Russen und Ukrainer seien vermutlich Teil ein und desselben Volkes. Diese Behauptung führte er 2021 in seinem Essay «Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern» aus, das zur ersten Salve im folgenden Krieg der Narrative wurde. Auch in seiner Rede, in der er drei Tage vor der Invasion vom 24. Februar das Minsker Abkommen zwischen Russland und der Ukraine von 2015 anprangerte, kam Putin auf die Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehungen zurück. Bei dieser Gelegenheit stellte er den ukrainischen Staat fälschlicherweise als ein künstliches Gebilde dar, das Wladimir Lenin und die Bolschewiken geschaffen hätten.[1]
Putins Missbrauch der Geschichte ist mehr als lediglich eine weitere Manipulation der Vergangenheit, um einen Vorwand für einen Akt der Aggression zu liefern. Sie ist auch Ausdruck von Putins eigenen Überzeugungen, die ihn verleitet haben, ein Land anzugreifen, das er grundlegend falsch eingeschätzt hat. Die Erwartung, dass diese «Militäroperation» innerhalb weniger Tage beendet sein würde – mit einer Siegesparade in Kyjiw und Massen jubelnder «befreiter» Ukrainer, die seine Truppen dankbar begrüßten, weil sie endlich mit ihren russischen Brüdern im historischen Schoß der einen russischen Nation «wiedervereint» sind –, hat sich nicht erfüllt.
Dieselbe Ukraine, die nach Putins Ansicht durch historische Verwerfungslinien und Sprachgrenzen so gespalten war, dass sie angeblich weder eine Daseinsberechtigung noch eine Chance hatte, Russlands Angriff etwas entgegenzusetzen, hielt stand und, mehr noch, wehrte sich. Die ukrainische Nation, die es nach Putins Ansicht niemals gab, machte über sprachliche, ethnische und religiöse Trennlinien hinweg mobil, um die russische Aggression zu stoppen.
Viele Menschen in Europa und auf der ganzen Welt, die Putins Geschichtsversion geglaubt hatten, wundern sich, warum und wie das geschehen konnte. Anfangs beobachteten sie entsetzt den russischen Angriff auf friedliche ukrainische Städte und ihre Zivilbevölkerung; dann verfolgten sie staunend den heldenhaften Widerstand der ukrainischen Armee und gewöhnlicher Bürger gegen den Angriff eines erheblich stärkeren Nachbarn. Die in diesem Band zusammengestellten Essays liefern Antworten auf eine Reihe wesentlicher Fragen zur Ukraine, ihrer Geschichte, Kultur, Identität und vor allem ihrer langen, stürmischen und häufig tragischen Beziehung zu Russland. Obwohl sie vor der Eskalation des russisch-ukrainischen Militärkonflikts zu einem umfassenden Krieg geschrieben wurden, sind sie heute aktueller denn je.
Der Band beginnt mit einer Einführung, die für die Notwendigkeit einer neuen Nationalgeschichte der Ukraine plädiert, welche die wichtigsten historiografischen Entwicklungen und Errungenschaften der letzten Jahrzehnte miteinbezieht und das Entstehen des modernen ukrainischen Staates erklärt.
«Kosakenstamm», der Titel des ersten Teils, bezieht sich auf den Wortlaut der ukrainischen Hymne, einen Text aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, der allen Ukrainern eine kosakische Abstammung zuschrieb. Das Kosakentum wurde zum Gründungsmythos der modernen ukrainischen Nation. Die Essays in diesem Teil befassen sich daher mit den verschiedenen Aspekten der kosakischen Geschichte und den aus ihr entsprungenen Mythologien.
Der Essay «Die Ukraine erscheint auf der Landkarte Europas» befasst sich nicht nur mit dem erstmaligen Auftauchen des Begriffs «Ukraine» auf einer europäischen Landkarte, sondern untersucht auch die synergetische Beziehung zwischen Kosaken und Fürsten, die in der traditionellen Geschichtsschreibung als Kontrahenten dargestellt werden. Das nächste Kapitel, «Russland und Ukraine: Gab es 1654 eine Wiedervereinigung?», analysiert die Fallstricke der Perejaslaw-Mythologie, deren man sich in Zeiten des russischen Kaiserreichs und der Sowjetunion bediente, um die russische Herrschaft über die Ukraine zu rechtfertigen, und die kürzlich vom neoimperialistischen Russland wiederbelebt wurde, um zu behaupten, Russen und Ukrainer seien «ein Volk». In «Hadjatsch 1658: Die Ursprünge eines Mythos» wird der Mythos betrachtet, der als Gegengewicht zu dem von Perejaslaw diente, indem er die Orientierung des kosakischen Staates in Richtung Polen als eine wünschenswerte Alternative darstellte. «Die Rückkehr Iwan Masepas» schließlich nimmt in den Blick, in welcher Weise die ukrainische Gesellschaft mit der kaiserzeitlichen Mythologie der Schlacht von Poltawa (1709) und der Darstellung des ukrainischen Hetmanen Ivan Mazepa umgegangen ist, der gegen das Kaiserreich rebellierte, als Verräter des Zaren und Erzfeind Russlands.
«Das rote Jahrhundert», der zweite Teil des Bandes, umfasst Artikel und Essays, die das blutigste Jahrhundert Europas und der Ukraine behandeln – das 20. Er beginnt mit einer Neuinterpretation der Russischen Revolution als einer Revolution der Nationen («Wie russisch war die Russische Revolution?») und diskutiert die Gründe, die Lenin und die Bolschewiken dazu führten, dem ukrainischen Streben nach Unabhängigkeit Zugeständnisse zu machen. Der Teil behandelt anschließend in zwei weiteren Artikeln die große ukrainische Hungersnot von 1932/33, welche jüngst vom ukrainischen Parlament und jenen einer Reihe anderer Länder als Völkermord anerkannt wurde: «Durch Hunger töten» ist eine Rezension von Anne Applebaums preisgekröntem Buch Roter Hunger: Stalins Krieg gegen die Ukraine, und «Die Vermessung der Großen Hungersnot» präsentiert die Ergebnisse eines Forschungsprojekts zur Historie dieser Tragödie, das sie eindeutig als menschengemachte Hungersnot einstuft.
Die nächsten beiden Essays, «Der Ruf des Blutes» und «Der Kampf um Osteuropa», behandeln die Relevanz der Ukraine für die internationale Politik des Zweiten Weltkriegs. Im ersten Fall zog Stalins Entscheidung, den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt zu unterzeichnen, eine teilweise Rehabilitierung des ukrainischen Nationalprojekts und seiner Rhetorik nach sich, die für die Rechtfertigung der sowjetischen Annektierung von Teilen Polens und Rumäniens vonnöten war. Im zweiten Schritt vertrete ich die Ansicht, dass sich die sowjetisch-amerikanischen Beziehungen am Ende des Zweiten Weltkriegs im Zuge des erstarkenden Wettstreits der beiden Länder um Osteuropa, das die Ukraine damals wie heute einschloss, zu verschlechtern begannen. Die Wirkung des ausbrechenden Kalten Kriegs auf die Einwohner der Ukraine wird in dem «Der amerikanische Traum» überschriebenen Essay behandelt.
«Abschied vom Imperium», der dritte Teil des Bandes, umfasst Texte zum Anteil der Ukraine an dem Kollaps der Sowjetunion. Mit dem Zerfall der UdSSR, deren Geschichte ich in meinem Buch The Last Empire ausführlich behandle, setze ich mich hier in einem kurzen Kapitel mit der Überschrift «Der Zusammenbruch der Sowjetunion» auseinander. Die Geschichte und das Andenken an die atomare Katastrophe von Tschornobyl (russisch Tschernobyl), einer der Faktoren des Zusammenbruchs, wird in den Essays «Tschornobyl» und «Die Wahrheit in unserer Zeit» behandelt. «Das Imperium schlägt zurück» zeichnet die Evolution der russischen Außenpolitik gegenüber der Ukraine nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach und untersucht den Ausbruch des aktuellen Konflikts.
Essays zur Politik der Erinnerung liefern zudem einen Kontext zum Verständnis des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine und seinem Beitrag zu bedeutenden Veränderungen in der ukrainischen Erinnerungspolitik. Der Essay «Als Stalin seinen Kopf verlor» bedient sich der Geschichte über die Enthauptung eines Stalin-Denkmals in der Ukraine, um den Zusammenprall sowjetischer und postsowjetischer historischer Narrative und unterschiedlicher Arten der Erinnerung auf liberaler wie nationalistischer Seite zu illustrieren. Davon handelt auch der Essay «Goodbye, Lenin!», der die Veränderungen in der Wahrnehmung der Geschichte seitens der ukrainischen Gesellschaft erklärt, die einen wichtigen Beitrag zum «Leninsturz» (Leninopad), der Graswurzelbewegung mit dem Ziel der Zerstörung von Lenin-Statuen, und später zu dem vom Parlament vorangetriebenen Prozess der Dekommunisierung leisteten.
Visionen der europäischen Zukunft der Ukraine und ihr Verhältnis zur Geschichte werden im vierten und letzten Teil dieses Bandes, der «Europäische Horizonte» heißt, vorgestellt. «Die russische Frage», der erste dieser Essays, behandelt die Entwicklung der russischen nationalen Idee und des Nationalismus, die Putins Vorstellung der Geschichte geprägt haben und die genutzt wurden, um den Krieg zu rechtfertigen. In «Das Streben nach Europa» rekonstruiere ich das Bild von Europa, wie es sich vom 19. Jahrhundert an in den Schriften ukrainischer Intellektueller präsentiert, und stelle die Behauptung auf, dass die Vorstellung von Europa als eine Antipode zu Russland entworfen wurde und im Hinblick auf die ukrainische Geschichte und Identität weiterhin als solche fungiert.
In «Das Neue Osteuropa» behandle ich die veränderte Verwendung des Begriffs «Osteuropa» nach dem Kalten Krieg von den sowjetischen Satellitennationen der Ära des Kalten Kriegs bis hin zu den ehemaligen Sowjetrepubliken Ukraine, Belarus und Moldawien. Welche Konsequenzen diese Verschiebung sowie die Entwicklung der Ukraine zum neuen Schlachtfeld zwischen dem vereinten Westen und Russland für die neue politische und kulturelle Landkarte Europas haben, wird in «Den Kontinent neu denken» gezeigt. Ich argumentiere, dass die Zeit nach dem Kalten Krieg ein neues Verständnis der Beschränkungen und Grenzen hervorgebracht hat, die nun in dem Krieg in der und um die Ukraine auf den Prüfstand gestellt werden.
Obgleich sie sowohl chronologisch als auch historiografisch ein weitläufiges Gebiet abdecken, diskutieren die in diesem Buch versammelten Texte nur einige Schlüsselmomente und -entwicklungen der ukrainischen Geschichte und der russisch-ukrainischen Beziehung. Ich glaube jedoch, dass sie zusammengenommen recht umfassende Antworten auf die Frage geben, warum die Ukraine von zentraler Bedeutung für die Konfrontation zwischen Ost und West in der Zeit nach dem Kalten Krieg gewesen ist und warum sie zum Zentrum des aktuellen Kriegs wurde – bislang der größte und tödlichste Krieg Europas im 21. Jahrhundert.
Kapitel 1Quo vadis, ukrainische Geschichte?
Nicht unähnlich der Geschichte vieler anderer Orte, Länder und Völker, wurzelt das Wissen über die Geschichte der Ukraine als Gebiet in jenen historischen Quellen, die heute wohl als globale oder nationenübergreifende Geschichtsschreibung charakterisiert werden würden. Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. beschrieb Herodot die heutige Südukraine und ihre multiethnische, von den Skythen dominierte, aber nicht auf sie beschränkte Bevölkerung in seinen Historien. Er verglich den Dnipro mit den übrigen im alten Griechenland bekannten Flüssen und kam zu dem Schluss, dass er allein dem Nil unterlegen sei. Die Länder und Völker der Ukraine sind daher Teil der Weltgeschichte, seit der «Vater der Geschichtsschreibung» über sie schrieb. Mehrere Jahrhunderte später fanden die ersten bekannten Einwohner der Ukraine, die Kimmerer, sogar in der Bibel Erwähnung.
Als die Rus-Chronisten in der Stadt Kyjiw Mitte des 11. Jahrhunderts n. Chr. begannen, ihre eigene Geschichte zu schreiben, verfügten sie bereits über eine bedeutende Menge an Literatur, größtenteils verfasst von gebildeten Griechen, deren Kaiser und Patriarchen einige Jahrzehnte zuvor das Christentum in die skythischen Lande gebracht hatten. Die Aufgabe der Chronisten war alles andere als einfach: Sie mussten die örtlichen Überlieferungen sammeln und in das christliche und kaiserzeitliche historische Schema einpassen, das die Missionare mitbrachten. Sie taten ihr Bestes, um sich selbst, ihre Herrscher und ihr Land in die Erzählung von der Schöpfung der Welt, in den Mythos der slawischen Ethnogenese und in die Geschichte des Byzantinischen Reichs einzubetten. Dabei beharrten sie darauf, dass sie ihr Schicksal stets selbst in der Hand gehabt hatten: Sie seien nie erobert worden und hätten die Wikinger (Varangianer) selbst eingeladen, über ihr Land zu herrschen, so wie sie auch aus freien Stücken das Christentum zu ihrer neuen Religion erwählt hätten. Doch das Konzept der Weltgeschichte und die Zeittafel, auf der vergangene Ereignisse festgehalten wurden, gingen unmittelbar auf byzantinische Schriften zurück.
Dem jähen Schrecken der mongolischen Invasion Mitte des 13. Jahrhunderts zum Trotz blieb die Vision von Kyjiw und Rus als Teilen des christlichen Universums bestimmend für die Sichtweise der Chronisten. Doch während die Welt der Rus-Fürstentümer an Größe verlor und ihre Herrscher eher regionale als globale Ambitionen zu hegen begannen, wurden die Chronisten zu Hütern des örtlichen Gedächtnisses, das kaum Verbindungen zur universellen Geschichte hatte. Erst im 16. Jahrhundert wandten Schriftgelehrte im Ausland ihre Aufmerksamkeit wieder Kyjiw und den ukrainischen Ländereien zu und regten lokale Geschichtsschreiber an, ihre Historie mit den globalen Entwicklungen in Relation zu setzen. Der Beginn der Reformation mit ihren Kämpfen zwischen Protestanten und Katholiken – in der Ukraine nahmen sie vor allem die Form von Anfeindungen hinsichtlich der Union von Brest (1596) an – ließ den beiden Lagern die orthodoxen Ukrainer und Belarussen als Widersacher in einem umfassenderen religiösen Kampf erscheinen. Polemiker auf beiden Seiten begriffen ihre Geschichte als Teil einer epischen Schlacht zwischen Christentum und Häresie. Die Mitte des 17. Jahrhunderts ausbrechenden Kriege der Kosaken zogen nicht nur die Aufmerksamkeit westlicher Historiker auf die Region, sondern brachten sie auch dazu, das kosakische Phänomen als Teil der allgemeinen europäischen Revolutionswelle oder des christlichen Kampfes gegen die Osmanen zu interpretieren.
«Die Ukraine mag eines der entlegensten Gebiete von Europa und der kosakische Name sehr modern sein; doch ist dies Land in jüngerer Zeit der Schauplatz glorreicher Taten gewesen, und seine Bewohner haben sich mit so großem Heldenmut wie nur je eine Nation in der Kampfeskunst bewährt», schrieb Edward Brown im Jahr 1672, als er Pierre Chevaliers Geschichte der Kosaken in Übersetzung unter dem Titel A Discourse of the Original, Country, Manners, Government and Religion of the Cossacks veröffentlichte.[2] Nach Browns Ansicht glichen die Kosaken in gewissem Maße seinen eigenen Landsleuten, da sie auf See glorreiche Siege erstritten hatten; die von den Kosaken besiedelten Steppen ähnelten in ihrer Weite dem Meer und machten die Orientierung mithilfe von Kompassen notwendig. Dieser anfängliche Versuch, der englischen Leserschaft die Ukraine nahezubringen, hob die Geschichte von Militär und Marine, heroische Taten und Parallelen zur englischen Lebensweise hervor.
Das 18. Jahrhundert brachte die Ideen der Aufklärung nach Osteuropa, wo sie von aufgeklärten Despoten wie Katharina II. ausgelegt und befördert wurden. Zur Hauptaufgabe ansässiger Historiker – anfangs kosakische Offiziere, später dann Adlige im Dienst des Russischen Reichs – wurde die Integration ihrer Vergangenheit in jene des Reichs und zugleich die Betonung der Besonderheiten ihrer Region. Dieses Doppel-Motiv wurde nach der Schlacht bei Poltawa (1709) von den Chronisten aufgenommen. Perfektioniert wurde es von Alexander Besborodko, der im ausgehenden 18. Jahrhundert zu einem der wichtigsten Gestalter der russischen Außenpolitik wurde. In seiner Nacherzählung der postpoltawischen Geschichte seiner hetmanatischen Heimat beschrieb er sie als Nutznießerin der aufklärerischen Regentschaft Katharinas II. Die kaiserzeitlichen Machthaber wiederum versuchten eifrig, die ukrainische Geschichte in die ihrer jeweiligen Reiche zu integrieren. In der Ukraine finanzierte ein örtlicher Generalstatthalter eine Geschichte Kleinrusslands aus der Feder von Dmitri Bantysch-Kamensky (1822). Die galizische Vergangenheit wurde aktiv in die Geschichte der Habsburgermonarchie eingegliedert.
Das Zeitalter des Nationalismus zerschlug die Verbindung zwischen lokaler und kaiserzeitlicher Geschichtsschreibung und machte die Nation und ihr Territorium zum zentralen Untersuchungsgegenstand. Mychajlo Hruschewskyj bewegte sich dabei nicht nur von einem Reich zum anderen, sondern entwickelte auch ein nichtimperiales intellektuelles Bezugssystem, um ein historisches Narrativ für die ukrainische Nation zu schaffen. Nationalhistoriker revolutionierten die Geschichtsschreibung, indem sie sich von den Annalen der Dynastien und Kaiserreiche abwandten und die Menschen studierten. Sie statteten ihre jeweilige Nation mit einer eigenständigen und einzigartigen Vergangenheit aus, und zugleich ließ ihr antiimperiales Projekt Raum für ein universalistisches Element. Demgemäß imaginierten die meisten ukrainischen Historiker von Mykola Kostomarow bis zu Mychajlo Drahomanow und Mychajlo Hruschewskyj ihr Land als Teil eines künftigen Staatenbundes – eines slawischen bei Kostomarow, eines europäischen bei Drahomanow und eines russischen beim frühen Hruschewskyj.
Mit dem 20. Jahrhundert kam die Idee einer Weltrevolution in die Ukraine. Kommunistische Schriftsteller stellten sich das Land als Teil einer Weltgemeinschaft sozialistischer Nationen vor; manche von ihnen wie beispielsweise Mykoloa Chwylowyj riefen die kulturelle Elite der Ukraine auf, sich in Richtung Europa zu orientieren. Ein anderer, Matwei Jaworskyj, betrachtete die Sowjetukraine als ein Piemont für Ukrainer außerhalb der UdSSR. Das stalinistische Regime setzte solchen Erwartungen ein brutales Ende; ihre Verfechter wurden festgenommen und getötet. Das Konzept der «Geschichte der UdSSR» reduzierte den nationenübergreifenden Aspekt der ukrainischen Geschichtsschreibung auf die Betonung des russisch-ukrainischen Verhältnisses – eine Beschränkung, die erst mit dem unerwarteten Ende der Sowjetunion im Jahr 1991 aufgehoben wurde.
Im Westen blieben die Ukraine und ihre Geschichte im Verlauf des Ersten Weltkriegs und der Zeit zwischen den Kriegen größtenteils unbeachtet, doch als sich die Ukrainer im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs in die tschechoslowakische Krise verstrickt sahen und sich zu einem Faktor in der «Vierten Teilung Polens» durch Deutschland und die Sowjetunion entwickelten, änderte sich die Lage. Der emigrierte ukrainische Historiker Dmytro Doroschenko veröffentlichte 1939 in Kanada seine Studie zur ukrainischen Geschichte, während der emigrierte russische Historiker Georgi Wernadski 1941 in den USA eine englischsprachige Übersetzung von Mychajlo Hruschewskyjs Studie zum Druck freigab. In Großbritannien veröffentlichte W.E.D. Allen 1940 seine Studie in der Cambridge University Press. Er definierte das «ukrainische Problem» als «einen der Hauptgründe für das fehlende Gleichgewicht in Kontinentaleuropa».[3]
Der europäische Krieg wurde bald zu einem globalen, und die Aufmerksamkeit der Historiker und der Öffentlichkeit wandte sich erneut von der Ukraine ab und Russland sowie der Sowjetunion als Ganzes zu. Doch der Krieg leistete auch einer Internationalisierung des Wissens Vorschub. Im Fall der Ukraine trieb er Hunderttausende ukrainische Flüchtlinge und eine ganze Reihe von Historikern nach Mitteleuropa und schließlich in die USA und Kanada. Die Kriegsgeschehnisse lenkten nicht nur die Aufmerksamkeit der englischsprachigen Bevölkerung auf diesen Teil der Welt, sondern sie brachten auch englischsprachige Autoren hervor, die bereit waren, darüber zu schreiben.
Die Logik des Kalten Kriegs, der die Welt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg dominierte, beförderte die Ausbreitung von Antikommunismus und Nationalismus als Mittel, sich dem russozentrischen historischen Narrativ der Sowjets entgegenzustellen. Doch die Ursprünge der ukrainischen Geschichte als akademische Disziplin in Nordamerika hatten auch ausgeprägte transnationale Eigenschaften. Als in Harvard ein Lehrstuhl für ukrainische Geschichte eingerichtet wurde, war sein erster Inhaber Omeljan Pritsak, ein anerkannter Experte für die Sprachen und Kulturen der Turkvölker. Ihor Ševčenko, sein engster Verbündeter und Mitbegründer des Ukrainian Research Institute, war eine Autorität auf dem Gebiet der byzantinischen Kulturgeschichte. Beide schrieben über die Ukraine und betteten deren Geschichte in den umfassenderen Zusammenhang der eurasischen und der byzantinischen Welt ein. Pritsaks Nachfolger Roman Szporluk hatte sich einen Namen als Experte für die europäische Geistesgeschichte gemacht, ehe er Ende der 1980er Jahre nach Harvard kam. Aufgrund ihres jeweiligen akademischen Hintergrundes, ihrer Interessen und Fachgebiete konnten sich die Begründer der ukrainischen Geschichtsschreibung in den USA und Kanada die ukrainische Geschichte nur als Teil der eurasischen, byzantinischen oder ostmitteleuropäischen Welt vorstellen.
Die ukrainische Geschichte neu denken
Die erste akademische Debatte zur ukrainischen Geschichte in Nordamerika fand 1963 in der Zeitschrift Slavic Review statt. Beteiligt waren der bereits erwähnte Turkologe Omeljan Pritsak, die Spezialisten für die Revolution von 1917–20 Arthur E. Adams und John S. Reshetar Jr. sowie Ivan L. Rudnyzkyj, der sich mit der ostmitteleuropäischen Geistesgeschichte befasste. Rudnyzkyj, Verfasser des programmatischen Aufsatzes «The Role of the Ukraine in Modern History», und Pritsak, der Anmerkungen dazu beigesteuert hatte, waren nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA emigriert. Beide waren von Wjatscheslaw Lypynskyj beeinflusst, der in den 1920er Jahren den Anstoß für die multiethnische Herangehensweise an die ukrainische Geschichte gegeben hatte. Die Wissenschaftler diskutierten die Fragen des historischen oder nichthistorischen Status der ukrainischen Nation, über Kontinuität innerhalb der ukrainischen Geschichte, das Wesen der Revolution in der Ukraine und ihre historische Position zwischen Ost und West.[4]
Ivan Rudnyzkyj, der 1963 die Behauptung aufgestellt hatte, die ukrainische Geschichtsschreibung habe sich in den akademischen Institutionen Nordamerikas noch nicht etabliert und sei bestenfalls ein Anhängsel der Russistik, organisierte 1978 in Kanada eine Konferenz zur ukrainischen Geschichte. Daraus ging die Veröffentlichung eines Sammelbandes mit dem Titel Rethinking Ukrainian History hervor, der neben neun Essays auch Transkripte einer Diskussion zu den maßgeblichen Herausforderungen enthielt, denen sich die ukrainische Geschichtsschreibung in Nordamerika gegenübersah. Zum Zeitpunkt der Konferenz waren an der Harvard University in den USA und an der University of Alberta in Kanada bereits Lehrstühle für ukrainische Geschichte und Institute für Ukrainistik eingerichtet worden. Einige der Studenten, darunter Orest Subtelnyj und Frank E. Sysyn, nahmen an der Konferenz teil und veröffentlichten ihre Aufsätze in dem Sammelband. Unter den Teilnehmern waren auch Roman Szporluk, seinerzeit an der University of Michigan, sein ehemaliger Student John-Paul Himka und Zenon E. Kohut, Mitglied des Doktorandenzirkels von Harvard, der an der University of Pennsylvania unter Alfred Rieber studiert hatte.
Zunächst hatten die Organisatoren die Frage zu klären, wen sie zu der Konferenz einladen wollten – ukrainische Historiker oder Ukraine-Historiker. Sie entschieden sich für Letzteres und luden Historiker mit und ohne ukrainischen Hintergrund ein. Zu Letzteren gehörte auch Patricia Herlihy, die zu jener Zeit am Wellesley College in Massachusetts forschte. Die Organisatoren mussten sich selbst und anderen noch beweisen, dass «ukrainische Geschichte» ein legitimer Oberbegriff für die Geschichte der ukrainischen Gebiete vor dem Aufkommen der Bezeichnung «Ukraine» als Ethnonym war. Omeljan Pritsak räumte dieses Problem durch einen Verweis auf die Geschichte Spaniens aus, das sich lange vor der Gründung des spanischen Staates und seiner offiziellen Benennung mit der Geschichte der spanischen Regionen auseinandergesetzt hatte. Im Verlauf der Diskussionen galt die Aufmerksamkeit der Teilnehmer vor allem Fragen der Periodisierung der ukrainischen Geschichte und der Etablierung angemessener englischsprachiger Begriffe. Doch die Hauptsorge, die Rudnyzkyj in seiner Einleitung zum Begleitband der Konferenz formulierte, bestand darin, dass unter Bedingungen, die die freie Entwicklung der Ukrainistik in der Sowjetunion verhinderten, Forscher zur ukrainischen Geschichte innerhalb Nordamerikas die Aufgabe übernehmen müssten, die ukrainische Historiografie im Westen zu repräsentieren.
«Wie sollten westliche Studenten der ukrainischen Geschichte auf diese betrübliche Lage reagieren?», schrieb Rudnyzkyj mit Hinblick auf den beklagenswerten Zustand der sowjetukrainischen Geschichtsschreibung. «Viele Angehörige der ukrainischen Diaspora sind der Meinung, man solle der ideologischen Orthodoxie der Sowjets mit einer ebenso rigiden und militanten ‹patriotischen› Orthodoxie begegnen. Nach Ansicht der Organisatoren dieser Konferenz wäre eine solche Herangehensweise kontraproduktiv. Stattdessen müssen wir ein freies, kritisches Denken zur Anwendung bringen, das durch keinerlei Dogma eingeschränkt wird, ob marxistisch oder nationalistisch.» Rudnyzkyj argumentierte, westliche Chronisten der ukrainischen Geschichte könnten die «Deformation» der sowjetischen Geschichtsschreibung beheben, wenn «sie selbst die Geschichte der Ukraine in einem universellen Kontext studierten». Er schrieb, indem man die ukrainische Geschichte im Kontext der Beziehung des Landes zur mediterranen Welt, zu Mitteleuropa und Eurasien behandle, könne man «die einzigartige historische Identität der Ukraine beleuchten» und «zum besseren Verständnis der Geschichte Osteuropas als Ganzes» beitragen.[5]
Die beiden maßgeblichen Entscheidungen – die Erforschung der ukrainischen Geschichte durch die Einladung nichtukrainischer Wissenschaftler auszuweiten und dieses neu errichtete Feld zu einem wesentlichen Bestandteil der Geschichtswissenschaften in Nordamerika zu machen – wichen deutlich von dem Modell ab, das die ukrainischen akademischen Exil-Institutionen praktizierten, insbesondere die Free Academy of Sciences und die Shevchenko Scientific Society. Aus diesen Entscheidungen resultierten die Ausbildung der ersten Generation ukrainischer Historiker an den Geschichtsfakultäten nordamerikanischer Universitäten und die anschließende Veröffentlichung von Monografien, die vor allem von den Instituten der Ukrainistik in Harvard und der University of Alberta herausgegeben wurden.
Zwischen 1982 und 1996 wurden drei Studien zur ukrainischen Geschichte publiziert. Roman Szporluks einflussreiche Schrift Ukraine: A Brief History (1982) bettete die moderne Geschichte der Ukraine in den Zusammenhang der Prozesse des nation building in Mittel- und Osteuropa ein. Aus Harvard kamen die Verfasser zweier bedeutender Synthesen ukrainischer Geschichte: Orest Subtelny mit Ukraine: A History von 1988, und Paul Robert Magocsi mit seiner History of Ukraine (1996). Subtelnys Untersuchung wurde oft als repräsentativ für das nationale Paradigma der ukrainischen Geschichte betrachtet; Magocsis dagegen wurde zum Inbegriff der multiethnischen Annäherung an das Thema.[6]
Die Entstehung eines unabhängigen ukrainischen Staates im Jahr 1991 hatte einen starken Einfluss auf die ukrainische Geschichtsschreibung. Subtelnys ins Ukrainische übersetzte Studie galt für längere Zeit als Standardwerk, das an die Stelle des russozentrischen und klassenbasierten Narrativs der Sowjetzeit trat. Es konkurrierte dort auch mit nicht mehr zeitgemäßen wissenschaftlichen Ansätzen, die etwa durch Arbeiten von ukrainischen Emigranten wiederentdeckt oder in die Ukraine «zurückgeführt» wurden und der «statistischen» Schule innerhalb der ukrainischen Geschichtswissenschaft angehörten. Nicht weniger tiefgreifend waren die Veränderungen im Westen, wo das Auftauchen der Ukraine auf der politischen Landkarte der ukrainischen Geschichte als eigenständigem Forschungsfeld zu dringend notwendiger politischer Legitimität verhalf.
Doch diese Anerkennung vollzog sich auf äußerst merkwürdige Weise, und zwar in Form einer Debatte in der Slavic Review(1995) über einen Artikel Mark von Hagens mit dem provokanten Titel «Does Ukraine Have a History?». Von Hagen behauptete, gemäß im Westen allgemein anerkannter politischer und akademischer Maßstäbe verfüge die Ukraine noch nicht über eine eigene Geschichte: Um diesen Status zu erreichen, müsse der Gegenstand vollständig in die nordamerikanische Geschichtsschreibung eingegliedert sein. Eine Reihe von Wissenschaftlern aus den USA, Kanada, Mitteleuropa und der Ukraine wurden eingeladen, auf von Hagens Aufsatz zu antworten, was auf einen bedeutenden Wandel der ukrainischen Geschichte als Studienfach hindeutete. Sie zog nun das Interesse führender Wissenschaftler nichtukrainischer Herkunft im Westen auf sich, während sich unter den Wissenschaftlern ukrainischer Abstammung Neuankömmlinge aus der postsowjetischen Ukraine befanden – wie der Autor dieses Buches.
Mark von Hagens Essay bot einen kritischen, aber wohlwollenden Überblick über das Studienfeld und gab, was noch wichtiger war, die Richtung seiner zukünftigen Entwicklung vor. Er griff die Frage des vermeintlichen Mangels an institutioneller, elitärer und sogar kultureller Kontinuität innerhalb der ukrainischen Geschichte erneut auf und schlug vor, diese «Schwächen» in Stärken zu verwandeln. «Gerade die Fluidität der Grenzen, die Durchlässigkeit der Kulturen, die historische multiethnische Gesellschaft sind es, die die ukrainische Geschichte zu einem sehr ‹modernen› Forschungsfeld machen könnten», schrieb von Hagen, der auf die Geschichte der UdSSR zwischen den Kriegen spezialisiert war. Er fuhr fort: «Ich möchte für das Studium der ukrainischen Geschichte und für ihr Wiedererstarken als akademische Disziplin innerhalb wie außerhalb der Ukraine als eine Geschichte plädieren, die von Interesse ist, gerade weil sie so viele der Klischees des nationalstaatlichen Paradigmas hinterfragt.»[7]
Eingeläutet wurde das Erscheinen des transnationalen Paradigmas im Feld der Ukrainistik im Allgemeinen und der Geschichte der Ukraine im Besonderen durch eine im Jahr 2009 von Georgiy Kasianov und Philipp Ther herausgegebenen Essaysammlung mit dem Titel A Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Andreas Kappeler, der einen Text zu dem Band beisteuerte, hat die Beschränkungen nicht nur des nationalen, sondern auch des multiethnischen Paradigmas auf besonders eindrückliche Weise deutlich gemacht. Die Ukraine, ein Land, das im Laufe der Jahrhunderte durch politische und kulturelle Grenzen geteilt und aufgrund seiner Staatenlosigkeit wohl stärker von transnationalen Strömungen beeinflusst war als die meisten anderen europäischen Regionen, könnte durchaus in besonderer Weise von einer transnationalen Herangehensweise an seine Geschichtsschreibung profitieren.[8]
Die Zukunft der Vergangenheit
Im Rahmen dreier Konferenzen, organisiert vom Institute of Ukrainian History, der National Academy of Sciences of Ukraine und dem Harvard Ukrainian Research Institute, erhielten Historiker aus aller Welt in den Jahren 2012 und 2013 die Gelegenheit zur Einschätzung des gegenwärtigen Forschungsstands. Die Konferenz zur ukrainischen Geschichtsschreibung in der Zwischenkriegszeit wurde im Juli 2012 in München abgehalten und von der Ukrainian Free University mitfinanziert; die Konferenz zum sowjetischen Erbe, ausgerichtet vom Institute of History in Kyjiw, fand im Mai 2013 mit Unterstützung eines Stipendiums von der Renaissance Foundation statt; und die vom Ukrainian Studies Fund mitfinanzierte Konferenz zur Zukunft der ukrainischen Geschichtswissenschaft wurde im Oktober 2013 an der Harvard University abgehalten. Ihrem Thema «Quo Vadis Ukrainian History? Assessing the State of the Field» hat dieser Text seinen Titel und sein Hauptthema zu verdanken.[9]
Die Durchführung der Konferenz und die Niederschrift der ersten Aufsatzentwürfe fanden einige Monate vor den Euromaidan-Protesten und der Revolution der Würde statt, auf die die russische Annektierung der Krim und der russisch-ukrainische Konflikt um die Ostukraine folgten. Manche Autoren bezogen diese Entwicklungen mit ein, indem sie ihre ursprünglichen Beiträge zu dem 2016 erschienenen Band The Future of the Past: New Perspectives on Ukrainian History, der die Ergebnisse der Konferenz bündelte, überarbeiteten. Auf ihre Bedeutung für die anhaltende Debatte um den wesentlichen Kern und die zukünftige Richtung der ukrainischen Geschichtsforschung gehe ich weiter unten noch ein. Die Nationalgeschichte, insbesondere das nationale Paradigma in der Darstellung der ukrainischen Vergangenheit, war sowohl Gegenstand kritischer Untersuchung als auch Ausgangspunkt für die meisten Historiker, die der Einladung zur Konferenz folgten.[10]
Den systematischsten Versuch einer Bilanzierung der zentralen Eigenschaften, der Vor- und Nachteile des nationalen Paradigmas unternahmen Georgiy Kasianov und Oleksij Tolochko. Sie reihten sich ein in die anhaltende Debatte um die Frage der Bedeutung einer mehrbändigen Geschichte der Ukraine – das traditionelle vom Institute of History of the National Academy of Sciences produzierte «Genre»[11] – und die Frage, wie dieses «Genre» aussehen sollte, wenn es fortbestünde. Die Autoren verwiesen dabei auf die Beschränkungen nicht nur des nationalen Paradigmas an sich, sondern auch auf die Grenzen traditioneller methodologischer Herangehensweisen und schlugen vor, das Konzept des modernen Nationalstaates und der damit auferlegten «Tyrannei der Territorialität» zu überwinden und sich stattdessen auf individuelle Regionen und/oder territoriale Einheiten zu konzentrieren, die größer waren als der Nationalstaat.
Es zeigte sich, dass dies die beiden Hauptrichtungen waren, die die Autoren von The Future of the Past einschlugen. Die Frage, was das Studium der Ukraine über die sowjetische, europäische und globale Geschichte verraten könne, wurde in Andrea Graziosis Auseinandersetzung mit seiner persönlichen «Entdeckung» der ukrainischen Geschichte aufgeworfen. Beantwortet wurde sie in den Essays von George Liber, Hiroaki Kuromiya und Mark von Hagen, die vorschlugen, die Geschichte und die politischen Ideen der Ukraine im 20. Jahrhundert neu zu interpretieren, indem man sie im Kontext von Imperialismus und antikolonialem Widerstand betrachtete. Nach von Hagens Ansicht hatte die Sowjetpolitik in der Ukraine eindeutig ein koloniales Fundament und brachte einen antikolonialen Widerstand hervor, der so unterschiedliche Ausdrucksformen fand wie die sozialistischen Schriften Pawlo Chrystjuks, den Nationalismus Dmytro Donzows und die Schriften der ukrainischen Nationalkommunisten der 1960er Jahre wie Iwan Dsjuba, der der ukrainisch-jüdischen Verständigung Vorschub leistete.
Die Verlagerung vom Transnationalen hin zum Regionalen und wieder zurück als Versuch, die Grenzen des nationalen Paradigmas zu überwinden, ist zu einer bedeutenden Entwicklung in der ukrainischen Geschichtsschreibung der vergangenen Jahrzehnte geworden. Wenige Regionen in der Ukraine haben so viel Aufmerksamkeit von Historikern, sowohl von ukrainischen als auch nichtukrainischen, erfahren wie Galizien. Als der Habsburger Historiker Johann Christian von Engel im ausgehenden 18. Jahrhundert die erste mitteleuropäische Arbeit zur ukrainischen Geschichte vorlegte, befassten sich ihre beiden Hauptteile mit den ukrainischen Kosaken und dem galizisch-wolhynischen Fürstentum.[12] Die Annexion Galiziens durch die Habsburgermonarchie nach der ersten Teilung Polens war Anstoß für ein Projekt der Neuinterpretation Galiziens im Kontext Österreichs und Österreich-Ungarns, der in Larry Wolffs Idea of Galicia auf äußerst erkenntnisstiftende Weise dargestellt wird.[13]
In seinem Beitrag zum Begleitband der Konferenz untersuchte Wolff, wie die galizische Geschichte von Habsburger Eliten in Wien, polnischen Intellektuellen in der Region und am Prozess des ukrainischen nation building Beteiligten wie Mychajlo Hruschewskyj wahrgenommen wurde. Iryna Wuschko reihte sich in den Chor derer ein, die die Tendenz der Anhänger einer national fokussierten Geschichtsschreibung kritisierten, Repräsentanten ihrer eigenen Nation von «anderen» gegenüber begangenen Missetaten oder kriminellen Handlungen freizusprechen. Sie rief ihre Historikerkollegen dazu auf, sich die Heterogenität der galizischen und ukrainischen Geschichte zu eigen zu machen, um «die Ukraine ins Zentrum einer europäischen – und nicht nur ukrainisch-nationalen – Erzählung zu stellen».
Die rechtsufrige, westlich vom Dnipro gelegene Ukraine, der in der traditionellen ukrainischen Geschichtsschreibung bislang wenig Aufmerksamkeit zuteilgeworden war, stand im Mittelpunkt der Beiträge von Faith Hillis und Heather Coleman, die sich mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auseinandersetzten. Beide Autorinnen befassten sich mit der Herausbildung modernen nationaler Identitäten in der Region und betonten zugleich deren einzigartigen Charakter und ihren Beitrag zu größeren nationalen und imperialen identitätsstiftenden Projekten. Hillis hinterfragte das bestimmende Paradigma des «Erwachens einer Nation» in der ukrainischen Geschichtsschreibung und lenkte das Augenmerk auf Verfechter der kleinrussischen Identität – ein wichtiger Faktor in der Geschichte nicht nur des russischen Nationalismus, sondern auch der Ukraine, der von Historikern, die innerhalb des ukrainischen nationalen Paradigmas arbeiteten, als randständig behandelt, wenn nicht gar vollständig übergangen wurde. Heather Coleman betonte, kein nation-building-Projekt in der rechtsufrigen Ukraine könne von Erfolg gekrönt sein, wenn es nicht die lokalen Identitäten religiöser und kultureller Figuren wie Petro Lebedynzew berücksichtige und anerkenne. Diese Schlussfolgerung traf vermutlich auch auf andere Regionen der Ukraine zu.
Ergab sich der transnationale Turn in der Forschung zur ukrainischen Geschichte aus der Unzufriedenheit mit dem nationalen Paradigma und der wachsenden Kritik am multiethnischen Ansatz, der die Unzulänglichkeiten des Ersteren in kleinerem ethnokulturellen Maßstab reproduzierte, so verdeutlichte eine Reihe von Essays in dem Band das Potenzial des transnationalen Paradigmas, Themen umzudeuten, die in den nationalen und multiethnischen Narrativen beträchtliche Aufmerksamkeit erfuhren, und neue Wege zum Verstehen vertrauter Phänomene aufzuzeigen. Yohanan Petrovsky-Shtern plädierte dafür, ethnische Historien in die Geschichtsschreibung der Ukraine als Region und multiethnische Gemeinschaft zu integrieren. In Mayhill Fowlers Appell, die Geschichte der ukrainischen Kultur zu «globalisieren», näherten sich das Transnationale, das Nationale und das Multikulturelle auf eine neue Weise an. Fowler unterschied die «Kultur in der Ukraine» von der «ukrainischen Kultur» und optierte für den transnationalen Ansatz, um die Forschung zu ersterer voranzutreiben. Sie verlangte nach der «Wiederentdeckung» imperialer und sowjetischer Schichten der «Kultur in der Ukraine».
Die Beziehungen zwischen Geschichte und Kultur in der Ukraine und im Ausland wurden in den Essays von Marta Dyczok und Wolodymyr Krawtschenko behandelt. Dyczok diskutierte den Widerspruch sowjetischer Modelle der Darstellung und Interpretation der Vergangenheit mit nationalistischen oder national beseelten Visionen der ukrainischen Geschichte. Sie verwies auf den fehlenden Konsens zwischen Politikern, Historikern und der Gesellschaft an sich im Hinblick auf ein historisches Narrativ. Krawtschenko erklärte den fehlenden Konsens mittels einer kritischen Beleuchtung des schwierigen Verhältnisses der ukrainischen Gesellschaft zu ihrem sowjetischen Erbe. Er stellte die These auf, die ukrainische Vergangenheit habe Teile der ukrainischen Gesellschaft für das deutlich erfolgreichere russische Projekt der Wiederaneignung und Umgestaltung von Elementen der sowjetischen historischen Mythologie zum Zweck des russischen nation building empfänglich gemacht. Für das weitere Vorgehen empfahl Krawtschenko, die sowjetische Geschichtserfahrung in die ukrainische nationale Erzählung zu integrieren, und verwies auf das «Modernisierungs»-Paradigma als wirksamstes Hilfsmittel zum Erreichen dieses Ziels.
Die in The Future of the Past versammelten Essays vermitteln einen guten Eindruck vom Stand der Forschung und zu einem gewissen Grad auch von der Lehre der ukrainischen Geschichte außerhalb der Ukraine, insbesondere in Nordamerika, dem Zentrum der nichtsowjetischen Forschung zur Geschichte der Ukraine vor 1991. Sie zeigen außerdem neue Wege zur Untersuchung der ukrainischen Vergangenheit auf.
Auf dem Weg zu einem neuen Narrativ?
Wie in den späten 1970ern, als sich Forscher zur ukrainischen Geschichte in den USA und Kanada zu ihrer ersten Konferenz mit dem Zweck einer Standortbestimmung zusammenfanden, strebt auch heute eine neue Generation von Historikern danach, Beziehungen zwischen den Entwicklungen der Geschichtswissenschaft innerhalb der Ukraine, wo der Großteil der Forschung stattfindet und die meisten Publikationen zum Thema herausgegeben werden, und der Historikerzunft außerhalb der Ukraine herzustellen. So wie in den 1970ern lehnen auch heute die meisten «Westler» die in der Ukraine vorherrschende historiografische Ausrichtung ab. Damals ging es um eine sowjetmarxistische Geschichtsschreibung; heute ist es das nationale Narrativ der ukrainischen Vergangenheit. Die Aufgabe ist größtenteils noch die gleiche wie damals: die Integration von Forschung und Publikationen zu ukrainischer Geschichte in die weltweite Historiografie.
Anders als 1995 fragt heute niemand, ob die Ukraine eine Geschichte hat. Während Akademiker mit ganz unterschiedlichem Hintergrund ihren Beitrag zu dem Forschungsgebiet leisteten und Themen und Denkansätze aus anderen Feldern der Geschichtswissenschaft einbrachten, wurde nicht mehr infrage gestellt, ob ein Studium der ukrainischen Geschichte seine Berechtigung habe. Wie oben angemerkt, diente die Erlangung der ukrainischen Unabhängigkeit auch der Legitimierung des Forschungsfeldes. Jüngere Forschungen zur ukrainischen Geschichte, die außerhalb des Landes durchgeführt wurden, sind maßgeblich von dem eben beschriebenen transnationalen und regionalen Turn beeinflusst. Das gilt auch für das anhaltende Interesse an Weltreichen, Grenzgebieten, Minderheiten und nationalen und kulturellen Identitäten sowie das wachsende Interesse an räumlichen Aspekten der Geschichtswissenschaft. All diese Ansätze helfen dabei, die Grenzen der ukrainischen Geschichte zu erweitern und ihr heuristisches Potenzial nicht nur im eigenen Land, sondern, wie Andrea Graziosi gezeigt hat, auch im Hinblick auf die europäische Geschichte als ganze zu erweitern.
Damit verfügt die Ukraine im Ausland über eine Geschichte. Doch hat sie auch eine im eigenen Land, in dem Sinne, wie von Hagen sie definiert – eine anerkannte schriftliche Aufzeichnung vergangener Erfahrungen? Die nationale Erzählung, die heute in der ukrainischen Geschichtsschreibung im eigenen Land vorherrscht, ist in den vergangenen Jahren auf erhebliche Probleme gestoßen, was ihre Rezeption sowohl durch Eliten als auch die allgemeine Bevölkerung angeht. Wie Marta Dyczok und Wolodymyr Krawtschenko im oben erwähnten Band aufzeigen, ist das Potenzial des ethnonationalen Narrativs nicht nur in rein akademischer und heuristischer Hinsicht erschöpft, sondern auch als Hilfsmittel zur Organisation des historischen Gedächtnisses der ukrainischen Gesellschaft mit dem Zweck, einen Konsens zu befördern. Sollten seine Verfechter eine weitere Chance erhalten?
Schließlich ringt die Ukraine noch immer mit dem Prozess des nation building, den die meisten europäischen Länder im 19. und frühen 20. Jahrhundert abgeschlossen haben – zumeist mithilfe des ethnonationalen Narrativs, das die meisten der am oben erwähnten Band Beteiligten nicht nur für unzeitgemäß halten, sondern auch für nicht hilfreich, wenn es um ein besseres Verständnis der ukrainischen Vergangenheit und ihres Stellenwerts geht. Ist es gerecht, der ukrainischen Gesellschaft ein Geschichtsverständnis «aufzuerlegen», geprägt von jenen transnationalen Prozessen, die sich in einer Zeit vollziehen, da die Ukraine von Staaten umgeben ist, welche das nationale Paradigma im Kern ihrer historischen Identität verankert haben und die Ukraine in einen teils mit militärischen Mitteln ausgetragenen Wettstreit zwingen?[14]
Die Ereignisse der vergangenen Jahre – die Revolution der Würde, der Verlust der Krim sowie die Unruhen und der russisch-ukrainische Konflikt in der Donbass-Region der Ostukraine – haben dazu beigetragen, die ukrainische Gesellschaft zur Verteidigung der Unversehrtheit und Eigenstaatlichkeit des Landes über ethnische, sprachliche, religiöse und regionale Grenzen hinweg zu mobilisieren. Die tragische Erfahrung von Krieg, Umsiedlung und Gebietsverlust hat die Zivilgesellschaft der Ukraine aktiviert. Wenn eine der Hauptaufgaben historischer Aufzeichnungen darin besteht, den Bürgern einer bestimmten Nation ihre Ursprünge zu verdeutlichen, dann gibt es dazu keinen besseren Weg, als eine Geschichte des Landes und seiner Einwohner zu verfassen und dabei die regionale und ethnische Diversität des Landes zu berücksichtigen und zugleich ihre Vergangenheit in die Geschichte jenes Teils der Welt einzubetten, dem es angehört.
Während Historiker von Imperien über Möglichkeiten diskutieren, eine «neue imperiale Geschichte» zu schreiben, ist die Zeit gekommen, die Notwendigkeit einer «neuen nationalen Geschichte» auf die akademische Agenda zu setzen, eine Gattung der Forschung, die das ethnonationale Paradigma der Vergangenheit überwinden und die Möglichkeiten nutzen würde, welche die globalen, transnationalen, multiethnischen und regionalen Ansätze bieten, um dem wachsenden Bedarf moderner Staaten, Nationen und Gesellschaften an gemeinschaftlichen Erzählungen und historischen Identitäten nachzukommen. Wenige Länder benötigen eine solche Art von Geschichte dringender als die Ukraine. Ein Wandel der ukrainischen Geschichte entlang der durch die neuen Trends der Geschichtsforschung vorgegebenen Leitlinien würde diese Erzählung anschlussfähiger und deutlich akzeptabler für verschiedene Teile der ukrainischen Gesellschaft machen, die noch immer weniger durch Fragen von Sprache und Kultur als vielmehr durch die unterschiedlichen historischen Erfahrungen der vielfältigen Regionen der Ukraine gespalten ist. Ein solcher Wandel würde die Ukraine auch ihren Partnern in der Europäischen Union gegenüber begreifbarer machen, deren Geschichte häufig aus den gleichen transnationalen Prozessen erwachsen ist.
Teil IKosakenstamm
Kapitel 2Die Ukraine erscheint auf der Landkarte Europas[15]
Das Wort «Ukraine», heute der Name eines unabhängigen Staates, ist mittelalterlichen Ursprungs und wurde erstmals von den Kyjiwer Chronisten des 12. Jahrhunderts für die Gebiete der heutigen Ukraine verwendet, die an die Pontische Steppe grenzen. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts fand es Eingang in das internationale Vokabular als Name für das Staatsgebilde, das die Kosaken im Zuge des Chmelnyzkyj-Aufstandes (1648–1657) gründeten. Damals konnten europäische Geografen die Ukraine bereits auf den Landkarten des französischen Ingenieurs und Kartografen Guillaume Levasseur de Beauplan finden. Allerdings war es keineswegs die erste Darstellung der Ukraine auf einer Landkarte Europas.[16]
Die Begriffe «Ukraine» und «Kosaken» tauchten gleichzeitig in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts auf europäischen Landkarten auf. Beide wurden erstmals auf einer Karte Osteuropas genannt. Eine Gruppe Kupferstecher und Kartografen hatte sie im Auftrag von Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, genannt «das Waisenkindchen» und einer der prominentesten Adeligen im Großfürstentum Litauen, zusammengestellt. Unter der Überschrift «Detaillierte Beschreibung des Großfürstentums Litauen und angrenzender Länder» zeigte sie nicht nur wesentliche politische und territoriale Entwicklungen, sondern auch soziale und kulturelle Veränderungen, die im Laufe des 16. Jahrhunderts in der Region stattgefunden hatten.
Die Radziwiłł-Karte umfasst das Gebiet des Großfürstentums Litauen, wie es vor der Lubliner Union (1569) mit dem Königreich Polen existierte. Ergänzt wird sie durch eine separate Karte des Dnipro. Die mit Abstand wichtigste Entwicklung, die sich darauf widerspiegelte, war die Entstehung einer Grenze, die das Großfürstentum etwa in zwei Hälften teilte. In einigen Abschnitten ähnelt sie der heutigen ukrainisch-belarussischen Grenze, verläuft entlang dem Prypjat und biegt dann nach Norden ab. Das Wort «Ukraine», mit dem Teile der Gebiete südlich der neuen Grenze bezeichnet sind, bezieht sich auf das Territorium rechtsufrig des Dnipro von Kyjiw im Norden bis nach Kaniw im Süden. Wenn man dem Kartografen trauen darf, lagen jenseits von Kaniw wilde Steppen, die mit Campi deserti citra Boristenem (wilde Felder diesseits des Borysthenes/Dnipro) bezeichnet sind. Die «Ukraine» erstreckte sich also über einen Großteil der an die Steppe grenzenden Region, in der die später als ukrainische Kosaken bekannte Volksgruppe heimisch war.[17]
Die Radziwiłł-Karte bietet einen einzigartigen Einblick in drei miteinander verflochtene Prozesse, welche die Zukunft der Pontischen Steppe prägten: die Neuverhandlung der Beziehungen zwischen der polnischen Krone und der örtlichen Aristokratie; die wirtschaftliche und kulturelle Kolonisierung der Dnipro-Region; und last, but not least der Aufstieg der ukrainischen Kosaken zu einer starken militärischen und später auch politischen und kulturellen Kraft.
Die Fürsten
Die Radziwiłł-Karte wird häufig Tomasz Makowski, ihrem vorrangigen Kupferstecher, zugeschrieben, wurde aber in Wirklichkeit von einer Kartografengruppe angefertigt, der unter anderem Maciej Strubicz angehörte. Sie entstand größtenteils zwischen 1585 und 1603, aber die erste bekannte Ausgabe erschien erst 1613 bei Hessel Gerritsz (Gerard) in Amsterdam.[18]
In vielerlei Hinsicht setzte die Radziwiłł-Karte etwas fort, was König Stephan Báthory während des Livländischen Kriegs (1558–1583) initiiert hatte und was man als Zeichen zunehmender Beteiligung der Aristokratie an den zuvor vom König dominierten Bereichen der Politik, Religion und Kultur deuten kann. Radziwiłł hatte in seiner Arbeit Unterstützung von anderen Adeligen; so heißt es, die Informationen über die Siedlungen am Dnipro habe er von Fürst Konstanty Wasyl Ostrogski, dem Woiwoden von Kyjiw und prominenten wolhynischen Magnaten, erhalten. Nicht unähnlich der Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi von Maciej Stryjkowski (1582), die mit Förderung des litauischen Aristokraten Bischof Merkelis Giedraitis aus Samogitien (Žemaitija) entstand, beschränkte sich Radziwiłłs Karte nicht auf das Großfürstentum Litauen, sondern umfasste auch die Gebiete der Rus, die es infolge der Lubliner Union (1569) an Polen verloren hatte. Die Eliten des Großfürstentums waren eindeutig unzufrieden mit dem Abkommen und brannten darauf, die durch die Union geschaffenen politischen und kulturellen Räume neu zu verhandeln.[19]
In ganz Europa war das 16. Jahrhundert geprägt von der Stärkung königlicher Macht, der Zentralisierung des Staates und der Regulierung politischer und gesellschaftlicher Gepflogenheiten. Die Kehrseite war eine wachsende Opposition der Aristokratie gegen diesen Machtzuwachs. Beide Tendenzen traten in Vorbereitung und Abschluss der Lubliner Union deutlich zutage, die nicht nur die Vereinigung der beiden Teile des polnisch-litauischen Staates, sondern auch die Stärkung der Krone zum Ziel hatte. Während König Sigismund II. August die Union wollte, waren die Adelsfamilien des Großfürstentums Litauen dagegen. Aber viele ihrer Bedenken mussten wegen der wachsenden Bedrohung von außen beiseitegeschoben werden, der man nur mit Polens Hilfe entgegentreten konnte.
Nachdem Iwan der Schreckliche 1558 die beiden Nachfolger der Goldenen Horde, die Khanate Kasan und Astrachan, unterworfen und damit die Kontrolle über die Wolga-Handelsroute errungen hatte, ließ er seine Armeen nach Westen vorrücken, um Zugang zur Ostsee zu bekommen. Der Livländische Krieg, den er im selben Jahr begann, sollte 25 Jahre dauern und Schweden, Dänemark, Litauen und schließlich auch Polen in die Kämpfe einbeziehen. Truppen des Moskauer Reichs drangen 1563 über die Grenze des Großfürstentums vor, eroberten die Stadt Polazk (im heutigen Belarus) und überfielen Wizebsk, Schklou und Orscha. Diese Niederlage mobilisierte im niederen litauischen Adel Unterstützung für die Union. Angesichts der Ansprüche Moskaus auf Gebiete der Kyjiwer Rus, zu denen nicht nur Polazk, sondern auch die übrigen ukrainisch-belarussischen Territorien des Großfürstentums gehörten, sah die Zukunft für dessen herrschende Elite düster aus. Nun erschien die Union mit dem Königreich Polen als einzig mögliche Lösung.
Im Dezember 1568 berief Sigismund II. August zwei Reichstage in Lublin ein – einen für das Königreich, den anderen für das Großfürstentum – in der Hoffnung, dass ihre Repräsentanten Konditionen für die neue Union erarbeiten würden. Die Verhandlungen begannen positiv, da beide Seiten sich auf die gemeinsame Wahl des Königs, einen gemeinsamen Reichstag oder ein Parlament und weitgehende Autonomie des Großfürstentums einigten. Allerdings wollten die Magnaten das in ihrem Besitz befindliche Kronland nicht zurückgeben – eine Hauptforderung der Exekutionisten, einer mächtigen Gruppe im polnischen Adel, die eine Rückgabe sämtlicher staatlichen und königlichen Ländereien forderten, die diese Magnaten widerrechtlich hielten. Die litauischen Delegierten unter der Führung von Mikołaj Radziwiłł, dem Roten, Anführer der litauischen Calvinisten und siegreicher Befehlshaber der litauischen Armee in ihren jüngsten Zusammenstößen mit den Moskauer Truppen, machten keinerlei Konzessionen. Sie packten ihre Koffer, sammelten ihr Gefolge aus adeligen Lehnsleuten und verließen den Reichstag. Aber dieser Schuss ging nach hinten los. Für die abreisenden Litauer völlig überraschend, begann der Reichstag des Königreichs Polen mit dem Segen des Königs, Dekrete zu verabschieden, die eine Provinz des Großfürstentums nach der anderen dem Königreich Polen unterstellten.
Die litauischen Magnaten, die gefürchtet hatten, ihre Provinzen an das Moskauer Reich zu verlieren, verloren sie nun stattdessen an Polen. Um eine feindliche Übernahme durch ihren mächtigen polnischen Partner zu verhindern, kehrten die Litauer nach Lublin zurück, gewillt, ein von den polnischen Delegierten diktiertes Abkommen zu unterzeichnen. Aber sie kamen zu spät. Im März fiel die Woiwodschaft Podlachien an der ethnisch ukrainisch-belarussisch-polnischen Grenze an Polen. Im Mai folgte Wolhynien, und am 6. Juni, einen Tag vor Wiederaufnahme der polnisch-litauischen Gespräche, wurden auch Kyjiwer und podolische Gebiete Polen übertragen. Die ukrainischen Woiwodschaften wurden nicht zusammen, sondern eine nach der anderen ins Königreich eingegliedert und erhielten als einzige Garantien die Verwendung der ruthenischen (mittelukrainischen) Sprache in Justiz und Verwaltung sowie den Schutz der Rechte der orthodoxen Kirche zugesichert. Den litauischen Aristokraten blieb nichts anderes übrig, als die neue Realität zu akzeptieren – wenn sie sich der Union weiterhin widersetzten, liefen sie Gefahr, noch weit mehr zu verlieren.[20]
Konstanty Wasyl Ostrogski, der bei Weitem einflussreichste ukrainische Fürst, entschied das Schicksal der Union und seines Landes, indem er den König unterstützte. Die durch die Lubliner Union gezogene Grenze teilte das Großfürstentum in zwei Hälften, trennte die zukünftigen ukrainischen und belarussischen Territorien ab und verstärkte damit Differenzen, die sich seit Langem entwickelt hatten. Historisch unterschieden sich die Woiwodschaft Kyjiw und Galizien-Wolhynien erheblich von den belarussischen Gebieten im Norden. Vom 10. bis zum 14. Jahrhundert waren sie Kerngebiete unabhängiger oder halb unabhängiger Fürstentümer, und nach der Nestorchronik und ihren Fortsetzungen in Kyjiw und Galizien-Wolhynien zu urteilen, unterschieden sie sich in ihrer Identität stark von anderen Regionen der Rus. Die Lage der ukrainischen Gebiete an der Peripherie des Großfürstentums Litauen und die Herausforderungen, vor die sie sich an der offenen Grenze zur Steppe gestellt sahen, hoben sie von der übrigen litauischen Welt ab.
Beim Reichstag von Lublin sahen die ukrainischen Eliten kaum Vorteile darin, die faktische Unabhängigkeit des Großfürstentums zu erhalten, das schlecht gerüstet war, dem wachsenden Druck von Krim- und Nogai-Tataren etwas entgegenzusetzen. Das Königreich Polen konnte dem Großfürstentum helfen, den Krieg gegen das Moskauer Reich zu führen, allerdings war es wenig wahrscheinlich, dass es den Ukrainern in den Konflikten mit den Tataren helfen würde.
Mit einer anderen Haltung war zu rechnen, wenn die Grenzprovinzen in das Königreich eingegliedert würden. Wie sich herausstellte, behielten die wolhynischen Fürstenfamilien ihre Besitztümer nicht nur, sondern dehnten sie unter polnischer Herrschaft drastisch aus. Konstanty Wasyl Ostrogski, der beim Lubliner Reichstag eine Schlüsselrolle spielte, behielt seine Posten als Starost von Wolodymyr, Marschall von Wolhynien und Woiwode von Kyjiw.
Die Gegensätze zwischen den wolhynischen Fürsten, die Sigismund II. August bei der Teilung des Großfürstentums Litauen halfen und von denen Ostrogski der prominenteste war, einerseits und den litauischen Aristokraten andererseits währten nicht lange, da beide Lager bald eine gemeinsame Basis darin fanden, politische und kulturelle Projekte zu entwickeln, die ihre Unabhängigkeit von der königlichen Autorität stärkten. Das kulturelle Erwachen fand beiderseits der neuen polnisch-litauischen Grenze statt, geschürt von den politischen Ambitionen der Fürsten und unmittelbar verknüpft mit den Religionskonflikten der damaligen Zeit. In Litauen ging die Familie Radziwiłł mit ihrem Beispiel voran und verband Politik, Religion und Kultur. Der Hauptgegner der Lubliner Union, Mikołaj Radziwiłł, der Rote, war zugleich der führende Vertreter des polnischen und litauischen Calvinismus und Gründer einer Schule für calvinistische Jugendliche. Sein Vetter Mikołaj Radziwiłł, der Schwarze, finanzierte den Druck der ersten vollständigen Übersetzung der Bibel ins Polnische, die in Brest an der ethnisch ukrainisch-belarussischen Grenze erschien. Johannes Calvin widmete ihm eines seiner Werke. Da die polnischen Könige katholisch blieben, trug die abweichende Religion ihrer aristokratischen Gegner dazu bei, deren Unnachgiebigkeit gegenüber der königlichen Autorität zu stärken. Das galt sowohl für Protestanten wie auch für orthodoxe Christen. Denn die Orthodoxen griffen die Initiative der Familie Radziwiłł auf, politische Opposition mit religiösem Dissens zu verbinden.
Der Erste, der dies tat, war ein orthodoxer Magnat namens Hryhorii Chodkiewicz (im Belarussischen Chadkiewicz), der wie die beiden Radziwiłł-Cousins die litauische Armee als Großhetman des Großfürstentums – einer der höchsten Posten in der Hierarchie – geführt hatte. 1566, zwei Jahre nach Erscheinen der polnischen Bibel, lud Chodkiewicz zwei Moskauer Flüchtlinge, die Drucker Iwan Fjodorow und Pjotr Mszislawez, in seine Stadt Zabłudów (Zabludaŭ) ein. Auf seine Bitten und mit seiner Förderung veröffentlichten sie dort eine Reihe von Büchern in Kirchenslawisch. Als Chodkiewicz 1572 starb, beendeten sie ihre Arbeit, aber seine Initiative sollte Folgen haben.
Einige Jahre nach Chodkiewiczs Tod begann Konstanty Ostrogski in Wolhynien sein eigenes Buchprojekt. 1574 verlegte er seine Residenz aus der wolhynischen Stadt Dubno in das nahe Ostroh. Er engagierte einen italienischen Architekten, der damals in Lwiw lebte, für den Bau neuer Festungsanlagen, deren Überreste noch heute in der Stadt zu sehen sind. Zudem holte er einen von Chodkiewiczs Druckern, Iwan Fjodorow, nach Ostroh, wo er am ehrgeizigsten Kulturprojekt des Fürsten mitwirken sollte: der Veröffentlichung der gesamten Bibel auf Kirchenslawisch. In seiner neuen Residenzstadt versammelte Ostrogski ein Gelehrtenteam, das den griechischen und den kirchenslawischen Bibeltext verglich, die kirchenslawische Übersetzung korrigierte und die maßgeblichste Bibelausgabe veröffentlichte, die jemals von orthodoxen Gelehrten produziert wurde. Es war ein wahrhaft internationales Projekt, an dem nicht nur Beteiligte aus Litauen und Polen, sondern auch aus Griechenland mitwirkten, während die Bibelausgaben, mit denen sie arbeiteten, aus so verschiedenen Orten wie Rom und Moskau stammten. Die Ostroger Bibel erschien 1581 in einer geschätzten Auflage von tausendfünfhundert Exemplaren.[21]
Die engen Kontakte zwischen Konstanty Ostrogski und den litauischen Adeligen sowie ihr gemeinsames Interesse, Kulturprojekte mit weitreichenden politischen Auswirkungen zu fördern, stützen die Vermutung von Fachleuten, die behaupten, Konstanty Ostrogski habe Fürst Mikołaj Krzysztof Radziwiłł geholfen, die Karte des Großfürstentums Litauen zu erstellen. Obwohl Radziwiłł keine politischen Ambitionen hegte, die seine Loyalität zum König und zur polnisch-litauischen Adelsrepublik untergraben hätten – er konvertierte vom Calvinismus zum Katholizismus und stellte sich 1606 gegen die Zebrzydowski-Rebellion –, deutet seine Landkarte darauf hin, dass er die historischen und kulturellen Ansprüche auf die Gebiete des Großfürstentums, die infolge der Lubliner Union verloren gegangen waren, nie aufgab. Es war ihr Interesse an diesen Territorien, vor allem jenen entlang des Dnipro, das Ostrogski und Radziwiłł verband.[22]
Ukraine
Die Radziwiłł-Karte des Großfürstentums Litauen bietet einen Blick auf Osteuropa aus dem Palastfenster eines litauischen Aristokraten, nicht aus der Residenz eines Königs oder seiner Diener. Die Kartografen präsentierten das alte Großfürstentum Litauen, als hätten König Sigismund II. August und seine Anhänger es auf dem Reichstag in Lublin 1569 niemals geteilt. Die neuen Grenzen des erheblich verkleinerten Großfürstentums sind zwar eingezeichnet, aber kaum zu erkennen, und die Karte umfasst sämtliche ehemaligen litauischen Besitztümer bis an die Dnipro-Mündung. Die am deutlichsten kenntlich gemachten Siedlungen sind nicht etwa die Verwaltungszentren königlicher Herrschaft, sondern die Residenzen der Fürsten, darunter auch Radziwiłłs Residenzstadt Olyka, die nach der Lubliner Union auf der polnischen Seite lag, und Ostroh, der Sitz der Ostrogskis.
Sowohl Olyka als auch Ostroh liegen in Wolhynien, jener Region, die auf der Karte als Hochburg der Fürsten erscheint. Sie reicht bis an den Dnipro und ist markiert mit: «Volynia ulterior, quae tum Vkraina tum Nis ab aliis vocitatur» (Äußeres Wolhynien, genannt Ukraine oder Nieder[-Dnipro]). Nach dieser Karte erstreckt sich die Ukraine – was nur ein möglicher Name von dreien ist – im Norden von Kyjiw, Ostrogskis Sitz als Woiwode der Region, nach Süden bis an den Ros und die Festung Korsun, die König Stephan Báthory 1581 bauen ließ. Sie grenzt an die Steppe, «Campi deserti» (Wilde Felder) genannt, die hier mit zahlreichen Reitern dargestellt ist, was eher auf ein Kampfgebiet als auf eine bewohnte Gegend hindeutet. Offenbar erlebte die Region ein rasches Wachstum, denn es sind zahlreiche Burgen und Siedlungen eingezeichnet, die auf früheren Karten nicht vorkamen. Die Radziwiłł-Karte zeigt die Territorien des Großfürstentums Litauen, wie sie vor der Lubliner Union (1569), der Vereinigung des Königreichs Polen mit dem Großfürstentum (Abb. 1, S. 300–301), existierten, und enthält eine ergänzende Karte des Dnipro (Abb. 2, S. 302–308).
Der Hinweis auf die «Ukraine» als «Äußeres Wolhynien» spricht Bände über die Ansichten und Ambitionen der Ostrogskis und anderer wolhynischer Fürsten, die den Erstellern der Radziwiłł-Karte vermutlich als Berater dienten. Er spiegelt wider, dass sie die rechtsufrig des Dnipro liegende «Ukraine» als zu Wolhynien gehöriges Gebiet sahen, und hob die Rolle hervor, die wolhynische Fürsten bei deren Kolonisierung gespielt hatten. Tatsächlich waren die Territorien, die auf der Radziwiłł-Karte als «Ukraine», «Äußeres Wolhynien» und «Nieder[-Dnipro]» gekennzeichnet waren, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zum Spielfeld wolhynischer Fürsten geworden.
Der Lubliner Reichstag untersagte den Fürsten, in Kriegszeiten eigene Armeen aufzustellen. Wegen der ständigen Gefahr von Tatarenangriffen an der Steppengrenze konnte die stehende Armee der polnisch-litauischen Adelsrepublik jedoch nicht ohne die militärische Schlagkraft der Fürsten auskommen. Ostrogski konnte allein schon eine Armee von zwanzigtausend Soldaten und Kavalleristen aufbieten – zehnmal größer als die