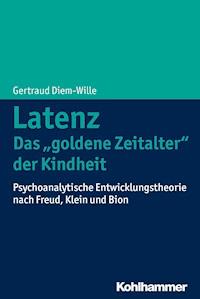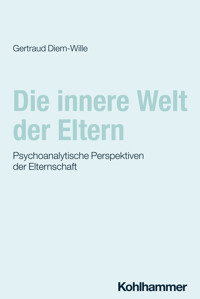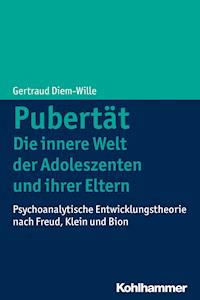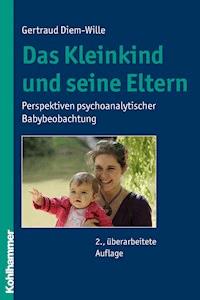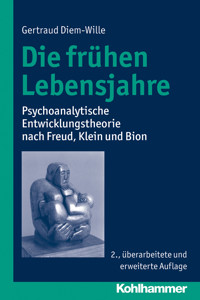
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung der emotionalen und intellektuellen Grundmuster der Persönlichkeit entscheidend. Dieses Buch stellt - unter Berücksichtigung der modernen hirnphysiologischen Forschung - die aktuelle psychoanalytische Theorie zur psychischen Entwicklung in der frühen Kindheit vor. In verständlichen Worten werden die Grundlagen der Entstehung des Körper-Ichs, der Emotionen, des Denkens und der psychosexuellen Entwicklung dargestellt und mit anschaulichen Beispielen aus der Säuglingsbeobachtung nach Esther Bick und der Kinderanalyse illustriert. Die Bedeutung von Liebe für die Entwicklung des Fühlens und Denkens und der Umgang mit Bösem (Neid, Aggression und Destruktion) werden theoretisch und anhand von Situationen erläutert, die es dem Leser ermöglichen, an eigene Erlebnisse anzuschließen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die ersten Lebensjahre sind für die Entwicklung der emotionalen und intellektuellen Grundmuster der Persönlichkeit entscheidend. Dieses Buch stellt - unter Berücksichtigung der modernen hirnphysiologischen Forschung - die aktuelle psychoanalytische Theorie zur psychischen Entwicklung in der frühen Kindheit vor. In verständlichen Worten werden die Grundlagen der Entstehung des Körper-Ichs, der Emotionen, des Denkens und der psychosexuellen Entwicklung dargestellt und mit anschaulichen Beispielen aus der Säuglingsbeobachtung nach Esther Bick und der Kinderanalyse illustriert. Die Bedeutung von Liebe für die Entwicklung des Fühlens und Denkens und der Umgang mit Bösem (Neid, Aggression und Destruktion) werden theoretisch und anhand von Situationen erläutert, die es dem Leser ermöglichen, an eigene Erlebnisse anzuschließen.
Professor Dr. Gertraud Diem-Wille lehrt Psychoanalytische Pädagogik an den Universitäten Klagenfurt und Wien. Sie ist Lehranalytikerin der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung und der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung.
Gertraud Diem-Wille
Die frühen Lebensjahre
Psychoanalytische Entwicklungstheorie nach Freud, Klein und Bion
2., überarbeitete und erweiterte Auflage
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen und Texten ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
2. Auflage 2013 Alle Rechte vorbehalten © 2007/2013 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Umschlagabbildung: Henry Moore, Maternity, 1924, Reproduced by permission of The Henry Moore Foundation © The Henry Moore Foundation. All Rights Reserved, DACS 2012/www.henry-moore.org Illustration: www.grafikramer.de Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN: 978-3-17-023016-3
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-023813-8
epub:
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur zweiten Auflage
Danksagung
Einleitung – die Relevanz der ersten Lebensjahre für die Persönlichkeitsentwicklung
1 Anlage-Umwelt-Kontroverse
1.1 Anlagebedingte Dispositionen
1.1.1 Chromosomenanomalien
1.1.2 Autismus
1.1.3 Intelligenz
1.2 Umweltbedingte Einflüsse
1.2.1 Beispiel: Problemfamilien mit Familienintensivbetreuung
1.2.2 Beispiel: Beruflich erfolgreiche Familien
2 Zur Entstehung des Körper-Ichs – Individuation durch die Erfahrung von Trennung und Verbundenheit
2.1 Gehalten werden durch die Eltern
2.2 Psychoanalytische Babybeobachtungen
2.2.1 Beobachtung von Elias
2.2.2 Gefilmte Beobachtungen von Sushma
2.2.3 Fallbeispiel von Lukas
2.3 Exkurs: Neurologische Konzepte der Bedeutung der Beziehungen für die Entwicklung des Gehirns
3 Die emotionale Entwicklung in den ersten Lebensjahren
3.1 Urgeschichte der emotionalen Entwicklung
3.1.1 Fallbeispiel: Eltern-Kleinkind-Therapie
3.1.2 Fallbeispiel: Erstgespräch mit den Eltern bei einer Babybeobachtung
3.1.3 Therapeutische Hilfe vor und während der Schwangerschaft
3.2 Die ersten drei Monate als Begegnung mit archaischen Ängsten und liebevoller Geborgenheit (paranoid-schizoide Position)
3.2.1 Babybeobachtung: Felix, das „Sonntagskind“
3.2.2 Lernen über menschliche Kommunikation
3.3 Integration der getrennten Teilobjekte zu einem konstanten Objekt und einem konstanten Subjekt (depressive Position)
3.3.1 Beobachtung von Felix im Umgang mit Hindernissen und Problemen
3.3.2 Wechselnde trianguläre Beziehungsmuster: Kind – Mutter – Vater
3.4 Emotionale Bildung statt emotionales Analphabetentum
3.4.1 Toleranz gegenüber kurzfristiger Regression in die paranoid-schizoide Position
4 Entwicklung des Denkens und der Fähigkeit zum Symbolisieren
4.1 Beginn des Denkens, Präkonzeption
4.1.1 Beispiele aus der Babybeobachtung
4.2 Magisches, egozentrisches Denken und symbolische Gleichsetzung
4.2.1 Denken in der paranoid-schizoiden Position
4.3 Logisches Denken nach dem Realitätsprinzip (Denken in der depressiven Position)
4.3.1 Wiedergutmachung und Kreativität
4.3.2 Sprachliche Entwicklung
4.4 Denkstörungen und emotionale Störungen
4.4.1 Fallbeispiel: Kinderanalyse von Ferdinand
4.4.2 Fehlentwicklungen im Denken und ihre Ursachen
4.5 Abschließende Bemerkungen
5 Die psychosexuelle Entwicklung des Kindes
5.1 Weiter Begriff der Sexualität
5.2 Das Konzept der Bisexualität
5.3 Infantile Sexualität
5.3.1 Orale, anale und phallische Phase
5.3.2 „Polymorph-perverse“ kindliche Sexualität
5.4 Der Ödipuskonflikt
5.4.1 Frühformen des Ödipuskonfliktes
5.4.2 Fallbeispiel: Kinderanalyse von Leo
5.4.3 Ödipuskomplex beim Jungen
5.4.4 Ödipuskomplex beim Mädchen
5.5 Sexueller Missbrauch – eine Perversion
5.5.1 Falldarstellungen von sexuellem Missbrauch
5.5.2 Prävention von sexuellem Missbrauch
5.6 Auswirkung der Bewältigung des ödipalen Konflikts auf das Denken/auf die innere Welt
5.6.1 Beobachtung von Benni beim Spiel
6 Epilog
Literatur
Personenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Wer die Fülle der Tugend in sich versammelt, Gleicht einem neugeborenen Kindlein. Bienen, Skorpione, Vipern und Schlangen beißen es nicht; Wilde Tiere schlagen es nicht; Raubvögel reißen es nicht. Seine Knochen sind schwach, seine Sehnen weich, Dennoch ist fest sein Griff. Es weiß noch nichts von der geschlechtlichen Vereinigung von Mann und Weib, Dennoch ist sein Glied erigiert: Das ist der Samenkraft Gipfel. Den ganzen Tag schreit es, Dennoch wird es nicht heiser: Das ist der Gipfel natürlichen Einklangs. Den Einklang kennen heißt: Ewig sein. Das Ewige kennen heißt: Erleuchtet sein. Das Leben mehren heißt: Unheil beschwören. Bewußt den Atem regeln heißt: Stärke (Starrheit) begehren. Wird ein Wesen fest, so wird es alt. Dieses nennt man: Nicht dem Weg gemäß. Nicht dem Weg gemäß wird enden bald. Kapitel 55
Vorwort zur zweiten Auflage
Dieses Buch stellt die frühe Entwicklung des Kindes im familiären Umfeld auf eindrucksvolle und wohl fundierte Weise aus psychoanalytischer Sicht dar. Es nimmt vor allem Bezug auf die theoretische Verbindungslinie Freud-Klein-Bion. Mit ihrer klaren, verständlichen und nicht mit Fachbegriffen überfrachteten Sprache richtet sich die Verfasserin deutlich an ein breites Lesepublikum – an Eltern und an all jene, die im weitesten Sinn mit der Erziehung von Kindern zu tun haben. Es geht ihr darum, die Entwicklung der kindlichen Psyche darzustellen. Die Vielzahl von detailreichen Beispielen aus der systematischen Beobachtung von Babys und Kleinkindern, aus alltäglichen Wahrnehmungen von kindlichem Verhalten in der Familie und im Umgang mit anderen sowie aus einer Reihe von klinischen Interventionen vermittelt den Leserinnen und Lesern eine anschauliche Vorstellung vom konzeptuellen Rahmen der Verfasserin und enthält viele einprägsame Vignetten aus dem kindlichen Alltag.
Dank der gewählten Darstellungsmethode mit beschreibendem Material, das anschließend im Hinblick auf seine Bedeutung für die Psyche und die Entwicklung interpretiert wird, ist es möglich, sich in die Details des kindlichen Spiels und der Interaktionen der beschriebenen Kinder zu vertiefen und danach Gedanken über die geschilderten komplizierten Vorgänge zu machen.
Auch Leserinnen und Leser, die mit dem psychoanalytischen Terrain bereits vertraut sind, werden in diesem Buch mit seiner unübersehbaren Fülle von Wissen und klinischen Erfahrungen und Überlegungen eine interessante und relevante Lektüre vorfinden. Die Verfasserin versteht es auf eindrucksvolle Weise, grundlegende Theorien der Psychoanalyse, die Erkenntnisse der Säuglingsbeobachtung, empirische entwicklungspsychologische Forschungsergebnisse und Aspekte der modernen Neurowissenschaften mit einer umfassenden klinischen Erfahrung in der Eltern-Kind-Psychotherapie und in der Kinderanalyse zu vereinen. Letztere ist besonders wertvoll, da die Bedeutung der Kinderanalyse für das aktuelle Verständnis von Fragen der kindlichen Entwicklung manchmal nicht ausreichend gewürdigt wird. Die Beispiele aus der analytischen Arbeit mit Kindern über lange Zeiträume machen deutlich, wie Kinder leiden, aber auch, welche Möglichkeiten die Psychoanalyse hat, ihnen durch das Wahrnehmen und Bearbeiten ihrer unbewussten Ängste Erleichterung zu verschaffen und ihre Fähigkeit zu emotionaler und kognitiver Entwicklung und zu mehr Lebensfreude zu erschließen.
Ich möchte kurz auf einige Punkte eingehen, die mich besonders beeindruckt haben. Erstens wird in der Herangehensweise der Verfasserin nachvollziehbar, wie wichtig die Kinderanalyse für die Pädagogik ist und in den Anfängen der Kinderanalyse als Disziplin und vielleicht ganz besonders in der deutschsprachigen Tradition war. Es ist ihr sehr daran gelegen, dass Eltern und all jene, die die anspruchsvolle Aufgabe der Kindererziehung zu erfüllen haben, von dem besonderen Verständnis profitieren können, das die Psychoanalyse ermöglicht – für die Ängste des Säuglings, die Wiederbelebung unverarbeiteter früher Emotionen durch die Geburt eines Babys, die Notwendigkeit einer zuverlässigen psychosozialen Unterstützung der Eltern während der Schwangerschaft und der ersten Lebensjahre ihrer Kinder –, damit sie Halt und Unterstützung vorfinden, wo immer dies erforderlich ist. Sie geht davon aus, dass die Wahrnehmung der unbewussten Aspekte unserer Erfahrungen befreiend wirkt, und beweist damit eine offene Haltung, die darum bemüht ist, sowohl Realismus als auch Hoffnung zu vermitteln – beides gelingt ihr in diesem Buch auf bewundernswerte Weise.
Zweitens wird die Rolle der Väter im Leben der heutigen Kinder mit großer Umsicht interpretiert – das Zusammensein von Müttern, Vätern und Babys wird in einigen der Fallbeispiele mit einer Natürlichkeit beschrieben, die man selten zu lesen bekommt. Und drittens stützt sich die Verfasserin in einer charakteristischen Weise auf deutschsprachige und britische psychoanalytische Traditionen, die mehr Bewusstsein für die Möglichkeiten schaffen sollte, die ein derartiger Ideenaustausch eröffnet. Zuletzt möchte ich die für sie so typische Ausgewogenheit hervorheben. Ihre Aufmerksamkeit gilt gleichermaßen den Aspekten, die Entwicklung und Glücklichsein ermöglichen, wie jenen, die ihnen im Weg stehen. Ihre positive Darstellung dessen, was Psychoanalyse im Leben eines Menschen bewirken kann, ist ein sehr taugliches Mittel gegen eine übermäßige Konzentration auf das Pathologische, und ihr so respektvoller Blick auf das menschliche Potenzial hat, wie ich meine, auch mit ihrer Begeisterung für die Säuglingsbeobachtung zu tun. Dieses Buch ist ein zeitgemäßer Beitrag zur aktuellen Beschäftigung mit den ersten Lebensjahren, der lange Bestand haben könnte und sehr zu begrüßen ist.
Die sorgfältig überarbeitete und ergänzte zweite Auflage zeigt, dass das Buch inzwischen ein unverzichtbarer Bestandteil der Ausbildung in psychoanalytischer Säuglingsbeobachtung und Psychotherapie sowohl im deutschsprachigen als auch im englischsprachigen Raum geworden ist.
Margaret Rustin, London 2013
Danksagung
Der Gedanke einer Einführung in die psychoanalytische Entwicklungspsychologie nach Freud, Klein und Bion entstand während meiner Lehrtätigkeit im Ausbildungsseminar für Psychoanalytiker in der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. In der Diskussion im Seminar „Psychoanalytische Entwicklungspsychologie“ wurde mir klar, was die Begriffe von Melanie Klein so schwer verständlich und schwer nachvollziehbar macht, wenn die Teilnehmer bisher vor allem mit dem Konzept der Triebtheorie vertraut waren. Bei der Leitung des Universitätslehrgangs „Psychoanalytic Observational Studies“ wurde mir und den Studierenden bewusst, dass es in der kleinianischen Tradition weder im deutschsprachigen noch im englischsprachigen Raum eine allgemein verständliche Darstellung der normalen Entwicklung in den ersten drei Lebensjahren gibt. Der reiche klinische Erfahrungsschatz der Psychoanalytischen Babybeobachtung nach Esther Bick, die vor allem in London an der Tavistock Clinic seit mehr als 50 Jahren gesammelt wurde, konnte ich durch meine Lehrerinnen Isca Salzberger-Wittenberg, Anne Alvarez und Margaret Rustin kennenlernen. Die klinische Arbeit in der Eltern-Kleinkind-Therapie nach dem Modell des „Under Five Counselling Service“ habe ich durch Lisa Miller und Dilys Daws vermittelt bekommen, auf die ich mich im Buch immer wieder beziehe. Für diese großzügige Unterstützung und Ermutigung bin ich sehr dankbar. Ich konnte auf die reiche klinische Erfahrung von Analytikern in London, vor allem Betty Joseph, Michael Feldman, Robin Anderson, Elisabeth Bott Spillius und Irma Brenman-Pick, zurückgreifen, die meine analytische Arbeit mit Kindern und Erwachsenen unterstützten. Es ist mir ein Anliegen, ihre großzügige Förderung und klinische Begleitung dankend zu würdigen.
Ich habe viel gelernt von meinen Patienten aller Altersstufen und meinen Kollegen. Dem Kohlhammer-Verlag vertreten durch Dr. Klaus-Peter Burkarth und Prof. Günther Bittner verdanke ich die Anregung, nach dem großen Interesse an meinem Buch „Das Kleinkind und seine Eltern“ eine Vertiefung der entwicklungspsychologischen Themen zu planen. Die intensiven Diskussionen im Rahmen der gemeinsamen Lehrtätigkeit an der Interuniversitären Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt mit den Universitätslehrern/innen Wilfried Datler, Helga Reiter, Kornelia Steinhardt, Irmtraud Sengschmied und Barbara Lehner haben mich Zusammenhänge klarer erkennen lassen. Die Teilnehmer/innen des Universitätslehrgangs haben mir durch ihre Fragen und ihr Interesse geholfen, zu erkennen, welche Grundannahmen und Denkmuster explizit gemacht werden müssen, um nachvollziehbar zu sein. Meinem Institutsvorstand Konrad Krainer danke ich für die wohlwollende Unterstützung und Ermutigung meiner Arbeit und für die Förderung meines Arbeitsschwerpunktes der Psychoanalytischen Pädagogik.
Für die erfrischend freundliche Kritik und Anregungen bei der Lektüre des Manuskripts bin ich meiner besten Freundin und ersten Leserin Christiane Siegl verbunden. Peter Marginter hat mir geholfen, durch kritische Fragen Darstellungen klarer formulieren zu können. Sein feines Sprachgefühl hat sich in zahlreichen Formulierungsvorschlägen niedergeschlagen, sein Anliegen, Gedanken nicht nur im Fachjargon sondern allgemeinverständlich auszudrücken, hat zur besseren Verständlichkeit des Textes wesentlich beigetragen. Sylvia Zwettler-Otte, eine kompetente Analytikerin und loyale Freundin, hat mich durch ihre Ermutigung und anerkennenden Worte unterstützt und hat das Manuskript mit unbestechlichem Auge redigiert. Meine Lektorin Frau Alina Piasny hat das Manuskript mit großer Sorgfalt und Sachkenntnis durchgearbeitet und ein Sach- und Personenregister erstellt.
Meine Kinder Katharina und Johanna und mein Schwiegersohn Ramsy haben mir durch ihre Kommentare und Unterstützung geholfen. Die Beobachtungen und Erfahrungen mit meinen lebhaften und wissenshungrigen Enkelkindern Samira und Karim lieferten reiches Anschauungsmaterial und Stoff für Beispiele. Meine beiden Enkelkinder haben sich nicht nur theoretisch für die Entstehung des Buches interessiert, sondern auch bei den Korrekturarbeiten am Computer auf meinem Schoß sitzend mitgearbeitet oder bei mir im Zimmer an einem Erlebnisaufsatz gearbeitet. Werner Koenne, dem Mann an meiner Seite, danke ich für seine teils humorvollen teils ernsthaften inhaltlichen Fragen und Anregungen aus der Perspektive des Naturwissenschaftlers und skeptischen Logikers. Seine selbstverständliche Förderung und Akzeptanz haben es mir erleichtert, diese Freizeit konsumierende Tätigkeit auszuüben.
Besonderer Dank gilt den Eltern Hanna und Ramsy Hadaya, Agnes Turner und Lucki Dostal für die Erlaubnis zur Abbildung ihrer Familienphotos.
Wien, im Sommer 2007
Gertraud Diem-Wille
Einleitung – die Relevanz der ersten Lebensjahre für die Persönlichkeitsentwicklung
„Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen.“
William Faulkner
Die Einsicht Freuds (1905a), dass die frühen Jahre für die Entwicklung der Persönlichkeit von überragender Bedeutung sind, stieß zunächst auf heftigen Widerspruch und Unverständnis. Die Sicht des Kindes als sexuelles Wesen, das ab der Geburt mit den widersprüchlichen Affekten Liebe und Hass, Eros und Todestrieb ringt, prallte gegen das sentimentale Verständnis der Unschuld des Kindes. Der Bibelspruch „Lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich“ (Matthäus 19:14) wurde fälschlicherweise als Bestätigung der Unwissenheit, der Naivität und Schuldlosigkeit der Kinder verstanden. Die grausame Seite der Kinder, ihre Eifersucht und ihr Neid oder exhibitionistisches Verhalten wurden kaum beachtet oder belächelt, da diese Verhaltensweisen bei den kleinen Menschen oft komisch wirken und Erwachsene durch ihr Lachen die eigene Betroffenheit abwehren. Es wurde angenommen, dass Kinder von schmerzlichen Gefühlen noch nichts verstünden.
Das psychoanalytische Verstehen der frühen Jahre als Grundlage der Persönlichkeitsentwicklung können wir mit dem Bild des Wurzelschlagens eines jungen Baumes vergleichen. Die frühen Aspekte der Entwicklung bilden die Wurzeln, ohne die kein lebender Baum existieren könnte. Eine tiefe, liebevolle Beziehung zu den Eltern oder Bezugspersonen erlaubt die Entwicklung einer tiefen und starken Wurzelbildung, die auch späteren stürmischen Lebensphasen standhält und Sicherheit gibt. Eine unzureichende Bemutterung und ungünstige Umweltbedingungen gestatten nur eine oberflächliche, flache Wurzelbildung, die bei Entwicklungskrisen dann vielleicht keinen zureichenden Halt gewährt. Dass ein Minimum an lebenserhaltenden Funktionen, wie emotionale Zuwendung und positive Umweltbedingungen, gegeben sein muss, um das Kind psychisch überleben zu lassen, zeigt die hohe Kindersterblichkeit in Waisenhäusern,1 die sich nur um das körperliche Wohlergehen der Kinder kümmerten. Frühe Fehlentwicklungen wie der Autismus oder Hospitalismus gehen auf frühe Deprivationserfahrungen zurück (Alvarez 2001, Spitz 1945).
Die Einschätzung der Kindheit in einer historischen Epoche bestimmt deren selbstverständlichen Umgang mit Kindern. Im 20. und 21. Jahrhundert hat sich Freuds Annahme durchgesetzt, dass frühkindliche Erfahrungen auch in den späteren Phasen einer normalen Entwicklung bestehen bleiben. Dasselbe, meint Williams (2003), gelte erst recht für eine pathologische Entwicklung. Erst im letzten Jahrzehnt ist die Erforschung des ersten Lebensjahres in das Zentrum der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit getreten. Die Beobachtung des frühkindlichen Verhaltens und der Interaktion in der Familie in deren Bedeutung für die psychische Entwicklung bedarf einer besonderen Schulung, wie sie etwa die psychoanalytische Säuglingsbeobachtung nach Esther Bick (1964) ermöglicht.
Das Bild des Wurzelschlagens eines Baumes zur Beschreibung der Qualität der Beziehungen der Eltern zum Kind verweist auf deren zentrale Bedeutung für die Stabilität der Person, vernachlässigt aber den anderen Aspekt, wie tiefgreifend nämlich die Eltern oder Bezugspersonen, deren Persönlichkeit und Verhalten gegenüber dem Kind dessen Sicht der Welt und die Wahrnehmung der anderen Person beeinflussen. Wie die Muster eines Stoffes werden die frühen Erfahrungen aufgenommen und bleiben im Unbewussten lebendig, als „Erfahrung im Gefühl“ (Melanie Klein).
Erst im 20. Jahrhundert, dem „Jahrhundert des Kindes“, wurde das Kind als ernst zu nehmende Person betrachtet. Ellen Kay (zit. in Hermann 1992, 43) fordert eine „Erziehung vom Kinde aus“, Maria Montessori (1982, 15) bezog sich auf die Aktivität des Kindes und sein Lernen-Wollen. Betrachten wir aber nun, welches Verhalten der Erwachsenen durch das Vorurteil der Unwissenheit der Kinder legitimiert wurde: Da man annahm, dass kleine Kinder keinen Unterschied zwischen der eigenen Mutter und dem eigenen Vater und einer anderen erwachsenen Person machen können, wurden sie zur Pflege fremden Personen überlassen. Das Weggehen der Eltern erfolgte abrupt und ohne jede Vorbereitung. Solange das Kind noch nicht sprechen konnte, wurde unterstellt, dass es noch nichts verstehen könne. Es wurden daher vor dem Kind alle Dinge verhandelt. Kinder wurden wie Gegenstände aufbewahrt und, wie Rousseau (1762) im „Emil“ vehement kritisiert, zur Ruhigstellung in Steckkissen gewickelt und an einem Haken an die Wand gehängt. Das Weggeben der Kinder zu einer Amme schien problemlos, da man dem Kind nicht unterstellte, eine emotionale Beziehung zur Mutter zu haben. Richtig ist vielmehr das Umgekehrte. Badinter (1980) beschreibt, wie im Frankreich des 18. Jahrhunderts die Kinder die ersten Lebensjahre bei einer Amme verbrachten und wie hoch die Kindersterblichkeit lag. Flaubert erwähnt 1857 in seinem für damalige Verhältnisse schockierend realistischen Roman „Madame Bovary“ beiläufig, wie Emma ihre Tochter nur zweimal in der Woche bei einer Amme besucht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Emma keine emotionale Beziehung zu ihrer Tochter aufbauen konnte und ihr Leben weiterhin als leer und schal empfand. Das Wegschicken der Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren war sowohl in königlichen und adeligen Kreisen zum Erlernen der höfischen Sitten die Regel (so wurde Maria Stuart mit sieben Jahren an den französischen Hof geschickt, wo sie mit 17 Jahren den Dauphin heiratete), wie auch im bäuerlichen Milieu, wo Kinder als Knechte oder Mägde arbeiten mussten. Schwere Kinderarbeit war bis ins 20. Jahrhundert in weiten Teilen der Welt üblich.
Lloyd deMause (1977) hat in einer umfangreichen Studie „Hört ihr die Kinder weinen“ eine psychogenetische Geschichte der Kindheit geschrieben, die die unterschiedlichen Einstellungen der Eltern zu ihren Kindern anhand von biographischen Berichten in verschiedenen Jahrhunderten in Europa und den USA untersucht.
Im Gegensatz zur Überzeugung von der kindlichen Unschuld sollten die bis ins 19. Jahrhundert üblichen Erziehungspraktiken des Schlagens, Befehlens und Lächerlichmachens das Böse im Kind bekämpfen: Das Wilde und Archaische sollte durch Drill, Zwang und strenge Strafe gebändigt werden. Der „aufgeklärte“ Pädagoge Schreber, dessen psychotischer Sohn durch seine Autobiographie „Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken“ (Schreber 1903) Berühmtheit2 erlangte, forderte für Kinder viel körperliche Betätigung im Freien, entwickelte aber auch „pädagogische Maschinen und Apparate“, um das Onanieren und das Daumenlutschen zu verhindern oder eine aufrechte Haltung beim Schreiben zu erzwingen (Schreber 1879, 1891).
Auch heute werden Kinder lächerlich gemacht, geschlagen, ohne Vorbereitung allein gelassen oder im Spital wochenlang von den Eltern getrennt. Heute wissen wir, dass wir den Kindern damit Schaden zufügen, da für sie eine lange Trennung von den Eltern traumatisierend ist. Besonders während einer Krankheit oder vor und nach einem operativen Eingriff brauchen sie die besondere Unterstützung ihrer Eltern, um mit diesen ängstigenden Erfahrungen umgehen zu können.
In diesem Buch wird versucht, die Erkenntnisse der Psychoanalyse für pädagogische Fragen fruchtbar zu machen und zu zeigen, wie die Erfahrungen, die wir als Babys und Kleinkinder machen, unsere Grundhaltung zur Welt bestimmen. Als Babys lernen wir zuerst zu fühlen. Wie wir unsere Gefühle zu organisieren beginnen, beeinflusst unser späteres Verhalten und unsere Kapazität zu denken. Diese Erklärungsversuche bewegen sich weitgehend auf Neuland, da die Psychoanalyse kein in sich geschlossenes System von Theorien darstellt. Es existieren innerhalb der verschiedenen psychoanalytischen Schulen unterschiedliche Annahmen über den Beginn der Ich-Entwicklung und dementsprechend auch verschiedene Theorien über die Funktionsweisen der menschlichen Psyche, die oft Anlass heftiger Kontroversen sind. In den folgenden Ausführungen beziehen wir uns hauptsächlich auf die Konzeption von Freud und deren Weiterentwicklung durch Melanie Klein, Wilfried Bion und die Londoner Post-Kleinianer Betty Joseph, Michael Feldman, John Steiner und Hanna Segal. Im Mittelpunkt steht die unter dem Terminus „Objektbeziehungstheorie“3 behandelte Beschreibung der intrapsychischen Vorgänge, wie sie sich aus der Beziehung zu den relevanten Personen (Objekten) entwickeln.
Die zentrale Bedeutung der Gefühle, auf die Freud zu Beginn des letzten Jahrhunderts hingewiesen hat, wird zunehmend von verschiedenen Disziplinen – wie der Neurologie, der Psychologie, der Psychoanalyse und der Biochemie – aufgegriffen. Es geht um die Frage, wie die Gefühle unser Denken bestimmen und warum Menschen erst menschlich werden, wenn sie lernen, sich emotional auf andere Menschen zu beziehen. Die biologische Erklärung unserer sozialen Verhaltensweisen geht von einem „sozialen Gehirn“ und dem biologischen System unserer Affektregulierung aus (Gerhardt 2004, Schore 2003). In der Neurologie und Biologie ist man sich heute einig, dass „unsere Rationalität, die die Wissenschaft so hoch gepriesen hatte, auf Emotionen aufbaut und ohne diese nicht existieren kann“. Damasio betont, dass der rationale Teil des Gehirns nicht unabhängig funktionieren kann (Damasio 2004, 5), sondern nur gleichzeitig mit den grundlegenden regulierenden und emotionalen Teilen des Gehirns. Er sagt: „Die Natur scheint den Apparat der Rationalität nicht einfach auf dem Apparat der biologischen Regulation gebaut zu haben, sondern auch von ihm und mit ihm“ (Damasio 1995, 128; kursiv im Original). Der höhere Teil des Kortex kann nicht unabhängig von der primitiven emotionalen Antwort operieren. Die Bestätigung der fundamentalen Bedeutung der frühen Erfahrungen während der Schwangerschaft im Mutterleib und in den ersten drei Lebensjahren durch die Naturwissenschaften unterstützt die Argumente und klinischen Ergebnisse der Psychoanalyse und der psychoanalytischen Sozialarbeit, die auf den Zusammenhang von früher Deprivation bei Kindern und deren späteren Kriminalität, Gewalt und Drogensucht hingewiesen haben.
Das Erkennen der Bedeutung der Gefühle ist besonders für Pädagogen von zentraler Bedeutung, und zwar nicht nur der Gefühle der zu erziehenden Kinder, sondern vor allem ihrer eigenen Gefühle. In der Pädagogik existierte lange die feste Überzeugung, dass man, so weit es eben geht, seine eigenen Gefühle zurückstellen soll, um den Schüler „objektiv“ und „gerecht“ behandeln können. Manche Lehrer können sich nicht eingestehen, dass ihre Sympathie zu Schülern oder ihre Ablehnung das Verhalten den Kindern gegenüber beeinflusst. Die psychoanalytische Pädagogik will Lehrern helfen, ihre Gefühle nicht wegzuschieben, sondern sie zu erkennen und über sie nachdenken zu lernen. Dann können sie Gefühle als Quelle des Verstehens nutzen – manchmal der eigenen Motive, und manchmal als zusätzliche Dimension der Information über den Schüler. Zur richtigen Einschätzung der Gefühle bei sich und bei den Schülern bedarf es einer Schulung, um das Verhalten und die Details der Beziehung des Schülers zum Lehrer und zu den anderen Mitschülern beobachten zu können. Da wir ein Leben lang gelernt haben, unsere Gefühle – vor allem die heftig liebevollen oder aggressiven – vor uns selbst und vor anderen zu verstecken, sind wir, wie Bergmann in seinem Film „Szenen einer Ehe“ (1973) zeigt, „emotionale Analphabeten“, die erst in einem schmerzlichen Lernprozess einen Zugang zu den eigenen Gefühlen und den der anderen Personen (wieder-) finden müssen.
Die psychoanalytische Behandlungstechnik in der kleinianischen Tradition betont vor allem das Deuten der Übertragung und Gegenübertragung. Statt der Orientierung am Inhalt des Erzählten konzentriert sich der Analytiker stärker auf die minutiöse Beschreibung der Interaktion zwischen Patient und Analytiker. Betty Joseph (1994) legt das Hauptaugenmerk auf die Rekonstruktion der Geschichte des Patienten im Hier und Jetzt, was in den beschriebenen Falldarstellungen aus Kinderanalysen illustriert wird.
In einem Universitätslehrgang, bei dem es um psychoanalytisches Beobachten ging, wurde von diesem neuen Zugang gesprochen. Eine Teilnehmerin sagte: „Es hat sich extrem viel getan in den letzten beiden Jahren (im Universitätslehrgang), außen und auch innen; oft war es eine Gratwanderung. Es war schmerzlich, mein eigenes Spiegelbild im Beobachten und in der Besprechung in der Gruppe zu sehen. Es war eine intensive Phase der Persönlichkeitsentwicklung – manchmal sehr schwierig – ich möchte aber keine Minute missen.“ Eine Kindergärtnerin, die schon während ihrer Ausbildung oft Beobachtungsaufgaben auszuführen hatte, war erstaunt, welche neuen Lerndimensionen durch die psychoanalytische Beobachtung eröffnet wurden. Vor allem das genaue, beschreibende Protokollieren fand sie lehrreich, da sie erlebte, wie schwer es ist, dabei nicht zu bewerten.
In diesem Buch soll die Entwicklung des Kindes in den ersten drei Lebensjahren in wichtigen Dimensionen des Denkens, der emotionalen Entwicklung und der psychosexuellen Entwicklung nicht nur in der Theorie, sondern durch Beispiele von Baby- und Kleinkindbeobachtungen dargestellt werden.
1 René Spitz spricht davon, dass bis zu 80 % der in Waisenhäuser eingelieferten Säuglinge das erste Lebensjahr nicht erreichen (Spitz 1945).
2 Freud beschäftigt sich in seiner Schrift „Über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia“ (1911) mit den homosexuellen Wurzeln der Paranoia. Schatzmann geht der Frage nach, wie die Wahnvorstellungen, über die Daniel Paul Schreber berichtet, mit den „Erziehungsapparaten“ seines Vaters in Zusammenhang stehen könnten (Schatzmann 1974).
3 Der Begriff „Objektbeziehung“ wurde von Freud (1915b, 127) als Bezeichnung für die intrapsychische Dimension individuellen Erlebens (oder internalisierte „Objektbeziehung“) verwendet; sie meint die Repräsentation des Selbst, des Anderen. Melanie Klein (1955, 138) hat als Erste eine Theorie der Objektbeziehung formuliert, die die Beziehung des Kindes zu seinen Bezugspersonen (Objekte) ins Zentrum der emotionalen Entwicklung stellt.
1 Anlage-Umwelt-Kontroverse
Eine der grundlegenden Fragen bei der Entwicklung des Kindes ist die nach der Bedeutung der biologisch ererbten genetischen Ausstattung und dem Einfluss der Umwelt. Die verschiedenen Antworten darauf beruhen auf unterschiedlichen Annahmen über das Wesen des Menschen, der Forschungsperspektive und der unterschiedlichen Interpretation von empirischen Daten. Es herrscht heute weitgehende Übereinstimmung, dass die kindliche Entwicklung in gleichem Maß einem universellen Muster folgt, individuelle Unterschiede aufweist und von Umweltbedingungen beeinflusst wird. Welches Gewicht diesen drei Einflussfaktoren beigemessen wird, hängt von der theoretischen Orientierung der Psychologen und der Art der Fragestellung ab.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Standpunkte extrem gegensätzlich. Vertreter der Rassentheorie betonten die biologische Vererbungslehre, die eine eindeutige Rassenzuordnung unterstellte. Sie sollte die Überlegenheit der „germanischen Rasse“ als „Herrenmenschen“ vor allen anderen „unterlegenen Rassen“, den „Untermenschen“, belegen. Diese „wissenschaftlichen“ Scheinargumente sollten im Nationalsozialismus die Vernichtung „minderwertigen Lebens“, aller deformierten und abnormen Personen und der Juden legitimieren. Die zwischen den Jahren 1933 bis 1945 systematische und bürokratisch organisierte Ermordung von mehr als sechs Millionen Juden, Roma, Homosexuellen und Kriegsgefangenen in den Konzentrationslagern der „Herrenrasse“ in Deutschland und Österreich hat eindrucksvoll bewiesen, dass im Nationalsozialismus „rassische Überlegenheit“ einem entmenschlichten systematischen Verbrechertum zum Vorwand diente.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!