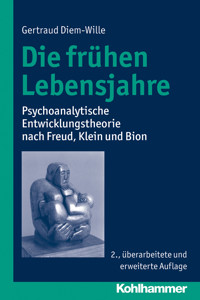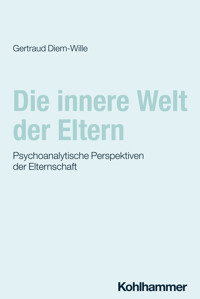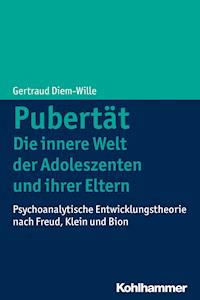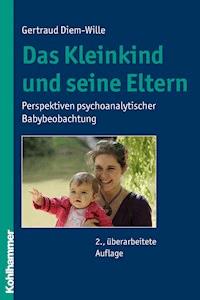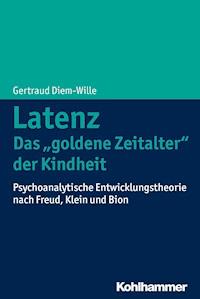
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Gertraud Diem-Wille illustrates the psychoanalytical development theories of Freud, Klein and Bion in regards to the ages between 6 and 11 years. The "golden age of childhood" with its desire for development and a willingness to learn describes a normal development. However, it may also show disruptions, which had so far not been recognisable, and which present themselves as learning difficulties, behavioural problems, fits of anger or tendencies to withdraw or use violence. Extensive case studies from child analyses show how inner conflicts may be identified and integrated with the help if interpretations.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Eltern Leopoldine und Heinz Wille
Und meine Großmutter Rosalia Frank
Gertraud Diem-Wille
Latenz Das »goldene Zeitalter« der Kindheit
Psychoanalytische Entwicklungstheorie nach Freud, Klein und Bion
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Bildnachweis S. 13: © Karim Hadaya
»Hoppity« aus When We Were Very Young von A.A. Milne. Text copyright © 1924 The Trustees of the Pooh Properties. »The End« aus Now We Are Six von A.A. Milne. Text copyright © 1927 The Trustees of the Pooh Properties. Published by Egmont UK Ltd and used with permission.
1. Auflage 2015
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-026064-1
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-026065-8
epub: ISBN 978-3-17-026066-5
mobi: ISBN 978-3-17-026067-2
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Einleitung
1
Körper und Psyche in der Latenz
1.1 Das Körper-Ich
1.2 Emotionale und psychosexuelle Entwicklung
1.2.1 Emotionale Entwicklung
1.2.2 Abwehrmechanismen in der Latenzzeit
Sublimierung
Reaktionsbildung
Verleugnung
1.2.3 Psychosexuelle Entwicklung
Sexueller Missbrauch und das Verschweigen
Umgang mit ödipalen Themen
1.3 Bewältigung von Emotionen
1.3.1 Eintritt in die Schule
Kinder in der Förderklasse
1.3.2 Veränderung der emotionalen Bedeutung der Eltern
1.3.3 Trennung, Verlust und Tod
2
Latenzzeit: Entwicklung des Denkens und des Lernens
2.1 Entwicklungstheorie nach Freud
2.1.1 Sexuelle Neugierde als Wissbegierde
2.1.2 Drei Beispiele einer sexuellen Aufklärung
2.2 Entwicklungstheorie nach Klein und Bion
2.2.1 Melanie Klein
2.2.2 Wilfred Bion
2.3 Fallbeispiele aus der Latenz
2.3.1 Beispiel eines fehlenden Containment
2.3.2 Beispiel aus der pädagogischen Praxis
2.4 Organisationsformen des Denkens nach Piaget
2.4.1 Von der Intuition zum Beginn des logischen Denkens und der rationalen Operation
2.4.2 Vom egozentrischen Denken zum Bezug auf allgemeine Regeln
2.4.3 Vom impulsiven Verhalten zum Beginn des Überlegens
3
Latenzkinder in Therapie
3.1 Technik der Kinderanalyse in der Latenzzeit
3.2 Fallbeispiele aus Kindertherapien
3.2.1 Erstes Fallbeispiel: Naomi
3.2.2 Zweites Fallbeispiel: Ben
3.2.3 Drittes Fallbeispiel: Elfi
4
Die Bedeutung des Lesens in der Latenzphase
4.1 Harry Potter
4.2 Die Chroniken von Narnia
5
Ausblick und Perspektiven
Literatur
Stichwortverzeichnis
Personenverzeichnis
Luca, mein achtjähriger Enkel, hüpft neben mir her,
hält plötzlich inne und sagt:
»Oma, ich bin so glücklich, weil ich ich bin!«
Was mein Leben reicher macht, in:
Die Zeit 13.10.2011, 106
Einleitung
Die Lebensphase zwischen 6 und 11 Jahren bringt große Veränderungen mit sich. Aus dem Kleinkind wird ein Schulkind, das in einer neuen Gruppe im Rahmen des verpflichtenden Schulbesuchs seinen Platz finden muss. Es soll die Kulturtechniken erlernen und kann dann als lesendes und schreibendes Schulkind die Welt aus einer neuen Perspektive kennenlernen.
Es mag deshalb verwundern, dass die Psychoanalyse diese ereignisreiche Zeit so stiefmütterlich behandelt. Man sucht vergeblich nach relevanten Büchern über diese Lebensphase, die nach Freud die Latenzzeit genannt wird. Dieser Begriff hat allerdings kaum Eingang in die Alltagssprache gefunden. Die zwei Gründe dafür liegen vermutlich darin, dass erstens Freud annahm, dass der Grundstein der Persönlichkeitsentwicklung in den ersten sechs Lebensjahren gelegt werde, in der die geschlechtliche Kernidentität entwickelt und die Grundmuster der Persönlichkeit gelegt werden. Diese Grundmuster können wohl modifiziert werden, bleiben aber in der Tiefe erhalten. Der zweite Grund hängt mit Freuds Konzept der libidinösen Entwicklung zusammen. Nach den intensiven Jahren der ödipalen Wünsche und Konflikte treten nach dem Untergang des Ödipuskonflikts die libidinösen Wünsche in den Hintergrund, d. h. sie sind nur mehr latent vorhanden, bleiben im Hintergrund und zeigen sich nicht so deutlich. Erst in der Pubertät erwacht die Triebentwicklung erneut und erfährt einen stürmischen Ausbruch, der eine neue Gestaltung der psychischen Entwicklung erzwingt. Die Latenzphase verbindet diese beiden stürmischen Zeiten und steht daher nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Dieser Zeitpunkt der ruhigen Zeit, in der die libidinöse Entwicklung vermindert ist, wird in allen Gesellschaften gewählt, um den Eintritt in die Schule zu organisieren. Sie wird als Zeit der »Schulreife« bezeichnet. Kinder in dieser Altersstufe wenden ihr primäres Interesse nun nicht mehr auf ihren Körper und den ihrer Eltern, sondern auf die äußere Welt, die Schulfreunde, Lehrer. Sie wollen Wissen erwerben, das ihnen eine neue Form der Selbständigkeit ermöglicht. Sie beginnen den Weg in die Schule selbständig zurückzulegen, können Aufschriften und einfache Texte lesen und so selbständig Informationen aufnehmen. Deshalb spricht Freud von dem »Goldenen Zeitalter der Kindheit«, das für Eltern und Lehrer erfreulich und im Verhältnis zu der Kleinkindphase relativ arm an Konflikten ist. Das Schiff der kindlichen Entwicklung steuert nach den Stürmen der frühen Kindheit nun in relativ ruhige Gewässer. Die Kinder genießen es, mit den Eltern gemeinsam etwas zu unternehmen. Aktivitäten wie Wandern, Schwimmen, Bootfahren, Kinobesuche oder gemeinsames Musizieren stehen hoch im Kurs.
Erhalten bleiben die großen individuellen Unterschiede der Kinder, die ja schon ab der Geburt durch unterschiedliche Temperamente und das Hineingeborenwerden in eine bestimmte Familie in einem sozialen Kontext andere Ausgangslagen haben. In dieser Latenzphase zeigt sich, ob es den Eltern und ihren Kindern gelungen ist, eine überwiegend hilfreiche Basis der emotionalen Entwicklung zu legen. Unzureichend bewältigte innere Konflikte, die sich in Angst vor Monstern, Spinnen, Riesen oder Hunden gezeigt haben, können nun in den Hintergrund treten.
Kinder fühlen in unterschiedlicher Weise den Wunsch, sich von der Kleinkindphase zu verabschieden. Stefanie kann sich eine »letzte Puppe« wünschen, Sebastian nun eine »richtige« Anglerausrüstung, um sich auf die Anglerprüfung vorbereiten zu können. Erwünschte Dinge der früheren Zeit werden als »babyisch« verächtlich gemacht und abgelehnt.
1
Körper und Psyche in der Latenz
Photographie Karim Hadaya
1.1 Das Körper-Ich
Nach den ersten Jahren der dramatischen körperlichen Entwicklung erfolgt in der Latenz, die wir zwischen dem 6. und dem 12. Lebensjahr festsetzen, eine Zeit der emotionalen und körperlichen Stabilisierung. Aus dem Körper des Neugeborenen mit seinen beschränkten mimischen, visuellen, olfaktorischen Mitteln der Kontaktaufnahme ist in rasanten Schritten ein Baby geworden, das seine Hände über dem Körper berühren kann, das strampeln und seine Zehen festhalten und seinen Körper drehen kann. Begeistert reagieren Eltern auf die sich weiterentwickelnden körperlichen Fähigkeiten des Umdrehens, des Robbens, des Aufsetzens und dann des Aufstehens und Gehens ihres Kleinkindes. Wer das Wiedergehenlernen einer lang erkrankt gewesenen Person mitverfolgt, ahnt, wie schwierig es ist, die steifen Glieder wieder gelenkig und biegsam zu machen, das Gleichgewicht zu halten und wieder Gehen zu lernen. Ein Kleinkind entwickelt diese Fähigkeiten mit Leichtigkeit in einem spielerischen Ausprobieren – angetrieben von dem Wunsch zu wachsen. Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus und unterschiedliche Abläufe des Bewegens, Aufstehens und Gehens. Ein genaues Hinschauen eröffnet eine vielfältige Welt, wie wir das beim psychoanalytischen Beobachten im Kindergarten oder des Säuglings in seiner Familie systematisch beobachten, beschreiben und in seiner Aussagekraft für die Persönlichkeit des Kindes zu verstehen versuchen. (Vgl. Diem-Wille und Turner 2012)
Aus dem unsicher gehenden Kleinkind wird ein gelenkiges und vitales Kind, das seine zunehmende Mobilität und Geschicklichkeit lustvoll erprobt. Kinder im Alter bis 6 Jahre sind konstant in Bewegung, selten gehen sie, sondern sie hüpfen, laufen, springen, klettern – mit der, wie es Anna Freud genannt hat, »Funktionslust«, der Lust, seinen Körper unter Kontrolle zu haben. Das Sauberkeitstraining führt zu einer wichtigen Errungenschaft, die das Beherrschenkönnen des Schließmuskels umfasst. Zunächst ist das Hergeben der Körperprodukte ein Akt, der mit der Beziehung zur Mutter verbunden ist. Das Hergeben des Stuhls wird vom Kind mit einem Geschenk an die Mutter symbolisch verknüpft; kommt es zu einem Kampf zwischen Mutter und Kind, kann das Behaltenwollen zu schwierigen Situationen führen. Das Loslassen und Hergeben ist auch ein Schritt der Reife.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!