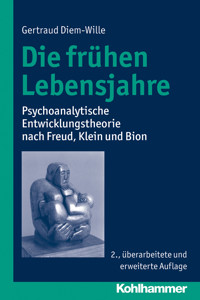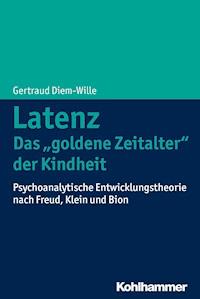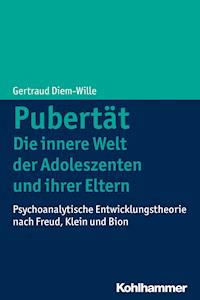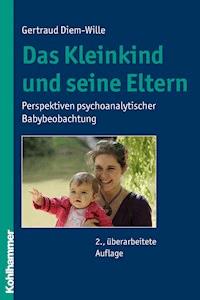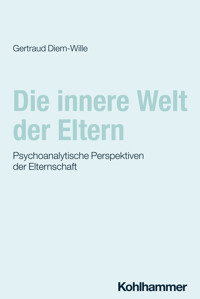
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses Werk behandelt die psychoanalytische Perspektive der Elternschaft - und damit die über Generationen weitergegebenen Beziehungsmuster, die in der inneren Welt der (werdenden) Mütter und Väter wirksam sind. Eigene Erfahrungen und Konflikte wirken sich entweder förderlich oder hemmend auf die Entwicklung der neuen Identität als Mutter oder Vater sowie den Beziehungsaufbau zum Baby aus. Anhand von Alltagsfamilien und Beispielen aus der Eltern-Kleinkind-Therapie werden die Bilder der "inneren Mutter" und des "inneren Vaters", die in den Eltern selbst angelegt sind, beschrieben. Zudem werden im Buch das Thema Schwangerschaft und die Beziehungsdynamiken bei besonderen Familienkonstellationen (z. B. Pflege- und Adoptionsfamilien) vorgestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
1 Elternschaft aus einer psychoanalytischen Perspektive
1.1 Die Bedeutung des Kindes für die Identität des Vaters
1.1.1 Fallbeispiel: Vater von Felice
1.1.2 Fallbeispiel: Vater von Kelly
1.2 Die Bedeutung des Kindes für die Identität als Mutter
1.2.1 Fallbeispiel: Mutter von Felice
1.2.2 Fallbeispiel: Mutter von Kelly
2 Schwangerschaft – Vorbereitung auf die Elternschaft
2.1 Kinderwunsch
2.2 Schwangerschaft als Thema der inneren Welt
2.3 Erleben der Schwangerschaft
2.4 Träume während der Schwangerschaft
2.4.1 Klinisches Fallbeispiel von Frau A.
2.5 Konflikthafte Schwangerschaft – Fehlgeburt
2.5.1 Konflikthafte Schwangerschaft ohne therapeutische Hilfe
2.5.2 Konflikthafte Schwangerschaft mit therapeutischer Hilfe
2.6 Fehlgeburt aus der Perspektive des Vaters
2.7 Schwangerschaft mit Hilfe von Reproduktionstechniken (AIH, AID, IVF)
2.8 Träume während einer IVF-Behandlung
3 Elternliebe – Elternhass
3.1 Mutterliebe – Mutterhass
3.2 Vaterliebe – Vaterhass
3.3 Entlastung der Eltern durch das Singen von Kinderliedern
3.4 Elternhass im Märchen und in der Mythologie
3.4.1 Elternhass in der Mythologie
3.4.2 Elternhass im Märchen
3.5 Besondere Ausgangssituationen
3.6 Abschließende Bemerkungen zum Kapitel
4 Besondere Familienkonstellationen
4.1 Parentifizierung – Umkehr der sozialen Rollen der Eltern und Kinder
4.2 Pflege- und Adoptionsfamilien
4.2.1 Fallbeispiel: Aus einem Pflegekind wird ein Vater
4.2.2 Fallbeispiel: Adoptivmutter – Adoptivtochter Aurica
4.2.3 Fallbeispiel: Frau P. mit den Adoptivkindern Alina und Leo
4.2.4 Fallbeispiel: Johanna – die alte Johanna
4.3 Patchwork-Familien – Stieffamilien
5 Eltern-Kleinkind-Therapie
5.1 Begriff der Eltern-Kleinkind Therapie
5.2 Fallbeispiele von Eltern-Kleinkind-Therapien
5.2.1 Fallbeispiel: Peter und sein Stiefvater
5.2.2 Fallbeispiel: Flora
6 Zur Bedeutung der Elternarbeit in Kindertherapien
6.1 Fallbeispiel: Die Therapie von Patrik und seinen Eltern
6.2 Fallbeispiel: Eltern von Mark (13 Jahre alt)
6.3 Fallbeispiel: Jonathan und seine Eltern
6.4 Fallbeispiel: Jana und ihre Eltern
7 Literatur
Stichwortverzeichnis
Die Autorin
Prof. i. R. Dr. Gertraud Diem-Wille ist Lehranalytikerin für Erwachsene, Kinder und Jugendliche der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung (WPV) und der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung (IPV). Sie ist in der Aus- und Weiterbildung von PsychotherapeutInnen und AnalytikerInnen tätig. Sie ist wissenschaftliche Co-Leiterin des Weiterbildungslehrgangs »Psychoanalytisch-orientierte Säuglings-, Kinder- und Jugendtherapie« an der Wiener Psychoanalytischen Akademie (WPA).
Gertraud Diem-Wille
Die innere Welt der Eltern
Psychoanalytische Perspektivender Elternschaft
Verlag W. Kohlhammer
Meinen ElternLeopoldine und Heinrich Willein Dankbarkeit
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2024
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-043223-9
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-043224-6epub: ISBN 978-3-17-043225-3
Vorwort
Die enorm große Bedeutung der Elternschaft für die Identitätsentwicklung der Frau und des Mannes ist sowohl alltagspraktisch nachvollziehbar als auch wissenschaftlich und klinisch belegt. Trotzdem wird der Bewusstseinszustand der Eltern in diesem krisenhaften Umgestaltungsprozess nur sehr wenig untersucht. Richards (1979, S. 41) spricht von »Lücken in der Entwicklungsforschung über die elterliche psychische Befindlichkeit« (übersetzt von GDW). Auch strukturell erfährt die Bezugseinheit der Paarbeziehung durch das Kind eine Erweiterung auf ein Drei- bzw. Mehr-Personen-System bzw. die Familie. Die Bedürfnisse der Paarbeziehung stehen oft im Widerspruch zu den Erfordernissen der Familie. Die Zeit und die Intimität des Paares wird besonders am Beginn der Familiengründung geringer, es entstehen neue Abhängigkeitsverhältnisse bezogen auf die Babybetreuung. Großeltern, Geschwister und Freunde erfüllen als Babysitter Aufgaben für die Familie. Die Umwandlung von einer Zweier- in eine Dreierbeziehung erfordert ein hohes Maß an Neustrukturierung und Neudefinition der jeweiligen Beziehung und erfordert so Fähigkeiten, die dabei entstehenden Konflikte auszutragen und zu verhandeln (Simon & Stierlin, 1984, S. 92). Bei konflikthaften Ehen kann die Geburt eines Kindes eine Entlastung bringen und daher stabilisierend wirken (Erikson, 1959; Lidz, 1974).
Die Elternschaft stellt trotz der großen physischen, psychischen und finanziellen Belastungen in allen Kulturen einen hohen Wert dar. Freud hat darauf hingewiesen, dass die Idealisierung der Kinder durch die Eltern die Reproduktion des eigenen längst aufgegebenen Narzissmus darstellt. (Freud 1914a, S. 57). Das Kind verkörpert die »Unsterblichkeit der Eltern«. Es soll die unausgesprochenen Wunschträume der Eltern erfüllen. Bettelheim betont, wie wichtig diese Idealisierung der Kinder für deren Selbstwertgefühl und Selbstachtung ist (Bettelheim, 1977). Die Freude, die die Eltern über die Existenz ihres Kindes haben, stellt die Quelle der späteren Selbstachtung des Kindes dar.
Aus psychoanalytischer Sicht stellt das Mutterwerden/Vaterwerden einen Kristallisationspunkt der radikalen Veränderung der inneren und der äußeren Welt dar. Tiefe Schichten der Persönlichkeit, die frühesten Erfahrungen – vermutlich schon die vor der Geburt erlebten Momente als Embryo – werden unbewusst wieder lebendig. Ich spreche daher von der Zeit der Schwangerschaft als einer »Umgestaltung der inneren Welt«, bei der wie bei der Formung eines Gebirges »tausendjährige Schichten nach oben gefaltet werden«, sodass »Relikte eines Meeres mitten im Festland des Wiener Beckens« zum Vorschein kommen. Alle Aspekte der Beziehung zur eigenen Mutter und zum eigenen Vater – nicht nur in der Gegenwart, sondern in den verschiedenen Entwicklungsphasen –, die realen und die phantasierten, werden aktiviert und neu geordnet. Es werden emotional die Seiten gewechselt – statt der Perspektive des Kindes muss sich die werdende Mutter und der werdende Vater nun als jemand sehen, der Verantwortung für ihr gemeinsames Kind übernimmt – oder wenn man sich dem nicht gewachsen fühlt, die Verantwortung verweigern. Jedenfalls muss eine Entscheidung getroffen werden.
All diese Fragen werden schon bei der Entscheidung, ein Kind zu bekommen, aktuell. Es geht daher in diesem Buch um die verschiedenen Perspektiven, sich mit einer möglichen oder unmöglichen Elternschaft auseinanderzusetzen. Der Gegensatz einer geplanten zu einer ungeplanten Elternschaft ist ebenso relevant, wie auch den Schmerz einer ungewollten Kinderlosigkeit zu ertragen, die Trauer um ein verlorenes Kind durch einen Schwangerschaftsabbruch oder einen spontanen Abortus. Frühe Entscheidungen bei einer durch Untersuchungen festgestellten Anomalie des Kindes oder eine Behinderung haben einen fundamentalen Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Vaters und der Mutter sowie auf die Paarbeziehung.
Der Schutz des (ehelichen) Kindes in einer Familie ist Teil der Menschenrechte. Die Gesetzgebung, die eine uneheliche Geburt regelt, ist abhängig von den politischen, religiösen und sozialen Gegebenheiten der jeweiligen Länder. Sie stellen den Rahmen dar, der für die psychische und emotionale Grundstimmung verantwortlich ist. Es wird daher notwendig sein, sich die enormen Veränderungen der Haltung zu einem ehelichen/unehelichen Kind vor Augen zu führen.
Das Buch beschäftigt sich mit Elternschaft als prinzipiellem Aspekt der Lebensgestaltung, d. h. die Entscheidung für oder gegen eine Elternschaft und deren Voraussetzung bzw. Auswirkung auf die Persönlichkeit sollen untersucht werden. Bleiben die Eltern zusammen, so übernehmen sie mindestens für zwei Jahrzehnte die gemeinsame Verantwortung für ihre Kinder, was eine große Herausforderung aber auch Entwicklungschance darstellt. Kommt es zu einer Trennung oder Scheidung, ist die Situation des alleinerziehenden Elternteils sowie der Kontakt zu dem getrenntlebenden Elternteil nicht nur für die Kinder, sondern auch für die beiden Eltern schmerzlich und erfordert eine psychische Trauer und einen Adoptionsprozess. Auch wenn ein Elternteil das Kind nicht mehr sehen darf oder will, bleibt die Elternschaft ein Leben lang bestehen, was meist zu bewussten oder unbewussten Schuldgefühlen führt, die oft verleugnet werden und dann zu depressiven Verstimmungen führen können. Neben der biologischen Elternschaft spielen auch verschiedene Formen der sozialen Elternschaft eine wichtige Rolle: Pflege- und Adoptionsfamilien sowie Patchworkfamilien stellen zum Beispiel besondere Ansprüche an alle betroffenen Personen. Es soll untersucht werden, welche Auswirkung die Übernahme solcher elterlicher Verantwortung auf die innere Welt der Eltern hat. Die Folge einer Kindesabnahme und die Art und Weise, wie diese durchgeführt wird, bzw. wie der weitere Kontakt zu den Kindern gestaltet wird, stellen psychoanalytisch relevante Fragestellungen dar.
Im zweiten Teil des Buches wird die besondere Situation der psychoanalytischen Arbeit mit Eltern in verschiedenen therapeutischen Settings beschrieben: die erste Hilfestellung in den frühen Lebensjahren bei dem in einer Eltern-Kleinkind-Therapie die Eltern mit dem Baby oder Kleinkind in einer Kurztherapie gesehen werden, um entstehende Probleme neu ordnen zu können, bevor sie sich zu massiven Störungen auswachsen. Die »Elternarbeit« mit Müttern und Väter, deren Kind in Psychotherapie oder Kinderanalyse ist, bedarf einer besonderen Darstellung, da sie als ein »zweites Patientensystem« besondere Aufmerksamkeit erfordert. Es hängt von den Eltern des Therapiekindes ab, ob eine Fortführung der Therapie möglich ist oder nicht.
Die Darstellung der Auswirkung der Elternschaft auf Väter und Mütter bezieht unterschiedliche empirische Daten ein. Wie Freud betont, haben Dichter und Denker psychoanalytische Zusammenhänge bereits erahnt und dargestellt, bevor Freud die bewussten und unbewussten psychischen Antriebskräfte erforschte. Es werden daher Beispiele aus der Literatur zur Illustration der Wechselwirkung zwischen der Entwicklung des Kindes und der Veränderung der Identität als Vater und Mutter herangezogen. Die im Rahmen eines Forschungsprojektes des Österreichischen Wissenschaftsfonds innerhalb der Follow-up-Studie zur Infant Observation an der Tavistock-Klinik durchgeführten Interviews mit Müttern und Vätern, deren Baby im ersten Lebensjahr von Studierenden beobachtet worden war, werden zum Thema ihrer Erfahrungen als Mutter und Vater angeführt (Diem-Wille, 1997).
In diesem klinischen Teil geht es um die Erfahrungen der Eltern im Rahmen von Eltern-Kleinkind-Therapien oder bei der begleitenden analytischen Arbeit mit Eltern während einer Kinderanalyse/Kindertherapie. In der Tradition von Freuds Herangehensweise, der von einer Einheit von Forschen und Heilen ausgeht, werden ausführliche Protokolle der therapeutischen Elterngespräche nachgezeichnet.1 Anhand dieser – aus der Erinnerung unmittelbar nach den Stunden rekonstruierten – wörtlichen Erzählungen der Eltern sowie der Deutungen der Analytikerin wird versucht, den Lesern das behutsame Heranführen an die emotionalen Verstrickungen der Eltern mit dem Kind näherzubringen. Ob eine Deutung »richtig« ist, bezieht sich nicht primär darauf, ob sie einen tatsächlichen Zusammenhang aufdeckt, sondern ob sie so gegeben werden, dass die Deutung zu einer Einsicht der Eltern führt. Es geht daher nicht nur um den Inhalt einer Deutung, sondern um die Wortwahl und den Zeitpunkt. So kann es hilfreich sein, die Eltern zu einem Verständnis der Handlung ihres Kindes hinzuführen, indem die Analytikerin sie fragt: »Wie können Sie das Verhalten ihres Kindes in dieser speziellen Situation verstehen?« Diese Frage führt eine neue Sichtweise ein, d. h. zum Beispiel über die Bedeutung eines Weinens, eines Wutausbruchs, einer trotzigen Reaktion des Kindes nachzudenken, statt diese einfach als »schlimm«, »ärgerlich« oder »frech« abzuwehren. Können die Eltern dann selbst den versteckten Sinn einer Handlung ihres Kindes verstehen, ist ein wichtiger Schritt der Bewusstmachung geschehen.
Bei der analytischen Arbeit mit Kindern und ihren Eltern geht es darum, die pathologischen Beziehungsmuster zu erkennen und durchzuarbeiten. Gelingt es, den Eltern ihren Anteil an der Symptomatik des Kindes bewusst zu machen, entsteht ein Freiraum, der vom Kind genützt werden kann. Die analytische Haltung der Therapeutin den Eltern gegenüber umfasst gleichzeitig zwei Ebenen, sie nicht nur als verantwortungsbewusste Eltern anzusprechen, sondern auch ihren »Baby-Teil«, den irrationalen, bedürftigen, archaischen – meist verdrängten – Teil im Blick zu haben und zu verstehen. Die emotionale Logik, die Verknüpfung in der freien Assoziation oder im Spiel des Kindes wird jeweils anschließend anhand des ausführlichen Stundenprotokolls diskutiert. Das klinische Material in der Verknüpfung mit der psychoanalytischen Theorie soll das Erforschen der jeweils einmaligen familiären Dynamik erleichtern. Die Symptome des Kindes, die die Psychoanalyse als Kommunikation über problematische, unbewältigte emotionale Verstrickungen versteht, können erst aufgegeben werden, wenn sie verstanden und besprochen wurden. Erst dann kann das Kind die Symptome (Bettnässen, Angst vor dem Kindergarten, Alpträume etc.) aufgeben, da sie verstanden wurden und dieser »Umweg« nicht mehr notwendig ist. Es ist wie ein Übersetzungsprozess von unbewussten durch Symptome ausgedrückten psychischen Schmerzen in direkte sprachliche Kommunikation. Kinder, denen in einer Therapie geholfen wurde, ihre Probleme zu verstehen, zeichnen sich durch einen rasanten Sprung in der sprachlichen Ausdrucksweise aus sowie durch ihre Fähigkeit, ihre Gefühle zu benennen und im kreativem Spiel auszudrücken.
Das »Entwirren« verwirrter transgenerativer Beziehungsmuster (wenn etwa von den Eltern im Kind der überstrenge Vater oder die zurückweisende Mutter gesehen wird), unter denen Eltern und Kinder leiden, schafft Freiraum zur Entwicklung für Eltern und Kinder. Durch das Sich-Hineinziehen-Lassen in die Übertragungs- Gegenübertragungsbeziehung empfindet die Analytikerin den psychischen Schmerz, die Hilflosigkeit, sadistische Lust, Verzweiflung oder Einsamkeit für kurze Momente, bevor diese Empfindungen mental verdaut als Deutungen den Patienten zur Verfügung gestellt werden können. Die ausführlichen Protokolle und die anschließenden Diskussionen stellen den Versuch dar, den Lesern Einblick in diesen dynamischen emotionalen Prozess zu gewähren. Die ungewöhnlich intimen Einblicke in den analytischen/therapeutischen Prozess verstehen sich als »Werkstattbericht«, um den Lesern einen emotionalen Zugang zum analytischen Prozess zu ermöglichen, statt aus einer distanzierten Beobachterrolle rasch Ergebnisse und Lösungen angeboten zu bekommen.
Endnoten
1Vorbilder einer detaillierten Wiedergabe einer Psychoanalyse stellen Kleins Darstellung einer Kinderanalyse (1975), die Beschreibung von Little Richard, Winnicotts The Piggle (1977), die Behandlung eines kleinen Mädchens sowie Parkers Meine Sprache bin ich. Modell einer Psychotherapie (1970) dar.
1 Elternschaft aus einer psychoanalytischen Perspektive
Es gibt eine Vielzahl von Elternratgebern, in denen versucht wird, Eltern Ratschläge für die Erziehung ihrer Kinder zu geben. Die Ausrichtung dieser Empfehlungen geht entweder von einer tendenziell typologisch autoritären Haltung aus, die die Durchsetzung des Willens der Eltern und den Gehorsam des Kindes zum Ziel hat, oder einer demokratischen, kooperativen Erziehung oder – als drittem Pol – einer antiautoritären Erziehung, bei der die Wünsche des Kindes erfüllt werden sollen, um seine Entfaltung und Kreativität zu fördern. Meist führt der Mangel an klaren Grenzen und Konsequenz zu einer Verunsicherung des Kindes. Dabei steht jeweils die äußere Realität im Mittelpunkt. Die Ratschläge beziehen sich auf das, was die Eltern tun sollen, um ein gewisses Verhalten des Kindes zu erreichen.
Was jedoch bedeutet eine psychoanalytische Perspektive der Elternschaft? Im Zentrum steht das Verstehen der Beziehung zwischen Eltern und Kind, und zwar in zwei getrennten, aber aufeinander bezogenen Welten – der realen äußeren Welt und der realen, inneren Welt der Fantasie, der Gefühle der Imagination von Eltern und Kind. Wir gehen von der Annahme aus, dass die innere Welt des Kindes mit den Repräsentanzen von Selbst-mit-Mutter-, Selbst-mit-Vater- und Selbst-mit-Elternpaar-Introjektionen der äußeren und inneren Erlebniswelten bevölkert ist, die als »innere Objekte« miteinander in Beziehung treten (Winnicott, 1978). Umgangssprachlich ausgedrückt heißt das, dass das Kind gleichsam durch die Brille seiner Gefühle, Ängste, Stimmungen die Erfahrungen mit den Eltern in sich, in seine innere Welt aufnimmt. Elternbilder, die »inneren Eltern«, sind daher nie Eins-zu-eins-Abbildungen der realen Eltern, sondern immer positiv oder negativ verzerrt. So kann ein Patient erst nach mehrjähriger Analyse einige positive Erinnerungen an seinen zunächst nur als kalt und ablehnend beschriebenen Vater entdecken. Aus den unterschiedlichen Lebensphasen lagern unterschiedliche Bilder (»Imagines«) der Eltern in der inneren Welt übereinander. Die wechselseitige Beeinflussung kann konstruktiv oder pathologisch sein und auch in einer mehrgenerativen Linie Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Kindes haben. Auf der Seite der Eltern ist die Entwicklung einer tragfähigen Beziehung davon abhängig, ob in der Mutter und dem Vater ein innerer Raum zur Verfügung steht, in dem dieser Elternteil über sein Baby/Kind nachdenken und es auch bei physischer Abwesenheit gedanklich mit den Eltern in Verbindung bleiben kann. Dann fühlt sich das Kind in Verbindung mit der Mutter/dem Vater, angenommen und verstanden. Ist die Mutter oder der Vater von ängstigenden oder verfolgenden Gedanken okkupiert, wie das etwa in einer postpartalen Depression der Fall ist, so ist sie/er nur physisch anwesend und emotional nicht für das Kind erreichbar. »Nur deine leere Hülle war bei uns, deine Seele war weg« beschreibt der Nobelpreisträger Liaou Yiwu (2013) diese Form des sich Verlassenfühlens eines Kindes. André Green (1993) spricht von der »toten Mutter«, die gleichzeitig physisch anwesend und geistig abwesend ist. Es wird später ausführlich auf das Konzept »Container und Contained« von Wilfred Bion eingegangen, der diese Form einer denkend-fühlenden Beziehung differenziert beschreibt. Es gibt keine lineare Beeinflussung, sondern eine aufeinander bezogene Wechselwirkung: Das Kind mit seinem besonderen Temperament beeinflusst und formt die Psyche der Eltern, wir sprechen von einer Identitätsentwicklung durch die Erfahrungen als Eltern, die sich um ihr Baby kümmern und sorgen. Elternschaft bedeutet eine lebenslange, nichtlineare Entwicklung der Person, die verschiedene Transformationen abhängig vom Alter des/der Kinder erfordert. Erfordern die ersten Lebensjahre des Säuglings eine besonders enge Beziehung, ist diese dann für die Latenz oder Pubertät kontraproduktiv, da das Kind oder der Jugendliche eine größere Unabhängigkeit benötigt, um selbständig werden zu können. Auch die spätere Fähigkeit, Großvater und Großmutter für die nächste Generation zu werden, ist nur durch eine Elternschaft eröffnet. Einen Enkel zu bekommen, kann ein großes Geschenk für die Großeltern darstellen. Isca Salzberger-Wittenberg meint, dass wir durch unsere Kinder »ein Verbindungsglied zwischen der vergangenen und der zukünftigen Generation sind..., dass ein Teil von uns in einer Zukunft jenseits unseres Lebenszyklus erhalten bleibt und so unsterblich ist« (Salzberger-Wittenberg 2019, S. 105). Es geht um die Fähigkeit etwas zu schaffen, zu umsorgen, zu schützen, zu nähren, zu lieben, zu respektieren und daran Freude zu empfinden« (Novick & Novick 2009, S. 31).
Das erste Mal Vater oder Mutter zu werden, stellt immer eine gewaltige psychische und physische Herausforderung dar, bei der diese wesentlich auf Unterstützungssysteme angewiesen sind. Wenn die Eltern von der Möglichkeit Gebrauch machen, »die seelischen Folgen der Elternschaft zu bedenken und zu erforschen, ... ist die Elternschaft entwicklungsförderlich« (Bründel et al., 2016). Diese seelischen Transformationen können mit bildgebenden Verfahren als tiefgreifende Veränderungen im Gehirn gezeigt werden (Ammaniti & Gallese 2014). Erik Erikson bezeichnet die siebte Stufe der psychosozialen Identitätsentwicklung im Lebenszyklus als »Generativität gegen Stagnierung«, wobei er die Elternschaft als »wesentliches Stadium der gesunden Persönlichkeitsentwicklung« bezeichnet (Erikson 1974, S. 118). Entfällt diese Erfahrung der schöpferischen Leistung, gemeinsam Kinder zu zeugen und aufzuziehen, so besteht die Gefahr einer Regression auf eine »Pseudointimität«, und sich selbst als Kind zu verwöhnen« (ebd.). Gemeinsam ein neues Lebewesen hervorzubringen, das als Produkt der Liebe erlebt wird, bei dem biologisch und psychisch beide Elternteile verschmelzen, kann als der Inbegriff der Kreativität des ödipalen Paares gesehen werden. Jeder kann im Kind Teile von sich und seinen Vorfahren und Teile, Ähnlichkeiten des geliebten Partners und seiner Familie erkennen und lieben.
Aspekte einer elterlichen Fürsorge können auch von Pflege- und Adoptiveltern sowie Angehörigen von Berufsgruppen, die sich durch soziales Engagement auszeichnen, wie Psychotherapeuten oder Sozialarbeiter erlebt werden, wobei aber die tiefgreifende Identitätsentwicklung (ins Positive oder Negative) und der Zwang, die Interessen eines anderen Wesens als gleichwertig zu sehen, in geringerem Maß gegeben sind.
Wir gehen mit Freud von der Annahme aus, dass das Unbewusste und alle Erfahrungen im Leben Eingang in die innere Welt gefunden haben: die Art und Weise, wie wir uns selbst, den anderen und die Welt wahrnehmen, uns bestimmen. Zwischen dem Säugling/Kind und seinen Eltern werden Informationen auf zwei Ebenen ausgetauscht: auf der bewussten Ebene durch Sprache und Handlungen und auf der unbewussten Ebene durch Intonation beim Sprechen, Kommunikationsformen allgemein, Art der Wahrnehmung und Verzerrung von idealisierten oder verfolgenden Qualitäten sowie mimischen Ausdrucksformen, die wir unbewusst sehr genau registrieren.
Freud geht davon aus, dass die Bedeutung des Unbewussten 80 % unserer Handlungen und Wahrnehmungen beeinflusst. Er vergleicht das Verhältnis von Bewusstem und Unbewusstem mit dem Verhältnis des sichtbaren Teils des Eisbergs mit dem viel größeren Teil, der sich unter der Wasseroberfläche befindet.
Zur Illustration der Auswirkung unbewusster Konflikte der Mutter auf ihren Umgang mit dem Kind, gebe ich ein Beispiel aus dem Alltag, das einen Idealtypus einer ambivalenten und einer zureichend-guten mütterlichen Haltung zeigt. Zwei dreijährige Kinder spielen auf dem Kinderspielplatz in Anwesenheit ihrer Mütter.
Kind A steigt die Treppe zur Rutsche hinauf, setzt sich flott hin, blickt kurz herum und rutscht mit viel Freude herunter. Die Mutter hat dem Kind einen freundlichen Blick zugeworfen, genickt und ist dann wieder zu ihrer Lektüre zurückgekehrt.
Kind B wird von seiner Mutter zur Rutsche begleitet. Halb steigt es hinauf, halb hilft die Mutter nach, setzt das Kind hin, läuft rasch nach vorne, um das Kind unten auffangen zu können. Gemeinsam gehen sie mehrere Male zurück und wiederholen das Hinaufsteigen und Rutschen.
Ein Beobachter könnte zu dem Schluss kommen, dass die Mutter von Kind A dem Kind kaum Beachtung schenkt, selbst mit ihrem Buch beschäftigt ist und sich bei dieser »gefährlichen« Aktion nicht wirklich gut um ihr Kind kümmert. Es kommt auch manchmal vor, dass eine andere Mutter sich aufregt und alarmiert darauf aufmerksam macht, dass ihr Kind »ganz allein« auf die Stufen der Rutsche hinaufgeklettert sei.
Ein Beobachter des Kindes B könnte zu der Ansicht kommen, dass die Mutter von Kind B eine äußerst liebevolle und aufmerksame Mutter ist, die sich vorbildlich um ihr Kind kümmert und ihre eigenen egoistischen Interessen hintanstellt.
Betrachten wir diese beiden Sequenzen aus einer psychoanalytischen Perspektive so interessiert uns, welche Vermutungen wir über die Beziehung der jeweiligen Mutter zu ihrem Kind anstellen können und welche Auswirkungen und Entwicklungschancen beim Kind erwartet werden können. In der Terminologie der Bindungstheorie nach John Bowlby und Mary Ainsworth geht es um die Qualität der emotionalen Bindung zwischen Mutter und Kind. (Bowlby, 2014; Ainsworth, 1978; Brisch, 2014).
Die Mutter von Kind A traut ihrem Kind zu, dass es nur dort hinaufklettert, wo es auch wieder allein herunterkommen kann. Sie vergewissert sich durch kurze Blicke, was ihr Kind macht und ob alles in Ordnung ist. Der kurze Blick des Kindes zur Mutter zeigt dessen Stolz, es allein geschafft, ein Hindernis überwunden zu haben. Die Freude beim Herunterrutschen drückt sein Selbstbewusstsein und seine Zuversicht aus, die Welt lustvoll zu meistern. Es wird vermutlich weitere Bereiche der Welt erforschen und seine Geschicklichkeit erproben.
Tatsächlich klettern kleine Kinder, die allein in einem kindgerechten Rahmen sind, nur so weit auf Gegenstände hinauf, wie sie sicher sind, wieder zurückzukönnen. Die Bewegungsobjekte von Emmi Pikler (2018), der ungarischen Kinderärztin und Pädagogin, stellen – ähnlich wie bei Montessori – Spielsachen und Klettergegenstände für Kinder dar, um selbst die Welt erforschen und zu erproben – wenn sie nicht von ehrgeizigen Eltern gepusht werden. Lass mir Zeit (2018) heißt eines ihrer wichtigen Bücher.
Die Mutter von Kind B stellt sich zwischen ihr Kind und die Welt. Nur mit ihrer Hilfe und Vermittlung kann das Kind die Treppe zur Rutsche hinaufsteigen und dann herunterrutschen. Es mag sogar sein, dass es dann, wenn es unbeobachtet ist, allein versucht und herunterfällt oder durch Zeichen der Mutter mitteilt, dass es hinaufgehoben werden will. Kind B erhält immer wieder die Botschaft »Du kannst es nicht allein! Du brauchst mich«. Und tatsächlich erlebt es immer wieder, dass es die Mutter braucht und kann keine Zuversicht entwickeln, es selbst, allein zu schaffen. Für Mutter B ist es äußerst anstrengend, dauernd diese Hilfsfunktion für ihr Kind ausüben zu müssen. Sie ist erschöpft und braucht viel Geduld und fühlt sich vermutlich oft überfordert.
Stellen wir Vermutungen über die Beschaffenheit der inneren Welt von Mutter A und Mutter B an: Die Mutter von Kind A scheint eine gute, stabile Beziehung zu ihrem Kind und Zutrauen zu sich als Mutter zu haben. Sie traut dem Kind zu, selbständig unter ihrer Aufmerksamkeit seinen Körper und seine Mobilität zu erproben und die Welt Stück für Stück neugierig zu erforschen. Falls das Kind A stolpert, steht es meist allein wieder auf und versucht es noch einmal – gute Voraussetzungen zur Entwicklung von Resilienz, Durchhaltevermögen und Ausdauer. Die Mutter A ist sich vermutlich ihrer ambivalenten Gefühle dem Kind gegenüber bewusst, weiß, dass sie es liebt, aber kann sich auch eingestehen, dass sie oft ärgerlich ist, sich manchmal überfordert fühlt und sich manchmal nach der Zeit mit ihrem Mann ohne Kinder sehnt. Sie weiß, dass sie als Mutter nicht perfekt ist und ist zufrieden, wie sie sich als Mutter und ihr Kind sich entwickelt. Sie kann sich auch Zeit für sich und gemeinsame Zeit mit ihrem Mann organisieren, da sie verschiedene Formen der Unterstützung (durch Großeltern, Freunde, Babysitter) annehmen kann.
Die Mutter von Kind B versucht vermutlich, eine perfekte Mutter zu sein, ihre Bedürfnisse denen des Kindes unterzuordnen, alles für ihr Kind zu machen. Hinter dieser ununterbrochenen Sorge um das Wohlbefinden ihres Kindes kann leicht eine geringe bis massive unbewusste Aggression und Ablehnung verborgen sein, die sie sich nicht einzugestehen traut. Es kann sein, dass durch eine schwere Geburt ein unbewusster Groll auf das Kind vorhanden ist, den sie sich nicht einzugestehen wagt. Es kann sein, dass sie denkt, sie müsse ununterbrochen für ihr Kind da sein. Es kann sein, dass sie es ganz anders als ihre berufstätige Mutter machen will, die sie früh in die Kinderkrippe gegeben und sie sich von dieser abgeschoben gefühlt hat. Es fällt ihr schwer, sich vom Kind auch nur für kurze Zeit zu trennen, um mit ihrem Mann gemeinsam ungestört zusammen sein zu können. Es kann sein, dass sie in der engen Beziehung zum Kind einen Ersatz für die fehlende emotionale/sexuelle Nähe zu ihrem Mann sucht. Es können höchst unterschiedliche Erfahrungen und Konflikte dahinterstehen, die eine kurze emotionale Trennung vom Kind, die seine Individualisierung fördern würde, behindert. Jedenfalls ist anzunehmen, dass die Beziehung zum Kind ambivalent und belastet ist. Durch die permanente Überforderung kann die Frustration und Unsicherheit der Mutter vermehrt werden. Kommen dann noch Entwicklungsverzögerungen beim Kind, Trotz oder Schlafprobleme dazu, so kann daraus rasch eine Verschärfung der Problematik entstehen.
Wenn wir von einer psychoanalytischen Perspektive sprechen, möge die Leserschaft vermutlich an pathologische, krankhafte Aspekte der Eltern denken. Sie meint jedoch das Einbeziehen der unbewussten Dimension der Person. »Normal« heißt nicht ohne Probleme, ohne Konflikte, ohne Projektionen oder ohne Abwehrmechanismen zu sein. Ganz im Gegenteil hat Freud gezeigt, dass es keine scharfe Grenze zwischen normal und krank, von gesund und pathologisch gibt. Wir sprechen vom alltäglichen Menschen als »Alltagsneurotiker«. Es gibt eine große Bandbreite des normalen »Alltagsneurotikers«. Der Unterschied auf diesem Spektrum zwischen normal und pathologisch besteht darin, wie massiv oder milde die Reaktionen sind, ob wir zwischen Fantasie und Realität unterscheiden können und über uns und unser Verhalten nachdenken können. Alle negativen Aspekte wie Neid, Konkurrenz, Rivalität oder Wünsche nach Bewundertwerden können in milder Form verwirklicht werden oder müssen verdrängt werden und äußern sich in psychischen Problemen wie depressiven Verstimmungen oder werden über den Körper durch psychosomatische Probleme (hoher Blutdruck, Migräne, Magengeschwüre etc.) ausgedrückt (McDougall, 1989). Die klinischen Beispiele sollen die Leser anregen, über die Kommunikation des Unbewussten in den Interaktionen von Eltern und Kindern nachzudenken, um zu verstehen, wie für jeden Menschen die Qualität seiner frühen Beziehung das Fundament für den einzigartigen Charakter seiner Erfahrung von sich und der Welt legt.
Bei der Beschreibung der inneren Welt der Eltern mag eine ähnliche Fehleinschätzung und Erwartung vorhanden sein – so als ob es eine perfekte Mutter oder einen perfekten Vater geben könnte. Jede Mutter und jeder Vater bringt ihre bzw. seine Persönlichkeit in diesen neuen Lebensabschnitt mit. Wir sprechen zwar davon, dass die Elternschaft eine Identitätsveränderung mit sich bringt, doch werden durch Schwangerschaft, Geburt und das neue Lebenswesen unbewusste Ebenen der Person, die bereichernden und belastenden Erfahrungen der vorhergehenden Generation lebendig. Wie bei der Faltung eines Gebirges bringt das neue Lebewesen in den Eltern tiefe frühere Gefühls- und Erlebensweisen an die Oberfläche. Die Psychoanalyse hat uns durch die klinischen Erfahrungen gezeigt, dass die psychische Realität ebenso bedeutend für die Entwicklung des Säuglings und Kindes ist wie die realen sozialen und ökonomischen Lebensumstände. Traumatische, verdrängte und nicht betrauerte Erfahrungen der Eltern und Großeltern können dann als »Geister im Kinderzimmer«, wie Selma Fraiberg dieses Phänomen genannt hat, wirken und eine Belastung für die Familie darstellen. Ebenso können das Meistern von hoffnungslosen Situationen, Resilienz und Hoffnung der früheren Generation eine Bereicherung für das neue Lebewesen darstellen. Die Fantasien, Hoffnungen, Ängste und Träume, die Erinnerungen an die eigene Kindheit, elterliche Vorbilder und Erwartungen beeinflussen die Entwicklung des Säuglings – sowohl die Wahrnehmung des Babys als auch die Art und Weise, wie die Mutter und der Vater mit dem Baby sprechen und es anfassen. Der innere Raum der Mutter, wie die Eltern über ihr Kind nachdenken und sich vom Baby emotional berühren lassen, ermöglicht das Entstehen einer emotionalen Beziehung, eines emotionalen Bandes (»Bonding«, Bowlby), eines Kontakts (»Linking«, Bion).
1.1 Die Bedeutung des Kindes für die Identität des Vaters
Die Elternschaft stellt für den Vater eine gravierende Veränderung dar, die seine Identität sowie seine Bedeutung in der Familie radikal ändert. Schon während der Schwangerschaft seiner Frau/Partnerin werden unbewusste, unerledigte Erfahrungen und Konflikte den eigenen Eltern gegenüber aktiviert. Der Übergang von Mannsein auf Vatersein stellt sowohl eine Krise als auch eine Chance und Herausforderung dar. Die Beziehung zu seiner Partnerin/Frau verändert sich, wenn sie Mutter wird. Aus einer Zweierbeziehung wird eine Dreierbeziehung. Bei der Geburt eines zweiten Kindes wird aus der Dreiergruppe eine wirkliche Familie, bei der das Kind nicht mehr an den Rhythmus des Paares angepasst werden kann, sondern den Bedürfnissen der Kinder ein größerer Raum eingeräumt werden muss. Wie gut ein Mann diese Umstellung auf eine Dreierbeziehung schafft, hängt von seiner emotionalen Reife, seiner emotionalen Ausgeglichenheit, seiner Konfliktfähigkeit sowie seiner Fähigkeit ab, sich selbst und andere zu verstehen.
Die Situation des Mannes, der Vater wird, ist in der gegenwärtigen Zeit in Europa und in den USA eine besonders schwierige. Traditionell stellte die Unterstützung der Frau in der Zeit vor und nach der Geburt durch Großeltern, Schwestern oder Freundinnen eine Matrix der mütterlichen und weiblichen Unterstützung dar. Durch die Mobilität der Gesellschaft, der Berufstätigkeit der Frauen, d. h. nicht nur der werdenden Mutter, sondern auch der werdenden Großmutter, können gebärende Frauen und junge Mütter oft nicht mehr auf ein unterstützendes und tragfähiges soziales Bezugssystem zurückgreifen, auf ein »Supportsystem«, das die Unsicherheit der neuen Anforderungen als Mutter mildert. Stern beschreibt diese Situation folgendermaßen: »Die weitgehend verschwundene funktionale Großfamilie, die der Mutter beistehen konnte, wurde durch keine anderen sozialen Einheiten ersetzt, ganz sicher nicht durch die Strukturen der medizinischen Versorgung und des Gesundheitssystems. Somit stehen der Ehemann und das Paar unter einem wachsenden Druck, sich die notwendige stützende Matrix allein zu schaffen – eine fast unmögliche Aufgabe« (Stern, 1998, S. 216).
Dabei geht es um zwei zentrale Aufgaben:
1.
Die Mutter körperlich zu schützen, sie von den alltäglichen Anforderungen der Lebensorganisation zu entlasten, ihre vitalen Bedürfnisse zu befriedigen und sie von der äußeren Realität abzuschirmen. Diese Entlastung ermöglicht es der Mutter, sich »nur um das Baby und um sich« zu kümmern.
2.
Die zweite Unterstützungsebene bezieht sich auf eine psychologische und pädagogische Ebene. Der Mutter emotionalen Halt und Anerkennung zu geben sowie ihr in Hinblick auf die Versorgung des Neugeborenen Anleitung und Erfahrung zur Verfügung zu stellen.
Männer sind gefordert, diese Lücke zu schließen. Einerseits kommt von Vätern der Wunsch, von der Geburt und Betreuung des Babys nicht mehr ausgeschlossen zu sein, bei der Geburt dabei und eng mit der Betreuung verbunden zu sein. Andererseits gilt es auch, die Lücke zu schließen, die durch oft in großer Entfernung lebende Großmütter oder berufstätige Großeltern entsteht. Der hohe Anteil von geschiedenen Großeltern macht die Unterstützung der neuen Familie oft noch schwieriger. Die Forderung nach einem »Papamonat« oder einer zeitlichen Entlastung von Eltern in den ersten vier Lebensjahren, wie es in vielen Ländern diskutiert wird, würde einen gesellschaftlichen Rahmen zur Wahrnehmung der Unterstützung durch die Väter darstellen.
Traditionell und von der Psychoanalyse in ihrer Bedeutung betont, war und ist die Aufgabe des Vaters, für das Mutter-Kind-Paar einen sicheren emotionalen Container zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig ist der Vater als Dritter wichtig, um nach und nach die enge Verbindung zwischen Mutter und Baby zu erweitern, um die Paarbeziehung zu stärken, d. h. der Vater ist auch derjenige, der darauf achtet, dass die Beziehung zwischen ihm und seiner Frau, das »ödipale Paar«, durch dessen Zusammenkommen das Baby gezeugt wurde, zu stärken. Der Mann vermittelt seiner Frau/Partnerin, dass diese Einheit die Basis der Familie ist. In Eltern-Kleinkind-Therapien schätzen wir den Einfluss des Vaters, der seiner Frau vermittelt, dass eine gewisse Trennung vom Baby notwendig ist, um dem Baby seine eigene Persönlichkeit erlebbar zu machen. Oft ist es für die Mutter nicht leicht, das Baby für kurze Zeitabschnitte loszulassen, sich Zeit für sich und auch Zeit für die Partnerschaft zu nehmen. Manche Familien berichten, dass sie seit der Geburt des Kindes immer zu dritt waren, oder die Mutter und das Baby sich nicht getrennt hätten. Die Frage der Therapeutin »Wann haben sie Zeit zu zweit verbracht?« wird vom Paar wie eine Erlaubnis verstanden, auch als Paar Zeit ohne das Baby verbringen zu dürfen.
Aus psychoanalytischer Sicht ist jedoch zu bedenken, dass sich die Väter ebenso wie die Mütter in einer inneren Umbruchsituation befinden, in der frühe Erlebnisse, kindliche Bedürfnisse nach Schutz und Geborgenheit aktiviert werden, sie ebenfalls sehr bedürftig erscheinen. Hat der Mann noch keine Erfahrungen mit der Versorgung und Betreuung eines kleinen Babys gemacht, so wird er die Aufgabe der Anleitung und Ermutigung nur schwer wahrnehmen können. Es bleibt daher wichtig, im Auge zu behalten, dass es für die gesamte Familie, d. h. auch den Vater, ein weibliches, mütterliches Netzwerk bereitzustellen gilt, um Hilfestellungen zur Verfügung zu stellen. Das können Hebammen, Stillgruppen, Tanten und Schwestern oder aber bezahlte Babysitter, Au-Pair Mädchen, Familienberaterinnen sein.
Die Geburt des Kindes stellt eine Krise und einen Einschnitt im Leben des Mannes dar. Der Geburtsvorgang birgt trotz aller modernen medizinischen Technologien ein großes Risiko für das Leben und die Gesundheit der Mutter und des Neugeborenen. Seit ca. 20 – 30 Jahren werden in Europa und in den USA die Väter routinemäßig eingeladen, bei der Geburt auch im Kreißsaal dabei zu sein. Die Brutalität des Geburtsvorgangs, der archäische Vorgang des Herauspressens des Babys aus der Gebärmutter stellt auch für viele Medizinstudenten ein erschreckendes Erlebnis dar. Väter, die üblicherweise wenig Erfahrungen mit diesen medizinischen Vorgängen haben können, werden von dem Geburtsprozess sehr unter Druck gesetzt. Das neue Familienmitglied stellt unbewusst auch einen Rivalen dar, der die frühere Geschwisterrivalität wieder aktualisieren kann.
Es ist unvorstellbar, welche Bedürfnisse ein Neugeborenes hat, bis es tatsächlich geboren wird, gefüttert, gepflegt und niedergelegt werden muss – und das sieben Tage in der Woche ohne Wochenendpause. Auch welche Anforderungen an die Mutter und den Vater gestellt werden, kann nicht antizipiert werden. Von »modernen« neuen Vätern wird erwartet, dass sie die Fürsorge für das Neugeborene mit der Mutter teilen. Trotzdem ist die Situation des Vaters ganz anders, da er nicht wie die Mutter das Baby bereits neun Monate in seinem Körper getragen hat, eng verwoben mit dem Größerwerden und der Entwicklung ist, seine Bewegungen gespürt hat und daher auch die Existenz des Babys noch keinen zentralen Platz in seinen Gedanken hatte. Für die Mutter, deren Körper durch das Wachstum des Embryos in allen Dimensionen verändert wird, ist es Teil von sich, auch wenn es als eigene Persönlichkeit psychischen Raum einnimmt.
Bei vielen werdenden Vätern entsteht eine geschwisterähnliche Rivalität mit der werdenden Mutter, was sich z. B. daran zeigt, dass sie psychosomatische Reaktionen zeigen, zunehmen, um einen ebenso wachsenden Bauch zu entwickeln etc. Der schwangere Körper der Frau ist eine neue Erfahrung, die sein sexuelles Begehren stimulieren oder vermindern kann. Es besteht eine Tendenz, dass die Väter eher keine Zeit allein mit dem neugeborenen Baby verbringen, aus Angst, es fallen zu lassen oder dessen Bedürfnisse nicht erfüllen zu können. Wenn sie allein mit dem Baby sind, tendieren sie später dazu, wildere Spiele und Bewegungen mit dem Baby auszuführen, auch schon relativ kleine Babys in die Luft zu werfen und sie wieder aufzufangen – vermutlich ein Ventil ihrer meist unbewussten Rivalität und Eifersucht, die aber von Babys durchaus lustvoll erlebt werden können. Garstick (2013, S. 44) spricht von einer »Gefahr der Überforderung der Männer«, wenn sie diese Matrix, dieses komplexe Unterstützungssystem für Frauen aufbauen sollen. Es hängt dann davon ab, ob der werdende Vater ein inneres Modell hat, mit dem er sich identifizieren kann. Findet er in der Gegenwart Bestätigung durch andere Männer und Väter, die ihn ermutigen und seine Leistung anerkennen? Kann die Frau Dankbarkeit für sein Engagement zeigen?
Mit einem Neugeborenen zu Hause ist der Vater nicht mehr die Nummer eins im Haus; das Baby (»his/her majesty the baby«) ist wie ein neues Geschwisterchen. Gedanken an seine eigene Kindheit und seine Eltern tauchen auf. Das Modell, wie sich ein Vater zum Kind verhält, wird von den Erfahrungen, die er als Kind mit seinem Vater gemacht hat, bewusst und unbewusst beeinflusst. Auch wenn sich der Vater vornimmt und plant, ein anderer Vater zu seiner Tochter oder zu seinem Sohn zu sein, hat er das Modell seines Vaters so sehr verinnerlicht, dass sich dieses oft auch gegen die bewussten Überlegungen durchsetzen wird. Die neue Aufgabe erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit aktuellen Zielsetzungen, aufsteigenden Rivalitätsgefühlen, sowie einer neuen Positionierung im System der Familie.
Zur Illustration der Anforderungen und Chancen der Elternschaft, die durch die Transformation der inneren Welt während der Schwangerschaft und nach der Geburt des Kindes in dem neuen Vater und der neuen Mutter entstehen, werden nachfolgend Interviews mit zwei Vätern über ihre Erfahrungen beschrieben.
In narrativen Interviews wurden Eltern, deren Baby in einer psychoanalytisch orientierten Babybeobachtung teilgenommen hatte, befragt. Es ging um die Bedeutung der Elternschaft für sie, die veränderte Beziehung zum anderen Elternteil und um ihr neues Selbstverständnis.2
Studierende, die eine psychotherapeutische Ausbildung machen, beobachteten für zwei Jahre die Entwicklung eines Kindes von der Geburt bis zum Ende des zweiten Lebensjahres. Dazu wurden Eltern, die ein Baby bekamen, gefragt, ob sie einer einstündigen Beobachtung einmal die Woche für den Zeitraum von zwei Jahren zustimmen. Als Eltern wurden keine Problemfamilien gewählt, sondern normale, durchschnittliche Familien. Das Hauptaugenmerk wurde auf die Entwicklung der inneren Welt des Babys gelegt, wie es durch die Interaktion mit den Eltern, die vielfältigen Einflüsse der Umgebung seine Persönlichkeit entwickelt. Die Familien waren sehr unterschiedlich: Es konnte das erste Baby oder eines mit älteren Geschwistern sein; die Eltern können sich das Baby gewünscht haben oder von der Schwangerschaft überrascht worden sein. Es sollte aus Erfahrung gelernt werden, wie groß das Spektrum der »Normalität« der kindlichen Entwicklung ist. Gleichzeitig richtete die beobachtende Person ihre Aufmerksamkeit auch nach innen, als »innere/r Beobachter/in«, der/die die eigenen Gefühle, Wünsche, Ängste und Erinnerungen, die beim Zusehen wieder lebendig werden, registrierte. Für die spätere Arbeit als Psychotherapeut ist diese Ebene sehr wichtig, um die eigenen Gefühle zu registrieren, und unterscheiden zu lernen, was durch die Interaktion in der Familie erlebt wird (in den Beobachter projiziert wird) und was aus der eigenen Biografie stammt (Miller et al., 1989; Diem-Wille, 2009).
1.1.1 Fallbeispiel: Vater von Felice
Das Interview fand im Wohnzimmer der Familie statt. Da der Vater während der Beobachtungen nicht anwesend gewesen war, stellt die Mutter ihm die Interviewerin vor.
Matty, wie er im Interview genannt wird, ist ein 35-jähriger, sportlicher Mann, der aus der Karibik stammt. Er arbeitet als Automechaniker in London. Er ist im Alter von sieben Jahren aus der Karibik, wo er die ersten Jahre seines Lebens mit seiner Schwester bei der Großmutter verbrachte, von seinen Eltern nach England geholt worden. Seit der zweijährigen Babybeobachtung seiner Tochter Felice ist noch ein Sohn geboren worden, der jetzt drei Jahre alt ist.
Auf die Frage der Interviewerin, wann Matty das erste Mal daran gedacht hat, Kinder zu bekommen, antwortet er: »Well, okay. Hintergrund. Ich habe fünf Kinder von vier verschiedenen Müttern. Okay?«
Diese Antwort soll vermutlich die Interviewerin schockieren und verwirren, was Matty tatsächlich gelang. Es dauerte einen Moment, bis die Situation klarer wurde. Diese Verwirrung der Interviewerin kann auch als Gegenübertragungsreaktion verstanden werden. Matty scheint seine Verwirrung, die er – wie wir gleich hören werden – als Teenager erlebte, in die Interviewerin zu projizieren und löst in ihr Ratlosigkeit aus. Oder ist dieser abrupte Kommentar eine Reinszenierung seines plötzlichen Herausgerissenwerdens aus dem friedlichen, vertrauten Leben mit der Großmutter in der Karibik zu seinen »fremden« Eltern, die er nicht kennt, ins kalte, regnerische England? Ist seine Promiskuität als ein Ausdruck seiner verzweifelten Suche nach Nähe und Liebe, die sich in raschen sexuellen Kontakten in verschiedenen, parallelen Beziehungen ausdrückt, zu verstehen? Zufrieden stellt Matty fest, dass »es die Interviewerin umgehauen hat«.
Matty: »Ich sage ihnen, ich habe immer Kinder gewollt, und ich wusste seit dem Alter von 16, 17 Jahren, dass ich fruchtbar war ... Als ich jung war, hatte ich Ambitionen, also ergriff ich Vorsichtsmaßnahmen.«
Als die Interviewerin (I.) meint, dass er die Idee, so zeugungsfähig zu sein, gern hat, lacht Matty und meint: »Ja, es ist nett, das zu wissen.« Männlichkeit und Zeugungsfähigkeit sind eng miteinander verbunden. Mehrmals betont Matty, dass er sehr fruchtbar sei und sich gar nicht vorstellen könnte, keine Kinder zeugen zu können. Einer seiner Onkel hätte 33 Kinder, eine Cousine bekam mit zwölf Jahren das erste Kind, eine andere mit 13 Jahren. Zu den drei Müttern seiner ersten drei Kinder, die alle in Mittelengland leben, hat er keinen Kontakt; er hat sie nie gesehen. Die Mütter füllten die Rubrik »Vater unbekannt« aus und erhielten staatliche Unterstützung. Von seinen Freunden erfahre er, wie es den Kindern geht.
Mit der Mutter von Felice, die Edith genannt wird, sei es anders gewesen:
Matty:»Edith hatte einige Jahre lang versucht, schwanger zu werden, wissen Sie ... Und sie dachte nicht, dass sie noch je Kinder bekommen könnte.«
I.:»Und Sie dachten: ›Ich kann es machen›'?
Matty:(lacht laut und zustimmend) »Ja, es war anders. Ich wollte ja immer Kinder, aber hatte ehrgeizige Pläne und Ziele.«
I.:»So, Sie sagen, dass Edith überzeugt war, keine Kinder mehr bekommen zu können; sie war schon älter und dann sagten Sie: ›Ich möchte auch Kinder, also schauen wir, was passiert‹«?
Matty:»Ja, so ähnlich (lacht). So klingt es sehr nett; nein, es war so ... Ich hatte Kinder außerhalb einer Beziehung und wollte die Kinder um mich haben ... Ich wollte meine Kinder sehen und mit ihnen sein.«
Aus der Tatsache, dass er so rasch Frauen schwängerte, was in der Folge zu Schwierigkeiten führte, wird in der Beziehung zu Edith eine erstrebenswerte Fähigkeit, ihren sehnlichsten Wunsch nach Kindern zu erfüllen, an den sie sich nicht mehr zu glauben wagte. Die enorme narzisstische Gratifikation und sein Stolz zeigen sich in den Worten und der Mimik von Matty.
Mögliche ambivalente Gefühle während der Schwangerschaft werden von Matty gänzlich verleugnet. Auf die Frage, wie die Zeit der Schwangerschaft für ihn gewesen sei, antwortet er einige Male mit »Ich habe alles darüber gelesen, das war okay.« Oder: »Es ist nichts Neues, so wie alle Montage nach den Sonntagen kommen« und »Es ist keine, keine große Veränderung deines Lebens«. Matty betont, nie Angst gehabt zu haben, weil er »bereit dazu war«. »Du weißt, dass du Leben weitergibst«, meint er. Erst als es eine Komplikation, nämlich eine Steißlage des Babys, gab, hatte er Angst: Angst um die Mutter und Angst um das Baby.
Aus »purer Neugierde« wollte Matty bei der Geburt dabei sein, obwohl das in der Karibik ganz ungewöhnlich für den Vater ist. »Es ist strikt ein weibliches Terrain«, sagt er. »Absolut wollte ich dabei sein. Ich würde es nicht für alles auf der Welt vermissen wollen.«
Die Geburt seiner Tochter Felice sei für ihn ein wunderschönes, sehr eindrucksvolles Erlebnis gewesen: Er durfte Felice als Erster in seinen Armen halten.
»Ich war überwältigt, wissen Sie. Ich konnte es nicht glauben. Es war, es war, es war so anders, so erfreulich, wissen Sie. Felice sah wunderschön aus, als sie herauskam, so hübsch ... ihr Kopf war nicht verdrückt ... keine Deformation. Hübsch. So ein hübsches Kind. Die Mutter war ganz arm, sie hatte Nachwirkungen vom Kreuzstich – aber sie war glücklich«, sagte Matty.
»Wann haben Sie sie zum ersten Mal gehalten?«, fragte die Interviewerin. Matty antwortete: »Als sie mir Felice gaben (lacht glücklich). Ich durfte sie halten, bevor ihre Mutter sie nehmen konnte, gleich nach dem Herauskommen.«
Sehr deutlich zeigt Matty, wie eindrucksvoll es für ihn war, das Größerwerden von Felice mitzuerleben und zu wissen, dass sie bei ihm und er bei ihr bleiben konnte. Nach fünf Abtreibungen der von ihm geschwängerten Frauen, drei getrennt lebenden Kindern und den verdrängten Schuldgefühlen darüber herrschte diesmal Freude und Glück. Die Mutter war überglücklich und konnte es kaum fassen, wirklich so spät in ihrem Leben – sie war 48 Jahre alt – doch noch schwanger zu werden, und zwar ganz problemlos und rasch. Nur die Lage des Babys, die einen Kaiserschnitt erforderte, gab Anlass zur Sorge. Sorge um die Mutter und Sorge um das Leben des Babys. Umso größer waren die Erleichterung, Freude und das Glück des Vaters, Felice, ein gesundes Baby, als erster in seinen Armen halten zu können. Matty sprach davon, dass er vermutlich »sehr naiv« sei, aber das alles »erfreulich und schön« finde.
Dieser erster liebevolle Blick des Vaters auf seine Tochter stellt die erste Begegnung zwischen den beiden dar; zudem der Blick eines Neugeborenen, das die neue Welt erkennt und sich als erstes an den Augen des Vaters anhält. Die Intensität dieses Blicks ist immer überraschend, es ist wie ein Festsaugen an den Augen dieser ersten Person, des ersten Objekts. Psychoanalytiker denken, dass im Vater dabei die Erinnerung an sein Aufgenommenwerden in der Welt durch die Liebe und Freude der Mutter/des Vaters wach werden. Winnicott (1971, S. 130) spricht vom »Glanz in den Augen der Mutter«, wenn sie ihr Baby anschaut. Wir können das aber auf den Blick des Vaters übertragen. Es ist Freude gemischt mit Erstaunen über die Vollkommenheit eines gesunden Babys. Die Mutter beschreibt es in ihrem Interview als glücklichen Moment zu sehen, wie liebevoll der Vater Felice anschaue, so als ob er sich gar nicht sattsehen könnte. Dieser Anblick tröstet sich darüber hinweg, dass sie ihr Baby wegen des Kaiserschnitts nicht selbst in den Arm nehmen und an die Brust legen kann. Das erste An-die-Brust-Legen stellt eine wichtige Erfahrung dar. Denn sie symbolisiert, dass die Trennung durch die Geburt keine absolute ist, sondern es durch das Stillen eine neue Form des Zusammenkommens gibt. Bion bezeichnet das Zusammenkommen der Brustwarze mit dem Mund des Babys als fundamentale Form des »Linking«, eines passenden Zusammenkommens.
Noch größer war die Freude von Matty und der Mutter, als sie zwei Jahre nach der Geburt von Felice wieder schwanger wurde und dann einem kleinen Jungen das Leben schenkte.
Auf die Frage, welche Auswirkung die Geburt von Felice auf ihn und sein Leben hatte, antwortet Matty nach einer kurzen Pause: »Ich würde es nicht Auswirkung nennen, sondern ›Thrill‹.«
Er verwendet den englischen Ausdruck, der auch im Deutschen genutzt wird, und eine Mischung von Angst und Lust – »Angstlust« bzw. Aufregung – meint. Ein Begriff, der ein zwiespältiges Gefühlserleben ausdrückt, das sich zwischen Angst und Lust, zwischen Leiden und Freude bewegt, einen »Nervenkitzel«, einen »Kick« – also ein abenteuerliches, intensives Ereignis meint. Matty beschreibt das Erleben wie folgt: »Alles ist möglich. Sie brachte nur Freude. Freude nicht Ängste ... Alles, was man tut, soll man aus Freude tun.«
Es fällt Matty schwer, widersprüchliche Gefühle und Konflikte zu beschreiben – alles soll Glück und Freude sein. Er scheint nur schwer über sich selbst nachdenken zu können. Er klammert sich an die Parole, dass alles reines Glück sein soll, Freude und keine Mühe, keine Ungeduld, kein Hass und keine Ablehnung – eben die Ambivalenz der Gefühle, die in jeder Beziehung wirksam ist.
VaterbildBetrachten wir Mattys Situation als Vater und welches Vaterbild er verinnerlicht hatte, so erfahren wir von einer äußerst schmerzlichen Bruchsituation. Seine Eltern folgten der Werbung, mit der Menschen aus der Karibik als Gastarbeiter in England gesucht wurden. Das Leben in England wurde in herrlichen, bunten Farben beschrieben. Wie leicht es wäre, Arbeit zu bekommen und sich in England eine neue, finanziell sichere Existenz aufzubauen.
Seine Mutter ließ ihn im Alter von neun Monaten gemeinsam mit seiner zwei Jahre älteren Schwester bei der Großmutter in großer Armut zurück. Von der Großmutter spricht er äußerst positiv und liebevoll, betont aber, dass er genau wusste, »dass sie nicht meine Mutter, sondern meine Großmutter war«. Alle Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen sahen einander täglich. Als seine Eltern nach sieben Jahren ihn und seine Schwester zu sich holen wollten, waren sie Fremde für ihn. Matty sagte:
»Es war ein ziemlicher Schock, als meine Mama, mein Bruder und mein Vater kamen und ich das tun musste, was sie sagten ... Jemand zeigte mit dem Finger auf meine Mutter und sagte: ›Das ist deine Mutter‹. Und ein Mann, der mein Vater genannt wurde, war mein Vater ... ›ein hohes Tier‹, ein ›Big shot‹ ... denn bis zu diesem Zeitpunkt war meine Großmutter das Zentrum, der Glanzpunkt, ›Highlight‹. Was sie sagte, habe ich gemacht, weil ich immer ihr gehört habe.«
Gegen seinen Willen wurde er von der geliebten Großmutter getrennt und kam mit den Eltern und seiner älteren Schwester nach England. Matty:
»Meine Mutter war eine totale Fremde. Ich rebellierte, ich rebellierte immer gegen mein Familienleben ... Ich sah keinen Grund, warum ich jemanden ›Mutter‹ oder ›Vater‹ nennen sollte ... Das Klima in England war bei meiner Ankunft scheiß kalt – so wie jetzt (lacht). Wie kann man von der Karibik in so ein kaltes Land ziehen?«
Die engste Beziehung besteht zu seiner zwei Jahre älteren Schwester, mit der Matty in der Karibik bei seiner Großmutter gelebt hatte.
Matty: »Ich hatte täglich Kämpfe mit meiner Mutter – wenn sie mich schlug, schlug ich zurück. ›Wenn du schreist, schreie ich zurück‹, brüllte ich sie an.«
Die massiven Schläge seiner vermutlich hilflosen Mutter blieben Matty in lebhafter Erinnerung. Seine Mutter bezeichnet er als wild und gewalttätig. Zu seinem Vater, der ihn nie schlug, hatte er eine bessere Beziehung. Matty bezeichnet ihn als »guten Freund«.
Matty sagt: »Die Beziehung ist sehr tief, wissen Sie. Wenn er spricht, hast du zuzuhören (lacht laut). Aber ich ...« »Was meinen sie mit ›tief‹?«, fragt die Interviewerin. Matty antwortet: »Eh, (lange Pause) mein Vater ist mein Stern, er, er, er ist ein guter Freund. Er hat nicht das Temperament meiner Mutter. Meine Mutter ist wie ein Vulkan, einen Moment ist sie ruhig und im nächsten hat sie einen Ausbruch, sie hat extrem hohen Blutdruck ... Mein Vater ist cool... Er ist ein Mann aus Eisen, alles ist nett und solid. Es bedarf eines guten Grundes, um ihn zu treffen.« « Können Sie mit ihm sprechen?«, fragt die Interviewerin. »Ja, mit ihm kann ich sprechen, aber mit meiner Mutter kann ich nie sprechen, weil sie immer sagt, ich widerspreche und argumentiere, verstehen Sie. Sie denkt, sie weiß alles, sie will auch jetzt noch mein Leben kontrollieren. Egal wie alt man ist, die Mutter weiß es immer besser. Ich könnte 16 sein oder 40 sein, ich soll tun, was sie mir sagt«, sagt Matty.
Immer wenn Matty etwas von seinem Vater erzählen will, kommt er auf die konfliktreiche Beziehung zu seiner Mutter zu sprechen. Wir nehmen an, dass Matty seinen Vater eigentlich als schwach erlebt, der sich nicht zwischen ihn und die strenge, gewalttätige Mutter stellen, ihn nicht beschützen konnte.
Matty betont, wie wichtig es für ihn sei, ein »ausgezeichneter Vater« zu sein. Er meint, er wisse, er ist ein ausgezeichneter Vater. Dann fällt es ihm aber sehr schwer zu beschreiben, was er darunter versteht. Als die Interviewerin nachfragt, meint er, das sei eine sehr wichtige Frage, über die er erst nachdenken müsse.
Matty ist überzeugt: »Elternschaft ist ein Lernprozess. Ich beginne, meinen akademischen Abschluss in Elternschaft zu machen. Meine Frau denkt, ich bin zu streng mit den Kindern.«
Seine Frau bewundert er für ihre mütterlichen Qualitäten und sagt: »Sie ist ›die‹ Mutter in meinen Augen, die Mutter! Sie verbringt ihre Zeit mit den Kindern, sie liest den Kindern Bücher vor ... Sie ist aktiv, wirklich an den Kindern interessiert ... Ich unterstütze sie, weil die Art und Weise, wie sie mit meinen Kindern ist, ist absolut positiv. Ich sehe andere Eltern, andere Mütter und ihre Art mit den Kindern zu spielen.«
»Ist das etwas, was Sie als Kind vermisst haben?«, fragt die Interviewerin. Matty antwortet: »In gewisser Weise Ja. Sie ist wirklich gut dabei ... sie hat meiner Meinung nach eine sehr gute Haltung den Kindern gegenüber; sie ist 90 Prozent mit den Kindern ... Die englischen Mütter haben nicht so ein aktives Interesse an den Kindern. Die Mütter aus der Arbeiterschicht stellen ein Kind hin und überlassen es sich selbst.«
Matty betont, wie er seine Frau unterstützt, weil sie sich so gut um seine Kinder kümmere und sie fördere. Als die Interviewerin diese Förderung der kleinen Kinder mit seiner eigenen Kindheit in Verbindung bringt und meint, er erlebe mit seinen Kindern etwas, was er als Kind vermisst habe, stimmt er zu und wird nachdenklich. Er und seine Schwester haben einen hohen Preis dafür gezahlt, dass die Eltern nach England auswanderten, weil ihnen eine glänzende Zukunft versprochen worden war. Seine Eltern wurden tief enttäuscht. Es war ein schwieriger Start, fünf Personen schliefen in einem Raum; die Eltern verdienten wenig Geld und mussten die Raten für das Haus zahlen.
Diskussion
Vater zu werden, Vater zu sein und seine Kinder bei sich zu haben, sie täglich zu sehen und in einer Familie zu leben, stellt die Erfüllung eines Wunsches von Matty dar. In seinem Leben waren Fortpflanzung und Familiengründung zwei gänzlich voneinander getrennte Welten. Fruchtbarkeit und Zeugungsfähigkeit stellten in seiner Jugend eher ein Problem dar; über Empfängnisverhütung wurde nicht gesprochen. Erst mit der aus Deutschland stammenden Frau, die ich Edith nenne, stellte die Schwangerschaft eine beglückende Wunscherfüllung dar, an die Edith wegen ihres Alters nicht mehr zu hoffen gewagt hatte. Durch seine Rebellion als Adoleszenter konnte er keinen Schulabschluss und damit keinen Zugang zu einer höheren Bildung erlangen. Sein Beruf als Automechaniker war und ist ein »Brotberuf«, der nicht seinen Wünschen entsprach, aber ein Einkommen für die Familie sicherte. Er übernahm Verantwortung für die Familie, war der Ernährer, musste aber alle seine ehrgeizigen Pläne aufgeben.
Der Übergang vom Mannsein zum Vatersein konfrontiert Matty mit den schmerzlichen Beziehungserfahrungen seiner Kindheit, dem frühen Verlassenwerden durch die Eltern. Ihm fehlten der Vater und all die Dinge, die er durch dessen Abwesenheit nicht erleben konnte. Seine eigene Vernachlässigung als Kind und die seiner Schwester werden durch die Geburt seiner beiden Kinder lebendig. Das große Lob, das er seiner Frau für die vorbildliche Beschäftigung mit den Kindern zollt, verweist auf den Schmerz, dass er als Kind all diese Liebe und Förderung nicht erlebt hat. Teilweise scheint er mit seinen Kindern identifiziert zu sein, die nun bekommen, wonach er sich gesehnt hat. Die drei weiteren Kinder, die er nie sieht, können als Wiederholung seines Schicksals, von Vater und Mutter verlassen worden zu sein, verstanden werden. Mit den beiden bei ihm lebenden Kindern ist eine Wiedergutmachung möglich. Matty ist sich bewusst, dass er mit der Rolle eines verantwortungsbewussten, reifen Vaters Schwierigkeiten hat. Er betont, wie leicht er wütend wird, genauso schreit wie seine Mutter, seinen Sohn in Kämpfe verwickelt, als ob zwei Jungen miteinander ringen. Manchmal wirkt es so, als ob ihm klar sei, dass seine Frau oft den Eindruck hat, drei Kinder zu haben. Seine verschütteten Bedürfnisse als Sohn gegenüber dem Vater und Sehnsucht nach einer zärtlichen, liebevollen Mutter werden ihm wieder schmerzlich klar. Seinen Sohn drängt er unbewusst in die Rolle eines eher wilden Knaben, den er zu ausgelassenen, spielerischen Boxkämpfen animiert.
1.1.2 Fallbeispiel: Vater von Kelly
Das Interview fand in der Wohnung des Vaters statt. Die Eltern trennten sich als Kelly zwei Jahre alt war. Beide Eltern stammen aus England, der Vater arbeitet als Steuerberater und engagiert sich sehr für sein Hobby, Schlagzeug in einer Jazzband zu spielen. Beide Eltern waren bei der Geburt von Kelly, dem ersten Kind, 30 Jahre alt.
Auf die Frage der Interviewerin, ob der Vater, den ich Miles nenne, Kinder wollte, bejaht er dies spontan. Immer schon wollte er Kinder haben, sagt er, obwohl er mit Kellys Mutter, noch nicht über das Thema Kinder zu bekommen, gesprochen hatte. Er fährt fort zu beschreiben, wie es für ihn war, als er erfahren hatte, dass seine Partnerin mit Kelly schwanger war:
»Als ich von der Schwangerschaft erfahren habe, war ich glücklich, extrem glücklich ... Ich nehme an, zu diesem Zeitpunkt war es erfreulich und doch zugleich auch ...Es war ein Wendepunkt in meinem Leben, weil ich dachte, nun muss ich mich disziplinieren, Verantwortung übernehmen und weniger selbstsüchtig sein ... Mehr auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen ...Wenn du ein Kind hast, hast du ein Leben in deinen Händen ... du hast Verantwortung.«
Der Gedanke, diese Verantwortung übernehmen zu wollen und seine Aufgabe zu erfüllen, beschäftigte ihn sehr. Miles hat ein klares Bild von den Aufgaben eines Vaters, die er erfüllen will, gut erfüllen will. Für ihn eröffnet sich eine neue Dimension, eine Dimension, die sein Leben und seine Identität verändert. Auch nach der schmerzlichen und ungewollten Trennung von seiner Frau bezeichnet er Kellys Geburt als das Wichtigste in seinem Leben. Sofort nach der Mitteilung über die Schwangerschaft, machte er seiner Partnerin einen Heiratsantrag. Sie heirateten und machten eine Hochzeitsreise nach Paris. Für ihn war immer klar, dass er nicht nur das Baby bekommen wollte, sondern es für ihn eine riesige Freude darstellte. Ihr durch ihre Skepsis, ob Miles das Baby überhaupt wolle, begründeter Kommentar, sie werde das Baby auf alle Fälle bekommen, passten so gar nicht zu Miles Freude und war für ihn wohl die erste Zurückweisung. Miles beschreibt die Zeit der Schwangerschaft als schwierige und schmerzliche Zeit für ihn:
»Als Grace (so nenne ich die Mutter, Anmerkung von GDW) schwanger war, fühlte sie sich nicht gut und hat mich sexuell abgewiesen. Und wir hatten während der gesamten Schwangerschaft keinen Sex und wir hatten keinen Sex, nachdem Kelly geboren war ... Meine Haltung war: ›Wenn das geschieht, damit mein Kind geboren werden kann, dann ist das der Preis, den ich gerne zahle.‹ Ich meine, ihre Zurückweisung war nicht angenehm, aber ich akzeptierte es als Teil meiner neuen Verantwortung.«
Wie schmerzlich diese Zurückweisung für ihn gewesen sein dürfte, wird am Ende des Interviews deutlich, als er sich eingesteht, dass er immer den Wunsch gehabt hatte, mit einer schwangeren Frau Sex zu haben. Aber er akzeptierte den Wunsch von Grace, wollte sich nicht aufdrängen und versuchte ihr das Leben zu erleichtern; er massierte ihr die Beine, war sehr aufmerksam, rücksichtsvoll und zärtlich. Er machte sich aber große Sorgen um die Gesundheit von Grace: »Ich machte mir Sorgen; du hoffst, alles wird gut gehen, bei der Geburt wird alles gut laufen. Wird das Kind in Ordnung sein? Es gibt so viele Ding, über die man sich Sorgen machen kann.«
Sein schmerzliches Ausgegrenztsein aus der Intimität mit seiner schwangeren Frau dürften zu seinen Sorgen beigetragen haben, da er seinen Ärger und Wut gar nicht bewusst wahrnehmen durfte. Bei ambivalenten Gefühlen gegenüber einer geliebten Person werden negative Gefühle verdrängt und tauchen in der Veränderung als Sorgen um das Leben oder die Gesundheit dieser geliebten Person auf und dürfen nur als solche wahrgenommen werden.
Da diese Schwangerschaft seiner Partnerin, die er sofort zu seiner Frau macht, einen heiß ersehnten Wunsch nach einem Kind erfüllt, stellt Miles sofort eine Beziehung zu Kelly her, hat Vorstellungen, wie dieses Kind aussehen wird:
»Ich konnte sie mir gleich vorstellen. Bei den Ultraschalluntersuchungen sah ich ihre Bewegungen, das Schlagen des Herzens und ihr Wachstum von Monat zu Monat. Unglaublich faszinierend ...Diese Untersuchungen waren auch beruhigend, da ihr physisches Wachstum zufriedenstellend war. Wir wollten uns beide vom Geschlecht des Kindes überraschen lassen.«
Miles wurde eng in die Schwangerschaft einbezogen. Er besorgte Bücher über Schwangerschaft und Geburt, die sie gemeinsam lasen. Sie besuchten gemeinsam einen Vorbereitungskurs für Eltern – so war eine emotionale Verbundenheit trotz der sexuellen Abstinenz möglich. Im Kurs wurde den Vätern gezeigt, wie sie ihre Frauen bei der Geburt physisch und emotional unterstützen konnten, auch über die Geburt wurde wöchentlich ausführlich gesprochen, was Miles als positive, beruhigende Erfahrung bezeichnet.
Auf die Frage, wie Kellys Geburt verlief, gibt Miles eine ausführliche Beschreibung, die das Hauptaugenmerk auf Kellys Gesundheit legt. Er sagt: