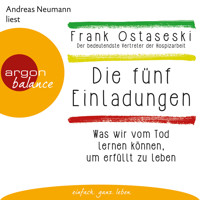11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur MensSana eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Durch die Endlichkeit des Lebens das Wunder im Augenblick entdecken Frank Ostaseski ist der bedeutendste Vertreter der Hospizarbeit und Sterbebegleitung in den USA. Seine bahnbrechende Leistung ist es, die Prinzipien Achtsamkeit und Mitgefühl im Hospizwesen verankert zu haben. Aus seinen jahrzehntelangen Erfahrungen als Begleiter von Schwerkranken und Sterbenden hat er fünf Leitsätze – "die fünf Einladungen" – entwickelt, die bis heute auch Grundlage seiner Kurse und Ausbildungen sind. In diesem Ratgeber zeigt er uns, wie wir diese nutzen können, um bewusster zu leben und die eigene Lebensqualität zu steigern. Richten wir uns nach diesen fünf Prinzipien, finden wir einen bereichernden Umgang mit dem Tod und navigieren entspannter durch jede Art von Übergang oder Krise. Die "fünf Einladungen" lauten: 1. Warte nicht. 2. Heiße alles willkommen, wehre nichts ab. 3. Gib dich ganz in die Erfahrung. 4. Finde mitten im Chaos einen Ort der Ruhe. 5. Kultiviere den Geist des Nicht-Wissens. Frank Ostaseski hat bei mehr als tausend Menschen am Sterbebett gesessen. In den "fünf Einladungen" destilliert er seine Erfahrungen zu einem eindrucksvollen Weg der Transformation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Frank Ostaseski Frank Ostaseski
Die fünf Einladungen
Was wir vom Tod lernen können, um erfüllt zu leben
Aus dem amerikanischen Englisch von Judith Elze
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Frank Ostaseskis bahnbrechende und Leistung ist es, die Prinzipien Achtsamkeit und Mitgefühl im Hospizwesen verankert zu haben. Aus seinen jahrzehntelangen Erfahrungen als Begleiter von Schwerkranken und Sterbenden hat er fünf Leitsätze – »die fünf Einladungen« – entwickelt, die bis heute auch Grundlage seiner Kurse und Ausbildungen sind. Sie zeigen uns, wie wir bewusster durchs Leben gehen können, und sie navigieren uns durch jede Art von Übergang oder Krise. Richten wir uns danach aus, finden wir einen entspannten und bereichernden Umgang mit unserer eigenen Endlichkeit. Die »fünf Einladungen« lauten:
1. Warte nicht.
2. Heiße alles willkommen, wehre nichts ab.
3. Gib dich ganz in die Erfahrung.
4. Finde mitten im Chaos einen Ort der Ruhe.
5. Kultiviere den Geist des Nicht-Wissens.
Frank Ostaseski hat bei mehr als tausend Menschen am Sterbebett gesessen. In den »fünf Einladungen« destilliert er seine Erfahrungen zu einem eindrucksvollen Weg der Transformation.
Inhaltsübersicht
Dieses Buch ist all [...]
Vorwort
Die Wandlungskraft des Todes
Warte nicht
Der Zugang zu den Möglichkeiten
Zugleich hier und im Verschwinden begriffen
Das Reifen der Hoffnung
Der Kern der Sache
Heiße alles willkommen, wehre nichts ab
Wie es ist
Wende dich deinem Schmerz zu
Die Liebe heilt
Gib dich ganz in die Erfahrung
Spiel keine Rolle, sei du selbst
Den inneren Kritiker zähmen
Der tosende Fluss
Die Schreie der Welt hören
Finde mitten im Chaos einen Ort der Ruhe
Die Ruhe im Sturm
Vorsicht, Lücke!
Mutige Präsenz
Kultiviere den Weiß-nicht-Geist
Die Geschichte mit der Vergesslichkeit
Nicht-Wissen ist am nächsten
Ergib dich dem, was heilig ist
Ins Leben hinein sterben
Dank
Dieses Buch ist all den Männern, Frauen und Kindern gewidmet, die mir im Sterben das Geschenk machten, bei ihnen sein zu dürfen.
Ihr seid meine wahren Lehrer.
Und
Stephen Levine, dem Herzensfreund.
Vorwort
Jeder Sturm hat, wie ein Nabel, ein Loch in der Mitte,
durch das eine Möwe in Stille fliegen kann.1
Harold Witter Bynner
Als Ärztin wurde mir beigebracht, der Tod sei das Gegenteil von Leben, ein körperlicher Vorgang, gekennzeichnet durch spezifische physiologische Veränderungen. Ich wurde trainiert, »die Sterbenden zu verwalten«, Leben zu verlängern, wo immer möglich, und ansonsten Schmerz und Leid im Zaum zu halten. Am schwierigsten war es, mit dem Schmerz der Überlebenden umzugehen, doch mit der Zeit trösteten sich die meisten Menschen mit dem Gedanken, dass es ein Leben nach dem Tod gebe, und fanden einen Weg, weiterzumachen. Trotz der vielen Erfahrungen mit Sterbenden reagierten meine Kollegen und ich kaum oder gar nicht emotional auf den Tod uns nicht Nahestehender, und wir waren mit Sicherheit nicht neugierig darauf. Ein solches Interesse wäre uns morbide vorgekommen. Die Vorstellung, dass der Tod den Lebenden etwas Wesentliches zu bieten hätte, wäre höchstens als bizarr eingestuft worden. In gewisser Weise spiegelte unsere »professionelle« Haltung also die Einstellung unseres ganzen Kulturkreises gegenüber dem Tod und den Sterbenden wider.
In diesem Umfeld begann Frank Ostaseski mit seiner mutigen und bahnbrechenden Arbeit. Er war der Erste, der uns bewusst zu machen schaffte, dass der Tod jedes Einzelnen etwas Einzigartiges und Bedeutsames ist und eine Chance bietet, Weisheit und Heilung zu erlangen – und zwar nicht nur den Sterbenden, sondern auch denen, die weiterleben. Der enorme Erfahrungsschatz, den er in dieses Buch einfließen lässt, wurde von den Menschen bereichert, die furchtlos sind, die ihren Weg in die Stille und Präsenz gefunden haben, die die Fähigkeit haben, sich mit dem Herzen und der Seele anderer zu verbinden, und mit dem Geschenk gesegnet sind, ihre Geschichte mitteilen zu können. Die fünf Einladungen ist voll von derart tief gehenden Berichten, dass sie wie ein Kompass wirken und eine Möglichkeit aufzeigen, wie man einen unbekannten Weg zu einem gewünschten Ziel gehen kann. Viele der hier geschilderten wahren Begebenheiten lesen sich wie Parabeln, wie Weisheitsgeschichten, die uns allen ermöglichen, unter den verschiedensten Umständen sinnvoller und weiser zu leben.
Das erste Mal begegnete mir der Tod zur Zeit meiner Geburt. Ich wog 2,1 Pfund und verbrachte die ersten sechs Monate meines Lebens in einem Inkubator zwischen den Welten ohne jeden Kontakt zu menschlichen Händen. Dann traf ich den Tod im Alter von fünfzehn Jahren wieder, als eines Nachts plötzlich meine chronische Krankheit zum Ausbruch kam und ich in rasender Geschwindigkeit bewusstlos in ein Krankenhaus in New York City gefahren wurde, wo ich fast ein Jahr lang im Koma lag. Die meisten Menschen, die mir vertraut sind, habe ich auf der Kippe zwischen Leben und Tod kennengelernt, als mich der tiefe Wunsch ergriff, einen Blick auf das eigentlich Wirkliche zu erhaschen. Frank Ostaseski ist einer von ihnen – mein Kollege, mein Gesinnungsgenosse, mein Lehrer. Mit den Fünf Einladungen hat er ein wunderbares Buch über das Leben an der Schwelle zum Tod geschrieben – und eigentlich über das Leben überhaupt. Er lädt uns ein, ihm in den Raum zwischen den Welten zu folgen. Am Tisch des Nicht-Wissens zu sitzen. Gemeinsam zu staunen. Weise zu werden.
Mein Großvater war Kabbalist und von Natur aus Mystiker. Für ihn war das Leben der beständige Dialog mit der Seele der Welt. Alle Ereignisse betrachtete er als offene Türen, und die Welt enthüllte sich ihm ständig neu. In den normalsten Vorgängen konnte er die tiefsten Bedeutungen erkennen. Die meisten Menschen haben diese Gabe nicht. Wir brauchen etwas Größeres, etwas, was uns in unserer gewohnten Wahrnehmung und Denkweise innehalten lässt, so dass wir die wahre Natur der Dinge erkennen. Der Tod ist ein solcher Zugang: Gewahrsein ist sein großes Geschenk. Für viele Menschen beginnt authentisches Leben erst im Angesicht des Todes, und zwar nicht unbedingt des eigenen, sondern in dem Augenblick, in dem jemand anders stirbt, der aus dem eigenen Umfeld stammt oder mit dem man sich sonst wie verbunden fühlt.
Das Wesen des Lebens an sich ist heilig. Wir stehen immer auf heiligem Boden. Und doch gehört das kaum zu unserer täglichen Erfahrung. Für die meisten von uns blitzt das Heilige ganz plötzlich auf wie ein scharfes Einatmen zwischen einem unbemerkten Atemzug und dem nächsten. Das alltägliche Gefüge, das die eigentliche Wirklichkeit überdeckt, wird gewöhnlich für diese eigentliche Wirklichkeit gehalten, bis irgendetwas ein Loch hineinreißt und sich die wahre Natur der Welt enthüllt. Dabei ist die Einladung zur Bewusstwerdung schon fast ein Allgemeinplatz. In seinem brillanten Buch Small is Beautiful weist Ernst Friedrich Schumacher2 deshalb darauf hin, dass wir nur sehen können, wofür wir einen Blick entwickelt haben. Er regt an, dass es bei der endlosen Debatte über die wahre Natur der Welt vielleicht nicht um Unterschiede geht, sondern ganz einfach um die unterschiedlich entwickelten Fähigkeiten unserer Augen.
Das Buch, das Sie gerade in den Händen halten, bietet einfache, kraftvolle Übungen an, mit denen Sie zu sehen lernen, was inmitten von allem Vertrauten eigentlich Wirklichkeit ist. Es bietet die Gelegenheit, hinter das Gewöhnliche zu schauen. Anders als in vielen anderen einschlägigen Büchern über den Tod und das Sterben geht es hier nicht um irgendeine traditionelle oder persönliche Theorie beziehungsweise Kosmologie. Es geht nicht um die Vorstellungen oder den Glauben von jemandem darüber, was die Sterbeerfahrung ist oder bedeutet. In diesem Buch teilt ein höchst bewusster Beobachter seine tiefe Erfahrung mit Ihnen und lädt Sie ein, Ihren Blick zu schärfen.
Mein Großvater lehrte mich, dass ein Lehrer kein Weiser ist, sondern jemand, der unsere Aufmerksamkeit auf die uns umgebende Wirklichkeit lenkt. Frank Ostaseski ist ein solcher Lehrer. Dieses Buch wird Sie an vieles erinnern. Mich hat es daran erinnert, dass wenige Dinge wirklich wichtig sind – und dass sie wirklich wichtig sind. Wie oft werden wir inmitten aller Fülle spirituell hungrig, obwohl uns viele Lehrer umgeben, die uns geduldig alles anbieten, was wir brauchen, um klug und gut leben zu können. Es erinnert mich auch daran, dass der Tod, genau wie die Liebe, etwas tief Innerliches, Intimes ist und dass diese Intimität die Voraussetzung für eine wirklich tiefe Lernerfahrung ist. Außerdem erinnert mich das Buch an die Einfachheit des wahren Lehrers und an die verbindende Kraft des Erzählens, die so viel tiefer geht als all die Oberflächlichkeiten, die uns voneinander trennen. Und schließlich erinnert es mich daran, dass wir alle zum Tanz geladen sind. Ich verspüre tiefe Dankbarkeit für die hier so großzügig angebotene Einladung, voll und ganz am Leben teilzunehmen. Da wird es Ihnen nicht anders gehen.
Letztlich ist der Tod eine sehr persönliche, innige Begegnung mit dem Unbekannten. Viele Menschen, die schon so gut wie gestorben waren und dank der modernen Wissenschaft wieder ins Leben zurückgeholt wurden, erzählen uns, dass diese Erfahrung ihnen den Sinn des Lebens enthüllt hat. Er besteht nicht darin, reich oder berühmt zu werden oder Macht zu erlangen. Der Sinn eines jeden Lebens ist, in die Weisheit hineinzuwachsen und zu lernen, besser zu lieben. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann ist dies das richtige Buch für Sie.
Dr. med. Rachel Naomi Remen
Autorin von Kitchen Table Wisdom: Geschichten, die heilen und Aus Liebe zum Leben
Einleitung
Die Wandlungskraft des Todes
Die Liebe und der Tod sind die größten Geschenke an die Menschen. Meistens werden sie ungeöffnet weitergegeben
Anonym
Leben und Tod kommen immer im Paket – das eine erhält man nicht ohne das andere. So wird der japanische Zen-Begriff shoji für den Kreislauf von Geburt und Tod wörtlich als »Geburt-Tod« übersetzt. Die einzige Trennung zwischen den beiden besteht in dem kleinen Bindestrich, einer schmalen Linie, die sie wiederum verbindet: Ohne Gewahrsein für den Tod können wir nicht wirklich lebendig sein.
Der Tod wartet nicht am Ende eines langen Weges auf uns. Er ist immer da, im Innersten jedes einzelnen Augenblicks. Er ist der heimliche Lehrer, versteckt, aber dennoch für alle sichtbar. Er hilft uns zu entdecken, was am wichtigsten ist im Leben. Und das Gute daran ist: Wir brauchen nicht bis ans Ende unserer Tage zu warten, um die Weisheit zu finden, die der Tod uns zu bieten hat.
In den letzten dreißig Jahren habe ich mit einigen tausend Menschen an der Schwelle des Todes gesessen. Manche waren voller Enttäuschung, als sie starben. Andere wieder blühten auf und gingen voller Staunen durch jene Tür. Der Unterschied bestand in der Bereitschaft, sich langsam in die tieferen Dimensionen dessen hineinzuleben, was es bedeutet, Mensch zu sein.
Die Vorstellung, dass wir im Sterben die physische Kraft, die emotionale Stabilität und die geistige Klarheit haben werden, um die Arbeit eines ganzen Lebens zu erledigen, ist eine naive Illusion. Deshalb ergeht an Sie mit diesem Buch die Einladung – nein, es sind fünf Einladungen –, sich jetzt schon mit dem Tod zusammen hinzusetzen, Tee mit ihm zu trinken und sich von ihm zu einem sinnvolleren und liebevolleren Leben inspirieren zu lassen.
Ein intensiveres Nachdenken über den Tod wird sich nicht nur darauf tief und positiv auswirken, wie wir sterben, sondern auch darauf, wie wir leben. Im Angesicht des Sterbens ist es eher möglich, zwischen Tendenzen zu unterscheiden, die uns in die Einschließlichkeit der Ganzheit führen oder uns in die Trennung und in weiteres Leiden locken. Doch geht es hier nicht um ein vages, homogenes Einssein. Ein besserer Ausdruck wäre »Vernetzung«. Jede Zelle unseres Körpers ist Teil eines organischen, ineinandergreifenden Ganzen, das harmonisch zusammenwirken muss, um für eine gute Gesundheit zu sorgen. Entsprechend existiert alles in einem beständigen Wechselspiel von Beziehungen, die sich im gesamten System widerspiegeln und alle seine Teile beeinflussen. Wenn wir diese grundlegende Wahrheit nicht beachten, leiden wir und schaffen wir Leiden. Wenn wir dagegen im Gewahrsein dieser Wahrheit leben, fördern wir die Ganzheit des Daseins und sind von ihr getragen.
Unsere Lebensgewohnheiten haben eine gewaltige Kraft, die uns zum Augenblick unseres Todes hintreibt. Da stellt sich automatisch die Frage: Welche Gewohnheiten wollen wir uns erschaffen? Unsere Gedanken sind keinesfalls wirkungslos. Sie manifestieren sich in Aktivitäten, die sich wiederum in Gewohnheiten verwandeln, und unsere Gewohnheiten verhärten sich zum Charakter. Unser unreflektiertes Verhältnis zum Denken kann unsere Wahrnehmungen beschränken, stereotype Reaktionen auslösen und die Einstellung vorherbestimmen, die wir zu den Ereignissen unseres Lebens haben. Die Trägheit dieser Muster können wir überwinden, indem wir uns unserer Sichtweisen und Glaubenssätze bewusst werden. Wenn wir das tun, treffen wir die klare Entscheidung, diese gewohnheitsmäßigen Tendenzen zu hinterfragen. Vorgefasste Meinungen und Gewohnheiten schalten das Denken aus und fördern ein Leben auf Autopilot. Fragen fördern einen offenen Geist und sind Ausdruck eines lebendigen Menschseins. Eine gute Frage hat Herz und entsteht aus der tiefen Liebe heraus, erkennen zu wollen, was wahr ist. Wir werden nie wissen, wer wir sind und warum wir hier sind, wenn wir uns die unbequemen Fragen nicht stellen.
Ohne den Tod als Mahner neigen wir dazu, das Leben für etwas Selbstverständliches zu halten, und verlieren uns häufig in der endlosen Jagd nach Bedürfnisbefriedigung. Wenn wir den Tod öfter im Bewusstsein haben, klammern wir uns nicht mehr so sehr am Leben fest. Vielleicht nehmen wir uns und unsere Vorstellungen nicht mehr ganz so ernst. Wir lassen ein wenig leichter los. Wenn wir anerkennen, dass der Tod zu jedem von uns kommt, würdigen wir, dass wir alle im selben Boot sitzen. Das kann uns wiederum dabei helfen, ein bisschen freundlicher und sanfter miteinander umzugehen.
Wir können das Bewusstsein vom Tod nutzen, um unser Leben zu würdigen, um uns zur Selbsterkundung zu ermutigen, um unsere Werte zu klären, um einen Sinn im Leben zu finden und um ein grundsätzlich positives Handeln zu entwickeln. Gerade die Vergänglichkeit des Lebens schenkt uns eine Perspektive. Wenn wir begreifen, dass es uns nie sicher ist, lernen wir es in seiner Kostbarkeit wertzuschätzen. Dann wollen wir keine Minute mehr vergeuden. Wir wollen unser Leben voll und ganz leben und es verantwortlich nutzen. Der Tod kann ein weiser Begleiter für ein gutes Leben und für ein Sterben ohne Reue sein.
Die Weisheit des Todes kann Ihnen auch dabei helfen, mit einem Verlust umzugehen oder mit Situationen, in denen Sie das Gefühl haben, sich in Kleingeistigkeit verrannt oder die Kontrolle verloren zu haben – egal, ob es sich um eine Trennung oder Scheidung, um eine Krankheit, eine Entlassung, das Zerplatzen eines Traums, einen Autounfall oder auch nur Ärger mit einem Kind oder mit den Kollegen handelt.
Kurz nachdem der renommierte Psychologe Abraham Maslow einen beinah tödlichen Herzinfarkt erlitten hatte, schrieb er in einem Brief:
»Die Konfrontation mit dem Tod – und die gewährte Gnadenfrist – lässt alles so kostbar, so heilig, so schön erscheinen, dass ich einen stärkeren Impuls als je zuvor empfinde, es zu lieben, zu umarmen und mich davon überwältigen zu lassen. Mein Fluss hat noch nie so schön ausgesehen … Der Tod und seine stets gegenwärtige Möglichkeit macht die Liebe, die leidenschaftliche Liebe, möglicher.«3
Ich bin kein Romantiker, was das Sterben angeht. Es ist harte Arbeit, vielleicht die härteste, die wir in unserem Leben je tun werden. Es gerät nicht immer gut. Es kann traurig, unbarmherzig, chaotisch, schön und mysteriös sein. Doch vor allem ist es normal. Wir alle gehen da durch.
Keiner von uns kommt lebendig von hier fort.
Die meisten Menschen, mit denen ich als Begleiter von Sterbenden, als Lehrer für mitfühlende Pflege und als Mitbegründer des Zen Hospice Project gearbeitet habe, waren »ganz normale Leute«. Sie wurden nun konfrontiert mit etwas, was sie bisher für weit entfernt oder unerträglich gehalten hatten: Sie gingen auf den eigenen Tod zu oder pflegten einen geliebten Menschen, der im Sterben lag. Und doch fanden die meisten von ihnen in sich und in der Erfahrung des Sterbens die Ressourcen, die Einsicht, die Stärke, den Mut und das Mitgefühl, um dem Unmöglichen auf außergewöhnliche Weise zu begegnen.
Manche von denen, mit denen ich gearbeitet habe, lebten in schrecklichen Verhältnissen – in schäbigen Hotels oder auf den Parkbänken hinter dem Rathaus. Es waren Alkoholiker, Prostituierte und Obdachlose, die am Rande der Gesellschaft nur mit Ach und Krach überlebten. Oft waren sie resigniert oder wütend über ihren Kontrollverlust. Viele hatten jedes Vertrauen in die Menschheit verloren.
Manche kamen aus Kulturen, die mir fremd waren, sprachen eine Sprache, die ich nicht verstand. Einige waren beseelt von einem tiefen Glauben, der sie durch schwere Zeiten trug, während andere jeder Religion abgeschworen hatten. Nguyen hatte Angst vor Geistern. Jesaja wurde durch »Besuche« von seiner toten Mutter getröstet. Da war ein an Hämophilie leidender Vater, der sich durch eine Bluttransfusion den HIV-Virus zugezogen hatte. Jahre vor seiner Krankheit hatte er entdeckt, dass sein Sohn schwul war. Doch am Ende starben sowohl Vater wie Sohn an Aids. Sie lagen in zwei Einzelbetten im selben Schlafzimmer nebeneinander und wurden von Agnes gepflegt, der Frau des Vaters und Mutter des Sohnes.
Viele sind in ihren frühen Zwanzigern gestorben, als ihr Leben gerade erst begonnen hatte. Doch war auch eine Frau namens Elizabeth darunter, die mich mit ihren dreiundneunzig Jahren fragte: »Warum kommt der Tod so früh zu mir?« Manche hatten ein glasklares Bewusstsein, während sich andere nicht mal an den eigenen Namen erinnern konnten. Einige waren umgeben von der Liebe der Familie und der Freunde. Andere waren vollständig allein. Alex, der keinerlei Unterstützung seitens geliebter Menschen bekam, war so verwirrt von seiner durch Aids verursachten Demenz, dass er eines Nachts hinaus auf die Feuerleiter kletterte und erfror.
Wir haben Polizisten und Feuerwehrleute gepflegt, die zahlreiche Leben gerettet hatten; Krankenschwestern, die sich um den Schmerz und die Atemnot anderer gekümmert hatten; Ärzte, die den Tod hatten attestieren müssen bei Patienten mit denselben Krankheiten, die jetzt ihre eigenen Körper verwüsteten. Menschen mit politischer Macht, Reichtum und guten Krankenversicherungen. Und Flüchtlinge, die kaum mehr als die Kleider besaßen, die sie am Leib trugen. Sie starben an Aids, Krebs, Lungenkrankheiten, Nierenversagen und Alzheimer.
Für manche war der Tod ein großes Geschenk. Sie versöhnten sich mit ihren längst verloren geglaubten Familien, sie gaben ihrer Liebe und Vergebung freien Ausdruck oder fanden die Freundlichkeit und Akzeptanz, nach denen sie sich ihr Lebtag gesehnt hatten. Andere wiederum überließen sich vollständig dem Rückzug und der Hoffnungslosigkeit und kehrten nie wieder von dort zurück.
Sie alle waren meine Lehrer.
Diese Menschen gewährten mir Einblick in die verletzlichsten Augenblicke ihres Lebens und ermöglichten es mir, auf persönliche Weise vertraut mit dem Tod zu werden. Mit der Zeit lehrten sie mich das Leben.
Kein Lebender versteht den Tod wirklich. Wie eine Frau, die dem Tod nahe war, mir einmal sagte: »Ich sehe die Schilder, die zum Ausgang weisen, viel klarer als Sie.« In gewisser Weise kann uns nichts auf den Tod vorbereiten. Und doch wird uns dabei alles helfen, was wir im Leben getan haben, was uns angetan worden ist und was wir daraus gelernt haben.
In einer wunderschönen Kurzgeschichte beschreibt der Nobelpreisträger Rabindranath Tagore die mäandernden Wege zwischen indischen Dörfern. Barfuß hatten die Kinder hüpfend und geführt von ihrer Vorstellung oder einem sich schlängelnden Fluss, einem Abzweig zu einem wunderschönen Ausguck oder im Umgehen eines spitzen Felsens Zickzackwege durch die Landschaft geformt. Wenn sie älter wurden, Sandalen und schwere Lasten zu tragen begannen, wurden die Wege schmal, gerade und zielgerichtet.
Ich selbst bin jahrelang barfuß gelaufen. Ich verfolgte in dieser Arbeit keinen geradlinigen Weg; ich bin mäandert. Und machte auf dem Weg kontinuierlich Entdeckungen. Ich hatte kaum ein Training und keinerlei Ausbildung außer einer Lebensretterurkunde des Roten Kreuzes, deren Gültigkeit inzwischen mit Sicherheit abgelaufen ist. Wie mit der Brailleschrift-Methode erspürte ich mir meinen Weg. Immer in Tuchfühlung mit meiner Intuition und im Vertrauen, dass zuzuhören am kraftvollsten eine Verbindung herstellt, während ich ein Refugium der Stille schuf und mein Herz öffnete. Das alles gab mir die Möglichkeit, zu entdecken, was wirklich hilft.
Der Tod und ich sind schon seit langem Gefährten. Meine Mutter starb, als ich noch ein Teenie war, mein Vater nur wenige Jahre später. Aber verloren hatte ich sie schon lange vor ihrem eigentlichen Tod. Sie waren beide Alkoholiker gewesen, so dass meine Kindheit jahrelang von Chaos, Vernachlässigung, Gewalt, fehlgeleiteter Loyalität, Schuld und Scham bestimmt war. Ich übte mich im Gehen auf Eierschalen als Vertrauter meiner Mutter, im Ausfindigmachen versteckter Likörflaschen, in unerfreulichen Zusammenstößen mit meinem Vater, im Wahren von Geheimnissen und wurde zu schnell erwachsen. In gewisser Weise war ihr Tod eine Erleichterung für mich. Mein Leiden war ein zweischneidiges Schwert. Ich wuchs auf mit Scham, Furcht, Einsamkeit und dem ständigen Gefühl, nicht geliebt zu werden. Zugleich half mir ebendieses Leid, mich mitfühlend mit dem Schmerz anderer zu verbinden; und das wiederum wurde Teil meines inneren Rufs, mich auf Situationen einzulassen, denen viele andere eher aus dem Weg gehen.
Die buddhistische Praxis mit ihrer Betonung der Vergänglichkeit, des ständigen Aufkommens und Vergehens jeder nur vorstellbaren Erfahrung, hat mich schon früh und einschneidend beeinflusst. Dem Tod ins Auge zu sehen ist grundlegender Bestandteil der buddhistischen Tradition. Es kann Weisheit und Mitgefühl reifen lassen und unsere Hingabe an das Erwachen stärken. Der Tod gilt als das letzte Stadium des Wachstums. Mit unserer täglichen Praxis der Achtsamkeit und des Mitgefühls kultivieren wir die heilsamen mentalen, emotionalen und physischen Qualitäten, die uns auf die Begegnung mit dem Unvermeidlichen vorbereiten. Durch die Anwendung dieser Fähigkeiten lernte ich, mich von dem Leid meiner jungen Jahre nicht lahmlegen zu lassen, sondern gerade ihm zu erlauben, meinem Mitgefühl als Grundlage zu dienen.
Kurz vor der Geburt meines Sohnes Gabe wollte ich verstehen, wie ich seine Seele in die Welt bringen könne. Daher meldete ich mich für einen Workshop bei der berühmten Schweizer Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross an, die vor allem wegen ihrer bahnbrechenden Arbeit mit dem Tod und den Sterbenden bekannt ist. Sie hatte vielen beim Abschiednehmen vom Leben geholfen. Ich stellte mir vor, sie würde mich lehren, wie ich meinen Sohn in sein Leben hinein einladen könnte.
Elisabeth war von der Idee fasziniert und nahm mich unter ihre Fittiche. Sie lud mich über die Jahre immer wieder zur Teilnahme an weiteren Programmen ein, ohne mir groß Anweisungen zu geben. Ich saß still hinten im Raum und lernte dadurch, dass ich beobachtete, wie sie mit Menschen arbeitete, die dem Tod ins Auge sahen oder schwere Verluste betrauerten. Dies formte die Art und Weise grundlegend, auf die ich später in der Hospizbetreuung Menschen begleitete. Elisabeth war erfahren, intuitiv und oft auch rechthaberisch, doch vor allem schenkte sie jedem, dem sie diente, rückhaltlose und nicht anhaftende Liebe. Mitunter war die Angst im Raum so überwältigend, dass ich meditieren musste, um mich zu beruhigen, oder Mitgefühlsübungen machte, indem ich mir vorstellte, dass ich den Schmerz transformierte, dessen Zeuge ich war.
In einer regnerischen Nacht nach einem besonders schweren Tag war ich so durchgeschüttelt, dass ich auf dem Weg zu meinem Zimmer in einer matschigen Pfütze auf die Knie sank und zu schluchzen begann. Meine Versuche, den seelischen Schmerz der Teilnehmer zu lösen, waren nur eine Strategie der Selbstverteidigung, ich wollte mich selbst vor dem Leid schützen.
Da kam Elisabeth zufällig vorbei und las mich auf. Sie nahm mich mit auf ihr Zimmer und bot mir einen Kaffee und eine Zigarette an. »Du musst dich öffnen und den Schmerz durch dich hindurchlassen«, sagte sie. »Es steht dir nicht zu, ihn zu tragen.« Ich glaube, ohne diese Lektion hätte ich nicht auf gesunde Weise in dem Leid präsent sein können, das ich in den folgenden Jahrzehnten miterleben sollte.
Der Dichter und buddhistische Lehrer Stephen Levine hat mich ebenfalls maßgeblich beeinflusst. Mehr als dreißig Jahre lang war er mein wichtigster Lehrer und ein guter Freund. Er war ein mitfühlender Rebell ebenso wie eine intuitive und authentische Führungspersönlichkeit, die verschiedene spirituelle Traditionen verfolgte und geschickt die Dogmen der einzelnen Ansätze vermied. Stephen und seine Frau Ondrea waren wirkliche Pioniere. In der Art und Weise, wie wir für die Sterbenden da sind, führten sie eine sanfte Revolution an. Vieles von dem, was wir im Zen Hospice Project erschaffen haben, geht auf ihre Philosophie zurück.
Stephen zeigte mir, dass es möglich war, mein Lebensleid aufzusammeln und als »Schrot für die Mühle« zu nutzen, es alchemistisch zu verwandeln in den Brennstoff für ein selbstloses Dienen – ohne viel Aufhebens davon zu machen. Zu Beginn gestaltete ich meine Arbeit und mitunter auch mein Verhalten nach seinem Vorbild, wie es treu ergebene Schüler nun mal tun. Er war sehr liebevoll und lieh mir wohlwollend seine Stimme, bis ich meine eigene fand.
Wie kommt es überhaupt, dass wir da sind, wo wir uns jetzt befinden? Das Leben häuft Lerngelegenheiten an und setzt uns ihnen aus; und wenn wir Glück haben, beachten wir sie.
Als ich in meinen Dreißigern in Mexiko und Guatemala herumreiste, meldete ich mich freiwillig zur Unterstützung für die Flüchtlinge Zentralamerikas, die schreckliche Not erlitten hatten, und erlebte entsetzliche Todesfälle mit. In den 1980ern zurück in San Francisco, schlug die Aids-Krise hart zu. Fast dreißigtausend Ortsansässigen wurde Aids diagnostiziert.4 Ich arbeitete an vorderster Front in der häuslichen Pflege, wo ich zu viele Freunde versorgte, die an diesem verheerenden Virus starben.
Schnell war klar, dass diese individuelle Reaktion nicht ausreichte. Daher startete ich in Zusammenarbeit mit meiner lieben Freundin Martha deBarros und einer Handvoll anderer das Zen Hospice Project. In Wahrheit ging die brillante Idee, das Hospiz zu gründen, auf Martha zurück. Sie war die Mutter, die das Programm unter der Schirmherrschaft des San Francisco Zen Center ins Leben rief.
Das Zen Hospice Project war das erste buddhistische Hospiz in Amerika, eine Verschmelzung spiritueller Erkenntnis mit praktischem sozialem Handeln. Wir glaubten, dass ein »zuhörendes Herz« kultivierende Zen-Praktizierende und diejenigen, die gehört werden mussten – im Sterben liegende Menschen –, auf natürliche Weise zusammengehörten. Wir hatten kein Programm und nur wenig Pläne, doch letztendlich bildeten wir tausend Hospizbegleiter aus.
Wir wollten zwar an die Weisheit der 2500 Jahre alten Zen-Praxis anknüpfen, doch hatten wir keinerlei Interesse, ein Dogma oder eine strikt buddhistische Sterbensweise zu vertreten. Meine Devise lautete: »Begegne ihnen da, wo sie sind.« Ich ermutigte unsere Pflegekräfte, die Patienten darin zu unterstützen, selbst herauszufinden, was sie brauchten. Selten brachten wir Menschen bei zu meditieren. Auch stülpten wir ihnen nicht unsere Vorstellung über den Tod oder das Sterben über. Wir gingen davon aus, dass die Menschen, denen wir dienten, uns zeigen würden, wie sie sterben mussten. Wir gestalteten eine wunderschöne offene Umgebung, in der sich die Bewohner geliebt und unterstützt fühlten und in der sie die Freiheit hatten, zu erkunden, wer sie waren und woran sie glaubten.
Ich lernte, dass die praktische Pflege etwas ganz Gewöhnliches ist. Du machst Suppe, gibst eine Rückenmassage, wechselst die Bettwäsche, hilfst bei der Medikamentengabe, hörst dir die Geschichten eines Lebens an, das jetzt zu Ende geht, und bist ruhig und liebevoll präsent. Nichts Besonderes. Eigentlich nichts weiter als Menschenliebe.
Doch bald wurde mir klar, dass uns diese alltäglichen Tätigkeiten – begriffen als Achtsamkeitspraxis – helfen können, uns aus unseren starren Sichtweisen und Vermeidungsstrategien herauszubewegen. Ob wir nun gerade das Bett machen oder ans Bett gefesselt sind, wir müssen uns der Ungewissheit des Lebens stellen. Wir werden uns der grundlegenden Wahrheit bewusst, das alles kommt und geht: jeder Gedanke, jedes Liebesspiel, jedes Leben. Wir sehen, dass in allem Leben auch das Sterben vorhanden ist. Jeder Widerstand gegen diese Wahrheit führt zu Schmerz.
Auch weitere grundlegende Erfahrungen formten die Art und Weise, wie ich dem Leiden begegne, und prägten mein Verständnis davon, was uns der Tod über das Leben lehren kann. Ich schloss mich anderen spirituellen Lehrern an und tat einen großen Sprung ins menschliche Leid, als ich ein einzigartiges Retreat in Auschwitz/Birkenau mitorganisierte. Ich leitete Trauergruppen, begleitete zahllose Menschen durch unheilbare Krankheiten, leitete Retreats für Menschen mit lebensbedrohlichen Krankheiten und organisierte viele – vielleicht zu viele – Gedenkgottesdienste.
Inmitten von alldem wurde ich Vater von vier Kindern und half dabei, sie zu bemerkenswerten Erwachsenen heranwachsen zu lassen, die inzwischen wiederum eigene Kinder haben. Ich kann Ihnen sagen: Vier Teenager zugleich zu erziehen fand ich oft viel härter als die Pflege sterbender Patienten.
Im Jahr 2004 gründete ich das Metta Institute zur Förderung achtsamer, mitfühlender Sterbebegleitung. Ich brachte große Lehrer zusammen, darunter Ram Dass, Norman Fischer, Rachel Naomi Remen und andere, die einen Lehrkörper von Weltklasse bildeten. Es ist ein für die Nachwelt bestimmtes Projekt, das darauf abzielt, der Pflege die Seele zurückzugeben und eine lebensbejahende Beziehung mit den sterbenden Menschen zu kultivieren. Wir haben Hunderte von Fachkräften im Gesundheitswesen ausgebildet und ein nationales Netzwerk zur Unterstützung von Ärzten, Erziehern und Fürsprechern derer gegründet, die es mit lebensbedrohlichen Krankheiten zu tun haben.
Schließlich hatte ich vor mehreren Jahren meine ganz persönliche Gesundheitskrise – einen Herzinfarkt, der mich mit meiner eigenen Sterblichkeit konfrontierte. Die Erfahrung zeigte mir, wie unterschiedlich der Blickwinkel von der anderen Seite der Bettdecke ist. Und stärkte mein Mitgefühl für die Kämpfe umso mehr, die ich bei meinen Schülern, Klienten, Freunden und bei Familienmitgliedern miterlebte.
Wir gehen im Leben so oft weiter, als wir uns je für fähig gehalten hätten, und das Durchbrechen dieser Barriere treibt uns zur Transformation. Irgendwer hat einmal gesagt: »Der Tod kommt nicht zu dir, sondern zu einem Menschen, den die Götter darauf vorbereitet haben.« Das ist ein Gedanke, der sich für mich richtig anfühlt: Der Mensch, der ich heute bin, ist nicht genau derselbe wie der, der sterben wird. Leben und Tod werden mich verändern. Ich werde auf manch grundlegende Weise anders sein. Damit etwas Neues in uns emportauchen kann, müssen wir offen sein für den Wandel.
Im Allgemeinen ist unsere Gesellschaft heute eher als in der Vergangenheit offen für ein Gespräch über den Tod. Es gibt mehr Bücher zum Thema, die Hospizarbeit ist im Spektrum des Gesundheitswesens gut integriert, es gibt Patientenverfügungen, und die ärztliche Sterbebegleitung ist in verschiedenen Staaten und Ländern inzwischen gesetzlich anerkannt.
Dennoch überwiegt immer noch die Meinung, das Sterben sei ein medizinischer Vorgang und wir könnten höchstens hoffen, aus einer schlimmen Lage das Beste zu machen. Ich habe den Schmerz der Menschen miterlebt, wenn sie mit dem Gefühl in den Tod gingen, Opfer der Umstände zu sein, an den schlimmen Auswirkungen von Faktoren zu leiden, die außerhalb ihrer Kontrolle waren, oder – noch schlimmer – wenn sie glaubten, sie selbst trügen die Schuld für ihr Problem. Zu viele Menschen sterben in Bedrängnis, mit Schuldgefühlen und Angst. Dagegen können wir etwas tun.
Wenn Sie ein Leben führen, das durch das Wissen um Ihren Tod erhellt ist, dann prägt dies Ihre Entscheidungen. Viele von uns haben die Vorstellung, zu Hause im Kreise der Menschen zu sterben, die wir lieben und die uns wiederlieben, getröstet von dem, was uns vertraut ist. Doch ist das nur selten der Fall. Während sieben von zehn Amerikanern nach eigener Aussage am liebsten zu Hause stürben,5 verscheiden in Wahrheit siebzig Prozent im Krankenhaus, Pflegeheim oder in einer Langzeitpflegeeinrichtung.6 (In Deutschland wollen nur etwa sechs Prozent ihr Leben im Krankenhaus beenden. Dennoch stirbt auch hier jeder zweite ältere Mensch in einer Klinik.7)
Manche behaupten, man sterbe so, wie man gelebt habe. Meiner Erfahrung nach ist das nicht pauschalisierbar. Doch stellen wir uns einmal vor, wir würden unser Leben im Bewusstsein dessen führen, was uns der Tod zu lehren hat, statt das Unvermeidliche nur meiden zu wollen. Wir können viel darüber lernen, voll und ganz zu leben, wenn wir uns mit dem Tod vertraut machen.
Stellen wir uns einmal vor, wir hörten auf, den Tod vom Leben abzuspalten. Wie wäre es, wenn wir das Sterben als letztes Stadium eines Wachstums verstünden, das uns eine beispiellose Chance zur Transformation bietet? Könnten wir uns dem Tod auch zuwenden wie einem großen Lehrer und uns fragen: »Wie werde ich nun also leben?«
Die Sprache spielt in unserem Verhältnis zum Tod und zum Sterben eine große Rolle. Ich verwende nicht gern den Begriff »die Sterbenden«. Das Sterben ist eine Erfahrung, durch die wir hindurchgehen, aber es ist nicht unsere Identität. Wie in anderen Verallgemeinerungen, bei denen wir Menschen in einen Topf werfen, die eine bestimmte Erfahrung durchlaufen, lassen wir uns damit die Einzigartigkeit der Erfahrung entgehen, die jeder Einzelne uns bieten kann.
Ich habe erlebt, wie ganz gewöhnliche Menschen am Ende ihres Lebens tiefe Einsichten entwickelten und in einen kraftvollen Transformationsprozess eintraten, der sie zu jemandem machte, der größer und weiter und viel wirklicher war als das kleine, abgetrennte Ich, als das sie sich selbst vorher verstanden hatten. Dabei geht es nicht um ein märchenhaftes gutes Ende, das dem vorhergehenden Leiden entgegensteht, sondern eher um die Transzendenz der Tragödie. Es geschieht regelmäßig und bei vielen Menschen, dass sie diese Fähigkeit in den letzten Monaten, Tagen oder mitunter gar Minuten ihres Lebens entdecken.
»Zu spät!«, denken Sie vielleicht. Und möglicherweise würde ich Ihnen zustimmen. Doch liegt der Wert nicht darin, wie lange sie diese Erfahrung genießen konnten, sondern darin, dass die Möglichkeit einer solchen Transformation besteht.
Jeder, der sich mit dem Tod beschäftigen möchte, kann von ihm lernen. Eine Öffnung des Herzens habe ich nicht nur bei Menschen miterlebt, die dem Tode nahe sind, sondern auch bei ihren Pflegern. Sie fanden in sich eine so tiefe Liebe, wie sie es nie vermutet hätten. Sie entdeckten ein tiefes Vertrauen ins Universum und die unverbrüchliche menschliche Güte. Dieses Wissen verließ sie nie mehr, welchem Leid auch immer sie begegnen mochten.
Wenn diese Möglichkeit zum Zeitpunkt des Sterbens gegeben ist, dann ist sie auch hier und jetzt gegeben.
Auf den folgenden Seiten wollen wir genau dieses Potenzial erkunden: die jedem von uns innewohnende angeborene Fähigkeit, zu lieben, zu vertrauen, zu vergeben und im Frieden zu sein. Ich möchte mit meinem Buch an das erinnern, was wir im Grunde schon wissen, was die großen Religionen zu veranschaulichen versuchen und was doch oft in der Vermittlung verlorengeht. Der Tod ist so viel mehr als ein medizinischer Vorgang. Er ist eine Zeit des Wachstums, ein Wandlungsprozess. Der Tod eröffnet uns die tiefsten Dimensionen unseres Menschseins. Er erweckt Präsenz sowie eine Intimität mit uns selbst und allem Lebendigen.
Die großen spirituellen und religiösen Traditionen haben verschiedenste Bezeichnungen für das Unnennbare: das Absolute, Gott, die Buddha-Natur, das wahre Selbst. Diese Begriffe reichen nicht aus. Tatsächlich sind alle Bezeichnungen zu klein gefasst. Es sind nur die Finger, die auf den Mond deuten, und nicht der Mond selbst. Ich möchte Sie einladen, die von mir verwendeten Begriffe so für sich zu übersetzen, dass es für Sie passt, damit Sie sie am besten mit dem verbinden können, was Sie kennen und worauf Sie im tiefsten Innern vertrauen.
Ich werde den einfachen Begriff des Seins verwenden, um auf das zu verweisen, was tiefer und weiter gefasst ist als unsere Persönlichkeit. Allen spirituellen Lehren liegt das Verständnis zugrunde, dass dieses Sein unser tiefstes gütiges Wesen ist. Unser normales Selbstgefühl, die übliche Art und Weise, wie wir das Leben erfahren, ist erlernt. Während wir heranwachsen und uns entwickeln, entsteht eine Konditionierung, die die uns angeborene Güte verdecken kann.
Das Sein hat bestimmte Eigenschaften oder wesentliche Qualitäten, die in jedem von uns als Potenziale vorhanden sind. Diese Qualitäten helfen uns, zu reifen sowie funktionaler und produktiver zu werden. Sie kleiden unser Menschsein aus und fügen unserem Leben Reichtum, Schönheit und Seelenkraft hinzu. Zu diesen reinen Qualitäten gehören Liebe, Mitgefühl, Stärke, Frieden, Klarheit, Zufriedenheit, Demut und Gleichmut, um nur einige zu nennen. Durch Übungen wie die Kontemplation und die Meditation können wir Geist, Herz und Körper beruhigen, was uns wiederum befähigt, unsere Erfahrung feiner und tiefer zu spüren. In der Stille, die wir da entdecken, sind wir in der Lage, die Gegenwärtigkeit dieser angeborenen Qualitäten wahrzunehmen. Sie sind mehr als emotionale Zustände, auch wenn wir sie zunächst als solche fühlen mögen. Es wäre hilfreicher, sie als unser inneres Führungssystem zu verstehen, das uns zu einem größeren Gefühl des Wohlbefindens führen kann.
Diese Aspekte unserer Wesensnatur sind ebenso untrennbar mit unserem Sein verbunden, wie die Nässe zum Wasser gehört. Anders gesagt: Alles, was wir für diese Reise brauchen, haben wir bereits. Es ist alles in uns vorhanden. Wir müssen nicht »jemand ganz Besonderes« werden, um Zugang zu den uns angeborenen Qualitäten zu gewinnen und sie im Dienste einer größeren Freiheit und der Wandlung nutzen zu können.
Ich befand mich in mehr als neuntausend Metern Flughöhe irgendwo oberhalb von Kansas, als ich die fünf Einladungen zum allerersten Mal aufschrieb. Die Rückseite einer Cocktailserviette musste dazu herhalten. Ich war auf dem Weg zu einer Begegnung mit anderen kritischen Denkern auf dem Campus der Princeton University, um an einem sechsstündigen Dokumentarfilm über das Sterben in Amerika mit dem Titel »On Our Own Terms« mitzuwirken. Der Raum war voll mit den führenden Gesundheitsexperten des Landes, Vertretern der ärztlichen Sterbebegleitung, Befürwortern einer neuen Gesundheitsversorgungspolitik und einer Gruppe hartgesottener Journalisten. Das war kein Ort für buddhistische Rhetorik. Der Produzent des Dokumentarfilms, Bill Moyers, zog mich beiseite und fragte, ob ich etwas zum Kern der Sterbebegleitung sagen könne.
Als ich an die Reihe kam, zog ich die Cocktailserviette heraus, auf die ich während des Flugs geschrieben hatte:
Warte nicht.
Heiße alles willkommen, wehre nichts ab.
Gib dich ganz in die Erfahrung.
Finde mitten im Chaos einen Ort der Ruhe.
Kultiviere den Weiß-nicht-Geist.
Die fünf Einladungen sind mein Versuch, die Lektionen zu würdigen, die ich am Sterbebett unendlich vieler Menschen gelernt habe. Es sind fünf Prinzipien, die beide Seiten unterstützen und von Liebe durchdrungen sind. Mir haben sie im Umgang mit dem Tod als verlässliche Führer gedient. Und wie sich zeigt, sind sie ebenso wichtig als Orientierung für ein voll und ganz gelebtes Leben. Menschen in allen möglichen Übergangssituationen und Krisen – wie der Umzug in eine neue Stadt, der Aufbau oder das Ende einer Partnerschaft oder die Lebensumstellung, wenn die Kinder das Haus verlassen haben – können sie ebenso mit großem Gewinn anwenden.
Für mich sind diese Einladungen fünf unerschöpfliche Übungen, die sich ständig weiter erforschen und vertiefen lassen. Sie haben allerdings kaum theoretischen Wert. Um sie zu verstehen, muss man sie leben und aktiv verwirklichen.
Eine Einladung ist die Bitte, bei einem bestimmten Ereignis mitzumachen oder daran teilzunehmen. Dieses Ereignis ist Ihr Leben, und mein Buch möchte Sie dazu einladen, für jeden Aspekt Ihres Daseins voll und ganz gegenwärtig zu sein.
Die erste Einladung
Warte nicht
Was immer wir aus unserem Leben gemacht haben,macht uns zu dem, was wir sind, wenn wir sterben.
Und alles zählt, absolut alles.8
Sogyal Rinpoche
Jack war fünfzehn Jahre lang heroinsüchtig und lebte in seinem Auto. Eines Tages ging er in der Annahme, er habe eine Bronchitis, in die Notaufnahme des San Francisco General Hospital. Ihm wurde Lungenkrebs diagnostiziert. Drei Tage darauf zog er im Zen Hospice Project ein. Seinen Wagen sah er nie wieder.
Jack führte ein Tagebuch, das er mich und andere Hospizbegleiter ab und zu lesen ließ. Er schrieb zum Beispiel:
»Jahrelang habe ich alle möglichen Dinge aufgeschoben. Ich stellte mir vor, ich hätte doch später immer noch jede Menge Zeit. Nur eine große Sache hab ich hingekriegt: den Abschluss meiner Ausbildung zum Motorradmechaniker. Und jetzt sagt man mir, ich hätte nicht mal mehr sechs Monate zu leben. Ich werde ihnen ein Schnippchen schlagen und es länger schaffen.
Aber wem mach ich da eigentlich was vor? Um die Wahrheit zu sagen: Ich hab Angst, bin wütend, müde und durcheinander. Ich bin erst fünfundvierzig Jahre alt und fühle mich, als wäre ich hundertfünfundvierzig. Es gibt so viel, was ich noch machen möchte, und jetzt hab ich nicht mal mehr genug Zeit zum Schlafen.«
Wenn Menschen im Sterben liegen, fällt es ihnen leicht, zu erkennen, dass jede Minute, dass jeder Atemzug zählt. Doch in Wahrheit begleitet uns der Tod schon immer, er gehört zum Leben dazu. Alles ändert sich permanent. Nichts ist von Dauer. Diese Vorstellung kann uns zugleich beängstigen und inspirieren. Doch wenn wir genau hinhören, lautet die Botschaft: »Warte nicht.«
»Das Problem mit dem Wort Geduld«, sagte Zen-Meister Suzuki Roshi, »liegt darin, dass es andeutet, wir würden darauf warten, dass etwas besser wird, dass wir auf etwas Gutes warten, das kommen wird. Ein präziseres Wort für diese Qualität wäre ›Beharrlichkeit‹; es ist die Fähigkeit, in jedem Augenblick bei dem zu bleiben, was ist, und Augenblick um Augenblick die Erleuchtung zu entdecken.«9
Wenn wir uns voll und ganz der Wahrheit verschreiben, dass alles unvermeidlich einmal endet, ermutigt uns das, nicht abzuwarten, sondern gleich damit anzufangen, jeden Augenblick auf zutiefst anteilnehmende Weise zu leben. Wir vergeuden unser Dasein nicht mehr mit sinnlosen Aktivitäten. Wir lernen, nicht mehr so stark an unseren Meinungen, unseren Wünschen und auch nicht mehr so an unserer Identität festzuhalten. Statt die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu richten, fokussieren wir uns auf die Gegenwart und darauf, dankbar für das zu sein, was sich uns jetzt gerade präsentiert. Wir sagen öfter: »Ich liebe dich«, weil wir die Bedeutung menschlicher Verbindung erkennen. Wir werden freundlicher, mitfühlender und versöhnlicher.
Die Einladung »Warte nicht« öffnet uns den Weg zum Erfülltsein, sie ist ein Gegenmittel gegen das Bedauern.
1
Der Zugang zu den Möglichkeiten
Es klingt fast banal, doch muss es ständig betont werden:
Alles ist Schöpfung, alles ist Fluss, alles ist Metamorphose.10
Henry Miller
Als ich Joe den Rücken wusch, blickte er über die Schulter zu mir hin und sagte resigniert: »Ich hätte nie gedacht, dass es so sein würde.«
»Was?«, fragte ich.
»Das Sterben.«
»Was hatten Sie denn gedacht, wie es wäre?«
Er seufzte. »Ich glaube, ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht.«
Joes Bedauern darüber, sich nie Gedanken über seine eigene Sterblichkeit gemacht zu haben, verursachte ihm mehr Leid als sein Lungenkrebs im Endstadium.
Der große koreanische Zen-Meister Seung Sahn war berühmt für seinen Ausspruch »Bald tot«. Dieser verschrobene Weckruf sollte daran erinnern, dass der Tod der »Elefant im Raum« ist: eine große Wahrheit, die wir alle kennen, über die wir aber nicht sprechen. Wir versuchen, sie uns vom Leibe zu halten. Wir projizieren unsere schlimmsten Ängste darauf, probieren es mit Euphemismen, schlagen ihr so gut wie möglich einen Haken oder vermeiden das Gespräch ganz.
Wir können zwar versuchen fortzulaufen, verstecken können wir uns aber nicht.
»Die Verabredung in Samarra« ist eine alte arabische Anekdote, die W. Somerset Maugham in seinem Theaterstück Sheppey wiedererzählt: Ein Händler in Bagdad schickt seinen Diener zum Markt einkaufen. Doch der Mann kehrt kurz darauf mit leeren Händen zurück, bleich und zitternd vor Angst. Er erzählt seinem Herrn, dass ihn in der Menge eine Frau angerempelt habe. Als er sie näher betrachtete, erkannte er sie als den Tod.
»Sie sah mich an und machte eine Drohgebärde«, sagt der Diener. »Bitte leiht mir Euer Pferd, damit ich die Stadt verlassen und meinem Schicksal entgehen kann. Ich werde nach Samarra gehen, dort wird der Tod mich nicht finden.«
Der Händler leiht also dem Diener sein Pferd, und der Mann reitet wie wild davon.
Später geht der Händler zum Markt, um seinen Einkauf selbst zu erledigen. Dort sieht er die Frau, die der Tod ist, und fragt, warum sie seinen Diener so bedroht habe.
»Das war keine Drohgebärde«, antwortet der Tod. »Ich war nur überrascht, ihn hier in Bagdad zu sehen, denn ich werde ihn heute Abend in Samarra treffen.«11
Wenn wir wie Joe die Augen vor der Unausweichlichkeit des Todes verschließen, überrumpelt er uns. Auch wenn wir in die andere Richtung rennen, werden wir doch immer vor seiner Tür landen. Es scheint nur so, als habe sich der Tod an uns herangeschlichen; dabei haben wir nur die Hinweise übersehen, die er »offen sichtbar versteckt« hatte.
Meist leben wir in dem Bewusstsein, der Tod komme irgendwann »später«. Wir bräuchten uns doch nicht jetzt schon so viele Sorgen darum zu machen. Das »Später« schafft die bequeme Illusion einer sicheren Distanz. Doch ständiger Wandel und Vergänglichkeit finden nicht in der Zukunft statt. Sie geschehen gerade jetzt. Der Wandel ist die Norm.
Uns ist eine große Enttäuschung sicher, wenn wir uns festklammern in der Hoffnung, dass sich die Dinge nie verändern werden. Das ist eine unangemessene Erwartung an das Leben. Mein Vater mahnte mich als Jugendlichen oft, »jeden Augenblick zu genießen. Er vergeht mit einem Wimpernschlag.« Ich glaubte ihm nicht. Einige Jahre später starb meine Mutter. Ich hatte keine Chance, mich von ihr zu verabschieden oder ihr zu sagen, dass ich sie liebte. Ich hatte in einer Art Traum gelebt. Das Bedauern darüber hielt mich über viele Jahre in seinen Fängen.
George Harrison sang die Wahrheit in den Worten »All things must pass« (»Alles muss vergehen«). Dieser Augenblick macht dem nächsten Platz. Alles schwindet vor unseren Augen. Das ist kein Zaubertrick. Es ist eine Tatsache des Lebens. Die Vergänglichkeit ist eine wesentliche Wahrheit, die ins Gewebe unserer Existenz eingewebt ist. Sie ist unausweichlich, völlig natürlich und unsere beständigste Gefährtin.
Ein Geräusch kommt und ist schon wieder vorbei. Ein Gedanke taucht auf und vergeht so schnell, wie er gekommen ist. Ein Anblick, ein Geschmack, eine Berührung, ein Gefühl – sie alle sind sich gleich: vergänglich, fließend, flüchtig.
Mein blondes Haar ist schon lange verschwunden. Die Schwerkraft macht mir mehr zu schaffen – meine Muskeln sind schwächer, meine Haut ist weniger elastisch, meine Körperfunktionen haben sich verlangsamt. Dies ist kein Fehler. Es ist Teil des natürlichen Alterungsprozesses.
Wo ist meine Kindheit geblieben? Wo das Liebesspiel der letzten Nacht? Alles, was heute da ist, wird morgen nur noch Erinnerung sein. Verstandesmäßig ist uns vielleicht klar, dass die Lieblingsvase unserer Mutter eines Tages vom Regal fallen und das Auto eine Panne haben wird oder dass die Menschen, die wir lieben, sterben werden. Unsere Arbeit besteht darin, dieses Verstehen vom Verstand ins Herz zu verlagern und dort tief zu verankern.
Die Evolution macht dieses unabänderliche Gesetz deutlich, wenn sie den Wandel in den verschiedensten Maßstäben von der Mikro- bis in die Makroebene zeigt. Die Vergrößerung einer menschlichen Zelle im Elektronenmikroskop zeigt eine wunderbare Struktur. Der Kern, das oszillierende Feld, die rhythmischen Wellen, selbst kleinere, in ständigem Fluss befindliche Partikel leben und sterben von Augenblick zu Augenblick.
Wenn wir durch das Hubble-Teleskop schauen, beobachten wir genau diese Dynamik. Unser sich ständig ausdehnendes Universum ist Gegenstand derselben Prozesse. Sicher, Planeten mögen länger leben als menschliche Zellen. Die Sonne wird vermutlich noch ein paar Milliarden Jahre so weitermachen wie bisher. Doch selbst die größten Galaxien haben die Eigenschaft der Vergänglichkeit. Sie formen sich aus großen Gaswolken, die Atome verbinden sich, und an einem bestimmten Punkt entstehen daraus Sterne. Mit der Zeit schwinden die einen, andere wiederum explodieren. Ähnlich wie wir werden Galaxien geboren, sie leben eine Zeitlang, und schließlich sterben sie.
Vor Jahren war ich engagiert in einem kleinen Kindergartenprogramm. Gelegentlich gingen wir mit den Drei- bis Fünfjährigen in den nahe gelegenen Wald und stellten ihnen die Aufgabe, »tote Sachen« zu finden. Die Kinder liebten dieses Spiel. Glücklich sammelten sie heruntergefallene Blätter, abgebrochene Zweige, ein rostiges Autoteil und mitunter die Knochen einer Krähe oder eines anderen kleinen Tieres. Wir legten diese Entdeckungen auf einer großen blauen Plane zwischen Tannen aus, damit die Kinder sie den anderen zeigen und etwas dazu erzählen konnten.
Die Kinder waren noch so klein, dass sie keine Angst kannten, sie waren nur neugierig. Sie untersuchten jedes Stück sorgfältig, rieben es zwischen den Fingern, rochen daran – sie erkundeten die »toten Sachen« hautnah und jedes auf seine Weise. Dann erzählten sie von ihren Entdeckungen.
Manchmal erfanden sie die erstaunlichsten Details über die Geschichte eines Gegenstands. Wie ein rostiges Autoteil von einem Stern oder einem gerade vorbeifliegenden Raumschiff heruntergefallen war oder wie ein Blatt von einer Maus als Bettlaken genutzt wurde, bis der Sommer kam und sie es nicht länger brauchte.
Ich erinnere mich, wie ein Kind sagte: »Ich denke, dass die Blätter, die von den Bäumen fallen, sehr gütig sind. Sie machen Platz für die kleinen neuen, damit sie wachsen können. Es wäre traurig, wenn sich die Bäume keine neuen Blätter wachsen lassen könnten.«
Obwohl wir die Vergänglichkeit meist mit Traurigkeit und Abschied assoziieren, geht es also gar nicht immer um den Verlust. Auch im Buddhismus wird die Vergänglichkeit als Gesetzmäßigkeit von Wandel und Werden gesehen. Diese beiden sich gegenseitig bedingenden Prinzipien sorgen für Gleichgewicht und Harmonie. Gerade so, wie es ein ständiges »Sichauflösen« gibt, ist auch das ständige »Werden« da.
Wir verlassen uns auf die Vergänglichkeit. Die Erkältung, die Sie heute beeinträchtigt, wird nicht ewig andauern. Dieses langweilige Abendessen wird ein Ende haben. Schlimme Diktaturen zerfallen und werden durch gedeihende Demokratien ersetzt. Uralte Bäume brennen nieder, damit neue geboren werden können. Ohne die Vergänglichkeit wäre kein Leben möglich. Ohne die Vergänglichkeit könnte Ihr Sohn nicht seine ersten Schritte tun. Ihre Tochter könnte nicht zur Abi-Fete gehen und erwachsen werden.
So wie große Flüsse aus dem Zusammenfließen vieler kleinerer entstehen, ist unser Leben eine Reihe verschiedener Augenblicke, die sich verbinden und den Eindruck eines einzigen kontinuierlichen Flusses vermitteln. Wir bewegen uns von Ursache zu Wirkung, von Ereignis zu Ereignis, von einem Punkt zum nächsten, von einem Seinszustand in einen anderen. Oberflächlich betrachtet, vermittelt das den Eindruck, unser Leben sei eine einheitliche, kontinuierliche Bewegung. In Wahrheit trifft das nicht zu. Der Fluss von gestern ist nicht derselbe wie der Fluss von heute. Um es mit den Weisen auszudrücken: »Wer in dieselben Flüsse hinabsteigt, dem strömt stets anderes Wasser zu.«12
Jeder Augenblick wird geboren und stirbt. Und auf sehr reale Weise werden wir mit ihm geboren und sterben mit ihm. In all dieser Vergänglichkeit liegt eine Schönheit. In Japan feiern die Menschen jedes Frühjahr die kurze, aber überreiche Kirschblüte. Draußen vor der Hütte in Idaho, wo ich unterrichte, leben die blauen Blüten des Leins nur einen einzigen Tag. Warum wirken solche Blumen so viel prachtvoller als Plastikblumen? Die Zerbrechlichkeit, die Kürze und die Unsicherheit ihres Lebens vereinnahmen uns, laden uns in die Schönheit, ins Staunen und in die Dankbarkeit ein.
Zerstörung und Schöpfung sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Im Jahr 1991 besuchte seine Heiligkeit der Dalai Lama San Francisco. In Vorbereitung auf seine Ankunft hatten tibetische Mönche im Museum für Asiatische Kunst im Golden Gate Park ein Mandala aus Sand geschaffen. Mit Hilfe winziger Werkzeuge ließen sie in einem komplexen Muster wunderbar gefärbte Kristalle auf den Boden rieseln. Das heilige Kunstwerk, das das Kalachakra oder das Rad der Zeit darstellte, wies einen Durchmesser von 1,8 Metern auf. Die Mönche hatten viele Tage unermüdlich daran gearbeitet, bis es vollendet war.
Doch nicht lange nachdem das Mandala fertig war, sprang eine gestörte Frau über das Samtseil, das um das fragile Gebilde aufgespannt war. Sie durchstürmte es wie ein Tornado, trat wild im Sand herum und zerstörte das sorgfältige Handwerk der Mönche vollständig.
Die Museumsleitung und die Sicherheitskräfte waren schockiert. Sie packten die Frau, riefen die Polizei und ließen sie festnehmen.
Die Mönche dagegen blieben gelassen. Sie versicherten der Museumsleitung, dass sie gern ein neues Mandala erstellen würden, in einer Woche wäre dieses ohnehin in einer Auflösungszeremonie wieder auseinandergenommen worden. Sie ließen den Sand des zerstörten Mandalas ruhig von der Golden Gate Bridge rieseln und fingen wieder von vorn an.
Lobsang Samten, der für die sandmalenden Mönche sprach, sagte zu den Reportern: »Wir haben keine negativen Gefühle [gegenüber dieser Frau]. Wir wissen nichts über ihre Gründe. Wir beten für sie in Liebe und Mitgefühl.«13
Für die Mönche hatte das Mandala seinen Sinn erfüllt. Seine Erschaffung und Zerstörung waren von Anfang an als Lehrstück für die Natur des Lebens vorgesehen.
Das Museumspersonal betrachtete das Mandala als unersetzbares Kunstwerk, als kostbaren Gegenstand. Für die Mönche war das Mandala ein Prozess, dessen Wert und Schönheit gerade darin bestand, dass es die Vergänglichkeit und die Nichtanhaftung lehrte.
In den Alltag übertragen, machen wir beim Kochen oder Backen eine ähnliche Erfahrung wie die Mönche bei der Erschaffung ihres Mandalas. Ich liebe es beispielsweise, Brot zu backen – das Wiegen der Mengen, das Mischen der Zutaten, das Jonglieren mit den Töpfen, das Kneten, das Gehenlassen des Teigs, das Bräunen des Brots im Ofen, das Schneiden des Brotlaibs und das Auftragen der Butter auf die Scheiben. Und dann ist das Brot weg. Mit jeder gut zubereiteten Mahlzeit, die wir mit Freude verzehren, vollziehen wir eine kleine Feier der Vergänglichkeit.
Zunächst einmal macht uns die Tatsache der Vergänglichkeit große Angst. Als Reaktion versuchen wir, alles so solide und sicher wie möglich zu machen. Wir tun unser Bestes, um unsere Lebensbedingungen zu gestalten und die Umstände so zu manipulieren, dass wir glücklich sein können.
Ich liege beispielsweise sehr gern im Bett, vor allem an einem kalten Wintermorgen. Die Laken sind weich und warm. Mein Körper ist ausgeruht und liebt die Zuflucht unter der Bettdecke. Mein Geist ist friedlich und noch nicht mit den Aufgaben des Tages beschäftigt. Für eine Weile ist die Welt in Ordnung. Ein perfekter Augenblick.
Und dann muss ich zur Toilette.
Ich widerstehe noch einen Moment, dann laufe ich schnell ins Bad. Nun fühle ich mich vorübergehend erleichtert und krieche wieder unter die Bettdecke – in der Hoffnung, noch einmal diesen perfekten Augenblick zu erleben. Doch ich kann nicht alles wieder genauso haben, wie es wenige Momente zuvor noch gewesen war. Ich kann keine Bedingungen schaffen, die für einen anhaltenden Glückszustand sorgen, wenn dieser Zustand den Wandel nicht zulässt.
Wie die meisten Menschen schätze ich gute Lebensbedingungen. Ich gehöre zu den Glücklichen, die genug zu essen, eine intakte Familie und wunderbare Freunde haben, und ich führe ein sehr schönes, behagliches Leben. Ich bin kein Vertreter eines asketischen Lebensstils. Mir geht es aber darum, dass wir lernen, harmonisch mit dem ständigen Wandel zu leben.
Normalerweise gestalten wir uns die Welt, indem wir Angenehmes suchen und Unannehmlichkeiten möglichst aus dem Weg gehen. Das scheint nur allzu natürlich, oder? Dabei machen wir uns selbst etwas vor, weil wir unsere Lebensumstände zwar manchmal so beeinflussen können, dass sie uns vorübergehendes Glück bringen. Das fühlt sich in dem Augenblick gut an, doch bald schon ist der Moment vorbei, und wir müssen wieder nach der nächsten befriedigenden Erfahrung suchen.
Das einzig Beständige im Leben ist der Wandel. Gibt es, wenn wir genau hinschauen, noch irgendetwas anderes? Sollten wir nicht gemäß dieser Wahrheit leben, kann endloses Leid die Folge sein. Das wiederum fördert unsere Ignoranz und ist der Nährboden für Gier, Abwehrverhalten und Bedauern. Diese Einstellungen verhärten sich zum Charakter und haben eine große Kraft, die sich häufig in der Zeit des Sterbens zeigt und den Menschen darin behindert, seinen Frieden zu finden.
Eines Tages kamen drei große, kräftige Frauen mittleren Alters in mein winziges Büro im Zen Hospice Project. Sie waren Schwestern und jüdischen Glaubens. Die eine war, wie sich herausstellte, eine hochrangige kommunalpolitische Beraterin. Ihre Mutter lag im Sterben, und der Arzt, ein Spezialist für Gehirntumoren, hatte sie zu mir geschickt.
Ich begann, ihnen von der Art unserer Pflege zu erzählen, davon, was wir taten und wie wir den Glauben eines jeden respektierten. Doch ich sah, dass sie mir nicht glaubten. Sie schauten auf die karge Einrichtung und den begrenzten Raum meines Büros, in das wir kaum alle hineinpassten.
Linda, die Beraterin, fragte rundheraus: »Warum sollten wir unsere Mutter hierherbringen? Richten wir ihr doch ein nettes Zimmer im Fairmont Hotel und mieten Pflegepersonal dazu, das rund um die Uhr bei ihr ist. Warum sollten wir nicht das tun, wenn wir es uns doch leisten können?«
Ich antwortete: »Das können Sie natürlich gern machen. Und ich könnte Ihnen ein paar Leute empfehlen, die Ihnen behilflich sind.« Dann machte ich eine Pause und griff nach einer Broschüre mit Fotos von unserem Hospiz. »Aber darf ich Sie um eine Kleinigkeit bitten? Zeigen Sie Ihrer Mutter diese Fotos, damit sie sehen kann, wie es hier aussieht, und bitten Sie sie um ihre Meinung.«
Als sie kurz darauf gingen, dachte ich, ich würde diese Frauen nie wiedersehen. Doch eine Dreiviertelstunde später klingelte das Telefon. Ich erkannte sofort Lindas scharfe, energische Stimme. »Mutter möchte Sie sehen«, sagte sie.
Man hatte mich vorgeladen. Ich fand mich also im Krankenzimmer der Mutter in einer der feinsten Einrichtungen San Franciscos ein. Hier traf ich nicht nur die drei Töchter, sondern auch ihren Rabbi, den Gehirntumorspezialisten und einen Psychiater an. Alle sahen mich erwartungsvoll an.
Ich stellte mich Abigail, der Mutter, vor. Sie saß ruhig im Bett, blätterte die Broschüre durch und fragte mich alles Mögliche. »Kann ich mein Chinaporzellan mitbringen?«
»Natürlich. Sie können etwas davon mitbringen«, antwortete ich.
»Wie sieht es mit meinem Schaukelstuhl aus? Ich liebe meinen Schaukelstuhl.«
»Natürlich. Sie können den Schaukelstuhl mitbringen.«
Plötzlich erstarrte Abigail. »Moment mal. Da gibt es kein Bad in meinem Zimmer? Sie wollen, dass ich über den Flur gehe, wenn ich auf die Toilette muss?«
Ich schaute ihr in die Augen. »Sagen Sie mir. Stehen Sie derzeit häufig auf, um zur Toilette zu gehen?«
Abigail ließ sich zurück auf das Kissen sinken. »Nein, ich gehe nicht zur Toilette. Ich kann gar nicht mehr laufen.« Dann wandte sie sich ihren Töchtern zu und sagte: »Ich möchte mit ihm gehen.«
Was Abigail gefiel, war wahrscheinlich die Tatsache, dass ich mich nicht gegen ihre Kratzbürstigkeit auflehnte und nicht versuchte, sie zu jemand anderem zu machen. Sie schätzte meine Ehrlichkeit. Sie konnte darauf vertrauen. Sie hatte keine Ahnung, wie sie durch den Sterbeprozess gehen sollte, aber sie glaubte, ich wisse es. Sie wusste, dass sie sich bei uns sicher fühlen konnte.
Am nächsten Tag zog Abigail bei uns ein. Eine Woche später starb sie. Ihre Töchter waren bei ihr, als sie starb.
Abigails Haltung änderte sich, als sie bereit war, sich der Wahrheit des aktuellen Augenblicks zu stellen – ehrlich zu sein, nicht davor zurückzuschrecken oder sich abzuwenden. Sie erkannte, dass sie vergänglich war und dass all ihre Lebensumstände im Fluss waren. Sie begab sich in die Übereinstimmung mit dem Gesetz von Wandel und Werden.
Es ist sehr kraftvoll, zu benennen, was gerade jetzt, in diesem Moment, vor sich geht. Statt an der Vergangenheit festzuhalten, kommen wir in Einklang mit der Wahrheit unserer gegenwärtigen Umstände und können das Kämpfen lassen.
Warum warten, bis wir sterben, um den Kampf aufzugeben und frei zu sein?
Die Vergänglichkeit lässt uns demütig werden. Sie ist absolut gewiss, doch können wir überhaupt nicht vorhersehen, in welcher Form sie sich zeigen wird. Wir haben kaum Kontrolle darüber. Entweder weichen wir ängstlich vor diesem Dilemma zurück, oder wir entscheiden uns für eine ganz andere Reaktion.
Das Geschenk der Vergänglichkeit liegt darin, dass sie uns direkt ins Hier und Jetzt verortet. Wir wissen, dass alles, was geboren wird, mit dem Tod endet. In diesem Bewusstsein können wir den Moment womöglich genießen und mehr Wertschätzung und Dankbarkeit in unser Leben einfließen lassen. Wir wissen, dass alles Sammeln damit endet, dass es wieder zerstreut wird. In diesem Bewusstsein können wir womöglich Einfachheit praktizieren und entdecken, was wahren Wert hat. Wir wissen, dass alle Beziehungen mit der Trennung enden. In diesem Bewusstsein können wir vielleicht vermeiden, von Trauer überwältigt zu werden, und Liebe von Anhaftung unterscheiden.
Die Aufmerksamkeit für den ständigen Wandel kann helfen, uns auf die Tatsache vorzubereiten, dass der Körper eines Tages sterben wird. Doch besteht ein unmittelbarerer Nutzen dieses Bewusstseins darin, dass wir lernen, schon hier und jetzt entspannter mit der Vergänglichkeit umzugehen. Wenn wir sie voll und ganz bejahen, tritt eine gewisse Gnade in unser Leben. Wir können – ohne uns zu sehr festzuklammern – Erfahrungen wertschätzen und auf tiefster Ebene fühlen. Wir sind frei und können das Leben genießen, die Beschaffenheit jedes vergehenden Augenblicks voll und ganz ertasten, gleich, ob es sich dabei um einen traurigen oder fröhlichen handelt. Wenn wir im Innersten verstehen, dass die Vergänglichkeit im Leben von allem steckt, dann lernen wir, den Wandel besser auszuhalten. Wir bringen allem mehr Wertschätzung entgegen und werden belastbarer.
In einem Essay schrieb Carol Hyman:
»Wenn wir lernen, uns ins Ungewisse loszulassen und darauf zu vertrauen, dass sich unser grundlegendes Wesen und das Wesen der Welt nicht unterscheiden, dann ist die Tatsache, dass die Dinge nicht dauerhaft und festgelegt sind, keine Bedrohung mehr, sondern eine befreiende Chance.«14
Alles wird auseinanderfallen. Das gilt für unseren Körper wie für unsere Beziehungen und für das Leben insgesamt. Es geschieht die ganze Zeit, nicht erst am Ende, wenn der Vorhang fällt. Zusammenzukommen bedeutet unvermeidlich, irgendwann Abschied zu nehmen. Das muss nichts Beunruhigendes sein. Das Leben ist so.
Unser Erdendasein ist nichts Dauerhaftes und Festgelegtes. Mit diesem Wissen im tiefsten Innern bereiten wir uns auf den Tod und auf Verluste jeglicher Art vor und bejahen den ständigen Wandel voll und ganz. Wir sind nicht nur durch unsere Vergangenheit determiniert; wir sind im Werden. Wir können Groll loslassen. Wir können vergeben. Wir können uns von allem Groll und Bedauern befreien, bevor wir sterben.
Warten Sie nicht damit. Was wir brauchen, befindet sich direkt vor unseren Augen. Die Vergänglichkeit ist der Zugang zu den Möglichkeiten. Wenn wir sie bejahen, finden wir wahre Freiheit.
2
Zugleich hier und im Verschwinden begriffen
Geh beim Verlauf deines eigenen Verschwindens in die Lehre.15
David Whyte
D