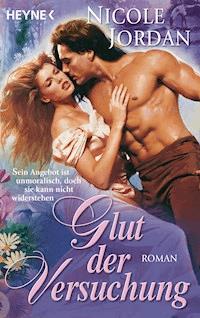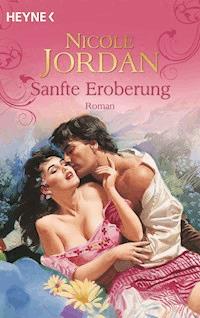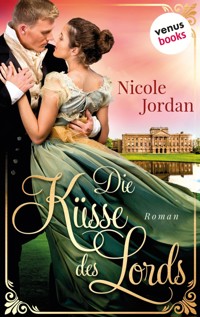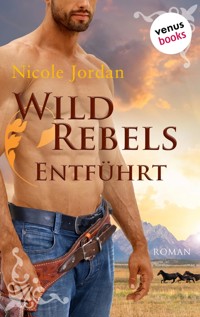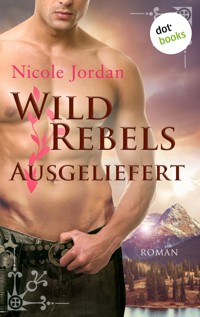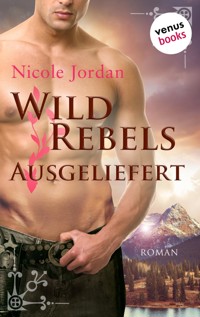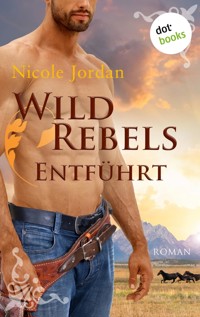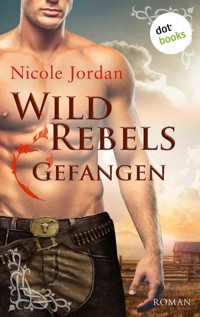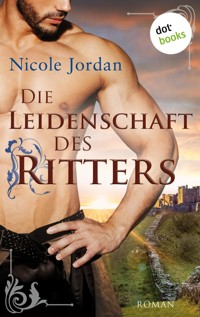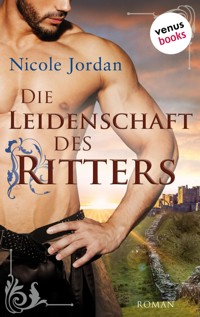Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie war seine Geisel – nun legt sie sein Herz in Ketten: Das Romance-Highlight »Die Gefangene des Wüstenprinzen« von Bestseller-Autorin Nicole Jordan jetzt als eBook bei dotbooks. 1847, Algerien. Schon lange ist Lady Alysson einem Offizier der britischen Armee versprochen, doch die Schöne denkt gar nicht daran, sich gleich nach ihrer Ankunft in den Hafen der Ehe zu fügen. Erst will sie die Geheimnisse dieses berauschenden Landes ergründen … doch der Zauber verfliegt schnell, als Alysson von einem Berberprinzen verschleppt wird. Sie soll seine Rache an Alyssons Verlobtem sein, mit dem Jafar eine bittere Fehde verbindet. Doch bald schon spricht Jafars glühender Blick nicht nur von Zorn, sondern auch von dem Begehren nach seiner unschuldigen Gefangenen. Wird Alysson seiner ungezügelten Leidenschaft widerstehen und seinen Fängen entkommen können? Oder wartet ihr Schicksal womöglich genau dort, in den Armen des Wüstenprinzen? »Nicole Jordan versteht es meisterhaft, ihren Fans ein sinnliches Lesevergnügen zu bieten.« Romantic Times Books Reviews Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Liebesroman »Die Gefangene des Wüstenprinzen« von Bestseller-Autorin Nicole Jordan. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
1847, Algerien. Schon lange ist Lady Alysson einem Offizier der britischen Armee versprochen, doch die Schöne denkt gar nicht daran, sich gleich nach ihrer Ankunft in den Hafen der Ehe zu fügen. Erst will sie die Geheimnisse dieses berauschenden Landes ergründen … doch der Zauber verfliegt schnell, als Alysson von einem Berberprinzen verschleppt wird. Sie soll seine Rache an Alyssons Verlobtem sein, mit dem Jafar eine bittere Fehde verbindet. Doch bald schon spricht Jafars glühender Blick nicht nur von Zorn, sondern auch von dem Begehren nach seiner unschuldigen Gefangenen. Wird Alysson seiner ungezügelten Leidenschaft widerstehen und seinen Fängen entkommen können? Oder wartet ihr Schicksal womöglich genau dort, in den Armen des Wüstenprinzen?
»Nicole Jordan versteht es meisterhaft, ihren Fans ein sinnliches Lesevergnügen zu bieten.« Romantic Times Books Reviews
Über die Autorin:
Nicole Jordan wurde 1954 in Oklahoma geboren und verlor ihr Herz restlos an Liebesromane, als ihre Mutter ihr zum ersten Mal aus »Stolz und Vorurteil« vorlas. Nicole Jordan eroberte mit ihren historischen Liebesromanen wiederholt die »New York Times«-Bestsellerliste und wurde mehrmals für den begehrten RITA Award nominiert. Heute lebt Nicole Jordan in Utah.
Nicole Jordan veröffentlichte bei dotbooks auch ihre historischen Liebesromane »Die Leidenschaft des Ritters« und »In den Fesseln des Piraten«.
Außerdem veröffentlichte sie in der »Regency Love«-Reihe:
»Die Küsse des Lords«
»Die Sehnsucht der Lady«
»Die Versuchung des Marquis«
Und in der »Rocky Mountains«-Reihe:
»Wild Rebels – Gefangen«
»Wild Rebels – Entführt«
»Wild Rebels – Ausgeliefert«
***
eBook-Neuausgabe Januar 2020
Dieses Buch erschien bereits 1997 unter dem Titel »Der Sohn des Scheichs« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1992 by Anne Bushyhead
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel »Lord of Desire« bei Avon Books.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1997 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
By arrangement with Spencerhill Associates
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Langenbuch & Weiß Literaturagentur, Hamburg/Berlin.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von
© shutterstock / mrbigphotos / Kochneva Tetyana / Purpurink / Annuitti / FXQuadro
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-999-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Gefangene des Wüstenprinzen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Nicole Jordan
Die Gefangene des Wüstenprinzen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Christa von Hadeln
dotbooks.
Wenn Lieb' in eines Mannes Brust ihr Zelt hat aufgeschlagen, Ist seine Ruhe hin, sein Leben schwer zu tragen. Wird diese Liebe tödlich, verdienet man fürwahr Des Arztes Lohn, zu bannen die Gefahr: Das Wasser, das er trinkt, befreit ihn nicht aus Todesnot, Wie frisch vergossnes Blut schmeckt ihm sein täglich Brot. Mit einer Schwäche, Ohnmacht, Nichtigkeit als waffenloser Held, Treibt dennoch ihn die Liebe auf ihres Kampfes Feld. Ahnungsvoll bleibt er, was auch er zu sich nimmt, Wenn er ums Leben in einem Meer von Sorgen schwimmt.
FARID UD-DIN ATTAR12. Jahrhundert
Prolog
Kent, England1840
Der knochige Berberhengst paßte nicht so recht in das Bild, das der stattliche Familiensitz des Herzogs von Moreland bot. Der prächtige, sonnengelbe Bau mit den klassisch ausgewogenen Proportionen stellte den Inbegriff von Eleganz und Würde dar, während die großzügig angelegten Rasenflächen mit den kunstvoll beschnittenen Taxushecken von gärtnerischer Architektur in höchster Vollendung zeugten.
Im Gegensatz dazu machte der feurige Berberhengst mit den hohen Beinen, dem sehnigen Körper und der langen dichten Mähne einen eher wilden Eindruck. Beim genaueren Hinsehen hatte er eine entfernte Ähnlichkeit mit den schlanken Vollblütern in den berühmten herzoglichen Ställen. Dieses Pferd war auf Ausdauer und Schnelligkeit und für den Überlebenskampf in der erbarmungslosen Wüste der Sahara gezüchtet worden. Ein livrierter Stallbursche bemühte sich, das ungeduldig schnaubende Tier am Zaumzeug festzuhalten, das jetzt zu allem Übel auch noch heftig mit den Hufen im Kies scharrte. Anscheinend konnte der kastanienbraune Hengst kaum mehr die Rückkehr seines Herrn erwarten.
Der Reitersmann, der jetzt die breiten Steinstufen vor dem herzoglichen Anwesen hinuntereilte, paßte ebenfalls nicht recht in diese vornehme Umgebung, trotz des maßgeschneiderten Reitrocks, des sorgsam gebundenen schwarzseidenen Halstuches und seines Anspruchs auf eine aristokratische Abstammung. Der junge Herr war der Enkel des Herzogs. Die gebräunte Haut, die kantigen Gesichtszüge und der scharfe Adlerblick verliehen ihm jedoch eine rücksichtslose Härte, die ein traditionell erzogener englischer Gentleman seiner Klasse niemals besitzen würde. Es war auch keineswegs stilgerecht, wie er sich auf den Rücken des Braunen schwang und ihn herumriß, als ob er im Sattel geboren wäre.
Die Muskeln des Pferdes spannten sich erwartungsvoll, als der Reiter aufsaß. Ungeduldig fieberte es der wiedergewonnenen Freiheit entgegen.
Aber Nicolas Sterling hielt die Zügel des Hengstes straff, als er zwischen den ehrwürdigen hohen Eichen auf dem Kiesweg davonritt. Wie immer drängte es ihn, das herzogliche Haus so schnell wie möglich zu verlassen, aber dieses Mal beherrschte er seine Ungeduld und zeigte seinem Großvater ein letztes Zeichen von Gehorsam und Respekt. Die Unterredung mit ihm war erfolgreich abgeschlossen. Er war frei und unabhängig und würde jetzt sein eigenes Leben führen. Zehn Jahre. Zehn lange Jahre in diesem fremden Land. Wie eine Gefangenschaft hatte er diese Zeit empfunden. Endlich konnte er die ihm aufgezwungene englische Erziehung und den englischen Namen, den er hatte annehmen müssen, abschütteln.
Der Geschmack der Freiheit brannte ihm auf der Zunge; sie schmeckte wie die würzige Herbstluft und war so lebendig wie die riesigen Eichen, deren Blätterdach sich allmählich zu färben begann. Seine Stimmung schien sich auf den Hengst zu übertragen. Mit weit geöffneten Nüstern und nach vorn gestellten Ohren tänzelte er leichtfüßig die bekieste Allee entlang.
Das Pferd scheute nicht, als eine Eichel auf seinen Kopf prallte und zu Boden sprang; das war das Ergebnis seiner Dressur. Geistesabwesend lobte Nicolas das Tier mit ein paar gemurmelten Worten; in Gedanken beschäftigte er sich bereits mit der bevorstehenden Abreise aus England.
Im nächsten Augenblick hörte er ein sonderbares Geraschel, dann ein dumpfes Geräusch, als ihm der seidene Zylinder vom Kopf schwebte und auf dem Weg landete. Der Kies spritzte hoch auf, als er den Hengst herumriß. Nicolas Sterling griff instinktiv nach dem Dolch an der Seite – eine Gewohnheit aus seiner Jugendzeit – bevor er sich bewußt wurde, daß er in diesem friedlichen Land keinen Grund hatte, eine Waffe zu tragen. Aber er hatte nicht erwartet, daß ihm von einem britischen Baum Gefahr drohen könnte.
Oder von einem weiblichen Wesen.
Aber genau das war der Fall, als er überrascht nach oben blickte. Er konnte sie kaum erkennen. Nur die Eicheln verrieten sie. Das schwarze Kleid verschwand beinahe zur Gänze im dichten Schatten des Eichenlaubs. Selbst als er durch die Zweige nach ihr spähte, warf sie eine weitere Eichel auf seinen am Boden liegenden Hut und verfehlte ihn nur knapp.
Der braune Hengst bäumte sich auf, warf den edlen Kopf zurück und schnaubte bedrohlich. Beruhigend legte Nicolas eine Hand auf den Nacken des Pferdes, aber er verzog ärgerlich das Gesicht.
»Die erste Eichel«, sagte er ruhig, »hielt ich irrtümlicherweise für naturgegeben, und die zweite, mit der du nach meinem Hut zieltest, entschuldigte ich als Zufall. Die dritte aber nicht. Vielleicht möchtest du wissen, welche Folgen eine vierte nach sich ziehen würde?«
Als sie nicht antwortete, verengten sich Nicolas Augen.
Jetzt hatte sich sein Blick an die Schatten gewöhnt, und er sah deutlich, daß der Störenfried auf dem überhängenden Ast ein junges, braunhaariges Mädchen von ungefähr dreizehn Jahren war. Der Rocksaum der kleinen Göre schwebte ungefähr vier Fuß über ihm, so daß ihre langen spitzenverzierten Unterröcke zu sehen waren.
Er schickte einen wütenden Blick nach oben und bekräftigte ihn mit einer drohenden Handbewegung. Die kleine Göre aber warf nur verächtlich den Kopf zurück. »Ich pfeif auf die Folgen. Mir jagen Sie keine Angst ein.«
Diese ungewöhnliche Antwort verschlug ihm die Sprache. Er war es nicht gewohnt, von einem weiblichen Wesen, noch dazu einem Kind, herausgefordert zu werden. Während Nicolas sie anstarrte, wußte er nicht, ob er die Kleine übers Knie legen oder das Ganze mit einem Schmunzeln abtun sollte. Er entschied sich fürs erstere und setzte eine angemessen strenge Miene auf.
»Wenn du eine weitere Eichel wirfst«, warnte er sie, »sehe ich mich gezwungen, dir für deine Ungezogenheit eine Tracht Prügel zu verabreichen.«
Daraufhin schob sich das Kinn des Mädchens noch ein paar Inch nach oben. »Da müssen Sie mich erst einmal fangen.«
»Oh, verlaß dich drauf! Und glaube mir, es wird dir noch leid tun, wenn du mich zwingst, dir nachzuklettern.« Seine Stimme war angenehm weich und dunkel, doch schwang eine nicht zu überhörende Drohung mit. »Nun, muß ich dich entwaffnen, oder bist du bereit, dich kampflos zu ergeben?«
Den drohenden Unterton mußte sie herausgehört haben. Nach kurzem Zögern ließ sie eine Handvoll Eicheln zu Boden fallen.
Nicolas war zufrieden. Sie würde es nicht erneut wagen, ihn oder den Hengst mit ihren Geschossen zu bombardieren. Aber er konnte nicht zulassen, daß sie weitere arglose Reiter aufs Korn nahm. »Du hättest dir Gedanken darüber machen sollen, was dabei passieren kann«, sagte er jetzt im Plauderton. »Wenn mein Pferd weniger gut geschult wäre, hätte es scheuen können, sich womöglich verletzt oder mir Schaden zugefügt.«
»Ich habe nicht auf Ihr Pferd gezielt, nur auf Ihren Hut. Nie würde ich einem Tier etwas antun. Außerdem hat es nicht gescheut, und Sie hatten keine Mühe, es zu halten, obwohl es so wild aussieht.«
»Du nimmst wohl an, du könntest dir ein Urteil über Pferde erlauben? Ich kann dir nur eins versichern. Dieses Tier bedeutet mir mehr als die verwöhnten Gäule im Stall des Herzogs.«
»Verkaufen Sie mir Ihr Pferd?«
Diese plötzliche Frage, die voller Erwartung vorgetragen wurde, überraschte ihn.
»Ich kann es mir leisten, einen guten Preis zu bezahlen«, entgegnete sie rasch, als er zögerte. »Mein Vater war über alle Maßen reich.«
Mehrere Antworten schossen ihm gleichzeitig durch den Kopf. Sein Pferd sei nicht zu verkaufen. Ein Hengst sei wohl nicht das geeignete Reittier für eine junge Dame. Seine Neugier war geweckt. »Was würdest du mit ihm machen?« fragte Nicolas statt dessen.
»Ich werde ein gutes Pferd brauchen, wenn ich von hier ausrücke.«
Er zog eine Augenbraue in die Höhe, als er sie anblickte. In ihrer Stimme schwangen wieder Trotz und Auflehnung mit, die ein gewisses Mitgefühl mit dieser aufmüpfigen Göre weckten. »Und wohin willst du ausrücken?«
»Nach Indien, natürlich.«
Ein Lächeln tauchte an seinen Mundwinkeln auf. »Ich fürchte, zu Pferd kannst du nicht bis nach Indien reiten.«
»Das weiß ich auch. Aber bis ich ein Schiff gefunden habe, das mich mitnimmt, muß ich doch wohl erst den Hafen erreichen, oder nicht?«
»Dieses Pferd hier ist nicht zu verkaufen«, erklärte Nicolas und versuchte das Lachen in der Stimme zu unterdrücken. »Jedenfalls dürften deine Eltern ziemlich besorgt sein, wenn du ausreißt.«
Eigentlich hatte er erwartet, sie wäre enttäuscht, aber zu seinem Erstaunen schwang sich das Mädchen mit fliegenden Röcken aus dem Geäst und landete auf der Steinmauer, die den Weg säumte. Dort verharrte sie einen Augenblick und blickte ihn prüfend an.
Ein bemerkenswertes Kind, dachte er. Diese weiten, sturmgrauen Augen, die in dem gleichmäßigen Oval des Gesichts sehr groß wirkten. Augen, die trotzig und zornig schauten ... und angstvoll. Langsam stiegen zwei dicke Tränen in ihnen auf und Trotz und Auflehnung schmolzen dahin. »Ich habe keine Eltern«, hauchte sie mit belegter Stimme.
Im nächsten Augenblick sprang sie von der Mauer herab und floh quer über den kurzgeschnittenen Rasen zum anderen Ende des Parks und verschwand unter den herabhängenden Zweigen einer Weidengruppe.
Der Schmerz dieses ungezügelten jungen Wesens beeindruckte Nicolas derart, daß er ihr folgte. Er fand sie auf dem Gras liegend mit dem Gesicht nach unten. Sie schluchzte, als ob ihre Welt in Stücke gegangen wäre. Unerklärlicherweise fühlte er sich schuldig. War er für diese Tränen verantwortlich?
Nicolas stieg ab und setzte sich abwartend neben sie. Er bewegte sich nicht und faßte sie nicht an. Sie sollte nur seine Nähe spüren, so wie er es mit seinen Pferden tat. Mit keinem Wort äußerte sie sich zu seiner Anwesenheit, aber sie versuchte ihr Schluchzen zu unterdrücken und daraus schloß er, daß sie sich seiner Nähe bewußt war. Nach einer Weile verebbten die Tränen, und sie schien wieder einigermaßen gefaßt.
Auf seine Fragen jedoch wollte sie nicht antworten. Was sie bedrücke, fragte er vorsichtig, aber sie murmelte nur heiser: »Gehen Sie weg.«
»Was für ein Gentleman wäre ich denn, wenn ich eine junge Dame in ihrer Verzweiflung allein ließe.«
»Ich bin nicht verzweifelt.«
»Warum wässerst du den Rasen mit deinen Tränen?«
Wieder blieb sie ihm die Antwort schuldig. Sie setzte sich auf, zog die Knie an sich heran und wie um sich vor ihm abzuschirmen, vergrub sie den Kopf in den Armen.
»Sag mir, was dich bedrückt, und ich gehe fort.« Wieder Schweigen. »Meine Geduld ist grenzenlos.« Nicolas lehnte sich zurück, als ob er sich auf ein langes Warten vorbereitete. »Wieso hast du keine Eltern mehr?«
Sie räusperte sich. Dann war ein nicht sehr damenhaftes Schniefen zu hören. »Sie ... sie sind gestorben.«
»Das tut mir leid. Und das ist noch nicht lange her?«
Nach kurzem Zögern nickte das Mädchen schwach.
»Und sie fehlen dir sehr?«
Diesmal nickte sie etwas heftiger, dennoch war sie zu keiner Antwort zu bewegen.
»Willst du mir nicht etwas darüber erzählen?« versuchte es Nicolas. »Ich würde gerne wissen, was vorgefallen ist. War es ein Unfall?«
Es brauchte noch etwas Zeit, aber mit sanfter Überredung gelang es Nicolas, die Ursache ihres Kummers zu erfahren. Vater und Mutter waren in Indien an der Cholera gestorben, und sie mußte wieder nach England zurück, um zur Schule zu gehen. Deshalb trug sie Trauerkleidung. Deshalb weinte sie so herzergreifend.
Nicolas blieb still. Jetzt verstand er sie. Er selbst hatte ähnliche Qualen durchgemacht. Er wußte, was es hieß, brutal aus der Kindheit gerissen zu werden und als Waise in endlosem Schmerz zu versinken. In Schmerz und Haß.
»Ich hätte auch sterben sollen!« Ihre Worte waren mehr ein dumpfes Gemurmel, da sie den Kopf unter den Armen verborgen hatte. Ihren Wunsch zu sterben verstand Nicolas ebenfalls. Das Schuldgefühl, am Leben geblieben zu sein, den Tod betrogen zu haben, der einem das Liebste auf der Welt genommen hatte. Er hatte mit ansehen müssen, wie sein Vater von einem französischen Bajonett niedergestochen, wie seine Mutter von den Soldaten, die schlimmer als streunende Schakale waren, mißhandelt und ermordet worden war.
»Ich hasse England!« rief das Mädchen plötzlich laut. »Ich hasse alles hier! Und es ist so kalt.«
Kalt, naß und fremd, dachte er. Die ewige feuchte Kälte hatte auch ihm zugesetzt, als er vor zehn Jahren gegen seinen Willen in dieses Land geschickt worden war, um bei Verwandten seiner Mutter zu leben. England war das krasse Gegenteil zu seiner Heimat – das weite Wüstenland, der endlose Himmel und die wildzerklüfteten Berge Nordafrikas. Als das Mädchen wieder aus tiefster Brust aufschluchzte, wollte er sie am liebsten tröstend in den Arm nehmen. Statt dessen fischte er aus seiner Tasche ein schneeweißes, mit seinem Monogramm besticktes Taschentuch heraus und drückte es ihr wortlos in die Hand.
»Mit der Zeit wirst du dich an das Klima gewöhnen«, erklärte er so zuversichtlich wie möglich. »Du bist ja erst wenige Tage hier.«
Sie übersah das Taschentuch und schniefte. »Mir ist die Hitze lieber.« Dann hob sie den Kopf und richtete das große, grau schimmernde Augenpaar auf ihn. »Ich werde weglaufen. Hier kann mich keiner festhalten.«
Die Entschlossenheit in ihrem Blick war ihm nicht entgangen. Erneut beeindruckte ihn dieser wilde Trotz. Sie war ein willensstarkes, rebellisches Kind ... nein, eigentlich war sie kein Kind mehr, eher ein junges Mädchen auf der Schwelle zum Weib. Sie war eine Knospe, die sich zu entfalten begann, überlegte er. Sie gab ihm weitere Rätsel auf. Sie hatte ein hübsches glattes Gesichtchen, in dem alles nicht so recht zusammenpassen wollte, und doch war es erstaunlich anziehend. In ein paar Jahren könnte sie zu einer Schönheit heranwachsen. Die dichten, geraden Brauen verliehen diesen unglücklichen Augen etwas exotisch Verhangenes, während das spitze kleine Kinn auf Eigensinn schließen ließ, der Schlechtes für jeden verhieß, der sich mit ihr anlegte.
Auf sonderbare Weise fühlte er sich ihr verwandt, diesem jungen, englischen Mädchen, das sich nach Indien zurücksehnte, wo es aufgewachsen war. Er verstand, daß sie sich zur Wehr setzte und den Erwachsenen trotzte, auch wenn sie ihr Bestes wollten.
Er konnte es ihr nachfühlen. Ihm war es ähnlich ergangen. Nicolas lehnte sich zurück und stützte sich mit den Handflächen ab. Der wilde kleine Junge von damals stand ihm vor Augen. Zweimal war er davongerannt, bis er einen Pakt mit dem Großvater eingegangen war. Bis zu seiner Volljährigkeit würde er in England bleiben und erzogen werden. Sollte er dann immer noch die Absicht haben, in das Land der Berber zurückzukehren, würde sein Großvater ihm die Wege ebnen.
War es das Ganze wert gewesen? Zehn Jahre lang hatte er sich nach seiner Heimat verzehrt, während sein Großvater fast daran verzweifelt wäre, aus dem kleinen ›wilden Araber‹ einen zivilisierten englischen Gentleman zu machen.
Die Verwandlung, die man letztlich als gelungen bezeichnen konnte, war für Nicolas schmerzhaft gewesen. Zur Hälfte hatte er englisches Blut. Seine Mutter war von einem Berberhäuptling geraubt worden, nachdem das englische Schiff von arabischen Piraten gekapert worden war. Sein kämpferisches Berberblut ließ sich nicht verleugnen, obwohl es sein Großvater vorgezogen hätte, diese Tatsache ganz unter den Tisch fallen zu lassen. Auch wenn seine Eltern schließlich geheiratet hatten, gehörte sein Vater einem anderen Glauben an.
Nicolas aber hatte die hohe Kunst, sich als Aristokrat zu benehmen, bis zur Perfektion gemeistert. Man akzeptierte ihn in der Gesellschaft und bei den Damen war er hochbegehrt, trotz seiner fragwürdigen Abstammung. Oder gerade deswegen. Die Damen von Stand, die sich den Anschein gaben, über seine Abkunft schockiert zu sein, waren bereit, ja sogar eifrig bemüht, ihn in ihre Betten einzuladen. Von Neugier getrieben wollten sie unbedingt herausfinden, ob er der gefährliche Wilde sei, den sie sich in ihrer Fantasie ausgemalt hatten.
Nicolas Blick fiel auf die junge Waise neben sich. Seine Zeit in England war abgelaufen, ihre begann erst. Sie würde Einsamkeit und Heimweh ertragen müssen, genau wie es sein Schicksal gewesen war.
Sein forschender Blick wanderte über ihr tränennasses Gesicht. Der salzig nasse Strom war zwar versiegt, nicht aber ihre Verzweiflung. Die Unterlippe zitterte leicht und verlieh ihr einen Ausdruck von Verwundbarkeit, der ans Herz rührte. Nicolas wollte ihr helfen. »Hast du hier Angehörige?« fragte er leise. »Hatten deine Eltern Verwandte?«
Das junge Gesicht verzog sich schmerzhaft, ehe sie eilig fortsah. Die Finger umklammerten das Taschentuch, das er ihr geliehen hatte. »Ich habe zwei Onkel, eigentlich sind es drei, wenn man den in Frankreich hinzuzählt. Aber die wollen mich nicht. Ich bin nur eine Last für sie.«
Bei der Erwähnung von Frankreich zog sich sein Magen zusammen, aber er ließ sich nichts anmerken, als er ihr antwortete. »Dann schlage ich vor, daß du sie vom Gegenteil überzeugst. Du mußt dich unentbehrlich machen, ihnen einen guten Grund geben, daß sie dich behalten wollen.«
Als sie sich umwandte und ihn mit großen erstaunten Augen anblickte, mußte er schmunzeln. »Wisch dir das Gesicht ab«, sagte er freundlich. »Die Wangen sind ganz verschmiert.«
Sie gehorchte ohne groß darüber nachzudenken. Dann hielt sie ihm das feuchte Tuch entgegen. »Das sollte ich Ihnen wohl lieber zurückgeben, vielen Dank.«
Das Taschentuch trug die Initialen seines englischen Namens. »Du kannst es behalten. Dort, wo ich jetzt hingehe, brauche ich es nicht mehr.«
Sie sah ihn fragend an. »Wohin gehen Sie?«
»Fort. In ein anderes Land.«
Ein Hoffnungsschimmer huschte ihr über das Gesicht, ah sie sich hinkniete. »Kann ich mitkommen? Bitte! Ich werde Ihnen auch keine Schwierigkeiten machen. Ich kann mich fabelhaft benehmen, wenn ich es wirklich will. Bitte.«
Offenbar war ihr die Ungeheuerlichkeit ihres Ansinnens nicht bewußt geworden. Wie konnte sie einen wildfremden Mann bitten, sie mitzunehmen! Das Flehen ihrer Stimme und ihrer Augen rührte ihn derart, daß er plötzlich wünschte, er könne ihre Bitte erfüllen.
Langsam hob er die Hand und wischte ihr mit dem Daumen eine letzte Träne fort. »Ich fürchte, das kann ich nicht«, sagte er bedauernd.
Gerade in diesem Augenblick hob der braune Hengst, der bis dahin brav dagestanden war, witternd den Kopf. Nicolas blickte sich um und bemerkte einen kleinen dunkelhäutigen Mann, der hinter den Weiden auftauchte. Er trug die Nationaltracht der Inder, eine weiße Baumwolltunika, weite Hosen und einen Turban.
Bei seinem Anblick setzte sich das Mädchen sofort auf, strich die zerknitterten Röcke glatt und wischte sich mit dem Taschentuch noch einmal über die Wangen.
Der kleine Mann näherte sich lautlos und verneigte sich tief vor ihr, wobei die braune Stirn fast die Knie berührte. »Sie haben mich sehr erschreckt, Missy Sahib. Sie hätten sich nicht so weit entfernen sollen an diesem fremden Ort. Erwin Sahib wird sagen, ich passe nicht gut auf Missy auf. Er wird mich schlagen und mich hinauswerfen. Allah möge mich beschützen.«
Nicolas erwartete, daß das Mädchen die Klage des Dieners mit einer Handbewegung abtun würde, statt dessen aber beruhigte sie ihn freundlich. »Onkel Oliver wird dich nicht schlagen, Chand. Er würde dir nie die Schuld geben, wenn ich mich daneben benehme.«
»Und Sie haben sich wieder vor mir versteckt, Missy Sahib.« Der Inder rollte die Augen nach oben. »Womit habe ich diese Undankbarkeit verdient?«
Sie sah tatsächlich zerknirscht aus. »Verzeih mir, aber du hättest dich nicht zu sorgen brauchen, Chand. Mir ist nichts zugestoßen. Dieser Gentleman« sie warf Nicolas rasch einen Blick zu »war so freundlich, mir sein Taschentuch zu leihen.«
Der Diener sah Nicolas an, musterte Gesicht und Kleidung und war zufriedengestellt. Der dunkle kleine Mann verneigte sich erneut, bevor er sich an seine Herrin wandte. »Erwin Sahib hat nach Ihnen verlangt. Darf ich sagen, daß Missy kommen, ja?«
Sie seufzte. »Ja, Chand, sag meinem Onkel, daß ich gleich kommen werde.«
Mit dieser Antwort schien der Inder zwar nicht zufrieden, aber er verneigte sich, zog sich zurück und murmelte etwas Unverständliches.
»Onkel Oliver«, erklärte sie, »hat mich nach England geholt, weil er sich für mich verantwortlich fühlt, aber ich weiß, daß er froh sein wird, mich endlich loszuwerden.«
Nicolas lächelte verständnisvoll. »Dann solltest du sofort damit beginnen, ihn umzustimmen.«
Das schwache Lächeln, das sie ihm zur Antwort gab, war zwar nur ein kläglicher Versuch, aber immerhin ein Lächeln. »Danke, daß Sie Chand nichts verraten haben ... über die Eicheln. Er hätte sich für mich geschämt.« Sie zögerte und nestelte am Taschentuch herum. »Ihm verdanke ich mein Leben. Als ich noch klein war, hat er mich in Indien vor einem Elefanten gerettet. Geistesgegenwärtig zog er mich vom Pfad weg, da mich sonst der wildgewordene Bulle zertrampelt hätte. Seitdem hat ihn mein Vater als Diener für mich eingestellt, damit er ständig aufpaßt, daß ich keine Dummheiten mache.«
»Und ist ihm das geglückt?«
Sie riß die Augen auf und starrte ihr Gegenüber einen Moment ungläubig an, bis sie begriff, daß er sie neckte. Das schuldbewußte Lächeln, das jetzt in ihrem Gesicht stand, war offen und ehrlich. »Ich fürchte, manchmal stelle ich Chands Geduld auf eine harte Probe.«
Das glaubte Nicolas ihr aufs Wort. »Versprich mir, keine Eicheln mehr zu werfen.«
»Gut. Versprochen.«
Kurz entschlossen stand er auf, strich sich über die Reithosen und musterte das Mädchen auf dem Rasen. Ihm war leicht zumute. Sie weinte nicht mehr, und der große Kummer war aus den graublauen Augen verschwunden.
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, schwang er sich auf den Berberhengst und warf einen letzten Blick über die Schulter. Das Mädchen hatte die Arme um die Knie geschlungen und blickte nachdenklich zu den Weiden hinauf. Wahrscheinlich versuchte sie sich ein Bild von ihrer Zukunft zu machen.
Zufrieden wandte sich Nicolas jetzt den Dingen zu, die vor ihm lagen. Heute war er einundzwanzig Jahre alt geworden, aber er feierte nicht seinen Geburtstag, sondern seine Freiheit, auch wenn der Herzog ihm dazu nur widerstrebend seinen Segen erteilt hatte. Und bald würde er die Rechnung begleichen und den entsetzlichen Mord an seinen Eltern rächen. Jetzt konnte er endlich in sein Land zurückkehren, in das Land, das die Franzosen Algerien genannt hatten.
Freiheit! Freiheit für das Volk seines Vaters! Zwei Aufgaben hatte er sich bei seiner Rückkehr gestellt. Er wollte die Franzosen aus seinem Heimatland vertreiben und sich an dem Mann rächen, der das Leben seiner geliebten Eltern auf dem Gewissen hatte.
Freiheit! Wie herrlich würde es sein, wieder den Boden der Heimat zu betreten, über den heißen Wüstensand zu galoppieren, den Durst an einer Quelle zu stillen und in dem bergigen Hochland Zuflucht vor der brennenden Hitze zu finden. Wie froh war er, diesem kalten, nebligen Land mit der verlogenen Moral und der sogenannten Zivilisation den Rücken zu kehren.
Als er wenige Augenblicke später seinen seidenen Hut auf dem Kiesweg liegen sah, ritt er weiter, ohne ihn aufzuheben. Er würde alles Englische ablegen, angefangen von seiner eleganten Kleidung bis zu dem Namen Nicolas Sterling.
Fortan würde er wieder den stolzen Berber-Namen annehmen, den man ihm bei seiner Geburt gegeben hatte. In Zukunft würde man ihn als Jafar el-Saleh kennen.
TEIL EINS
Leidenschaft ist wie Afrika; ihre Sehnsucht wie ein Sturm in der Wüste – einer Wüste, deren glühende Weite sich in ihren Augen widerspiegelt – einer Wüste der azurblauen Liebe, des sich nie verändernden Himmels und der kühlen sterngesprenkelten Nächte.
Honoré de Balzac
Kapitel 1
Algier, Nordafrika1847
Endlich war der Augenblick der Rache gekommen.
Jafar stand auf der dunklen Terrasse vor dem hell erleuchteten Zimmer und beobachtete gelassen den Mann, den er töten würde. Die Doppeltüren waren weit geöffnet und mit seidenen Gazeschleiern verhangen. Das feine Gewebe verlieh der Abendgesellschaft in den Räumen einen festlichen Schimmer und dämpfte das Geräusch frohen Lachens und der angeregten Unterhaltung der Gäste ein wenig ab. Die Vorhänge erfüllten zugleich eine sehr wichtige Aufgabe. Sie schirmten den Beobachter ab und gestatteten ihm, die hier versammelten wohlhabenden Europäer und deren Gastgeber, Oberst Gervase de Bourmont, ungestört zu betrachten, während er selbst unsichtbar blieb.
Mit dem Finger schob Jafar den Vorhang einen Spaltbreit zur Seite. Mit kaltem, entschlossenem Gesichtsausdruck musterte er seinen Feind. Der Oberst war ein hochgewachsener, dunkelhaariger Mann in den Dreißigern, ein Offizier, der auffallend gut aussah und eine überlegene Intelligenz ausstrahlte. Jafar hatte dem Franzosen nie Auge in Auge gegenübergestanden, aber der Name Bourmont war seit siebzehn Jahren in seinem Gedächtnis eingebrannt.
Jetzt endlich war es soweit.
In den vergangenen Monaten, gleich nach dem Eintreffen Bourmonts in Algier, hatte sich Jafar genauestens mit den Gewohnheiten des Colonels vertraut gemacht. Seine Spione hatten gute Arbeit geleistet. Er kannte den offiziellen wie privaten Tagesablauf des Mannes bis ins kleinste Detail. Was er zum Frühstück aß. Welchen Weg er jeden Morgen zu seiner Dienststelle durch die engen, gewundenen Gassen von Algier nahm. Welche Pferde er bevorzugte. Welcher Prostituierten er seine Gunst schenkte.
Der Oberst liebte dunkle, voll erblühte Schönheiten mit üppigen Rundungen und aufreizender Sinnlichkeit. Aus diesem Grunde war die Wahl seiner Braut überraschend.
Jafars Augenlider verengten sich, als er den Vorhang ein weiteres Mal beiseite schob, um die junge Frau neben dem Oberst genauer in Augenschein zu nehmen. Sie war von durchschnittlicher Größe. Ihre Taille war schmal. Ein Mann konnte sie leicht mit den Händen umspannen. Zweifelsohne war sie aus gutem Hause und höchstwahrscheinlich Jungfrau.
Als Jafar von Alysson Vickerys Existenz erfuhr, wußte er sofort, daß er sie zum Werkzeug seiner Rache machen würde. Mit grimmiger Genugtuung musterte er seine Beute. Bald würde Miss Vickery in seiner Gewalt sein. Sehr bald. Ihre Unschuld würde ihm nur zum Vorteil gereichen, überlegte er kalt. Der Oberst würde dann um so mehr bereit sein, ihre Unschuld und Ehre zu schützen.
Das festliche Ereignis heute abend hatte die Gerüchte einer bevorstehenden Verlobung bestätigt. Der Empfang wurde ihr zu Ehren gegeben, und während des ganzen Abends hatte der Oberst ihr eifrigst den Hof gemacht und war nicht von ihrer Seite gewichen.
Jafar entging nicht, wie sehr der Oberst von ihr beeindruckt war. Offensichtlich stammte die junge Dame aus einem begüterten Hause. Sie trug ein Kleid aus matter heller Seide mit einem weich fallenden Rock und einem knappen enganliegenden Mieder, das mit feinen Perlenschnüren bestickt war. Noch auffallender war der vierreihige Perlenschmuck, den sie um den Hals trug. Die dichten, kastanienbraunen Haare waren zu einem losen Knoten geschlungen – entgegen der neuen Mode hatte sie gänzlich auf die niedlichen Ringellöckchen verzichtet. Aber weder die Perlen noch die eigenwillige Frisur oder das elegante Pariser Modellkleid erregten seine Aufmerksamkeit.
Was ihm sofort auffiel, war die Lebhaftigkeit, die verhaltene Energie, die von ihr ausging. Inmitten der Gäste wirkte sie wie eine Oase in der Wüste, Wie ein Wasserquell zog sie einen durstigen Mann an.
Unwillkürliche Bewunderung erschien in Jafars Augen, als er die wohlgeformte Wölbung der bloßen Schultern und des festen, hohen Busens betrachtete. Der Ausschnitt des Abendkleides war nach europäischen Maßstäben keinesfalls übertrieben, da nur der hellhäutige Ansatz ihrer Brust zu sehen war. Aber der Eindruck war atemberaubend.
Während seine Augen den berauschenden Anblick festhielten, überlegte er, wie sich diese sanften Rundungen wohl unter seinen Händen oder an seinen Lippen anfühlen würden.
Ein kaum merkliches Lächeln umspielte seinen Mund.
Es würde vielleicht nicht mehr lange dauern, bis er es herausfand.
Alysson hatte nicht mehr den geringsten Zweifel. Onkel Honoré versteckte sich vor ihr.
Sie hatte in dem Augenblick Verdacht geschöpft, als der gute Honoré aus dem Empfangsspalier verschwunden war und es ihr überlassen hatte, die Gäste an Gervases Seite zu begrüßen. Erst jetzt, wo sie endlich eine kleine Pause hatte, konnte sie die Gelegenheit wahrnehmen, um sich auf die Suche nach ihrem Onkel zu machen.
Von dem hasenherzigen, ältlichen Franzosen war nichts zu sehen.
»Du kannst dem Unvermeidlichen nicht entkommen, mon oncle«, sagte Alysson flüsternd zu sich selbst und wußte nicht, ob sie verzweifelt oder belustigt sein sollte. Wenn sie ihn fand, würde sie ihren feigen Verwandten zur Rede stellen. Er hatte die Entscheidung lange genug hinausgeschoben. Morgen würde es zu spät sein.
Alysson öffnete ihren bemalten Seidenfächer und wedelte sich Kühlung zu. Diese Bewegung war dazu angetan, ihre Hilflosigkeit zu verbergen, während ihr Blick über die Gäste schweifte. Vor gut einer Woche war sie in Algier angekommen und hatte bis jetzt nur wenig von der Stadt gesehen, die Schlupfwinkel der Piraten und Bollwerk der Türken gewesen war. Von der Umgebung hatte sie überhaupt nichts zu Gesicht bekommen – und sie konnte ihre Ungeduld kaum bezähmen.
Der gute Onkel Honoré würde sie niemals verstehen. Er hatte keine Ahnung von den Dingen, die sie bewegten. Daß sich ein Herz nach Leidenschaft und Abenteuern sehnte, war ihm unbegreiflich. Nie würde er einsehen, daß elegante Abendgesellschaften wie diese ihren Erwartungen vom Leben nicht entsprachen. Aus diesem Grunde war sie nicht nach Algier gekommen.
Eigentlich sollte sie mit dieser Soiree, die für sie gegeben wurde, zufrieden sein. An diesem Abend war sie gekrönten Häuptern vorgestellt worden. Für die Tochter eines Kaufmanns ein gesellschaftlicher Erfolg, in Alyssons Augen aber ein schaler Triumph.
Mit einiger Anstrengung trug sie ein höfliches Lächeln zur Schau, als sie die eleganten Gäste aus Europa betrachtete. Prächtige Garderoben, aber oberflächlich. Komisch, dachte sie, früher wollte sie unbedingt dazugehören. Hier und da hörte man ein amüsiertes Lachen, aber es war nur die aufgesetzte Heiterkeit gelangweilter Ehefrauen und machtgieriger Politiker. Eine Kapelle von fünf oder sechs Musikern spielte im Hintergrund, aber leider nur fade französische Weisen und nicht die fremden, exotischen Rhythmen des Nahen Ostens. Die Gäste unterhielten sich auf französisch. Belangloses Geplauder und Klatschgeschichten. Sogar die Einrichtung war französisch und verwandelte die hohen Räume mit den maurischen Bögen und dem filigranen Gitterwerk in einen beliebigen europäischen Ballsaal.
Nur die hellblauen und leuchtend roten Fliesen im Mosaik des Fußbodens erinnerten noch an den Orient. Am liebsten hätte Alysson die Schuhe ausgezogen und den kühlen Steinboden durch ihre Seidenstrümpfe gespürt, aber sie hatte ihrem Onkel versprochen, ihr bestes Benehmen an den Tag zu legen.
Und sie hatte tatsächlich Wort gehalten. Seit einem Monat hatte sie ihre Wildheit und Abenteuerlust bezähmt und sich fromm wie ein Lamm betragen.
Aber nun genug damit.
Alysson klappte den Fächer zusammen und machte sich auf die Suche nach ihrem Onkel. Endlich erspähte sie ihn. Halbverdeckt von einer Zimmerpalme unterhielt er sich angeregt mit einem französischen Ehepaar, das sich in der neuen Kolonie niedergelassen hatte. Honoré, der auf die sechzig zuging, war klein von Gestalt und neigte zur Rundlichkeit. Sein Kopf war von dünnem silbernem Haar bedeckt. Er reichte seiner Nichte bis knapp an das Ohr.
Honoré zuckte unbewußt zusammen, als er Alysson auf sich zukommen sah.
Nachdem sich ihr Verdacht bestätigt hatte, bedachte sie den alten Herrn mit einem vorwurfsvollen Blick. Dieser Großonkel, Honoré Larousse, war der Bruder ihrer verstorbenen französischen Großmutter, die dem Terror der Französischen Revolution als Emigrantin entkommen war. Von ihren drei Onkeln war er ihr der liebste.
»Verzeihen Sie«, fragte Alysson die Gäste aus Frankreich höflich, »Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich Ihnen meinen Onkel entführe?« Sie hakte Honoré unter und zog ihn beiseite. »Hast du dich etwa vor mir versteckt?«
Er murmelte etwas Verneinendes und versuchte vom Thema abzulenken. »Wie kommt es, daß du allein bist, ma chère?« fragte er auf französisch. »Noch vorhin bemühte sich ein Dutzend junger Galane um deine Aufmerksamkeit. Du willst mir doch nicht weismachen, Gervase habe dich verlassen.«
»Ich habe mich nur einen Augenblick lang zurückgezogen, mon oncle«, antwortete Alysson in der gleichen Sprache. Ihr Schulfranzösisch war mit den Jahren sehr viel besser geworden, vor allem, seitdem sie einen Sommer mit Honoré in Frankreich verbracht hatte. »Der Prinz wünschte Gervase in einer geschäftlichen Angelegenheit zu sprechen. Sein Stab begleitete Gervase in die Bibliothek. Aber darum geht es nicht. Du hast versprochen, mir heute abend deine Entscheidung mitzuteilen. Erinnerst du dich?«
»Ja, ganz richtig.« Seine buschigen weißen Augenbrauen zogen sich zusammen, als er vergeblich versuchte, seine Nichte ein wenig einzuschüchtern, aber Alysson begegnete seinem Blick gelassen und war eher bemüht, nicht zu lachen. Es lag auf der Hand, daß ihr Onkel einer Strafpredigt ausweichen wollte.
»Du siehst aus, als ob du eine Erfrischung vertragen könntest«, erklärte er und vermied es, ihr eine Antwort zu geben. Hastig ergriff er zwei Gläser Champagner, die ein Kellner auf einem Tablett vorbeitrug, und drückte seiner Nichte eines davon in die Hand. Honoré führte den dünnen Glaskelch an die Lippen, nippte daran und verzog angewidert das Gesicht. »Merde!«
Alysson hatte diese Reaktion erwartet. Als über alle Grenzen hinaus bekannter Weinhändler verabscheute Onkel Honoré Weine minderer Qualität. Und dieses Getränk erinnerte ihn wohl eher an eine Brause.
»Nimm es nicht so tragisch, Onkelchen«, tröstete sie ihn. »In ein paar Jahren wirst du in der Lage sein, deine eigenen Weine zu genießen.« Honoré baute in der Gegend von Bordeaux Wein an und hatte vor, ein zweites Unternehmen in Algerien zu gründen. Zu diesem Zweck beabsichtigte er Land in der französischen Kolonialprovinz zu erwerben, das hier ausreichend und zu niedrigen Preisen zu haben war, nachdem der Krieg mit den Arabern als so gut wie beendet galt. Er hoffte nun, auch hier den Weinbau und den Handel in der Tradition seiner Vorfahren fortzusetzen.
»Wenn ich mit diesem Gesöff bis dahin überlebe«, klagte er.
»Darum solltest du deine Pläne so früh wie möglich in die Tat umsetzen, Onkelchen.«
»Morgen ist früh genug.«
»Ah, ja ... morgen. Wollen wir uns dann über unsere kleine Expedition unterhalten?«
Morgen würden sie einen Ausflug zu den fruchtbaren Ebenen an der Küste unternehmen, wo Onkel Honoré seinen Wein anbauen wollte. Als praktisch veranlagter Geschäftsmann bestand Honoré darauf, das Land vor dem Kauf persönlich in Augenschein zu nehmen.
Alysson begleitete ihren Onkel nur, weil sie angeblich nicht allein zurückbleiben wollte. In Wirklichkeit aber war sie darauf erpicht, in seiner Begleitung das Land jenseits der besiedelten Gebiete zu bereisen. Es war schon lange ihr Wunsch, die südliche Region und das Innere der Provinz zu erkunden. Seitdem sie die Landschaftsbilder von Delacroix gesehen hatte, die auf seiner Algerienreise entstanden waren, wollte sie das rauhe, unwirtliche Land unbedingt selbst erkunden. Ihr Onkel hielt jedoch herzlich wenig von Unternehmungen dieser Art.
Alysson konnte diese Einstellung nicht begreifen. »Möchtest du denn gar nichts über das Land wissen, das du erwerben willst?« fragte sie ungläubig.
Honoré schüttelte unwillig den Kopf. »Nein. Absolut nicht. Was haben meine Weingärten davon, wenn ich mir die Wüste ansehe? Wahrscheinlich würde die Expedition meiner Gesundheit nur schaden, was auch für dich gilt, ma chère. Außerdem interessiert es mich nicht, ob die Eingeborenen auf dem Kopf stehen können oder nackt auf ihren Kamelen turnen. Sollen sie mit ihren barbarischen Sitten unter sich bleiben.«
»Onkelchen, sie stehen nicht auf dem Kopf!« Alysson war jetzt tatsächlich entsetzt. Sie unternahm einen neuen Versuch und dämpfte die Stimme zu einem inständigen Flehen. »Wie steht es mit unserer Abmachung? Eins kannst du doch nicht leugnen. Die ganze Zeit habe ich mich wie ein Engel betragen, und Gervase durfte mir den Hof machen, so wie du es wolltest ...«
»Aber du willst ihn nicht heiraten.«
Jetzt war es an Alysson, die Augenbrauen zusammenzuziehen und die Stirn zu runzeln. »Davon war bei unserer Abmachung nicht die Rede.«
»Schon möglich. Wie sollst du dich auch in diesen Mann verlieben, wenn du ihn ein paar Monate lang nicht sehen wirst?«
»Wir werden doch nur ein paar Wochen unterwegs sein, mein lieber Onkel. Und ich sagte dir doch schon vorher, diese Reise wird meine Entscheidung, Gervase zu heiraten, nicht beeinflussen.«
Honoré schien sie mit den Augen zu durchbohren. »Wenn ich mich weigere, wirst du diese Reise bestimmt ohne mich durchführen.«
»Ich würde mich nur ungern deinen Wünschen widersetzen. Aber du hast recht, ich würde mir überlegen, ob ich nicht allein aufbreche.«
»Du lieber Himmel, ich kann nicht zulassen, daß du wochenlang allein in diesem barbarischen Land unterwegs bist.« In den dunklen Augen blitzte es verschmitzt auf. »Dann ist es nur von Vorteil, daß ich bereits die notwendigen Vorkehrungen getroffen habe, meine Liebe.«
Alysson blickte ihren Onkel lange an. Als sie den Sinn seiner Worte begriffen hatte, strahlte sie über das ganze Gesicht. »Mon cher, was bist du doch für ein ausgekochter Halunke! Schon die ganze Zeit hattest du insgeheim vor, diese Reise zu machen.«
Honoré gluckste in sich hinein. Er sah aus, als ob er höchst zufrieden mit sich sei. »Bitte, sage Gervase nichts davon. Er wird nicht beglückt sein, wenn ich deinen charakterlichen Mängeln Vorschub leiste.«
»Nein, selbstverständlich nicht. Er könnte mir vorwerfen, ich hätte dich mit List und Tücke überredet.« Alysson wollte nicht länger beim Thema Gervase bleiben und wandte ihre Gedanken den morgigen Ereignissen zu. »Wir sollten früh aufbrechen, wenn dir das möglich ist.«
»Du hast doch meine Zusage, oder?«
»Ja«, antwortete Alysson unbeirrt, »aber ich möchte ganz sicher sein, daß es dein Ernst ist.«
»Nur deinetwegen, liebste Nichte, werde ich mich morgen zu nachtschlafender Zeit aus den warmen Federn wälzen, um in diese furchtbare Wildnis aufzubrechen.«
»So furchtbar ist sie nicht, Onkel. Die Ebene von Algerien wird dich an bestimmte Gegenden in Frankreich erinnern.«
»Das ist deine Meinung.« Honoré blickte sie wieder unter den zusammengezogenen dichten Brauen an. »Schlag dir aber eins aus dem Kopf, meine Liebe. Löwen und Elefanten werden nicht gejagt. Diesen Unsinn überlassen wir lieber deinem Onkel Olivier«, meinte er grimmig.
Honorés Bärbeißigkeit störte sie nicht. Sie beugte sich vor, um seine Wange zu küssen. »Ganz bestimmt nicht. Ehrenwort.«
»Ich sollte dich nicht so verwöhnen, mein liebes Kind.«
Alysson überging seine Bemerkung und blickte ihn verschwörerisch an. Gut, als Kind mochten sie ihre Eltern vernachlässigt haben, aber von Geburt an war sie von einer Schar von Dienern verwöhnt worden, und später, nach dem Tode der Eltern, waren ihre drei Onkel sehr nachsichtig mit ihr gewesen, besonders Onkel Honoré. Er war Vaterersatz geworden, und sie liebte ihn von Herzen. »Du verwöhnst mich wirklich ganz gräßlich, bester aller Onkel ... Und du genießt es jeden Augenblick.«
Er lachte in sich hinein und tätschelte ihre Hand. »Seine Hoheit schien heute abend sehr eingenommen von dir«, bemerkte Honoré mit zufriedener Miene.
In Anbetracht der vorangegangenen halben Stunde vermied es Alysson geschickt, darauf zu antworten. Seine Königliche Hoheit hatte wohl das Stigma ihrer unstandesgemäßen Herkunft übersehen, aber er hatte sie unter den Gästen ausgewählt, um ihre Meinung über Algerien zu hören. Volle zehn Minuten hatte er sich mit ihr unterhalten.
Alysson war sich dieser Auszeichnung völlig bewußt. Schließlich war er der Sohn des Königs von Frankreich und Generalgouverneur von Algerien, während sie nur eine kleine bürgerliche Engländerin war. Ihr Vater war ein kluger und erfolgreicher Kaufmann gewesen, der im Handel mit der Ostindischen Kompanie ein Vermögen gemacht hatte. Dieser Umstand machte sie zweifelsohne in erster Linie für den Prinzen interessant. Er hätte es gern gesehen, wenn sie einen Teil ihres Vermögens in Algerien investierte.
Ein ironisches Lächeln umspielte Alyssons Mund, als sie über ihre Schultern zu den Doppeltüren an der Gartenseite des Salons blickte. An diesem Abend waren sie weit geöffnet, aber zum Schutz gegen die kühle Nachtluft mit Gazevorhängen versehen. »Ich möchte ein paar Schritte hinausgehen und frische Luft schnappen. Kommst du mit?«
»Nein, nicht jetzt, meine Liebe. Ich glaube, ich werde nach dem Mann Ausschau halten, der uns von den Weingärten erzählte.«
»Falls Gervase nach mir fragt, sage ihm, ich sei gleich wieder da.«
Honoré gestattete ihr, sich allein zu entfernen, schärfte ihr aber ein, daß sie der Ehrengast sei und nicht zu lange fortbleiben dürfe. Alysson reichte einem vorbeikommenden Kellner das Champagnerglas, raffte den Rock ihres Abendkleides – ein luftiges Gewirk aus heller Mousselinseide – und trat hinaus auf die schmale Terrasse.
Wie das Haus, das Honoré für die Dauer ihres Aufenthaltes in Algerien gemietet hatte, war auch Gervases Anwesen um einen Innenhof gebaut. Vor ihr führten breite Steinstufen hinunter zu einem wilden Durcheinander von Oleandern, Palmen und Lotusbäumen, die in kurzen Abständen von brennenden Fackeln erleuchtet waren. Einen Augenblick lang schienen sich die Schatten zu bewegen und Alysson glaubte, daß sich jemand im Garten aufhalten könnte – einer der Gäste vielleicht. Aber dann rührte sich nichts mehr. Wahrscheinlich hatte sie sich getäuscht.
Obwohl der Sommer längst vorüber war, empfand sie die Nachtluft als wohltuend mild. Algier erfreute sich eines mediterranen Klimas. Nach der stickigen Hitze in dem großen Saal genoß sie die angenehme Kühle auf der Haut. Der Duft von Zitronenblüten und Jasmin mischte sich in das unerklärliche Mysterium der afrikanischen Nacht. Alysson schloß die Augen, atmete tief durch und genoß die Gerüche des Südens, das Plätschern der Brunnen und das Rascheln der hohen Dattelpalmen.
Auf sonderbare Weise anders und doch wieder ähnlich war dies hier im Vergleich zu Indien, wo sie aufgewachsen war. Und wie anders würde es sein, ein fremdes Land in der Gesellschaft von Onkel Honoré zu entdecken und nicht mit Onkel Oliver.
Honoré war zwanzig Jahre älter als Oliver, ein gesetzter Franzose der Mittelschicht, der die Annehmlichkeiten seines Hauses und Herdes zu schätzen wußte und dem Leben eines Globetrotters nichts abgewinnen konnte. Ihr britischer Onkel Oliver hingegen war ein richtiger Zigeuner, den es unablässig in fremde Länder zog. Ein Junggeselle, der sich für einen großen Entdecker hielt.
Im Verlauf der letzten drei Jahre hatte sie mit Onkel Oliver einen großen Teil der Welt gesehen. Mit siebzehn, alt sie die leidige Schulzeit endlich hinter sich gebracht hatte, überredete sie Oliver, sie auf seine weiten Reisen mitzunehmen. Mit ihm hatte sie den Zaren von Rußland besucht, Tiger in Indien gejagt und die einsamen Wüstenstriche Arabiens durchquert.
Oliver behandelte sie mehr wie einen Sohn, aber sie beklagte sich nie. Sie waren seelenverwandt und die geborenen Abenteurer. Genau wie er war sie der Faszination unbekannter Länder und exotischer Kulturen erlegen.
Zum Beispiel Algerien. Wie Champagnerperlen stieg die Aufregung bei dem Gedanken an den kommenden Morgen in ihr auf. Morgen. Morgen würde sie an der Seite von Onkel Honoré ein neues Abenteuer beginnen.
Ein leiser Schritt hinter ihr setzte den Träumereien ein Ende. Alysson wandte sich um und stand Gervase gegenüber, der sie mit einem fragenden Stirnrunzeln anblickte.
»Dein Onkel sagte mir, daß ich dich hier finden würde, ma chérie«, sagte er auf französisch.
Allyson begrüßte ihn mit einem Lächeln. »Im Salon wurde mir zu heiß, und ich kam hierher, um die kühle Brise zu genießen.«
»Wie ich hörte, hast du Honoré überredet, eine Expedition ins Landesinnere zu unternehmen.« Die Mißbilligung war aus seinem Ton deutlich herauszuhören.
Alysson ließ sich auf keine Diskussion ein, da sie sich ihre angenehme Stimmung nicht verderben lassen wollte. Sie zeigte in den Garten hinunter. »Dein Haus ist sehr schön, Gervase.«
Mit entschlossenem Ausdruck ging er einen Schritt auf sie zu.
»Es wird auch dein Haus sein, wenn wir heiraten, Alysson.« Er fuhr rasch fort, um ihr die Antwort abzuschneiden. »Ich möchte nicht, daß du diese Reise unternimmst. Es ist schon schlimm genug, daß du deinen Onkel zur Küste begleiten mußt, um ihm beim Landkauf zu beraten. Du solltest ihn dann nicht noch ins Landesinnere schleppen.«
»Gervase, weißt du eigentlich, wie sich das anhört? Du benimmst dich bereits wie ein gestrenger Ehemann.«
»Ich glaube, ich habe das Recht, dein Vorhaben in Frage zu stellen.«
»In Frage zu stellen vielleicht, aber nicht zu verbieten«, antwortete sie und versuchte einen leichten Ton beizubehalten. Sie wußte, daß er keine Besitzansprüche anmeldete, sondern sich für sie verantwortlich fühlte und sie beschützen wollte.
»Ich verbiete es dir ja auch nicht, ma cocotte, aber du mußt doch einsehen, daß es unsinnig ist.«
Er sprach mit der Vertraulichkeit einer seit vielen Jahren bestehenden Freundschaft. Sie hatte ihren Spitznamen ›Wildfang‹ beibehalten, den er ihr bereits in ihrer Jugendzeit verpaßt hatte. Sie hatten sich vor vielen Jahren kennengelernt, im ersten Sommer, den sie in Frankreich bei ihrem Onkel Honoré verbracht hatte. Es traf auch zu, daß Gervase ihr damals wenig Aufmerksamkeit schenkte, als sie eine wilde freche Göre von vierzehn Jahren war.
Alysson musterte ihn nachdenklich. Gervase war ein ungewöhnlich gutaussehender Mann. Er war groß, athletisch gebaut, dunkelhaarig und mit einem frechen Schnauzbart. In der dunkelblauen Uniform der französischen Armee sah er einfach umwerfend aus, und es lag auf der Hand, daß er seine Wirkung auf die Damenwelt nicht verfehlte. Alysson war der gleichen Meinung, und doch ... Er war charmant und aufmerksam und einer ihrer besten Freunde, aber ein wenig zu nüchtern und gesetzt, wenn sie kritisch war. In Frankreich hatte er jedenfalls diesen Eindruck auf sie gemacht. Sie hatte gehofft, ihre Meinung würde sich in Algerien ändern, wo er sich als Held und Abenteurer bewähren konnte. Als Colonel der französischen Armee war Gervase zum Chef der Bureaux Arabes ernannt worden, einer Behörde der französischen Regierung in Algerien.
Gervase war es gewesen, der Onkel Honoré vorgeschlagen hatte, sein Unternehmen auf das koloniale Algerien auszudehnen. Honoré hatte darauf bestanden, daß Alysson ihn auf dieser Reise begleitete. Ihm lag schließlich sehr viel daran, sie im sicheren Hafen der Ehe zu wissen. Er war nicht sehr begeistert darüber, daß sie mit Oliver in der Welt herumreiste oder sich bei dem dritten Onkel, der Arzt in London war, tagelang im Krankenhaus herumtrieb und ständig Gefahr lief, sich zu infizieren.
Honoré zuliebe hatte sie eingewilligt, ernsthaft über Gervases Antrag nachzudenken. Damit wollte sie sich bei ihrem Lieblingsonkel für all seine Zuneigung und Fürsorge bedanken. Honoré war immer für sie dagewesen und hatte sie wie eine eigene Tochter behandelt. Vor allem gab er ihr das Gefühl, geliebt und gebraucht zu werden – um ihrer selbst geliebt, nicht wegen ihres großen Vermögens.
Ihre Onkel waren ihre Rettung gewesen. Sie hatte sich bemüht, ihre Zuneigung zu gewinnen und betrachtete sich als Glückskind, dem es gelungen war, das Herz der drei zu erobern. Sie gaben ihr das Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Familie. Mit ihnen konnte sie ihre Hoffnungen und Träume teilen. Das traf besonders auf Onkel Honoré zu.
Und jetzt forderte er zum ersten Mal etwas von ihr. Er bat sie die Ehe mit einem Mann zu erwägen, den sie schon lange bewunderte und achtete. Es war das einzige, worum sie Onkel Honoré jemals gebeten hatte.
Und Gervase war ihr nicht gleichgültig.
Daß er unbeirrt mit ihrem Jawort rechnete, war allerdings ein reines Wunschdenken seinerseits. Mehr als einmal hatte sie Gervase erklärt, sie fühle sich noch nicht reif für die Ehe. Sie war ja auch gerade erst zwanzig Jahre alt geworden. Er aber war felsenfest davon überzeugt, daß er sie umstimmen konnte.
Alysson wünschte, sie wäre so sicher wie er. Sie wollte mehr für Gervase empfinden als nur echte Freundschaft. Sie wollte sich in ihn verlieben, aber es würde auch grausam sein, ihm falsche Hoffnungen zu machen. Jedenfalls hatte sie Onkel Honoré versprochen, Gervases Antrag nicht sofort abzulehnen. Daher war sie mehr als froh, ihre Reise morgen beginnen zu können und eine räumliche wie zeitliche Entfernung zwischen ihm und sich zu legen. Vielleicht würde die Trennung ihr Gelegenheit geben, ihre Gefühle für ihn zu prüfen und sich über ihre Zukunft an Gervases Seite klarzuwerden.
Gervase dachte offensichtlich ebenfalls über ihre morgige Abreise nach, denn er schüttelte den Kopf. »Ich würde dich am liebsten begleiten, Alysson. Aber leider erfordert mein Dienst meine Anwesenheit. Ich möchte gar nicht erst darüber nachdenken, was dir ohne meinen Schutz zustoßen könnte.«
»Du solltest dir darüber nicht den Kopf zerbrechen, Gervase. Die Eskorte, die du bereitgestellt hast, wird bestimmt ausreichend sein.«
»Ich könnte besser über deine Sicherheit wachen.«
»Deine Leute sind bewaffnet und ich auch. Und du weißt ja, ich bin ein ausgezeichneter Schütze.«
»Trotzdem wäre es mir lieber, wenn du hier bliebst.« Er blickte sie vorwurfsvoll an. »Ich muß gestehen, mir ist unerklärlich, warum du dich in dieses Abenteuer stürzt und ein so großes Risiko auf dich nimmst.«
Alysson war einen Augenblick verunsichert. Natürlich ziemte es sich nicht für eine Frau, einer so ausgeprägten Reiselust nachzugeben. Aber sie konnte Gervases altmodische Ansicht über ihr Verhalten nicht teilen, geschweige denn, sich ihm fügen. »Was für ein Risiko? Du hast doch selbst gesagt, der Krieg ist beendet.«
»Er wird erst wirklich zu Ende sein, wenn Abd el-Kader sich ergibt. Und selbst wenn das der Fall wäre, würden einige seiner Gefolgsleute zweifellos versuchen, den Heiligen Krieg weiterzuführen.«
Es war unnötig zu fragen, was Gervase damit meinte. Lange bevor sie nach Algerien gekommen war, hatte Alysson von dem Anführer der Berber, Abd el-Kader, gehört. Vor fünfzehn Jahren hatte er Berber und Araber im Heiligen Krieg gegen Frankreich vereinigt. Der blendend aussehende, großartig auftretende Scheich war einst der Mittelpunkt der Pariser Salons gewesen, allerdings bevor der Krieg sich so brutal entwickelte.
Man konnte den Arabern nicht allein die Schuld an den Auswüchsen geben. Als die Franzosen 1830 in das Land einfielen, wurden unverzeihliche Greueltaten begangen. Die Franzosen schreckten vor nichts zurück, um diese stolze Nation zu erobern und zu unterwerfen. So viel sie gehört hatte, war auch Gervases Vater an diesen unmenschlichen Ausschreitungen mitschuldig gewesen. Ihm wurde nachgesagt, er habe grausame Aktionen zur Unterdrückung der Aufständischen angeordnet.
Gervase war anders als sein Vater geraten, zum Glück.
Er war überhaupt anders als die meisten seiner Landsleute. Er zeigte großes Verständnis für die Notlage der Araber. Vor knapp sechs Monaten erst war er nach Algerien gekommen, aber schon jetzt zeigte er eine weitaus menschlichere Einstellung als die meisten Franzosen, die ihre Rolle als Eroberer spielen wollten. Schon aus diesem Grund war sie überzeugt, daß er ein ausgezeichneter Administrator im Bureaux Arabes sein würde.
Trotzdem fand sie, daß Gervase sich über ihren Abstecher in das Landesinnere übertrieben aufregte. Erst im vergangenen Jahr war Abd el-Kader mit seinen Gefolgsleuten in das benachbarte Marokko abgedrängt worden, und die Grausamkeiten auf beiden Seiten nahmen Gott sei Dank ein Ende. Die französischen Kolonisten wurden nicht mehr massakriert und in ihren Häusern ausgeräuchert. Die Bevölkerung der nördlichen Provinzen fügte sich endlich der mächtigen französischen Armee, und die Ebene von Algier war für Europäer durch den militärischen Schutz endlich wieder passierbar. Einige französische Siedler waren sogar weit ins Landesinnere gezogen, um dürres Brachland urbar zu machen.
Nein, wenn ihr das Risiko zu groß erschienen wäre, hätte sie diese Reise nicht in Erwägung gezogen. Nicht ihretwegen, aber die Sicherheit Onkel Honorés würde sie niemals aufs Spiel gesetzt haben. So wie die Dinge lagen, machte sie sich bereits große Vorwürfe, ihrem Onkel während des Abstechers in die Sahara Unbequemlichkeiten zuzumuten. Wenigstens würde die Hitze jetzt im Oktober etwas erträglicher sein.
Nein, Gervases Befürchtungen konnte sie nicht teilen. Er machte eine unwirsche Geste. »Alysson, würdest du mir jetzt bitte zuhören! Unerwartete Gefahren können auftauchen. Banditen, Sklavenhändler, hungernde Nomaden, fanatische Araber, die nicht wahrhaben wollen, daß der Krieg beendet ist. Auch sollte man sich vor Deserteuren aus der Fremdenlegion hüten.«
»Chand wird uns begleiten.«
»Das ist für mich ganz gewiß kein Trost«, erwiderte Gervase schroff. »Chand ist dir ergeben, das steht fest, aber für eine Dame ist er wohl nicht der geeignete Diener. Es gefällt mir ganz und gar nicht, daß du ohne weibliche Begleitung reist.«
Alysson warf ihrem Gegenüber, mit dem sie so gut wie verlobt war, einen warnenden Blick zu. Sie schätzte keinerlei Kritik an ihrem treuen indischen Diener. »Gervase, vielleicht wußtest du es nicht, aber ich verdanke Chand mein Leben, und das mehr als einmal.«
Als sie merkte, daß ihr Ton etwas zu scharf geworden war, lenkte sie ein und lächelte ihn entwaffnend an. Mit logischen Argumenten und Charme würde sie seine schlechte Laune schnell vertreiben. »Chand ist immer mein Freund und zugleich Diener gewesen. Außerdem scheinst du zu vergessen, daß ich Engländerin bin. Die Engländer haben von den Arabern weniger zu befürchten als die Franzosen.«
Gervase wollte diesen Punkt nicht gelten lassen. »Die Araber hassen alle Ungläubigen«, entgegnete er unbeirrt und schüttelte wieder den Kopf. »Und ich kann dich doch nicht ...«
»Gervase, du machst dir unnötige Sorgen.«
Er seufzte betrübt auf. Schließlich zog er die Schultern hoch, und seine Gesichtszüge entspannten sich. »Ich möchte doch nur, daß dir unterwegs nichts zustößt. Und ich bin egoistisch, glaube ich. Die kommenden Wochen ohne dich werden unerträglich sein.«
Er griff nach ihren Händen und führte sie an die Lippen. »Weißt du überhaupt, wie sehr ich dich liebe?«
»Gervase ...« Alysson protestierte schwach. Die Leidenschaft in seinen Augen beunruhigte sie ebenso wie seine Liebeserklärung. Sie fürchtete kaum etwas, aber Liebesbeteuerungen weckten qualvolle Erinnerungen in ihr, die sie lieber verdrängte. Sie hatte aus bitteren Erfahrungen gelernt, sich vor Glücksrittern und Mitgiftjägern zu hüten, die sie mit süßen Schmeicheleien für sich gewinnen wollten.
Gewiß, Gervase hatte nichts mit ihnen gemeinsam. Sie war überzeugt, daß er sie aufrichtig liebte, aber sie verstand nicht, was er in ihr sah. Zugegeben, sie war keine Schönheit, und ihre unbändige Natur war wohl kaum eine Eigenschaft, die sich ein Mann für seine Ehefrau wünschte.
Er blickte sie noch immer durchdringend an. Alysson spürte das heiße Verlangen in seinem Blick, und das verunsicherte sie. Sie fand sich seiner Anbetung unwürdig. »Gervase ...«, sagte Alysson, der nicht ganz wohl in ihrer Haut war, »du hast versprochen, mir Zeit zu lassen.«
Er seufzte leise. »Da befinde ich mich wohl in bester Gesellschaft. Honoré hat mir von einem Maharadscha erzählt, dem du im letzten Jahr einen Korb gegeben hast.«
Erleichtert, daß Gervase auf keiner Antwort bestand, lächelte sie reuevoll. »Ganz so war das nicht. Der Maharadscha wollte mich als seine dritte Ehefrau kaufen. Onkel Honoré war bereit, mit ihm über den Preis zu feilschen, aber mir paßte es nicht, den dritten Platz einzunehmen.«
Gervase lächelte sie bei dieser Bemerkung so liebevoll an, daß sich ein Gefühl der Wärme in ihrem Herzen breitmachte. »Nein, mein kleiner Wildfang, natürlich würdest du darauf bestehen, die erste zu sein! Und wie üblich würdest du auch deinen Kopf durchsetzen. Wenn wir erst einmal verheiratet sind, wirst du mich gewiß genauso um deinen Finger wickeln wie Honoré, Alysson ...« Seine Stimme verebbte, als er sie langsam in die Arme zog. »Darf ich dich küssen, damit ich die kommenden Wochen ohne dich überstehe?«
Eine so aufrichtige Bitte konnte sie nicht abschlagen. Schweigend nickte sie und wünschte sich inständig, daß sie für Gervase ebenso empfinden könnte wie er für sie.
Auf ihre Zustimmung hin nahm er sie noch fester in seine Arme und neigte den Kopf. Seine Lippen waren warm und voller Liebe – aber mit der behutsamen, schicklichen Zurückhaltung, die sich ein Gentleman einer jungen Dame gegenüber auferlegt. Alysson empfand seine Rücksichtnahme nicht gerade als Kompliment und war von seinem Kuß enttäuscht. Sie wünschte sich, Gervase würde sie zielstrebiger und hingebungsvoller umarmen, so daß Leidenschaft und Begehren sie ergriff, wie es die Dichter schwärmerisch beschrieben. Aber das war nie der Fall gewesen. Gervases Küsse waren zwar überzeugend und gekonnt, aber in seinen Armen empfand sie nicht das erregende Prickeln, das den Puls beschleunigte. Es sprang einfach kein Funken zwischen ihnen über. Statt dessen ließen sie seine Zärtlichkeiten immer irgendwie ... enttäuscht zurück.
So wie jetzt. Bei diesem Kuß fehlte etwas. Die eigenen Lippen öffneten sich in Erwartung, als sich seine Zunge in ihren Mund tastete, aber das Herzklopfen blieb aus. Sein behutsames Vorgehen erfüllte sie nur mit einer unerklärlichen Sehnsucht. Die Umarmung des erfahrenen Mannes rief nur ein Gefühl von Traurigkeit hervor, das ihr bewußt machte, daß er nicht der Mann ihrer Träume war und sie nicht die Frau, die er brauchte und verdiente.
Gervase schien jedoch mit ihrer Reaktion zufrieden zu sein, denn als er den Kopf hob und sich aufrichtete, blickte er sie voller Verlangen an. »Geh rasch fort, ma chérie«, sagte er mit einem heiseren Flüstern. »Sieh zu, daß du nicht zu lange fortbleibst. Wir werden gleich nach deiner Rückkehr heiraten.«
Alysson wollte protestieren, aber Gervase brachte sie zum Schweigen und drückte ihr rasch einen Finger auf den Mund.
Als er sie schließlich freigab, trat er einen Schritt zurück. »Willst du hier den Rest des Abends verbringen? Die Gäste werden dich bald vermissen.«
»Noch einen kleinen Augenblick.«
»Also schön, aber wirklich nur einen Augenblick, sonst holst du dir noch eine Erkältung.«
Alysson unterließ es, ihm darauf zu antworten, daß sie in ihrem Leben noch nie eine Erkältung gehabt hatte. Statt dessen blickte sie ihm still nach, bis er im Inneren des Hauses verschwunden war.
Als sie sich wieder umwandte, ließ sie den Blick über den im Halbdunkel liegenden Gartenhof schweifen. Die Unterhaltung mit Gervase und sein Kuß hatten ihre Unruhe genährt. Sie dachte jetzt wieder an den kommenden Morgen, ging die unzähligen Stufen in den Garten hinunter und spazierte den mit Fackeln beleuchteten Kiesweg entlang.
Sie war gerade ein paar Meter gegangen, als sie plötzlich stehenblieb. Ein Mann im Abendanzug tauchte vor ihr im Halbschatten auf, eine Schulter lässig an den dicken Stamm einer Palme gelehnt. Unwillkürlich fuhr sie mit der Hand zum Hals und wollte aufschreien, aber sie brachte nur einen kleinen Piepser hervor.
Er rührte sich nicht von der Stelle, als er sie in fließendem Französisch ansprach: »Verzeihen Sie, daß ich Sie erschreckt habe, Mademoiselle.«
Alysson versuchte das wild klopfende Herz zu beruhigen, während sie die Gestalt näher in Augenschein nahm. Das Gesicht war von den tanzenden Schatten halb verdeckt, und sie konnte kaum etwas erkennen. Gefährlich schien er nicht zu sein. Der Mann war groß und schlank und machte eine glänzende Figur. Er war beeindruckend, ja, aber nicht zum Fürchten.
»Hat Ihnen niemand beigebracht«, fuhr er auf französisch fort, »daß es dem Ruf einer jungen Dame schadet, nachts allein in einen Garten zu gehen und dort einen Mann zu küssen?« Alysson starrte ihn immer noch an.
Sein Ton klang belustigt, aber dennoch schwang so etwas wie ein leiser Vorwurf mit. Es machte sie sprachlos.
Vor Verlegenheit wurde ihr heiß. Dieser Mann hatte gesehen, wie sie Gervase geküßt hatte! Und jetzt schoß ihr auch noch die Zornesröte in die Wangen. »Und hat Ihnen niemand beigebracht, Monsieur«, entgegnete sie wütend, »daß es unhöflich ist, ein intimes Gespräch zu belauschen? Sie hätten sich sofort bemerkbar machen müssen.«
»Dazu gaben Sie mir keine Gelegenheit.«