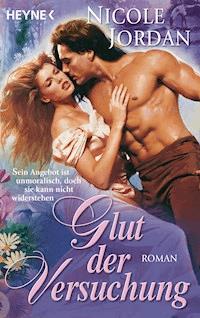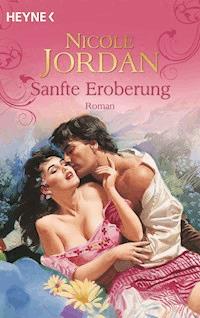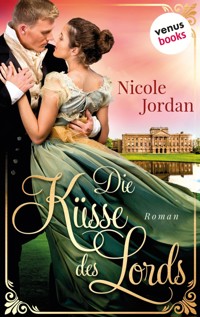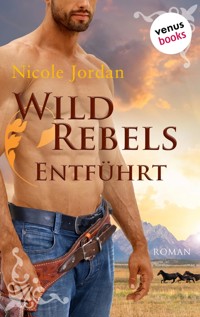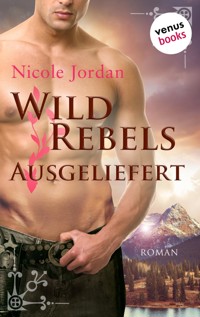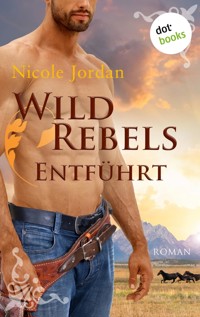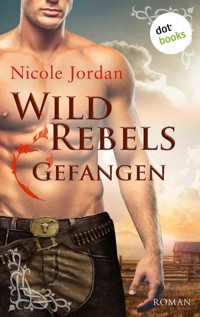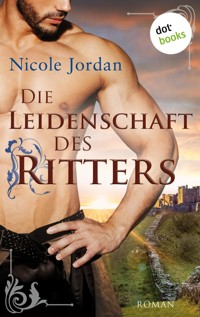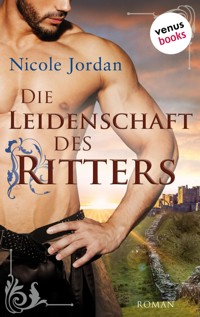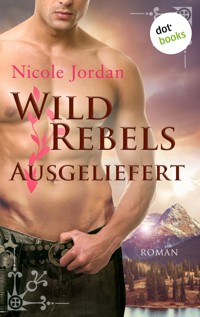
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rocky Mountain
- Sprache: Deutsch
Er nimmt sich, was er begehrt – aber kann er sie zähmen? Die historische Romanze »Wild Rebels – Ausgeliefert« von Nicole Jordan als eBook bei dotbooks. Rocky Mountains, 1884. Die junge Jessica sieht sich nach dem Tod ihres Vaters von Feinden umzingelt: Gierige Hände greifen nach ihrem Erbe, einer begehrten Silbermine. Die Schöne ist verzweifelt – doch dann bietet ihr ein geheimnisvoller Fremder seine Hilfe an. Der ebenso charismatische wie undurchschaubare Garrett Devlin verspricht, ihr beizustehen – doch der Preis dafür ist skandalös. Jessica ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Willen, sich nicht zu verkaufen, und der unstillbaren Sehnsucht, die Garretts Blicke von Anfang an in ihr entfacht haben. Kann sie es wagen, ihm zu vertrauen? »Nicole Jordan versteht es meisterhaft, ihren Fans ein sinnliches Lesevergnügen zu bieten.« Romantic Times Books Reviews Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Liebesroman »Wild Rebels – Ausgeliefert« von Bestseller-Autorin Nicole Jordan ist der dritte Band ihrer fesselnden Rocky-Mountains-Reihe. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rocky Mountains, 1884. Die junge Jessica sieht sich nach dem Tod ihres Vaters von Feinden umzingelt: Gierige Hände greifen nach ihrem Erbe, einer begehrten Silbermine. Die Schöne ist verzweifelt – doch dann bietet ihr ein geheimnisvoller Fremder seine Hilfe an. Der ebenso charismatische wie undurchschaubare Garrett Devlin verspricht, ihr beizustehen – doch der Preis dafür ist skandalös. Jessica ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Willen, sich nicht zu verkaufen, und der unstillbaren Sehnsucht, die Garretts Blicke von Anfang an in ihr entfacht haben. Kann sie es wagen, ihm zu vertrauen?
»Nicole Jordan versteht es meisterhaft, ihren Fans ein sinnliches Lesevergnügen zu bieten.« Romantic Times Books Reviews
Über die Autorin:
Nicole Jordan wurde 1954 in Oklahoma geboren und verlor ihr Herz restlos an Liebesromane, als ihre Mutter ihr zum ersten Mal aus »Stolz und Vorurteil« vorlas. Nicole Jordan eroberte mit ihren historischen Liebesromanen wiederholt die »New York Times«-Bestsellerliste und wurde mehrmals für den begehrten RITA Award nominiert. Heute lebt Nicole Jordan in Utah.
Nicole Jordan veröffentlichte bei dotbooks auch ihre historischen Liebesromane »Die Leidenschaft des Ritters« und »In den Fesseln des Piraten«.
Außerdem veröffentlichte sie in der »Regency Love«-Reihe:
»Die Küsse des Lords«
»Die Sehnsucht der Lady«
»Die Versuchung des Marquis«
Und in der »Rocky Mountains«-Reihe:
»Wild Rebels – Gefangen«
»Wild Rebels – Entführt«
»Wild Rebels – Ausgeliefert«
***
eBook-Neuausgabe April 2020
Dieses Buch erschien bereits 1998 unter dem Titel »Glühender Stern« bei Heyne.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1992 by Anne Bushyhead
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel »Wildstar« bei Avon Books.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
By arrangement with Spencerhill Associates
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Langenbuch & Weiß Literaturagentur, Hamburg/Berlin.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / anetta / Atomazul / Galyna Andrushko / Mariabo2015 / Anton Watman
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-984-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Wild Rebels 3« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Nicole Jordan
Wild Rebels – Ausgeliefert
Roman
Aus dem Amerikanischen von Nicole Hölsken
dotbooks.
Für Jay; natürlich;
meinen hell leuchtenden Stern.
Das hier ist nur für Dich.
… Twere all one
That I should love a bright particular star
And think to wed it, he is so above me.
William Shakespeare
… Alles war eins
Daß ich solch einen hellen besonderen Stern lieben sollte
und ihn heiraten will, er steht so weit über mir.
William Shakespeare
Kapitel 1
Silver Plume, Colorado; 1884
Die schlanke und nackte Gestalt des Spielers lehnte am Fenster seines Hotelzimmers im zweiten Stock, seine Aufmerksamkeit richtete sich auf den Tumult auf der Straße unter ihm. Das dumpfe Geräusch galoppierender Hufe hatte den Frieden des trägen Sommermorgens gestört und die wenigen braven Seelen aufgeschreckt, die nach dem Trubel einer ausgelassenen Nacht schon wieder auf den Beinen waren. Es war Sonntag, der einzige Tag in der Woche, an dem es in einer unzivilisierten Minenstadt wie Silver Plume etwas gemächlicher zuging. Abgesehen von den vereinzelt an den Geländern angebundenen Gespannen und Packeseln war die Hauptstraße nahezu leer.
Den wütenden Reiter, der ‒ und dazu noch ohne Sattel ‒ wie verrückt die staubige Straße hinunterpreschte, schien der Frieden nicht zu interessieren.
Gespannt beobachtete Garrett Devlin die Vorgänge von seinem Hotelfenster aus. Normalerweise hätte eine solche Störung ihn nicht weiter beschäftigt, aber er war aus einem bestimmten Grund in diese Stadt gekommen. Alles was in Silver Plume geschah, interessierte ihn einfach. Und der Anblick, der sich ihm hier jetzt bot, faszinierte ihn geradezu.
Es war eine Frau, die da unten die Straße entlanggaloppierte, deutlich erkennbar nicht nur an den Röcken aus blauem Baumwollsatin und den vier Zoll spitzengesäumter Unterwäsche, die darunter zu erkennen war, sondern auch an der langen Mähne honigblonden Haares, das wild im Wind flatterte.
»Marshal!«, hörte Devlin sie rufen. Sie ritt auf den Mann mit dem Abzeichen auf seiner Weste zu, der gerade an der Gemischtwarenhandlung gegenüber vom Hotel vorbeiging. »Marshal Lockwood!«
Sie brachte ihr Pferd so abrupt direkt vor dem Marshal zum Stehen, daß seine Hufe den Staub aufwirbelten und rief atemlos: »Wartet!« Devlin sah, daß ihre Brust sich hob und senkte. Ihre Stimme klang verzweifelt.
Höflich berührte der Marshal seinen Hut mit der Hand, blieb aber sicherheitshalber auf dem Plankenweg stehen, außerhalb der Reichweite des schnaubenden Pferdes. »Morgen, Miss Jess. Was kann ich für Euch tun?«
Sie hatte Mühe, wieder Atem zu schöpfen, und ihre vollen Brüste hoben und senkten sich bei dieser Anstrengung. Devlin betrachtete die Wirkung mit dem wohlwollenden Blick eines Kenners.
Sie trug einen Überwurf ‒ eine Art lockeres Kleidungsstück, wie man es eigentlich nur im Hause trug ‒ aus glänzendem dunkelblauem Satin ohne Turnüre. Die Fülle ihres lockigen Haares war auf verführerische Weise zerzaust, so, als ob sie gerade erst aufgestanden wäre. Was wahrscheinlich auch der Fall war, dachte Devlin, entzückt von dem erregenden Anblick. Sie sah ein wenig jünger aus, als er aufgrund ihrer sinnlichen Rundungen zuerst vermutet hatte. Vielleicht zwanzig. Aus dieser Entfernung konnte er zwar die Farbe ihrer Augen nicht erkennen, aber er sah, daß ihr Gesicht vor Ärger oder vielleicht auch vor Angst gerötet war.
»Riley ist angeschossen worden!«, stieß sie schließlich keuchend hervor.
»Was zum Donner?« Nun blickte der Marshal nicht länger verständnislos, sondern bestürzt drein und runzelte die Stirn »Euer Vater ist angeschossen worden?«
Sie nickte mit dem Kopf, aber ihre Stimme bebte, als sie antwortete, »Man hat ihm in den Rücken geschossen. Er war oben in der Mine … und ging die Bücher durch.«
Mit einer verzweifelten Geste deutete sie nach oben auf die zerklüfteten Berge, die hinter dem Laden zu sehen waren, so daß Devlin einen Augenblick lang nach oben sah. Die imposanten Bergspitzen aus Granit schienen Himmel und Erde zu beherrschen. Sie überragten die Stadt, ebenso wie die tiefe Schlucht, in der Silver Plume kauerte. Von seinem Aussichtspunkt aus konnte Devlin die zahlreichen Schutthalden der Minen sehen, ebenso wie die Pfade, die sich serpentinenartig die steilen Berghänge emporwanden und in der unermeßlichen Weite des blauen Himmels zu verschwinden schienen.
»Ein Aufseher der Silver Queen Mine hat ihn gefunden und nach Hause gebracht«, hörte Devlin sie sagen. »Es geht ihm ziemlich schlecht. Wenn man ihn nicht rechtzeitig gefunden hätte, wäre er jetzt wahrscheinlich schon tot. Die Blutungen habe ich stillen können, aber er ist noch nicht außer Gefahr. Ich habe Angst…, daß er doch noch stirbt.« Ihre Stimme verlor sich in einem Schluchzer, aber dann schluckte sie schwer. »Ich habe schon nach dem Arzt geschickt. Er ist unterwegs.«
Der Marshal war offenbar noch immer damit beschäftigt, das alles zu verdauen. »Verdammt, wer sollte denn so etwas tun?«
»Das wißt Ihr doch ganz genau! Burkes Handlanger, wer sonst!«
»Aber, Miss Jess, das könnt Ihr doch gar nicht wissen ‒«
»Ich weiß es ganz genau! Und jetzt sagt mir, was Ihr in dieser Sache zu unternehmen gedenkt.«
»Ich werde zur Wildstar Mine hinaufgehen und mich mal etwas umsehen.«
Frustriert ballte sie ihre kleine Hand zur Faust. »Wer immer es war, er ist doch bestimmt schon längst über alle Berge. Warum bringt Ihr diesen Ashton Burke nicht endlich hinter Schloß und Riegel? Er ist es, der hinter diesem Anschlag steckt. Das weiß ich ganz genau.«
Ashton Burke. Devlin kannte den Namen. Burke war ein reicher englischer Kapitalist, dem nicht nur dieses Hotel sondern auch ein Dutzend Saloons und Spielhallen in drei Städten und jede Menge Anteile an den umliegenden Minen gehörte.
»Könnt Ihr das beweisen?«
»Er hat uns letzte Woche bedroht, weil Riley ihm die Wildstar nicht verkaufen wollte. Was für einen Beweis braucht Ihr denn noch?«
»Nun, Miss Jess, Ihr wißt, daß ich nicht einfach herumlaufen und Leute ohne Beweis verhaften kann. Außerdem würde ein rechtschaffener Mann wie Mr. Burke niemals solch drastische Gewaltmaßnahmen ergreifen.«
Ihre höhnische Antwort wurde von einer ebenso gereizten wie verführerischen Stimme hinter Devlin übertönt.
»Garrett, Liebling, so langsam fange ich an, mich einsam zu fühlen. Warum kommst du nicht zurück ins Bett?«
Er würdigte die üppige Schönheit mit dem ebenholzfarbenen Haar, die in seinem Bett lag, keines Blickes. Lena war Kartengeberin im Diamond Dust Saloon nebenan. Gelegentlich arbeitete sie auch als Freudenmädchen, wobei das Wort Freude hier besondere Betonung verdiente. Sie wählte ihre Kunden mit Sorgfalt aus, und schon am ersten Abend, da Devlin an ihrem Farotisch gesessen hatte, hatte sie sich an seine Fersen geheftet.
Devlin war an eine solch unmittelbare Aufmerksamkeit gewöhnt. Mit seinem rabenschwarzen Haar, den rauchgrauen Augen und seinem verblüffend gutem Aussehen waren ihm die Frauenherzen schon immer zugeflogen. Manchmal war es ihm schon lästig, wie ihm die Frauen hinterherliefen. Aber in diesem Fall war es von Vorteil gewesen. Durch seine zuvorkommende, kultivierte Erscheinung war es ihm ein Leichtes, als Glücksspieler durchzugehen, während seine Bekanntschaft mit Lena Thorpe es ihm erlaubte, mehr über die Stadt herauszufinden, ohne unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Im Augenblick jedoch beachtete er Lenas lockende Stimme nicht, denn die Unterhaltung auf der Straße hatte sein Interesse geweckt.
»Hat Riley den Täter erkannt?«, fragte Marshal Lockwood.
»Nein, das habe ich Euch doch schon gesagt«, erwiderte die junge Frau, die er ›Miss Jess‹ nannte, scharf. »Irgendsoein hinterhältiger Feigling hat ihn in den Rücken geschossen. Wie hätte er dann wohl sehen sollen, wer es war? Alles was ich weiß ist, was der Aufseher gesagt hat. Heute Morgen hat ein Fremder dort herumgeschnüffelt. Er hatte eine Narbe über einem Auge und saß auf einem Rotschimmel.«
Jetzt war Devlin ganz Ohr. Eine Narbe über einem Auge. Saß auf einem Rotschimmel. Er kniff die grauen Augen zusammen und beugte sich vor. In den drei Tagen, die seit seiner Ankunft vergangen waren, hatte er keine Spur von dem Mann ausfindig machen können, nach dem er suchte. Dies war der erste Anhaltspunkt, der sich ihm seit dem Eisenbahnraub vor zwei Wochen bot.
»Ihr solltet einen bewaffneten Trupp zusammenstellen«, rief die blonde Schönheit vorwurfsvoll. »Um rechtschaffene Bürger davor zu schützen, kaltblütig niedergeschossen zu werden, statt hier herumzustehen und Burke und seine Revolverhelden zu verteidigen. Aber vielleicht steht Ihr ja auch auf seiner Gehaltsliste.«
Marshal Lockwood wurde rot im Gesicht ‒ ob aus Wut oder aus Schuldbewußtsein war sich Devlin nicht sicher ‒ und schimpfte los: »Für solch eine Vermutung besteht kein Anlaß, Ma’am. Ich bin der rechtmäßig gewählte Vertreter des Gesetzes in dieser Stadt, und ich dulde es nicht, daß jemand meine Integrität anzweifelt.«
Miss Jess straffte die Schultern. »Und ich dulde es nicht, mit ansehen zu müssen, wie mein Vater angeschossen wird, während der Schuldige ungeschoren davonkommt. Ich warne Euch, Marshal, wenn Ihr nichts gegen Ashton Burke unternehmt, dann tue ich es. Ich werde Zurückschlagen. Im Zweifel heuere ich eben meine eigenen Revolverhelden an. Burke wird die Wildstar niemals bekommen, darum kämpfe ich bis zum letzten Atemzug. Und jetzt muß ich wieder nach Hause zu Riley. Der Doktor dürfte mittlerweile dort sein.«
Sie wandte ihr Pferd, und als sie sich umdrehte, streifte ihr Blick das Hotelfenster, an dem Devlin stand. Einen Augenblick lang trafen sich ihre Augen, und sie nahm seine geschmeidige, muskulöse Gestalt wahr, die sich ihrem Blick darbot. Ihre Reaktion auf seine Blöße amüsierte und entzückte ihn: Sie errötete und senkte hastig den Kopf, bevor sie ihr Pferd zum Galopp antrieb.
»Miss Jess, macht bloß keine Dummheiten!«, brüllte Marshal Lockwood ihr hinterher, der angesichts ihrer Drohung, die Angelegenheit nun selbst in die Hand zu nehmen, offensichtlich beunruhigt war. »Habt Ihr gehört?«
»Was ist denn das für ein Tohuwabohu da draußen?«, fragte Lena und trat neben ihn. Der Duft ihres teuren Parfüms und der reine Geruch nach Frau hüllte ihn ein, als sie ihre Arme um seine schlanke Taille schlang.
Mit dem Kopf deutete Devlin auf die Straße unter ihnen.
Lena warf einen Blick aus dem Fenster, als die blonde Reiterin davongaloppierte. »Warum hat sie es denn so verdammt eilig?«
»Kennst du sie?«
Lena zuckte die Achseln und gähnte, mit einer Hand zupfte sie an den dunklen, gelockten Haaren auf seiner Brust. »Ihr Name ist Jessica Sommers. Sie hat eine Pension für Bergarbeiter, die sie verköstigt, während ihr Vater sie mit dem nötigen Arbeitsgerät versorgt. Riley Sommers schwebte mit seinem Kopf schon immer in den Wolken. Mittlerweile schuftet er seit sechs Jahren in diesem Claim, hat es aber nie zu etwas gebracht.«
»Er ist heute Morgen angeschossen worden.«
»Was Du nicht sagst.«
Sie schien nicht allzu überrascht zu sein, wie Devlin bemerkte. Gewalt gehörte hier ja schließlich auch zum Leben. Silver Plume war eine typische Minenstadt des Westens: unzivilisiert, rauh und ungehobelt. Die Männer, die hier lebten, kannten nur harte Arbeit und ihre Hoffnungen; in der steinharten Erde fanden sie manchmal Reichtümer, die ihre kühnsten Träume übertrafen, manchmal aber auch den Tod.
»Und was hat Sommers mit Ashton Burke zu tun?«
»Oh, Riley liegt sich mit Ash schon seit Urzeiten in den Haaren.« Plötzlich spürte Devlin ein angenehmes Kitzeln unterhalb seiner Taille. Er sah, wie Lena eine leuchtendrote Federboa über seinen straffen Bauch und über die schwarzen, gekräuselten Haare seiner Lenden zog.
»Süßer«, wisperte sie heiser in sein Ohr, »haben wir denn nichts besseres zu tun, als über alte Fehden zu reden?« Sie preßte ihren nackten, üppigen Körper gegen seinen bloßen Rücken und machte ein paar verführerische Bewegungen.
Er spürte, wie er steif wurde. Lena gab einen sinnlich-kehligen Laut freudiger Erregung von sich. Unbeirrbar legten sich ihre Finger um seinen männlichen Speer, der anschwoll und lang und dick wurde. In zärtlicher Liebkosung erforschte und streichelte sie sein erigiertes Glied. »Also du bist schon ein prächtiger Bursche.«
Sein Gelächter war tief und sehr männlich, doch er bewegte sich nicht und genoß ihr Spiel und das Gefühl ihrer warmen, streichelnden Finger, die ihn einzuhüllen schienen.
Lena preßte sich heftiger gegen sein Gesäß und ließ einladend ihre Hüften kreisen, »Nimm mich noch einmal, mein männlicher Schatz.«
Er war nun vollkommen erregt und wandte sich mit wollüstigem Lächeln zu ihr um: »Es ist mir ein Vergnügen, Ma’am. Stets zu Diensten, einer schönen Dame einen Gefallen zu erweisen.«
»Meine Güte, wie vornehm dieser Bursche daherreden kann!«
»Wer redet denn hier?«, murmelte er und ließ seine Hände ihren Rücken hinab und bis unter die glatten Hügel ihres Gesäßes gleiten. Er hob sie ohne Eile hoch, schlang ihre gespreizten Beine mit Leichtigkeit um seine Schenkel und preßte sie mit dem Rücken gegen die Wand.
Lena gurrte und packte seine nackten Schultern, die Federboa war vergessen. Als sie sich gegen ihn preßte, beugte er die Knie und glitt tief in ihr feuchtes, warmes Fleisch hinein. Ihr heiseres Keuchen verwandelte sich in ein heißes Wimmern.
Hart stieß er ihre Hüften gegen die seinen und nahm sie zum dritten Mal an diesem Morgen. Doch ein Teil seines Geistes hatte an diesem lustvollen Vergnügen keinen Anteil. Er dachte an das Gespräch über den Fremden mit der Narbe über dem Auge, das er gerade soeben mit angehört hatte ‒ und überlegte, was er deswegen unternehmen würde.
Er war fest entschlossen die Bekanntschaft von Miss Jessica Sommers zu machen. Aber in der Zwischenzeit konnte er genausogut den restlichen Morgen genießen.
Sechs Häuserblocks entfernt, in der Küche eines kleinen Bergarbeiterhäuschens schlang Jess ihre Finger ineinander, bis sie schmerzten, während sie Doc Wheeler dabei beobachtete, wie er die Revolverkugel vom Kaliber 44 aus dem Rücken ihres Vaters entfernte. Wenigstens hatte er im Augenblick keine Schmerzen. Bewußtlos lag Riley Sommers auf dem Bauch auf dem harten Eßtisch, sein Blut tropfte auf den gelben, handgewobenen, kleinen Baumwollteppich hinunter. Die karmesinroten Flecken wirkten in dem glänzenden Sonnenlicht, das durch das Fenster hereinfiel, auf obszöne Weise lebendig.
Jess hatte gar nicht bemerkt, daß das erstickte Schluchzen, das die ganze Zeit zu hören gewesen war, von ihr kam, bis der Partner und beste Freund ihres Vaters, Clem Haverty, ihr voller unbeholfener Zuneigung den Arm tätschelte.
»Hat ihn ganz schön erwischt«, flüsterte der verhutzelte alte Maultiertreiber heiser, »aber der alte Riley hat noch nie ohne Kampf aufgegeben. Er wird es schaffen, Jess.«
»Oh, Clem«, sagte sie mit bebender Stimme; dann schluckte sie und bemühte sich um Fassung. Ein Zusammenbruch konnte weder ihren Vater retten noch ihr selbst dabei helfen, diese schreckliche Situation durchzustehen.
Wie konnte es dazu kommen? Riley hatte so hart gearbeitet, um dahin zu kommen wo er war, und was hatte er jetzt davon? Eine Kugel im Rücken. Es war kaum zu ertragen.
Sie spürte, wie Clem ihr voller Mitgefühl den Arm drückte und blickte durch einen Tränenschleier zu ihm auf. Die tiefen Linien, die sich unter dem struppigen grauen Haar in seine Stirn gegraben hatten, zeigten, wie besorgt er war. Er kämpfte gegen die gleiche Furcht an, die auch ihr zu schaffen machte: eine heftige, nagende Angst, die sich wie Säure in die Magengrube zu fressen schien.
»Irgend jemand hat ihn vorsätzlich umbringen wollen«, murmelte Clem und zupfte an seinem langen Bart.
Jess nickte, doch sie traute ihrer Stimme nicht genug, um zu antworten.
»Ich werde den Bastard finden, der es getan hat. Und dann mache ich mir ein Fest draus, ihn am nächstbesten Baum aufzuknüpfen.«
Daran, daß ihm ein solcher Fluch entschlüpft war, konnte man erkennen, wie erschüttert er war. Clems Wortwahl hätte normalerweise zwar immer die ganze Prärie in Brand setzen können, aber in ihrer Gegenwart strengte er sich immer an, seine Zunge im Zaum zu halten. Normalerweise gestattete Jess keine Flüche im Haus ihres Vaters, ebensowenig wie in der Pension nebenan, wo Clem und ein Dutzend anderer Bergleute wohnten. Aber diesmal machte sie eine Ausnahme. In diesem Fall teilte sie Clems Gefühle voll und ganz.
Im Stillen fügte sie seinem Fluch ihre eigene Verwünschung hinzu und der Zorn, der sich ihrer bemächtigte, war eine willkommene Ablenkung von ihrer Angst. Sie konzentrierte sich auf ihre Wut und richtete sie auf den Mann, der für diese niederträchtige Tat verantwortlich war: Ashton Burke. Allein der Gedanke an ihn erfüllte sie mit eiskalter Wut. Männer wie Burke, reiche und mächtige Männer, die andere Menschen manipulierten, verdienten ein solches Schicksal eher als Riley. Alle reichen Männer der Welt, alle Silberkönige, alle Eisenbahngesellschafter, Bankiers, Industrielle und ihre geldgierigen Agenten, all die geldscheffelnden Parasiten, die von der harten Arbeit und dem ehrlichen Schweiß anderer Leute lebten.
In diesem Augenblick gab Doc Wheeler einen befriedigten Laut von sich und holte seinem Patienten eine abgeflachte Bleikugel aus dem Rücken. Eilig trat Jess an seine Seite und hielt ihm eine Schale hin, in das er sie legen konnte.
»Die bewahrt Ihr besser auf, junge Dame. Riley wird sie bestimmt sehen wollen.«
»Wird er es schaffen, Doc?«, fragte Clem voller Angst.
Der Arzt grinste. »Sicher wird er es schaffen. Die Kugel ist einen guten Viertelzoll an seiner Lunge vorbeigegangen ‒ er hat Glück gehabt. Außerdem ist Riley zäher wie altes Leder. Um ihn umzubringen, muß man schon mehr anstellen.«
Jess spürte, wie ihr die Knie weich wurden. Sie murmelte ein erleichtertes Gebet, dann sank sie auf einen Küchenstuhl und hielt sich mit der Hand den Mund zu, während Clem sich ohne Scheu die Tränen abwischte.
Nachdem Doc Wheeler das rohe Fleisch mit Karbol gereinigt und sich das Blut von den Händen gewaschen hatte, bandagierte er sorgfältig Rileys Rücken. Dann trugen er und Clem den bewußtlosen Mann in das kleine blau-weiße Schlafzimmer und legten ihn mit dem Gesicht nach unten auf das Bett, dessen Decken Jess bereits zurückgeschlagen hatte.
»Er wird wahrscheinlich noch eine Weile ohne Bewußtsein bleiben«, erklärte der Arzt. »Ich werde Euch eine Flasche Morphium hier lassen, das Ihr ihm geben müßt, wenn er zu sich kommt. Schlaf ist die beste Medizin für ihn. Achtet darauf, ob er Fieber bekommt und laßt mich holen, wenn es diese Nacht zu hoch wird. Sonst komme ich morgen erst wieder, um den Verband zu wechseln.«
Jess dankte dem Arzt und bat Clem, ihn nach draußen zu begleiten ‒ sie selbst war zu besorgt, um ihren Vater jetzt allein lassen zu wollen. Als Clem wieder ins Schlafzimmer zurückkehrte, saß sie am Bett. Er folgte ihrer stummen Geste und setzte sich in den Schaukelstuhl neben dem ihren, wobei er die Daumen in die Hosenträger seines Overalls aus blauem Segeltuch einhakte.
Schweigend betrachteten sie eine Weile den Patienten, bis Jess schließlich mit leiser Stimme sagte: »Hinter all dem kann nur dieser Burke stecken.«
»Ziemlich wahrscheinlich.«
»Marshal Lockwood hat mir nicht geglaubt.«
»Kann ich mir vorstellen.«
»Verdammt, das ist einfach nicht fair!«
»Nein, bestimmt nicht.«
»Burke kann sich mit seinem Geld alles kaufen. Alles, was man sich wünschen kann. Warum will er jetzt ausgerechnet das eine haben, wofür Riley sein Leben lang so hart gearbeitet hat?«
»Keine Ahnung. Kommt mir nicht richtig vor, daß Burke alles tun kann, wozu er grad Lust hat.«
»Nun, diesmal kommt er mir nicht davon!«, schwor Jess.
»Und was hast du vor?«
»Ich sorge dafür, daß er es sich demnächst zweimal überlegt, bevor er seine Revolverhelden losschickt, um seine schmutzige Arbeit zu tun.«
Clem strich sich über den grauen Bart und warf ihr einen mißtrauischen Blick zu. »Halt dich lieber von Burke fern, Jessie. Wenn er Riley das hier wirklich angetan hat, dann ist er zu allem fähig.«
Jess wandte den Blick ab. Entschlossen preßte sie die Lippen aufeinander. »Ich glaube, du hast das falsch verstanden, Clem. Ashton Burke sollte sich besser von mir fernhalten. Er wird keine Ansprüche auf Wildstar geltend machen, und er wird Riley niemals mehr weh tun. Nie wieder.«
Diesen Schwur würde sie halten. Ihr ganzes Leben hatte Jess mitbekommen, wie ihr Vater sich abmühte, seinen Lebensunterhalt aus den Silberminen Colorados zu bestreiten, zuerst als Schürfer, dann als Besitzer einer zweitklassigen Erzmine. Er hatte sich weitaus länger abgemüht, als die einundzwanzig Jahre ihres Lebens, und hatte den Schmerz verlorener Träume und zerstörter Hoffnungen die ganze Zeit über ertragen müssen.
Jeden Penny, den er besaß, setzte er auf eine Mine, die sich genausogut als wertlos herausstellen konnte. Niemandem war es gelungen, ihn zur Vernunft zu bringen, noch nicht einmal Jess’ Mutter.
Der Sirenengesang des Silbers war Riley zu Kopf gestiegen. Immer vermutete er den Erfolg gleich nebenan, nur noch einige wenige Fuß den Stollen entlang. Und diese große Silberader würde ihn auf der Stelle zu einem wohlhabenden Mann machen.
Er hatte sie nie gefunden.
Und jetzt wollte ihm Ashton Burke sogar diesen erbärmlichen Traum noch nehmen. Burkes Lady J Mine grenzte direkt an Rileys Wildstar oben in der Cherokee Schlucht an. Letzte Woche war es gewesen, da Burke vor ihrem Haus erschienen war und angeboten hatte, Riley die Mine für eine beträchtliche Summe Bargeld abzukaufen. Nicht nur, daß Riley nicht hatte verkaufen wollen, er hatte in dem Zeitpunkt, da ihm dieses Angebot gemacht worden war, auch eine verborgene Bedeutung vermutet.
»Siehst du es denn nicht, Jess?«, hatte er ihr erregt erklärt. »Falls Burke in der Lady J Mine auf eine Ader gestoßen ist, dann ist vielleicht auch jede Menge Erz in der Wildstar. Ich muß es nur finden.«
Sie hatte nicht das Herz gehabt, ihm seine Hoffnungen zu zerstören. Sie hatte nicht darauf bestanden, ihm die Wahrheit vor Augen zu führen ‒ daß Burke aus reiner Rachsucht handelte. Mit dem Kauf der Mine verfolgte er einzig und allein den Zweck, ihrem Vater zu schaden und ihn aus dem Geschäft zu drängen.
Das schien ihr so klar wie der helle Tag. Die erbitterte Rivalität dauerte nun schon seit der Zeit vor ihrer Geburt an, seit Riley es gewagt hatte, ein Mädchen zu heiraten, das Burke für sich hatte gewinnen wollen. Und Ashton Burke war ein Mann, der es haßte, wenn seine Pläne vereitelt wurden. Er haßte jeden, der ihm nicht Platz machte. Jess war sich sicher, daß Burke es geradezu genoß, die Existenz kleiner Leute wie ihren Vater zu zerstören, besonders wenn es ihm dazu verhalt, weiterhin Reichtum und Macht anzuhäufen.
Aber sie würde es nicht zulassen, daß er Erfolg hatte. Wenn sie sich gegen einen mächtigen Silberbaron wie Burke stellen mußte, um ihren Vater zu schützen, dann würde sie das auch tun.
Es dauerte mehr als drei Stunden, bevor Riley sich zum ersten Mal bewegte. Als seine Augenlider flatterten, richtete sich Jess kerzengerade in ihrem Sessel auf.
»Was … ist geschehen?«, fragte ihr Vater mit heiserer Stimme, um gleich darauf zusammenzuzucken und vor Schmerz laut aufzustöhnen.
Hastig kniete Jess neben seinem Bett nieder und griff zärtlich nach seiner Hand. »Du darfst jetzt nicht sprechen, Riley. Du bist schwer verletzt.«
»Fühlt sich an … als ob … jemand mir eine Stange Dynamit in die Schulter gestoßen hätte.«
Clem beugte sich über das Bett und grunzte. »Beinahe. Man hat dir in den Rücken geschossen.«
»Wer …?«
»Riley, bitte«, bat Jess inständig. »Komm jetzt, du mußt deine Medizin nehmen.«
Sie bat Clem, ihr zu helfen, indem er den Kopf ihres Vaters hochhielt, während sie ihm mit dem Löffel eine starke Dosis Morphium einflößte. Riley zog vor Schmerz eine Grimasse, schluckte die Medizin aber gehorsam hinunter. Als sie fertig war, ergriff er ihre Hand und wollte weder sie noch das Thema wieder fallenlassen.
»War es Burke?«
»Kennst du sonst noch jemanden, der deinen Tod wünschen könnte?«, antwortete Jess grob.
»Wußte immer … Burke wollte mir eins überbraten, aber ich … hätte nie gedacht, daß er so weit gehen würde, mich in den Rücken zu schießen.«
Liebevoll streichelte Jess das schweißnasse, von grauen Strähnen durchzogene Haar ihres Vaters. »Ich auch nicht.«
»Jess? … Muß dir etwas erzählen … über deine Ma …«
»Riley, sprich jetzt nicht, bitte.«
»Falls ich abkratze.«
»Du wirst nicht sterben!«, rief sie wütend, dann fing sie sich wieder und atmete tief ein, um sich zu beruhigen. »Sei jetzt still und schlaf, wie der Arzt es gesagt hat.«
»Du verstehst nicht … Burke … er weiß nichts von dir … Muß es ihm erzählen … damit er dir nichts tut.«
»Niemand wird mir etwas antun. Hör jetzt auf, dich zu quälen und konzentrier’ dich darauf, gesund zu werden. Wenn du wieder auf dem Damm bist, mache ich dir eine ganze Schüssel voller Erdbeerkuchen.«
»Erdbeeren?« Das Lächeln, das Riley ihr zuwarf, war verzerrt und matt. »Für … mich allein?«
»Ja, nur für dich allein.« Sie beugte sich über ihn und küßte zärtlich seine Schläfe. »Und jetzt schlaf.«
Es dauerte noch eine Weile, aber schließlich tat das Morphium seine Wirkung. Sie drückte die Hand ihres Vaters ein letztes Mal, zog die Decke hoch, wobei sie darauf achtgab, den Verband nicht zu berühren, dann ging sie zur Vorratskammer neben der Küche, wo Riley seine Waffen aufbewahrte.
Von einem Regal nahm sie eine doppelläufige Schrotflinte und eine Patronenschachtel herunter und lud die Waffe.
Kapitel 2
Im Wilden Westen gab es eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie man ums Leben kommen konnte, und im Laufe seiner Karriere war Devlin dem Teufel schon einige Male von der Schippe gesprungen. Einmal war er von einer Ladung Eisenbahnschwellen fast zerquetscht worden, die sich verschob, als er die Weiterführung eines Streckenausläufers für eine der vielen Eisenbahnlinien seines Vaters überwachte; 1874 war er beim Zurücktreiben einer Herde beinahe von einem Longhornrind aufgespießt worden; einmal hatte ihn der Schuß eines empörten, alles andere als nüchternen Ehemannes um Haaresbreite verfehlt, der im übrigen nie den Mut aufgebracht hätte, sich mit einem bekannten Revolverhelden anzulegen, wenn er ein paar Gläser Whisky weniger getrunken hätte; während des Black Hill Goldrausches war er in Dakota fast von dem Speer eines Sioux-Kriegers durchbohrt worden.
Aber noch nie zuvor hatte er einem Racheengel mit goldbraunem Haar und feuersprühenden Augen gegenübergestanden. Sie stürmte wie ein Wüstenwirbelwind in Burkes privaten Spielsalon und brachte den frischen Geruch des Lebens mit, während sie eine Todesdrohung in der Hand hielt.
Inmitten der glänzenden Vertäfelung aus Walnußholz und den polierten Kristallkandelabern sah ihre Waffe unscheinbar, aber tödlich aus. Devlin bemerkte, daß sie sich seit heute Morgen umgezogen hatte. Ihr herrliches Haar hatte sie züchtig unter einem kleinen Hut hochgesteckt. Unter ihren grauen Röcken sah man eine bescheidene Turnüre, und das hochgeschlossene Jackenmieder brachte ihre festen, üppigen Brüste äußerst schmeichelhaft zur Geltung. Im Vergleich zu den prächtigen Gewändern, die die wenigen anwesenden Damen zur Schau stellten und der eleganten Abendgarderobe der männlichen Gäste, wirkte ihr schlichtes Kleid geradezu schäbig.
Es war Sonntag, weshalb der Diamond Dust Saloon für die Öffentlichkeit geschlossen war, aber im privaten Salon hatte sich eine große Gesellschaft versammelt. Devlin war Ashton Burkes Einladung zu einem freundschaftlichen Faro-spiel gefolgt, wobei weniger die Aussicht auf Informationen als das Versprechen hoher Einsätze, unbegrenzten Champagners und eines vornehmen Publikums gelockt hatte.
Er saß direkt neben Burke, als Jessica Sommers so überraschend erschien. Devlin beobachtete gespannt, wie sie sich einen Weg durch die Menge und den Dunst des Zigarrenrauchs bahnte. Auf halbem Wege quer durch das Gesellschaftszimmer hielt sie inne und suchte mit zusammengekniffenen Augen die Gäste ab.
Der gesamte Raum wurde nach und nach ruhig, abgesehen von dem schnellen Klicken des sich noch drehenden Rouletterades.
»Burke!«, stieß sie gepreßt hervor, als sie den blonden Engländer entdeckt hatte. In ihrer Stimme lag so etwas wie grimmige Vorfreude.
Stühle begannen zu scharren, als sich die Menschen in der Schußlinie in Sicherheit brachten. Nur Devlin blieb regungslos sitzen. Ihr Anblick faszinierte ihn. Gold, dachte er mit seltsamer Freude. Ihre Augen waren golden, genau wie ihr goldbraunes Haar, und jetzt flammten sie auf, wie Bernstein im Sonnenlicht. Sie war rasend vor Wut und wollte Blut sehen.
Neben Devlin wich die schwarzhaarige Lena, angetan mit einem schulterfreien Kleid aus mit künstlichen Edelsteinen besetztem roten Satin, von ihrem Tisch zurück, wo sie als Kartengeberin tätig war. Ashton Burke, der auf der anderen Seite saß, blieb regungslos sitzen. In seinem gut geschnittenen Frack und seinem Klappzylinder, eine schlanke Zigarre zwischen den Zähnen, schien er Macht und Reichtum geradezu zu verkörpern.
Burke schien nicht allzu beeindruckt zu sein, weder von seiner haßerfüllten Besucherin noch von der Waffe die sie trug. Er legte eine weitere Karte auf den mit grünem Filz bezogenen Spieltisch, bevor er seine Zigarre weglegte, mit höflicher Geste seinen Hut berührte, und sie mit spöttischer Höflichkeit anlächelte.
»Miss Sommers«, sagte er, sein vornehmer britischer Akzent war kultiviert und knapp. »Welchem Umstand verdanken wir die Ehre dieses ungewöhnlichen Besuchs?«
»Unterlaßt Euer herablassendes Getue, Burke. Ihr wißt ganz genau, warum ich hier bin ‒ weil einer von Euren Revolverhelden meinen Vater in den Rücken geschossen hat und ihn dann liegenließ, weil er ihn für tot hielt. Eigentlich dachte ich, daß selbst eine Schlange wie Ihr es seid noch über ein Gewissen verfügt, aber das war niederträchtig, sogar für Euch.«
Ashton Burkes Lächeln geriet immer noch nicht ins Wanken, wurde aber entschieden abweisender. »Ach, ja, Euer Vater. Es tat mir wirklich leid, als ich von seinem … Unglück hörte. Wie geht es ihm?«
»Er ist am Leben, und das ist wohl kaum Euer Verdienst!«
»Aber Ihr irrt Euch, meine Liebe. Ich hatte mit seinem Unfall nichts zu tun und meine Leute ebensowenig.«
»Unfall …?« Jessica Sommers biß sich auf die Lippen und rang offensichtlich um Selbstbeherrschung. »Haltet mich nicht zum Narren! Ihr wünscht Euch doch nichts sehnlicher, als Riley tot zu sehen, damit Ihr Euch seinen Claim unter den Nagel reißen könnt.«
»Ihr habt keinen Grund, unbewiesene Anschuldigungen gegen mich zu erheben, nur weil ich angeboten habe, die Wildstar-Mine für einen äußerst großzügigen Preis zu kaufen. Das Eigentum Eures Vaters interessiert mich lediglich auf gesetzlicher Ebene. Ich will die Möglichkeit ausschließen, daß sich die beiden Claims und die damit verbundenen Besitzverhältnisse überschneiden. Aber mein Interesse geht keineswegs so weit, daß ich ihm ein Leid zufügen würde. Ich schlage vor, Ihr sucht anderswo nach dem Übeltäter. Und jetzt … dies ist eine private Gesellschaft, Miss Sommers. Wenn Ihr also fertig seid, werde ich Euch von jemandem nach draußen begleiten lassen.«
Ihre glühenden bernsteinfarbenen Augen wurden immer bedrohlicher, sie machte keinerlei Anstalten zu gehen. »Ich warne Euch nur ein einziges Mal, Burke. Ihr werdet Eure Revolverhelden von meinem Vater fernhalten, habt Ihr mich verstanden? Und wenn Riley sich auch nur ohne sichtbaren Anlaß den Zeh stößt, werde ich Euch dafür zur Verantwortung ziehen.« ‒ Sie hob das Gewehr ‒ »Hiermit werde ich hinter Euch her sein und Euch mit so vielen Kugeln durchlöchern, daß Ihr wie ein Sieb aussehen werdet. Man wird Goldsand mit Euch auswaschen können.«
Burkes Lächeln verblaßte. »Ich schlage vor, daß Ihr davon Abstand nehmt, solche wüsten Drohungen auszustoßen, Miss Sommers. Ich würde es sehr bedauern, Marshal Lockwood veranlassen zu müssen eine Belohnung für Eure Festnahme auszusetzen.«
Äußerlich schweigsam und unbeteiligt, innerlich jedoch voller Interesse und sogar mit etwas Mitgefühl, beobachtete Devlin die Auseinandersetzung zwischen der Unruhestifterin und dem Silberkönig. Er konnte Jessica Sommers ohnmächtige Wut und Burkes gelassene Überlegenheit ebenso spüren wie den Haß, mit dem sie einander begegneten. Die Feindseligkeit zwischen beiden war gefährlich, fast greifbar.
Sie standen sich gegenüber wie zwei Berglöwen, die die Krallen ausgefahren hatten, um für den gleichen Bau zu kämpfen. ‒ Ein faszinierender Anblick.
Gespannt blickte Devlin von einem zum anderen, und plötzlich war er erstaunt, wie ähnlich sie einander waren. Beide hatten feine Gesichtszüge, denen die Entschlossenheit eine gewisse Härte verlieh. Zugegeben, Burkes Augen waren blaßblau und Jessicas golden, und wahrscheinlich war er etwa dreißig Jahre älter. Aber trotzdem sahen sie aus, als ob sie aus dem gleichen Holz geschnitzt gewesen wären.
Devlin verstaute diese interessante Beobachtung im hintersten Winkel seines Gedächtnisses. Plötzlich nahm er aus den Augenwinkeln eine Bewegung war. Hinter Jess war ein Mann aufgetaucht, der sich außerhalb ihres Gesichtskreises bewegte. Ein magerer schwarzhaariger Mann mit dem Namen Hank Purcell; Devlin hatte ihn vor etwa einer Stunde kennengelernt. Er zielte mit seinem sechsläufigen Colt direkt auf Jessica Sommers’ Schulterblätter.
Devlin hatte nicht vorgehabt sich einzumischen, aber das war gewesen, bevor die Chancen aus dem Gleichgewicht geraten waren. Mit einer schnellen Bewegung seines Arms ließ er seine Pistole aus dem Spielerversteck im Ärmel in seine Handfläche fallen. Die stupsnasige Derringer hatte zwar nur eine geringe Reichweite, aber doch Kraft genug, zwei solide Bleikugeln abzufeuern. Die eine, die Devlin in die Decke schoß, ließ Gipsstaub auf Purcells Kopf herabrieseln, die zweite bewahrte er sich auf, als Purcell erstarrte.
Der Knall hallte in dem eleganten Raum laut wieder. Devlin sah Miss Sommers zusammenfahren und spürte, wie Burke sich neben ihm verkrampfte, aber seine Aufmerksamkeit galt Purcell, der hinter dem Mädchen stand. »Ich würde keinen weiteren Gedanken daran verschwenden«, schlug er mit vorgetäuschter Gelassenheit vor, während er mit dem Daumen den Abzug der kleinen Derringer zurückhielt.
Jess fuhr herum, und als sie ihrem Angreifer ins Gesicht sah, ließ ihr Ausdruck zunächst Verblüffung, dann Abscheu erkennen, als sie die Waffe in Purcells Hand erblickte. »Dies ist die Art, wie Ihre Leute neutral bleiben, Mr. Burke?«
»Senkt die Waffe«, befahl Devlin, als ob sie gar nichts gesagt hätte.
Purcells brutales Gesicht nahm einen aufsässigen Ausdruck an.
»Sonst ist heute Euer Todestag«, fügte Devlin liebenswürdig hinzu. Er konnte geradezu spüren, wie sich Ashton Burkes blaßblaue Augen in ihn hineinbohrten, aber die Entscheidung des Silberkönigs überraschte ihn nicht.
»Tu, was er sagt, Hank«, befahl Burke.
Nach einem weiteren Augenblick sinnlosen Zögerns legte Purcell den Revolver behutsam auf den Boden.
»Jetzt tretet langsam zurück.« Devlin wartete, bis der Mann mit erhobenen Händen und nach außen gerichteten Handflächen zurückgewichen war. Dann schenkte er der zornigen jungen Frau ein träges Lächeln: »Miss Sommers, ich finde, daß jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um sich zu verabschieden.«
Sie drehte sich langsam um und warf ihm einen langen
Blick zu, der gleichzeitig mißtrauisch und fragend war. Aber offensichtlich war sie immer noch auf Streit aus, denn ihre Augen wanderten weiter zum Silberkönig. »Vergeßt nicht, was ich gesagt habe, Burke«, warnte sie leise, bevor sie auf dem Absatz kehrt machte und auf die Tür zu ging.
Die schweigende Menschenmenge, die ihr den Weg freimachte, gab Seufzer der Erleichterung von sich, als sie gegangen war. Es dauerte jedoch eine ganze Zeit, bis die Gäste wieder zu ihrer vorherigen Beschäftigung zurückkehrten und der Geräuschpegel wieder anstieg.
Im Gegensatz dazu war das Schweigen an Devlins Tisch geradezu bedrückend. Als er die kleine Pistole wieder in seinen Ärmel gleiten ließ, konnte er förmlich spüren, daß Burke vor Zorn kochte.
»Hat Euch nie jemand erklärt, Mr. Devlin, daß es für einen Fremden nicht klug ist, in einer Streitfrage, die ihn nichts angeht, Partei zu ergreifen?«
Devlin lächelte vergnügt. »Das ist eine meiner größten Schwächen, Mr. Burke. Ich habe es noch nie geschafft, eine Dame in einer Notlage allein zu lassen … oder unbeteiligt dabeizustehen, wenn jemand in einen Hinterhalt geriet. So etwas paßt mir einfach nicht. Unter den gegebenen Umständen verstehe ich es aber durchaus, warum Ihr die Sache nicht in dem gleichen Licht seht wie ich.«
»Da habt Ihr absolut recht. Das tue ich nicht! Wenn ich einem Mann meine Gastfreundschaft anbiete, erwarte ich zumindest einen gewissen Grad von Höflichkeit, wenn nicht sogar Loyalität.«
»Nun, dann werde ich den Vorzug Eurer Gastfreundschaft nicht länger in Anspruch nehmen.« Devlin schob den gelben Stapel Hundert Dollar Chips, die er gewonnen hatte, in die Mitte des Tisches. »Behaltet es«, sagte er gelassen, »als Zeichen meiner Wertschätzung für einen vergnüglichen Abend und um den Schaden an Eurer Decke zu beseitigen. Und jetzt entschuldigt mich bitte.«
Devlin nickte der bestürzt dreinblickenden Lena höflich zu, schob seinen Stuhl zurück und erhob sich. Er hielt lange genug an, um Purcells sechsläufigen Revolver mit dem Fuß unter einen Tisch zu stoßen und schlug dann den gleichen Weg ein, den vor ihm Jessica Sommers genommen hatte. Mindestens drei Augenpaare ‒ Burkes, Purcells und Lenas ‒ schienen derweil Löcher in seinen Rücken brennen zu wollen.
Draußen, in der Dunkelheit, lehnte Jess an dem hölzernen Geländer und versuchte, ihr Zittern zu unterdrücken. Sie hörte das Schwingen der Flügeltüren, dann das Geräusch gemächlicher Schritte auf dem Plankenweg. Sie wußte, daß er es war, auch ohne hinzusehen. Sie wollte nicht, daß er ihre vorübergehende Schwäche sah, deshalb straffte sie die Schultern und wischte sich die verräterischen Tränen aus den Augen. Erst dann wagte sie es, ihm über die Schulter hinweg einen Blick zuzuwerfen.
Er war etwa zwei Meter entfernt stehen geblieben. Seine Hutkrempe war ein wenig heruntergezogen und verbarg einen Großteil seines schwarzen Haares. Trotz des goldenen Scheins einer Straßenlaterne in der Nähe konnte sie seine Gesichtszüge nicht sehen. Aber schließlich kannte sie sein Gesicht bereits und war erstaunt und verblüfft gewesen. Wenn man einen Mann überhaupt als schön bezeichnen konnte, dann war er es. Schön wie die Sünde. Ohne etwas an sich zu haben, das auch hur im Mindesten verweichlicht war.
Er war kein Oststaatendandy; er verkörperte ungeschliffene, diamantenharte Männlichkeit in einer vierundzwanzig Karat Fassung.
Er gehörte zu der Art von Männern, die vernünftige Mütter dazu veranlaßte, ihre Töchter einzusperren oder sie gehörig zu warnen. Auch ihre Mutter hatte sie vor solchen Männern gewarnt. Gerade jetzt, in seinem unauffälligen, teuren Anzug, die Daumen in die Taschen seiner Brokatweste eingehakt, sah er elegant und vornehm aus und … gefährlich.
Ein dunkler Engel mit dem Lächeln eines Teufels.
Jess hatte dieses Lächeln drinnen im Saloon gesehen. Sogar in jenem angespannten Augenblick, als er eine Waffe auf Purcell gerichtet hatte, hatte das sinnliche Lächeln, das er ihr zugeworfen hatte, sie bis ins Mark getroffen, so daß ihr flau wurde und die Knie zitterten.
Als sie sich dieses Lächeln und sein gutes Aussehen jetzt in Erinnerung rief, hätte sie am liebsten die Flucht ergriffen. Aber sie war ihm etwas schuldig.
»Ich danke Euch, Mister, für das, was Ihr getan habt«, sagte sie leise.
Er antwortete mit einer leichten Verbeugung, die bei jedem anderen Mann absurd und affektiert ausgesehen hätte, bei ihm den Eindruck vollendeter Eleganz aber nur noch verstärkte. »Keine Ursache, Miss Sommers. Es war mir eine Ehre, Euch zu Diensten gewesen zu sein.«
Seine Umgangsformen waren die eines Gentleman, seine sanfte, seidenweiche Stimme die eines Mannes, der mit Damen umzugehen wußte. Diese Stimme machte Jess nervös. Sie war an harte Männer und deren harte Sprache gewöhnt, und bei ihnen wußte sie sich auch zu behaupten. Mit seiner Art jedoch wußte sie nicht umzugehen. Nun, da sie ihm so dicht gegenüberstand, fühlte sie sich unzulänglich, fast schon ländlich ‒ und das trotz ihrer zweijährigen Ausbildung in einem vornehmen Mädchenpensionat in Denver, in das man sie geschickt hatte, um zu lernen, wie sich eine Dame verhielt.
»Ich fürchte, ich habe Ihren Namen nicht ganz verstanden«, sagte sie vorsichtig und versuchte sich der Manieren, die man ihr in der Schule beigebracht hatte, zu erinnern.
»Ich heiße Devlin. Garrett Devlin.«
Er trat einen Schritt auf sie zu, klappte seine Hutkrempe, mit dem Daumen zurück und lächelte sanft auf sie herab, ein Lächeln, das ihr erneut den Atem raubte. Aber es waren seine Augen, die ihre Aufmerksamkeit fesselten. Seine scharfsinnigen, intelligenten Augen. Jess starrte zu ihm hoch und versuchte ihre Farbe zu ergründen. Drinnen, im glänzenden Licht der Kronleuchter, hatten sie kühl und kristallgrau dreingeblickt. Hier, im Schatten glänzten sie in rauchigem Silber.
Oh ja, er ist eindeutig gefährlich, dachte sie ein wenig hilflos, obwohl sie sich im Stillen dafür tadelte, daß sie sich so sehr in seinen Bann ziehen ließ.
»Und Ihr seid Jessica Sommers«, hörte sie ihn höflich sagen. »Miss Jess für einige. Ich hörte Euer Gespräch mit dem Marshal heute Morgen mit an.«
Verwirrt runzelte sie die goldbraunen Augenbrauen und dachte an den vergangenen Morgen zurück. Dann erinnerte sie sich und spürte, wie eine plötzliche Hitzewelle über sie hinwegwogte. Der Mann am Fenster. Der nackte Mann am Fenster. Sie hatte nur den oberen Teil seines Körpers gesehen, seine entblößte Brust und seine geschmeidigen, muskulösen Schultern, und das auch nur für einen Augenblick. Aber dieser eine Blick war mehr als genug gewesen, um ihr seine Männlichkeit und seine körperliche Überlegenheit gegenüber allen anderen Männern, die sie kannte, vor Augen zu führen.
In dem Versuch, ihre Verwirrung zu verbergen, trat Jess einen Schritt zurück und stieß gegen das Geländer.
»Wurde Euer Vater schwer verletzt?«
Dankbar für den Themenwechsel schüttelte sie den Kopf. »Nein … er ist auf dem Wege der Besserung. Nach Meinung des Arztes hat er Glück gehabt, die Wunde sah schlimmer aus als sie war. Riley hat den ganzen Tag über geschlafen und bisher sogar noch nicht einmal Fieber bekommen.« Sie hielt inne, um diesem Mann für seine Teilnahme zu danken. »Es ist sehr freundlich von Euch, sich nach ihm zu erkundigen.«
Der sanfte Schwung seiner schönen Lippen zog sie ganz in seinen Bann. In der Nähe wieherte ein Pferd auf der Straße und erinnerte Jess daran, wo sie war. »Es tut mir leid, daß Ihr in meinen Streit mit Burke verwickelt wurdet. Ich fürchte, Ihr habt Euch jetzt in ihm einen ernst zu nehmenden Gegner geschaffen.«
Devlin zuckte die Achseln, eine langsame Bewegung dieser kraftvollen, eleganten Schultern. »Ich habe mir schon früher Feinde geschaffen.«
Das kann ich mir gut vorstellen, dachte Jessica und betrachtete ihn schweigend und mit abschätzigem Blick. Und er schien sich nicht im mindesten Sorgen deswegen zu machen. Immerhin, Garrett Devlin sah nicht aus wie ein Mann, der leicht zu erschrecken war. Genau genommen sah er aus wie ein Mann, dem mit Respekt begegnet wurde ‒ egal, wo er auch hinkam ‒ und sogar durch einen Mann wie Ashton Burke.
»Wie kommt es, daß Ihr mit Menschen wie Burke verkehrt?«, fragte sie neugierig.
»Ich habe mich in der Stadt nach einem guten Spiel umgesehen und er hat es mir ermöglicht.«
Jess verzog das Gesicht zu einer Grimasse und fragte in mißbilligendem Tonfall: »Ihr seid von Beruf Spieler?«
Devlin zuckte erneut mit den Schultern, aber diesmal war sein Blick belustigt. »Unter anderem. Habt Ihr etwas gegen diesen Beruf einzuwenden?«
Tatsächlich hatte sie eine ganze Menge gegen Spieler, fast ebensoviel wie gegen wohlhabende Silberbarone. Ihrer Meinung nach waren sie faule, wertlose Menschen, die auf Kosten des Unglücks und Mangels an Geschicklichkeit anderer Menschen lebten. Garrett Devlin gehörte wahrscheinlich auch in diese Sparte, aber nachdem was er gerade für sie getan hatte, wäre es äußerst unhöflich gewesen, ihn wegen seines Berufs zurechtzuweisen. Ihre Konfrontation mit Burke hätte in einer Katastrophe enden können. Wenn es Hank Purcell gelungen wäre, sich an sie heranzuschleichen und sie ihres einzigen Schutzes ‒ ihrer Waffe ‒ zu berauben, hätte sie wie eine Närrin dagestanden. So jedoch hatte sie Burke die Meinung sagen können und gleichzeitig ihre Würde behalten. Nein, sie war Mr. Devlin dankbar, egal, was oder wer er war.
Jess wandte sich um und blickte die Straße hinab. Es war eine ruhige und glücklicherweise friedliche Nacht, der große Halbmond tauchte die Stadt in silbernes Licht und ließ die rauhe Silhouette der umliegenden Berge hervortreten. Bei Nacht waren die Berge besonders schön, von einer natürlichen Erhabenheit, die im Tageslicht verschwand. Bei Nacht konnte man die Schutthalden der Minen nicht sehen, die die felsigen Abhänge verunstalteten. Auch die lauten Mühlen in den Außenbezirken der Stadt waren verstummt.
Im Augenblick herrschte auch kaum Betrieb in den Saloons und den Tanzsälen an der Hauptstraße. Das einzige Geräusch war ein leises Summen der Menschenmenge im Diamond Dust Saloon. Und auch Jess blieb ganz stumm, sogar auch dann, als Devlin auf sie zukam und sich neben sie an das Geländer lehnte.
»Ich habe nichts dagegen einzuwenden«, bekannte er, »mit einem Mann an einem Tisch zu sitzen, solange er ehrlich ist.«
»Oh, beim Kartenspiel ist Ashton Burke ganz sicher ehrlich«, erwiderte sie voller Bitterkeit. »Ein Mann wie er hat keinen Grund zu mogeln, denn reich wird er auf viele andere Weisen.«
»Ihr denkt also, daß Burke seinen Reichtum mit Hilfe von Männern wie Eurem Vater erlangt hat?«
»Ja, das denke ich, Mr. Devlin. Burke hat sich immer genommen, was er von dieser Stadt wollte, unwichtig wem er damit schadete. Jeder weiß, daß er ein gewissenloser Schurke ist, aber keiner kann es beweisen. Doch diesmal wird er damit nicht durchkommen!«
Nach diesen leisen und dennoch ungestümen Worten spürte sie, wie Devlins graue Augen ihren Körper hinunterglitten und sich auf das Gewehr hefteten, das sie immer noch in Händen hielt. »Glaubt Ihr denn, daß Eure Warnung ihm Einhalt gebieten wird?«
»Vielleicht nicht. Aber er würde keine Drohung von mir ernst nehmen, es sei denn, sie würde durch Blei unterstützt.«
Devlin warf der jungen Frau neben sich einen Seitenblick zu, der voller Anteilnahme und mit einem Anflug von Bewunderung war. Er konnte sich gut vorstellen, was sie im Moment empfand. Wut, Enttäuschung, Sorge um ihren Vater, Angst. Eigentlich hatte sie gar nicht in diesen Saloon gehen wollen, in dem sich viele Spieler und elegant gekleidete Damen versammelt hatten, um Burke zu stellen. Und doch hatte sie es getan. Und das alles hatte sie ganz sicher nicht kalt gelassen. Es war ihm nicht entgangen, daß ihre Stimme gezittert hatte, und er hätte schwören können, daß er ein heiseres Schluchzen vernommen hatte, als er ihr nach draußen gefolgt war. So hart gesotten wie du tust, bist du doch gar nicht, stimmt’s mein Schatz? dachte er.
Plötzlich verspürte er den überwältigenden Drang, sie in seine Arme zu nehmen und ihr zu sagen, daß sie nicht alleine dastand, daß alles gut werden würde. Aber er wußte ganz genau, wohin eine solche Torheit ihn führen würde. Er würde sie küssen, bis sie schließlich atemlos in seinen Armen lag. Und dann würde es ihn nur noch mehr nach ihr verlangen, als es ohnehin schon der Fall war. Und er würde sie verführen wollen …
Er war nicht darauf vorbereitet, so weit zu gehen. Liebreizende Unschuldslämmer wie Jessica Sommers bedeuteten für einen Mann wie ihn doch eigentlich nur Ärger. Außerdem war er absolut nicht sicher, ob er diesen Konflikt wirklich für sie ausfechten wollte.
»Wißt Ihr denn diese Schrotflinte überhaupt zu bedienen?«, fragte er und deutete auf die Waffe, die sie in der Hand hielt.
»Doch ja, mein Vater hat es mir beigebracht. Ich kann auch mit einer Pistole schießen, aber ein einziges Gewehr kann gegen Burke und seine Männer eben nichts ausrichten. Dafür bräuchte man eine Armee.« Sie seufzte und sprach ihre Gedanken aus: »Ich werde zumindest einen bewaffneten Aufseher für die Mine anheuern müssen, jemanden, der Burke nicht verpflichtet ist. Dieser miese kleine Marshal ist einfach zu feige, um etwas gegen ihn zu unternehmen ‒ und der Clear Creek County Sheriff ist kaum besser. Beide verdanken ihre Jobs der Unterstützung Burkes, wie auch die Hälfte aller anderen Männer in diesem Regierungsbezirk.« Plötzlich verstummte sie und blickte nachdenklich zu Devlin empor.
Devlin war sofort auf der Hut. Er kannte diesen berechnenden Blick, den Frauen immer dann annahmen, wenn sie darüber nachdachten, wie sie das, was sie von einem Mann wollten, am besten bekommen konnten. Bei dieser Sommers war der Blick zwar nicht ganz so kühl und kalkulierend, wie er es schon bei anderen Frauen erlebt hatte, aber nichtsdestotrotz doch eindeutig berechnend. Ach, süße fessle, was geht nur grade in deinem hübschen Kopf vor? Er mußte nicht lange warten, um es herauszufinden.
»Ihr seid Burke nicht verpflichtet«, sagte sie langsam.
»Nein«, stimmte er argwöhnisch zu.
»Ich nehme nicht an, daß Ihr an dem Job interessiert wärt.«
»Job?«
»Der eines bewaffneten Aufsehers für unsere Mine. Ich könnte Euch« ‒ sie holte tief Luft ‒ »zweihundert Dollar im Monat zahlen.«
Ihr Angebot überraschte ihn zwar, beeindruckte ihn jedoch keineswegs. Für das, was man in dieser Gegend verdienen konnte, war der Lohn außergewöhnlich hoch, aber Devlin verdiente an einem einzigen Tag häufig mehr.
Da er nicht antwortete, sprach sie hastig weiter, wobei der Eifer, den sie zu verbergen versuchte, ihm zu Herz ging. »Im Job mit inbegriffen sind auch Unterkunft und Verpflegung. Ich serviere die besten Mahlzeiten, die Ihr hier in der Gegend finden werdet.«
Bist Du ebenfalls im Angebot enthalten, kleine Unruhestifterin? Wenn ja, hätte ich nicht übel Lust, es anzunehmen.
Devlin schüttelte den Kopf, um seinen Gedanken Einhalt zu gebieten. Miss Jessica Sommers war eine anständige Frau, er hatte keinen Zweifel daran. Er hatte genug Frauen dieser Art kennengelernt, um zu wissen, woran er war und die Finger davonzulassen. Eine Frau wie sie mußte man heiraten. Und wenn der Vater auch nur den geringsten Verdacht hatte, daß jemand den Ruf seiner Tochter ruiniert hatte, so würde er ihn mit dem Gewehr verfolgen. Nein, in eine solche Angelegenheit wollte er unter keinen Umständen verstrickt werden. Außerdem wäre es doch ziemlich sinnlos gewesen, ausgerechnet im Zuge eines solch dummen Streits den Tod zu finden.
Andererseits war es bereits zu spät: Burke hatte er sich schon zum Feind gemacht. Im Grunde hatte er also nichts zu verlieren, und wenn er Jessicas Angebot annahm, konnte ihn das in seinem Ziel einen Schritt weiterbringen. Wenn er in dieser Fehde Partei ergriff, so hatte er jeden Grund, Fragen über einen Mann mit der Narbe über dem rechten Auge zu stellen. Und war er deshalb nicht in erster Linie hierhergekommen? Um einen Gesetzlosen und eine organisierte Bande zu finden, die der Colorado Central Eisenbahn sechzigtausend Dollar in Bargeld und Silberbarren geraubt ‒ und den Maschinisten und Heizer dabei getötet hatten.
Neben der Beschreibung der Narbe und des Rotschimmels, war Devlins einziger Anhaltspunkt ein Gesprächsfetzen, den ein bei dem Raubüberfall verwundetes Opfer mitangehört hatte: »… zurückkommen zur ›Plume‹.«
Er war hierher gekommen, um auf der Lauer zu liegen und herumzuschnüffeln, doch die Spur schien bereits erkaltet zu sein. Das heißt, bis Riley Sommers angeschossen wurde.
»Es wäre eine ehrliche Arbeit«, fügte Jess hinzu, offensichtlich immer noch eifrig bemüht, ihn zu überzeugen.
Devlin mißverstand ihre Anspielung keineswegs. »Womit Ihr sagen wollt, daß das für das Spielen nicht zutrifft?«
»Nun, ja … ich …«
Ihr Stammeln und die feine Röte, die ihr Antlitz überzog, machten deutlich, daß sie zwar taktvoll sein wollte, aber auch von ihm keine gute Meinung hatte. Es war zwar absurd, aber er fühlte sich von ihrem Urteil in seiner Ehre verletzt. Aber er dachte nicht weiter darüber nach, als sie eilig wieder auf ein mögliches Anstellungsverhältnis zu sprechen kam.
»Ihr würdet ausschließlich nachts arbeiten, oben in der Mine bleiben und darauf achten müssen, daß keiner dort herumläuft. Ihr könntet immer noch tun … was auch immer es ist, was Ihr während des Tages unternehmt. Und es würde nicht für längere Zeit sein, nur bis mein Vater wieder auf den Beinen ist. Oder hattet Ihr etwa vor, die Stadt ausgerechnet jetzt wieder zu verlassen?«
»Noch nicht, nein.«
Sie zögerte, dann blickten ihre bernsteinfarbenen Augen bittend zu ihm empor. »Ich könnte vielleicht auf zweihundertfünfzig im Monat hochgehen. Aber mehr kann ich mir, fürchte ich, nicht leisten.«
Ach Süße, schau mich doch nicht auf diese Art an, es sei denn, du möchtest mehr bekommen, als das, worum du mich gerade bittest. »Über den Lohn mache ich mir keine Sorgen«, sagte Devlin.
»Nun, wenn es Burke ist, über den Ihr Euch Gedanken macht, dann könnt Ihr sicher sein, daß es keinen Unterschied für Euch machen wird, ob Ihr nun für mich arbeitet oder nicht. Nach dem heutigen Vorfall wird er Euch in jedem Fall mit Feindseligkeit begegnen, zumindest, wenn Ihr in der Stadt bleibt. Burke wird Euch das, was Ihr diese Nacht getan habt, nicht verzeihen, und man kann nicht voraussagen, wie er sich an Euch rächen wird. Und Hank Purcell wird zweifelsohne versuchen, Euch Schwierigkeiten zu machen. Aber Ihr seid erfahren genug im Umgang mit Waffen, daß er es sich zweimal überlegt ‒ das seid Ihr doch, oder?«
Der besorgte Klang ihrer Stimme brachte ihn beinahe zum lächeln. »Erfahren genug für das, was Ihr möchtet.«
»Das dachte ich mir. Niemand, der nicht weiß, was er tut, würde eine Waffe so auf einen Mann richten, wie Ihr es getan habt. Ihr seht also, es gibt wirklich keinen Grund, den Job nicht anzunehmen. Es sei denn … Ihr habt, so wie der Marshal, Angst, Euch gegen Burke zu stellen.«
In dem Augenblick, da sie es ausgesprochen hatte, wußte Jess, daß sie zu weit gegangen war. Ein blitzender, lebendiger Funke leuchtete in seinen Augen auf, etwas, das an Zorn grenzte, obwohl seine Antwort ebenso scharf wie belustigt klang. »Versucht nicht, mich zu manipulieren, Miss Sommers. Daran sind schon bessere Intriganten, als Ihr es seid, gescheitert.«
Sie errötete wieder und senkte den Kopf. »Es tut mir leid. Es gab keine Veranlassung für mich, das zu sagen. Was auch immer Ihr seid, Ihr seid kein Feigling.«
Was auch immer ich bin? Du verstehst es wirklich das Selbstwertgefühl eines Mannes zu treffen, nicht wahr, mein Herz?
Als er keine Antwort gab, seufzte sie. »Vielleicht war diese Idee ja doch nicht so gut. Wenn ich mich bemühe, werde ich schon jemand anders finden. Ich danke Euch noch einmal für Eure Hilfe, Mr. Devlin. Gute Nacht.«
Sie wollte sich abwenden, aber seine Hand auf ihrem Arm hinderte sie daran. »In Ordnung, Miss Sommers, ich werde ein paar Wochen bleiben. Ich nehme Euer Angebot an. Ihr habt Euch einen bewaffneten Aufseher beschafft.«
Ungläubig blickte sie zu ihm auf.
Du vertraust mir nicht, nicht wahr, mein Engel? Das ist gut. Ich bin ein gefährlicher Mann für ein Unschuldslamm wie dich. Um deinetwillen, halte dich fern von mir.
Doch Devlin sprach den Gedanken nicht aus. Stattdessen lächelte er. »Kommt, Miss Sommers.« Er hielt ihren Ellbogen fest und geleitete sie zu seinem Hotel. »Wir wollen mein Gepäck holen.«
Kapitel 3
»Wartet eine Minute!« Jessica blieb plötzlich stehen und sah ihn argwöhnisch an. »Wo gehen wir eigentlich hin?«
Mit einem leichten Druck seiner Finger auf ihren Ellenbogen, drängte Devlin sie wieder vorwärts und lenkte sie den hölzernen Plankenweg entlang. »Zu meinem Hotel hier in der Nähe.«
»Ihr bringt mich in Euer Hotelzimmer?« Mit beunruhigender Deutlichkeit erinnerte sich Jessica daran, daß sie diesen Mann erst heute Morgen mit entblößter Brust am Fenster seines Zimmers hatte stehen sehen ‒ und der maskuline Duft nach Sandelholzseife, den er ausströmte, war auch nicht gerade dazu angetan, die Erinnerung zu lindern. Es hatte eine seltsame Wirkung auf sie. Tatsächlich machte es sie nervös, ihm so nahe zu sein »Ich fürchte, das wäre ganz und gar nicht schicklich«, sagte Jess schwach, doch er lachte nur leise in sich hinein.
»Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es wäre auch nicht gerade ritterlich, Euch nachts alleine hier draußen auf der Straße stehen zu lassen.«
»Niemand würde es in dieser Stadt wagen, einer Dame zu nahe zu kommen, Mr. Devlin. Und ich bin eine Dame, das kann ich Euch versichern.«
»Das habe ich nie bezweifelt, Miss Sommers.« Sein Grinsen war sinnlich und boshaft und traf sie wie ein Blitzstrahl. Jess schluckte schwer und hörte kaum, daß er fortfuhr. »Ich versichere Euch, daß Ihr auch in meinem Zimmer vollkommen sicher seid. Insbesondere, da Ihr derartig bewaffnet sein.«
Als sie immer noch unsicher dreinblickte, zog Devlin eine seiner dunklen Augenbrauen in die Höhe. »Ihr fürchtet Euch doch nicht etwa vor mir?«
Durchaus ein bißchen. Aber viel mehr noch fürchtete sie sich davor, daß er seinen Entschluß, für sie zu arbeiten, vielleicht wieder ändern würde, wenn sie ihn aus den Augen ließ. Außerdem hatte sie ja auch immer noch das Gewehr bei sich. »Nun gut, Mr. Devlin. Ich werde mit Euch gehen.«
»Nennt mich Devlin oder Garrett. Mister ist mir angesichts unseres zukünftigen Verhältnisses nun doch etwas zu unpersönlich.«
Seine Wortwahl war nicht gerade dazu angetan, sie zu beruhigen, aber schließlich wäre es albern gewesen, sich deshalb mit ihm zu streiten. Trotzdem konnte es sicher nicht schaden, wenn sie ihn an die Art dieses Verhältnisses erinnerte.
»In Ordnung … Devlin. Und die meisten Männer, die für mich arbeiten nennen mich Miss Jess.« Sie sah wie er eine Augenbraue hob, doch er entgegnete nichts.
Über die Außentreppe an der Seitenmauer des Hotels erreichten sie das Stockwerk, auf dem er wohnte. Der mit eleganten Teppichen und teurer Tapete ausgestattete Korridor wurde von kristallenen Armleuchtern erhellt. Jess, die nie zuvor im Diamond Dust Hotel gewesen war, ertappte sich dabei, wie sie berechnete, wieviel es Wohl kostete, ein Haus wie dieses zu führen. Außerdem wunderte sie sich darüber, wie erfolgreich Devlin als Glücksspieler offensichtlich war. Denn er mußte gut sein, wenn er es sich leisten konnte, hier zu wohnen.
Und dann das Zimmer. Dekadent, das war Jess’ erster Gedanke, nachdem Devlin eine Lampe angezündet hatte. Das Mobiliar aus schwarzem Walnußholz schimmerte, und die weinroten Wandteppiche schienen nahezu zu glühen. Zaghaft trat sie ein und gestattete es Devlin, die Tür hinter ihr zu schließen. Über der Kommode hing ein Kristallspiegel mit reich verziertem Goldrahmen, eine Verzierung, die sich am Waschtisch und am Kopfteil des gewaltigen Federbetts wiederholte.
Gegen ihren Willen ertappte Jess sich dabei, wie sie das Bett anstarrte, auf der eine Tagesdecke aus weinrotem Samt und feine Leinentücher zusammengeknüllt lagen. Bevor sie es verhindern konnte, schoß ihr das Bild Devlins durch den Sinn. Die Vorstellung, wie er sich so nackt wie am heutigen Morgen auf dem Bett räkelte, brachte ihre Wangen zum Glühen.
Hastig wandte sie den Blick ab. Doch da fiel ihr Blick auf eine rote Federboa, die nachlässig über die Lehne eines Ledersessels gehängt worden war. Dieser weibliche Firlefanz konnte wohl kaum Devlin gehören. Und sie bezweifelte ernsthaft, daß er von selbst hierhergewandert und sich über die Sessellehne gelegt hatte. Ob er häufig Frauen mit aufs Zimmer nimmt? Sofort unterdrückte Jess den Gedanken wieder; eigentlich wollte sie es doch gar nicht wissen.
Im Gegensatz zu ihr schien Devlin absolut nicht befangen zu sein ‒ weder wegen des zerwühlten Bettes noch wegen des offenkundigen Beweisstückes, das seine weibliche Begleitung liegengelassen hatte. Als er Jess zum Sessel hinüberführte, nahm er die Boa und warf sie fort. »Setzt Euch. Ich werde Euch etwas zu trinken holen.«
»Etwas zu trinken?«
»Würdet Ihr Whisky bevorzugen oder Brandy?«, erkundigte er sich, als er zu der Kommode ging.
»Ich trinke keinen Alkohol.«
»Heute Abend schon. Nach allem, was Ihr heute durchgemacht habt, braucht Ihr einen Schluck.«