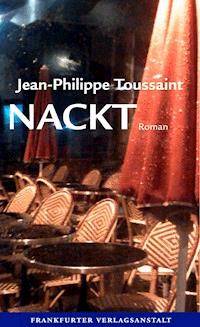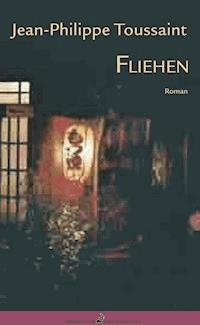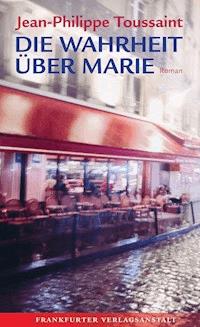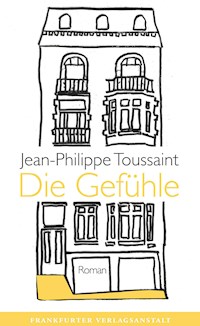
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Nachdenken über die Moderne und deren technischen Auswüchse wie Blockchain und Bitcoin, konspirative Treffen und ein wenig Action à la James Bond – davon handelte Toussaints letzter Roman Der USB-Stick. In Die Gefühle, dem zweiten Band seines neuen Romanzyklus, zeichnet er das abenteuerliche Porträt eines Mannes, der die Erfahrung der Unvorhersehbarkeit macht: Für seinen Helden Jean Detrez, dessen berufliche Beschäftigung mit der Zukunft nicht besagt, dass er seine eigene Zukunft im Griff hätte, verflechten sich Liebe, Sex und Tod auf abenteuerliche Weise. Seine Ehe scheitert, als sie sagt: "Ich liebe dich nicht mehr." Ihr letzter gemeinsamer Abend ist der Tag des Referendums Großbritanniens, eine doppelte Niederlage für den Mitarbeiter der Europäischen Kommission. Und mit dem Brexit wird nicht nur sein Traum von Europa zu Grabe getragen, auch sein Vater liegt im Sterben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Nachdenken über die Moderne und deren technischen Auswüchse wie Blockchain und Bitcoin, konspirative Treffen und ein wenig Action à la James Bond – davon handelte Toussaints letzter Roman Der USB-Stick. In Die Gefühle, dem zweiten Band seines neuen Romanzyklus, zeichnet er das abenteuerliche Porträt eines Mannes, der die Erfahrung der Unvorhersehbarkeit macht: Für seinen Helden Jean Detrez, dessen berufliche Beschäftigung mit der Zukunft nicht besagt, dass er seine eigene Zukunft im Griff hätte, verflechten sich Liebe, Sex und Tod auf abenteuerliche Weise. Seine Ehe scheitert, als sie sagt: »Ich liebe dich nicht mehr.« Ihr letzter gemeinsamer Abend ist der Tag des Referendums Großbritanniens, eine doppelte Niederlage für den Mitarbeiter der Europäischen Kommission. Und mit dem Brexit wird nicht nur sein Traum von Europa zu Grabe getragen, auch sein Vater liegt im Sterben.
Bravourös, turbulent, auch humorvoll-amüsant: Jean-Philippe Toussaint schreibt große Literatur. Und wie immer bei diesem wunderbaren Autor verleiht nicht allein die Handlung dem Buch seine Spannung: »Sie entspringt Toussaints Kunst, Satz um Satz neue Seitentüren zu öffnen und uns über vermeintliche Umwege immer tiefer in die eigentliche Geschichte zu führen.« (NZZ)
Inhalt
I – An dem Tag war es …
II – Mein Vater starb im Dezember …
III – Es gibt entscheidende Augenblicke im Leben …
Und ich weiß, woher ich komme, auch wenn ich nicht weiß, wohin ich gehe.
Victor Hugo
I
An dem Tag war es in Brüssel mörderisch heiß. Für Diane und mich waren es die letzten Stunden unseres gemeinsamen Lebens. Seit einigen Wochen redeten wir nicht mehr miteinander. Unsere Ehe, die zehn Jahre gedauert hatte, endete in Kälte und Feindseligkeit. Es war der 23. Juni 2016, der Tag, an dem in Großbritannien das Referendum über den Brexit durchgeführt wurde. Gegen Abend zog in Brüssel ein heftiges Gewitter auf, das von sintflutartigen Regenfällen begleitet wurde. Ich sehe mich, wie ich im Wohnzimmer unseres Apartments in der Rue de Belle-Vue von der Fensterbucht aus den wolkenbruchartigen Regenfall betrachtete. Die Zweige der Weiden bogen sich im Wind. Hin und wieder durchschnitt ein Blitz den Himmel, in der Ferne hörte man das Donnergrollen über den Teichen von Ixelles. Diane saß in dem vom Gewitter verdunkelten Wohnzimmer auf dem Sofa hinter mir und blätterte schweigend in einer Zeitschrift. Bald sollte sie das Zimmer verlassen, ich hörte, wie sie durch den Flur zum Schlafzimmer ging. Das war unser letzter gemeinsamer Abend in der Wohnung in der Rue de Belle-Vue (meine Entscheidung, die Wohnung zu verlassen und mir nach den Sommerferien eine neue Wohnung zu suchen, war zu diesem Zeitpunkt bereits gefallen).
Wie das Referendum in Großbritannien ausgegangen war, habe ich erst am nächsten Tag aus dem Radio erfahren. Ich hatte am frühen Vormittag ein Treffen bei der Europäischen Kommission. Nach meiner Besprechung verließ ich das Berlaymont und überquerte mit ein paar Kollegen die Rue de la Loi auf dem Weg zum Justus-Lipsius-Gebäude, das sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet. Das Justus Lipsius war damals noch der einzige Sitz des Europarates, das neue, vom Architekten Philippe Samyn entworfene »Europa«-Gebäude – jener berühmte ausgehöhlte Kubus aus Glas im Herzen des Europaviertels, der nachts leuchtet – wurde erst Anfang des nächsten Jahres in Betrieb genommen. Im Foyer des Justus Lipsius herrschte weit mehr Betrieb als üblich. Man lief mehreren Fernsehteams über den Weg, und Dutzende Reporter eilten Richtung Pressesaal. Ich habe noch heute den Auftritt des Präsidenten des Europäischen Rates an diesem Tag vor Augen, wie er im Kielwasser eines Haufens von Beratern und Personenschützern entschlossen über den roten Teppich an der Reihe der Flaggen der europäischen Staaten vorbeischritt. Sein Gesicht war ernst, seine Haltung feierlich. Er stieg aufs Podium und begann seine Ansprache ungewohnt ergriffen. »Ich bin mir vollkommen der Schwere der Situation und auch des dramatischen Ausmaßes der Stunde bewusst, die wir gerade erleben. Es ist ein historischer Moment, aber sicherlich nicht der Moment, überstürzt zu reagieren. Die letzten Jahre waren die schwierigsten Jahre unserer Geschichte, aber ich möchte jedem von Ihnen versichern, dass wir bereit sind, uns dieser bedauerlichen Konstellation zu stellen, und ich denke immer an das, was mein Vater zu mir sagte: ›Was dich nicht umbringt, macht dich stärker.‹« Ich beobachtete den Präsidenten des Europäischen Rates bei seiner Ansprache auf dem Podium. In dem Moment, als er seinen Vater erwähnte, überflog seine Augen ein flüchtiger Schleier der Befangenheit, der nur einen Augenblick anhielt. Er deutete ein Lächeln an, das Lächeln eines erwachsenen Mannes, der in der Öffentlichkeit über seinen Vater spricht, mit der gebührenden Bescheidenheit, dem Respekt und der Pietät des Sohnes, und ich konnte nicht umhin, an meinen Vater zu denken, an meinen eigenen Vater, Jean-Yves Detrez, der einmal Europakommissar gewesen war. Seit ich vom Sieg des »Leave« beim britischen Europareferendum erfahren hatte, musste ich daran denken, was er empfunden hätte. Seine Welt, so wie er sie immer gekannt hatte, war ins Wanken geraten. Die Krisen häuften sich in Europa, und überall war der Populismus unerbittlich auf dem Vormarsch. Der Humanismus, den mein Vater immer mit Eifer verteidigt hatte, schien in schlechterem Zustand denn je. Der Brexit war nur der letzte, spektakulärste und der auf die unangenehmste Weise unerwartete Ausdruck dieses tödlichen Niedergangs.
Bis zu welchem Grad kann man etwas vergessen, das einem widerfahren ist? Ich hätte mir vielleicht nie die Frage gestellt, wenn ich nicht einige Monate später auf meinem Handy ein kompromittierendes Foto wiedergefunden hätte. Ich saß in einem Thalys, hatte am Vormittag in Paris an einer Sitzung von Zukunftsforschern teilgenommen und kehrte noch am selben Abend nach Brüssel zurück. Hin und zurück an einem Tag. Ich war müde, der Tag war lang gewesen. Ich ließ mich vom Zug wiegen. In meinen Sitz zurückgelehnt, ließ ich gedankenlos mit dem Daumen Bilder auf meinem Telefon vorbeidefilieren, als ich zufällig auf das Foto einer halbnackten jungen Frau stieß. Es war etwas unscharf und in diesem Sommer in einem Hotelzimmer aufgenommen worden, anlässlich einer Klausurtagung von Zukunftsforschern in Hartwell House unweit von London, an der ich teilgenommen hatte. Ich erinnerte mich nicht mehr an die genaueren Umstände, unter denen das Foto entstanden ist. Ich erinnerte mich nur, am Ende einer Abendgesellschaft mit dieser Frau zusammen gewesen und sehr spät in der Nacht mit ihr die repräsentative Treppe von Hartwell House hinaufgegangen zu sein, aber ich erinnerte mich nicht mehr daran, was danach geschehen war, oder anders gesagt, meine Erinnerungen verflossen von einem bestimmten Zeitpunkt an im Nebel eines alkoholisierten Abends. Kein Zweifel aber, dass das Foto sehr wohl in einem Zimmer der Residenz von Hartwell House aufgenommen wurde, und von wem sonst, wenn nicht von mir, denn schließlich hatte ich es gerade in meinem eigenen Handy gefunden, zu meiner großen Überraschung und zu meinem großen Unbehagen. Ich hatte gleichwohl keinerlei Erinnerung, dass es in dieser Nacht zu irgendeiner Intimität mit dieser jungen Frau gekommen wäre, auch wenn das Foto ein sichtbares Dementi der wackligen Zeugenschaft meines Gedächtnisses zu liefern schien. Es lag ganz offenkundig ein Widerspruch vor zwischen dem, was mir meine Erinnerung sagte, und dem, was das Foto zeigte.
Seit mehreren Jahren organisiert mein Freund und Kollege Peter Atkins diese Treffen in Hartwell House, eine Tagung von Zukunftsforschern, bei der sich die Teilnehmer – politische Entscheidungsträger, Analysten und internationale Experten – eine Woche lang in dem hochherrschaftlichen Rahmen des Hartwell House zusammenfinden, um sich gemeinsam die Zukunft vorzustellen. Die Zukunft war für mich, der ich täglich im Rahmen meiner Arbeit für die Europäische Kommission mit ihr Umgang hatte, ein vollkommen abstrakter Begriff, den ich als Modell darstellen und durch Zahlen ausdrücken konnte. Aber wenn ich auch in meinem beruflichen Leben ganz unbestritten die Zukunft beherrschte, wurde mir bewusst, dass ich seit einiger Zeit die Herrschaft über mein Privatleben verloren hatte. Die Ehe mit Diane war am Zerbrechen, wir waren in eine Ehekrise geraten, deren Ausgang ich nicht absehen konnte. Die Zukunft lag für mich unrettbar im Dunkeln. Ich verfügte nicht über die geeigneten Verfahren, mir vorstellen zu können, was aus uns werden würde. Ich, der ich glaubte, so gut in der Ausübung meines Berufs zu sein, war aller Mittel beraubt, was meine Liebesgeschichte mit Diane betraf. Es ist anzunehmen, dass uns in Herzensangelegenheiten die Zukunftsforschung keine Hilfe leistet – oder anders gesagt, dass es für die Liebe keine Methode gibt.
Als ich in den 1990er-Jahren begann, mich beruflich für die Zukunftsforschung zu interessieren, wurde mir recht schnell klar, dass es dabei einen abgrundtiefen Unterschied zwischen zwei Begriffen gibt, die auf den ersten Blick ähnlich erscheinen können, sogar gleich, die aber nicht von derselben Natur sind, die öffentliche Zukunft und die private Zukunft. Das Wissen und die Erforschung der öffentlichen Zukunft, also das, was im Zentrum meiner beruflichen Aktivitäten steht, ist Sache einer eigenständigen Disziplin, die wie die Statistik oder die Demografie über einen ganzen Komplex von Techniken und spezifischen methodischen Werkzeugen verfügt. Nach allen Regeln der Kunst angewandt, erlaubt die Zukunftsforschung, die wesentlichen, noch unerkannt in der Gesellschaft schlummernden Veränderungen zu erkennen, bevor sie ans Tageslicht treten, was uns ermöglicht, die großen Hauptlinien der Entwicklungen vorwegzunehmen. Während der Wille oder der Wunsch, die eigene Zukunft zu vorauszusehen, eher eine Sache des Spiritismus und des Hellsehens ist. Hier zieht man also besser eine Kristallkugel oder Tarotkarten zu Rate, um in diese Zukunft zu sehen. Aber will man denn wirklich immer wissen, was die nächsten Tage oder die nächsten Wochen für einen bereithalten, was in einer mehr oder weniger entfernten Zukunft aus einem wird, will man also bereits am Morgen wissen, dass das Erstaunlichste, was einem am Morgen beim Aufstehen passieren kann, ist, zu erfahren, dass man im Laufe des Tages möglicherweise sterben oder in den bevorstehenden Stunden ein neues Liebesabenteuer oder eine Sexaffäre haben wird? Der Sex und der Tod, nichts anderes kann uns mehr berühren, soweit es um uns selbst geht.
Im Sommer 2016 nahm ich an einer der von meinem Freund Peter Atkins organisierten Klausurtagungen der Zukunftsforscher in Hartwell House teil. Für ein paar Tage stand die Zukunft im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Wir erforschten sie mit der Fürsorge des Experten. In kleinen Arbeitsgruppen erkundeten wir sie an mit grünem Filz bezogenen Konferenztischen. Wir untersuchten sie mit unendlicher Sorgfalt, um mithilfe von sondierenden Szenarien Darstellungen verschiedener denkbarer Zukünfte zu entwickeln. Ich kannte Peter Atkins schon seit langem, seit fast zwanzig Jahren studierten wir gemeinsam die terras incognitas der Strategischen Zukunftsforschung und erforschten ihre letzten brachliegenden Steppen. Anfang der 2000er-Jahre hatte Peter sich dem Team des Government Chief Scientific Adviser in London angeschlossen, das den britischen Premierminister in Fragen der Technologie berät. Er war damit beauftragt, im Rahmen dieser Regierungsagentur die erste Beratungsstelle für Strategische Zukunftsforschung ins Leben zu rufen. Dabei machte sich Peter mit den anspruchsvollsten Techniken der Disziplin vertraut und lernte die meisten der Politiker, Militärs und hohen Beamten kennen, die in dieser Domäne in Großbritannien arbeiteten. Später kamen ausländische Experten auf Studienreisen zu ihm nach London, die in ihrem Land eine eigene Beratungsstelle planten und sich ein Bild von den Verfahren machen wollten, und so wurde Peter zu einer Schlüsselfigur unserer kleinen, abgeschlossenen Welt der Zukunftsforscher. 2011 verließ Peter seinen Posten in der britischen Oberverwaltung, um sich mit der Gründung der Hartwell House Association selbstständig zu machen. Das wichtigste Ereignis der Gesellschaft war die sommerliche Klausurtagung der Zukunftsforscher. Von der ersten Sitzung an hatte Peter das Prinzip des live challenge eingeführt. Die Idee war, dass sich jedes Jahr die Teilnehmer einer neuen Herausforderung in Echtzeit stellen und in den fünf Tagen der Klausur ein einziges Thema von allgemeinem Interesse bearbeiten sollten. Im Jahr 2016 fand diese Tagung von Hartwell House Anfang Juli statt, also nur zehn Tage nach dem Brexit-Referendum.
Am Montag, dem 4. Juli 2016, nahm ich in den frühen Morgenstunden den Zug von Brüssel nach London. Ich hatte mich an der Gare du Midi mit meinem Freud Viswanathan Ajit Pai verabredet, mit dem ich für die Europäische Kommission arbeite. Viswanathan gehörte mit zur Gruppe von Hartwell House, und wir hatten vereinbart, zusammen zu fahren. Im Eurostar hatten wir es uns auf einem leeren Viererplatz bequem gemacht, holten unsere Zeitungen heraus und stellten unsere Laptops auf die Tische. Viswanathan hatte sich bequem zurückgelehnt und die Financial Times aufgeschlagen, deren lachsfarbene Seiten er vorsichtig mit dem leisen Rascheln des Zeitungspapiers durchblätterte, ein sanftes Morgenrauschen, zum Verschwinden verurteilt wegen des angekündigten Niedergangs der Zeitungen auf Papier. Kurz nach der Abfahrt wurde uns an unserem Platz ein sehr gutes Frühstück serviert. Viswanathan war ebenso wie ich verärgert über den Ausgang des britischen Referendums, schien sich aber nicht entmutigen lassen zu wollen. Im Gegenteil, er hielt, während er Gebäck und Fruchtjoghurt (seinen und meinen, den ich ihm gerne abgetreten hatte) genoss, eine flammende Hommage im Rückblick auf das Großbritannien, das er im Laufe seiner Studienjahre Anfang der 1990er-Jahre in Cambridge kennengelernt hatte. Damals, weißt du, war das wirklich ein äußerst anregendes Umfeld, sagte er, es herrschte eine Atmosphäre des freien Denkens, der intellektuellen Neugier, man sprach vom new internationalism. Zu dieser Zeit war Großbritannien offen für die anderen Kulturen. Es war auch der Moment, wo man in Großbritannien gut zu essen begann, mit guten Weinen, gereiftem Käse und vorzüglichen Olivenölen. Die britische Gesellschaft atmete anders, es gab eine erstaunliche Öffnung auf die Welt hin. Viswanathan zufolge ging es seit Beginn der 2000er-Jahre damit bergab, und auch die Finanzkrise von 2008 war nicht gerade hilfreich. Die beginnende Rezession wurde von einer einwandererfeindlichen Rhetorik und dem Wüten der Boulevardpresse gegen Europa begleitet. Wenn man da noch eine Prise Zynismus und ein paar Zauberlehrlinge hinzufügt, so Viswanathan, braucht man nicht lange nach den Gründen für den Brexit zu suchen (und nachdenklich löffelte er meinen Kirschjoghurt aus, während er einen Blick aus dem Zugfenster warf).
Bei der Ankunft in London war meine Überraschung groß, als Viswanathan Ajit Pai mich in der Bahnhofshalle von St. Pancras ohne weitere Umstände stehen ließ, mit der Mitteilung, er habe einen Termin in einer Wirtschaftskanzlei in Kensington und würde erst am nächsten Tag nach Hartwell House kommen. Er verschwand in einem Taxi, und ich wechselte den Bahnhof und nahm allein den Zug nach Aylesbury. Als ich im Schloss Hartwell House ankam, wurde ich in mein Zimmer im zweiten Stock der Residenz geführt, ein geräumiges, elegantes Zimmer mit Stilmöbeln. Die Vorhänge und die Tagesdecke schillerten in narzissgelben und pastellgrünen Farbschattierungen. Ich wusch mir im Badezimmer mit antiken Armaturen aus Kupfer die Hände und ging zum Mittagessen wieder nach unten. Ich durchquerte das Erdgeschoss und bewunderte im Vorbeigehen die Rokoko-Kamine aus Marmor und die Meisterwerke, die die holzgetäfelten Wände der großen Halle schmückten. Ich betrat den Speisesaal, in dem vier runde Tische mit weißen Tischtüchern und Silberbesteck für jeweils zehn bis zwölf Personen gedeckt waren. Der Saal war sehr hoch und hatte vier Fenstertüren, die auf den Park gingen. Es waren etwa fünfzehn Personen im Raum, sie saßen oder standen um das Buffet herum und bedienten sich selbst. Viele der Gesichter kannte ich vom Sehen, aber es waren nicht wirklich Freunde darunter, Viswanathan war in London geblieben, und Peter Atkins hatte ein Meeting mit seinen Mitarbeitern, um den Beginn der Veranstaltung vorzubereiten. Wie so oft, wenn ich an einem fremden Ort ankomme, fühlte ich mich eingeschüchtert. Ich ging zum Buffet, nahm einen großen Teller und begann, mich zu bedienen. Es waren noch nicht alle Teilnehmer unserer Tagung eingetroffen, einige hatten bereits zu Mittag gegessen und waren beim Kaffee, andere hatten gerade erst mit dem Essen begonnen. Nachdem ich meinen Teller gefüllt hatte, setzte ich mich an einen Tisch, an dem bereits sieben oder acht Personen saßen. Ich aß schweigend, ohne den anderen Tischgenossen viel Aufmerksamkeit zu schenken, und hörte nur halb den Gesprächen um mich herum zu. In fast jeder Gesellschaft gibt es, und dem entging auch unsere Tagung der Zukunftsforscher nicht, immer jemanden, der sich dadurch auszeichnet, dass er arroganter ist als die anderen, ein Alleswisser, der sich die Freiheit herausnimmt, seine Nachbarn zu belehren. Sehr schnell hatte ich den einen an unserem Tisch ausgemacht. Noch ziemlich jung, keine vierzig Jahre alt, kantig und mit breiten Schultern, gestreiftem Hemd und Hosenträgern, ein Mann mit kräftiger Stimme. Egal wo man war, ob man ihm zuhörte oder nicht, seine Stentorstimme hallte fernhin, dass einem die Ohren klingelten. Zu dieser kräftigen Stimme kam eine unerträgliche Stimmfärbung hinzu. Der Typ hatte anscheinend ein ununterdrückbares Bedürfnis, anderen seine Überlegenheit zu beweisen, eine Überlegenheit, bei der man sich fragte, worauf sie beruhen konnte. Er sprach nicht mit seinen Nachbarn, er erteilte ihnen eine Lektion. Er hatte jede Regung zu einem Gespräch an unserem Tisch im Keim erstickt und das Wort an sich gerissen, um keinen Widerspruch duldend den ganzen Tisch zu unterhalten, wobei er seine Blicke betont auf die junge Frau richtete, die sich neben mich gesetzt hatte, weniger um ihre intellektuelle Zustimmung zu suchen, sondern um auf diskrete Weise eine galante Hommage zu machen. Ich kannte den Namen dieser jungen Frau nicht (er stand auf ihrem Namensschildchen, aber ich hatte mich nicht gegen ihren Busen gebeugt, um ihn zu lesen). Ich wusste auch nicht, was genau sie tat, ich wusste nur, dass sie aus Finnland kam, ich war ihr bereits einmal auf einem Kolloquium zur Zukunftsforschung in den Vereinigten Staaten begegnet. Der Mann auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches hörte nicht auf, große Reden zu schwingen. Später erfuhr ich, dass er Scott Adams hieß. Er machte schon was her, hatte aber zugleich auch etwas Unangenehmes an sich (sogar etwas Libidinöses in der Art, wie er die Brotkrumen zwischen seinen Fingern knetete oder sein Essen gierig zum Mund führte). Er besaß auch, um seine Sätze zu unterstreichen oder dem Gesagten eine besondere Betonung zu verleihen, die unangenehme Art, zu den Nebenleuten körperlichen Kontakt aufzunehmen, legte beispielsweise seine Hand fest auf den Arm der Nachbarin, und all das, ohne dabei die Finnin an meiner Seite über den Tisch hinweg aus den Augen zu lassen, denn er hatte mehrere Eisen im Feuer. Er war das absolute Gegenteil meines Tischnachbarn zur Rechten, eines Japaners, der genauso zurückhaltend war wie ich, und der, nachdem er sich diskret auf seinen Sitz geschlichen hatte, kein Wort sagte, die Augen gesenkt hielt und sich bemühte, so wenig Raum wie möglich in Anspruch zu nehmen. Das einzige Mal, dass er sich mit einer fast unhörbaren Stimme an mich wandte, war, um mich um Brot zu bitten, wobei er sich fast für die Dreistigkeit seines Ersuchens entschuldigte. Beim Thema Brexit, das die Gemüter beschäftigte, begann Scott Adams, der vorgab, seine Ohren überall zu haben, und in der besseren Gesellschaft verkehren musste, die Anekdote vom Pizza-Gipfel zu erzählen. Ich hatte schon gerüchteweise von dieser Pseudokonferenz auf einem Flughafen gehört, aber nichts, was sich als erwiesen herausgestellt hätte. Die Geschichte handelte davon, dass die Entscheidung, ein Referendum über den weiteren Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union ins Leben zu rufen, in einer Pizzeria im Chicagoer Flughafen O’Hare bei der Rückkehr der britischen Delegation von einem NATO-Gipfel getroffen worden sein sollte. Die Hauptdarsteller des Stücks, von dem Scott Adams uns erzählte, waren der britische Premierminister und sein Außenminister, die er mit nervenaufreibender Vertrautheit bei ihren Vornamen (Dave und William) nannte, als handelte es sich um Freunde von ihm, die Mist gebaut hätten, sogar ziemlich großen Mist, von dem er uns lachend berichtete. Er erzählte uns diese Anekdote, die sicherlich nicht aus erster Hand stammte und deren Authentizität fragwürdig war, in allen Einzelheiten, als ob er selbst dabei gewesen wäre, nicht ohne völlig überflüssigerweise die rhetorische Warnung hinzuzufügen, sie bloß niemandem weiterzuerzählen. Es müsse vertraulich bleiben (off the record, wie er sich ausdrückte). Und mit verschwörerisch gesenkter Stimme, wobei er uns ein Zeichen machte, näher an ihn heranzurücken, ließ er uns wissen, dass der einzige Weg, den Dave an diesem Abend gefunden hätte, um die Einheit der Konservativen Partei während des Wahlkampfes 2015 zu sichern, darin bestand, ein Referendum über den Verbleib in der Europäischen Union in Aussicht zu stellen. Das ist doch schier unglaublich!, sagte er. Stellen Sie sich einmal vor, dieses katastrophale Referendum, das einen Zusammenbruch des Pfund Sterling verursachen und Großbritannien aller Voraussicht nach in eine beispiellose Krise führen wird, wurde von drei oder vier gelangweilten Politikern vor ihrer Pizza an irgendeinem Ecktisch im Terminal 3 des Chicagoer O’Hare-Flughafens ausgeklüngelt. Das war mit Sicherheit eine Pizza capricciosa, mokierte er sich und griff nach der Serviette seiner Nachbarin, um sich selbstgefällig den Mund abzuwischen (ich bemerkte den erschreckten Blick seiner Nachbarin, die nicht wusste, ob sie ihn darauf hinweisen dürfte, dass es ihre Serviette war, die er genommen hatte). Ob nun an seiner Anekdote vom Pizza-Gipfel etwas dran war oder nicht, das Unangenehme an seiner Geschichte war nicht so sehr der snobistische Insider-Ton, mit dem er sie erzählt hatte, sondern vielmehr die ungenierte Vertrautheit, mit der er sich an die Protagonisten des Stücks herangemacht hatte (auch wenn natürlich die am Brexit beteiligten britischen Spitzenpolitiker nicht frei jeder Schuld waren, bei weitem nicht).
Scott Adams schwadronierte weiter emphatisch über den Zustand der Welt. Man spürte bei ihm ein Bedürfnis, systematisch eine im Widerspruch zur allgemein akzeptierten Meinung stehende Position zu verteidigen. Ein Ansatz, der intellektuell lobenswert gewesen wäre, wenn es darum geht, sich zum Advocatus Diaboli zu machen, um eine Frage in all ihren Facetten, selbst den widersprüchlichsten zu bewerten, die ihn aber oft zu schwefligen rhetorischen Verrenkungen führte. Die meisten Historiker lassen das 20. Jahrhundert mit dem Jahr 1914 beginnen, nicht wahr, erklärte er uns, seinen Kaffee schlürfend, die Untertasse in der Hand. Nun gut, für die Historiker der Zukunft müsste also der Befund viel einfacher sein, denn alle sind sich einig, das 21. Jahrhundert habe mit dem 11. September 2001 begonnen. Aber es kann ebenso gut sein, fügte er hinzu, indem er seine Tasse wieder auf den Tisch stellte, dass ein anderes Datum mit dem Jahr 2001 in Konkurrenz treten wird, und dieses andere Datum – er hielt einen Moment inne, um zu prüfen, welchen Eindruck er machte – ist 2016! Dieses Jahr, ja! 2016, sehen Sie, ist ein Schlüsseljahr, eine Welt geht zu Ende und eine neue Ära beginnt. Mit dem Brexit wird eine neue Seite aufgeschlagen. Aber 2016 geht es nicht nur um den Brexit, sagte er. 2016 wird auch das Jahr der Wahl von Trump sein! Weil Trump diesen November gewählt werden wird! Am Tisch gab es einzelne Lacher, Schulterzucken und missbilligendes Raunen. Ich meine es ernst, sagte er. So unwahrscheinlich Ihnen dieser Sieg heute noch erscheinen mag, völlig unmöglich ist er nicht. Und das ist keine Wahrsagerei, sagte er uns, sondern das Resultat einer sehr gut fundierten Analyse (der Filmemacher Michael Moore kommt übrigens zu den gleichen Schlussfolgerungen wie ich, fügte er hinzu, während er sich ein Gebäck vom Kuchentablett schnappte). Ich beobachtete Scott Adams von der gegenüberliegenden Seite des Tisches, und ich ärgerte mich über diese sensationslüsterne Vorhersage, die er gerade gemacht hatte und die so gar nichts mit Zukunftsforschung zu tun hatte, die sogar das Gegenteil von Zukunftsforschung war. Dieser Scott Adams hatte offensichtlich nichts von der Zukunftsforschung verstanden, es war also an der Zeit, dass er an einer Klausurtagung wie der unseren teilnahm, um etwas über die Ethik und die Zielsetzungen unserer Disziplin zu lernen. Das Pikante in dieser Angelegenheit aber war (zu diesem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht), dass ausgerechnet er es sein sollte, der uns als Experte in die in Hartwell House angewandte Methode einführen sollte, er war der berühmte Scott Adams, den Peter für dieses Jahr angeworben hatte, um den methodischen Teil unserer Tagung abzudecken. Während ich immer noch nicht wusste, um wen es sich da handelte, hörte ich weiter seinen geschwollenen Reden zu. Er war sich seiner Sache sehr sicher, schnappte sich weiterhin süße Häppchen vom Kuchenteller und zählte die verschiedenen objektiven Parameter auf, die seiner Meinung nach den Sieg von Trump im November erklären würden. Von dem Dutzend dieser Gebäckstückchen auf dem Teller hatte er allein bereits sieben gegessen (ich hatte ihn aus den Augenwinkeln beobachtet und insgeheim mitgezählt). Einmal in Schwung, war er übrigens nicht mehr zu bremsen, er hatte uns noch mehr Enthüllungen zu machen. Nachdem er uns Trumps Sieg im November verkündet hatte, prophezeite er uns noch mit derselben Rhetorik und denselben Vorbehalten (»ich behaupte ja nicht, dass es notwendigerweise eintreten wird, aber ich sage, dass wir diese Hypothese nicht als unmöglich ansehen sollten«), den Triumph der Populisten in den Niederlanden und den Sieg der rechtsextremen Kandidatin bei der französischen Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr, bevor er bühnenwirksam mit einem Zitat schloss, das er Kurt Vonnegut zuschrieb (und Schande über den, der nicht wusste, wer Kurt Vonnegut war): »Die Geschichte ist nur eine Aufeinanderfolge von Überraschungen, sie kann uns nur daran gewöhnen, überrascht zu werden.« Das war nun wirklich zu viel für mich, das war mehr, als ich ertragen konnte. Ich erhob mich vom Tisch, ohne den Kaffee genommen zu haben, und ging auf mein Zimmer (es gab ohnehin keine süßen Häppchen mehr auf dem Kuchenteller).
Auf dem Zimmer war es sehr dunkel, ich hörte, wie der Regen an die Fenster klopfte. Ich wollte die Nachttischlampe einschalten, aber es war ein kompliziertes Unterfangen, ich suchte lange nach dem Schalter, der sich nicht am Lampenkabel befand, sondern an der Glühbirne, ein Schalter, den man nicht nach oben oder unten bewegen musste, sondern nach rechts (die Briten, nun aber mal ehrlich). Ich hielt einen kurzen Mittagsschlaf und ging kurz vor drei Uhr wieder hinunter in die Eingangshalle. Ich sah Peter Atkins, der beschäftigt war, mit Dokumenten in der Hand Neuankömmlinge zu begrüßen, und die Teilnehmer drängte, sich zur Eröffnungssitzung in das Nebenhaus zu begeben. Wir verließen die Residenz und liefen in kleinen Grüppchen unter einem bedrohlichen Himmel eine Allee hinauf. Es hatte aufgehört zu regnen, und von den nassen Ästen der Bäume tropfte es feucht herunter. Es herrschte ein beflissenes Treiben rund um Scott Adams, mehrere Leute folgten ihm, man umringte ihn, drängte sich in seinem Gefolge. Ich war etwas zurückgeblieben, ging schweigend für mich. Da fiel mir unter den Teilnehmern eine junge Frau auf, die ganz allein vor sich hin schritt, eine Mappe in der Hand, und die ich in unserer Gruppe noch nicht wahrgenommen hatte. Sie trug eine Bluse aus roher Seide, eine Mohairweste und eine Perlenkette um den Hals. Es ging eine unaufdringliche Eleganz von ihr aus, ein Charme und eine gewisse Zurückhaltung, die sofort meine Aufmerksamkeit erregten. Ich weiß nicht, was genau die Anziehung ausmachte, aber wenn auch die meisten der anwesenden Männer sich eher zu der Finnin hingezogen fühlten, deren Aussehen zugegebenermaßen in unserer etwas nüchternen Versammlung aus dem Rahmen fiel, mit ihren langen Beinen und ihren hochhackigen fuchsiarosa Pumps, so war es für mich eher diese unscheinbare junge Frau, die mich anzog. Ich wagte nicht, sie anzusprechen, ich begnügte mich damit, ihr mit etwas Abstand zu folgen, ohne die Augen von ihr zu lassen. Hinter ihr betrat ich den James-Gibbs-Saal, in dem die Eröffnungsveranstaltung stattfinden sollte. An jedem Platz rund um den großen U-förmigen Tisch waren ein Notizblock, ein Bleistift und das Programm der Tagung ausgelegt. Einige der Teilnehmer hatten sich bereits gesetzt, andere unterhielten sich noch beiläufig, während sie auf den Beginn der Veranstaltung warteten. Ich ließ einen Moment verstreichen, blieb neben der jungen Frau in der Mohairweste stehen, zögerte, blätterte geistesabwesend in einem Programm, das ich vom Tisch aufgenommen hatte, bevor ich mich neben sie setzte.
Für die Eröffnungssitzung hatte Peter Atkins eine externe Rednerin hinzugezogen, eine Psychologin, die innovative Methoden der Gruppenkommunikation entwickelt hatte. Anstatt sich die Teilnehmer nacheinander in klassischer Weise vorstellen zu lassen, »Mein Name ist Soundso, ich arbeite für die oder jene Organisation« (diese Informationen, so sagte sie uns, finden Sie in der Broschüre, die an Sie verteilt worden ist), schlug sie vor, damit wir uns besser kennenlernten, wir gleich mit einer ersten Übung beginnen sollten, die sie Tell the story of your names