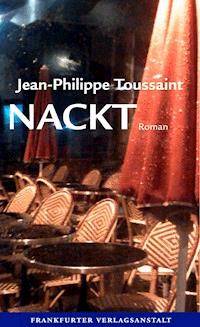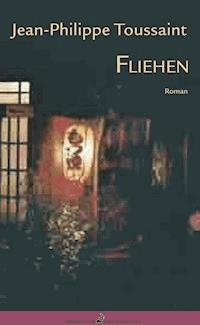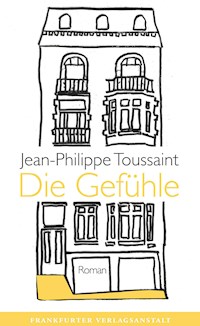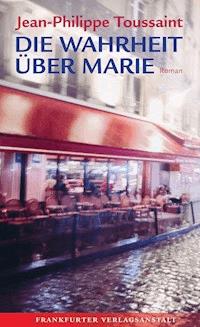Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marie Madeleine Marguerite de Montalte ist Künstlerin und berühmte Modedesignerin mit Filialen auf verschiedenen Kontinenten. Ihre aufsehenerregenden Kreationen, darunter ein Kleid aus Honig, Höhepunkt einer spektakulären Modenschau in Tokio, sind weltweit begehrt und werden in Museen ausgestellt. Marie, eine Frau von Welt und eine Frau ihrer Zeit, gestresst, großstädtisch, kapriziös, leidenschaftlich und unnahbar – alles dreht sich um sie für den namenlosen Erzähler, sein Sehnen, Erinnern, seine Imagination. In Paris nur wenige Straßen voneinander entfernt wohnend, führt es die Liebenden in den vier Teilen des Romanzyklus in einem atemlosen Nach- und Nebeneinander durch Tokio und Shanghai bis nach Elba. Wie die Gezeiten folgt ihre Liebe einer ewigen Abfolge aus Kommen und Gehen, Suchen, Finden, sich Verfehlen – eine Liebe, so zeitlos und flüchtig, wie sie nur ein Zauberer auf Papier zu bannen vermag. Jean-Philippe Toussaint hat mit der Figur der Marie, ein Anagramm von "aimer", lieben, eine verführerische, komplexe und zeitlose Metapher entworfen: für die Kunst, die Literatur, die Liebe und das Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie Madeleine Marguerite de Montalte ist Künstlerin und berühmte Modedesignerin mit Filialen auf verschiedenen Kontinenten. Ihre aufsehenerregenden Kreationen, darunter ein Kleid aus Honig, Höhepunkt einer spektakulären Modenschau in Tokio, sind weltweit begehrt und werden in Museen ausgestellt. Marie, eine Frau von Welt und eine Frau ihrer Zeit, gestresst, großstädtisch, kapriziös, leidenschaftlich und unnahbar – alles dreht sich um sie für den namenlosen Erzähler, sein Sehnen, Erinnern, seine Imagination. In Paris nur wenige Straßen voneinander entfernt wohnend, führt es die Liebenden in den vier Teilen des Romanzyklus in einem atemlosen Nach- und Nebeneinander durch Tokio und Shanghai bis nach Elba. Wie die Gezeiten folgt ihre Liebe einer ewigen Abfolge aus Kommen und Gehen, Suchen, Finden, Sich-Verfehlen – eine Liebe, so zeitlos und flüchtig, wie sie nur ein Zauberer auf Papier zu bannen vermag.
»Selten wurde in der aktuellen Literatur böser, lustiger, lakonischer und klüger über eine große und ratlose Liebe geschrieben. Nächster Nobelpreis, der nach dem für Modiano in die französischsprachige Welt geht, bitte an Toussaint.«
(NIKLAS MAAK, FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG)
Marie Madeleine Marguerite de Montalte
Pressestimmen zu Marie Madeleine Marguerite de Montalte
»Schwerelos erzählt Jean-Philippe Toussaint eine Liebesgeschichte, die sich als eine der schönsten in der französischsprachigen Gegenwartsliteratur entpuppt.« Deutschlandfunk
»Wie Toussaint die Fieberkurve der fast stummen Liebeskatastrophe mit der knapp-suggestiven Beschreibung der Schauplätze zu einem feinen Gewebe aus Emotionen und Impressionen zusammenfügt, das ist schlicht meisterhaft.« Basler Zeitung
»Eine der schönsten Liebesgeschichten der neuen französischsprachigen Literatur.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Wer mit einer derart kühlen Eleganz über das Wesen der Leidenschaft schreiben kann wie Toussaint; wer das Flüchtige des Moments so nachhaltig zu bannen vermag, muss ein Zauberer sein.« Kulturspiegel
»Alle Romane lassen sich getrennt voneinander verstehen, aber erst zusammen entfalten sie die wahre Wucht des erzählerischen Kosmos des Belgiers Jean-Philippe Toussaint.« Welt kompakt
»Jean-Philippe Toussaints Marie-Romane sind Nocturnes. Melancholisch durchwehte Nachtstücke, dramatisch, mit rasanten Läufen und übermütigen Trillern, voller Schmerz und Bitterkeit, verspielt, amüsant, todtraurig.« Stuttgarter Nachrichten
»Toussaint erzählt eine grandiose Eifersuchtsgeschichte, die einem die Blätter zwischen den Fingern verbrennen lässt. So dicht geballte Sinnlichkeit, so elektrische Abgründe, so fein zitternde Zärtlichkeit – eine herrlich explosive Mischung.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
»So nah am Schmelzpunkt von Logik und Erotik war er bisher nie. Jenseits fast von Glück und Schmerz kommt auch die Liebesgeschichte in diesem Roman nicht zu Ende. Und keiner hätte diese Endlosschleife der Liebe bauschiger, straffer, knisternder, schärfer umzuschnüren vermocht als Joachim Unseld, Toussaints Übersetzer, Verleger und verlässlichster Zeuge in Deutschland.« Süddeutsche Zeitung
»Toussaints Erzählungen sind ein wunderbares raffiniertes Spiel um Lug und Trug in Liebe und Leben, so wunderbar und anrührend, dass eine erfüllte Sehnsucht auf den Leser überspringt.« WDR3
»Der Belgier Jean-Philippe Toussaint hat seine grandiose Tetralogie rund um die undurchschaubare Schönheit Marie abgeschlossen. Toussaint ist ein funkelnder Autor. Die Verzauberung der Gegenwart durch Literatur: Toussaint hat sie erreicht.« Journal Frankfurt
»Jean-Philippe Toussaint, ein moderner Romantiker, hat mit seiner Marie-Tetralogie eine brillante Liebesgeschichte geschrieben.« TAZ
»Toussaint ist der beste, erfindungsreichste, beobachtungsschärfste französischsprachige Erzähler der Gegenwart; seine Bücher sind Tiefenbohrungen ins Heute.« Niklas Maak, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
»Unerhörte Spannung … Wir haben es mit einem hocherotischen Roman zu tun! Und mit einem Meisterwerk voller Anmut, Melancholie und Schönheit.« Neue Zürcher Zeitung
»Sie lieben und weinen: Jean-Philippe Toussaint schaut zwei Menschen bei der atemlosen und ziellosen Jagd nach den Köstlichkeiten des erwachsenen Lebens zu.« Welt am Sonntag
Jean-Philippe Toussaint
Eine Romantetralogie
Aus dem Französischen von Joachim Unseldund Bernd Schwibs (Sich lieben)
Inhalt
Sich lieben
Winter
I – Ich hatte eine kleine Flasche mit Salzsäure …
II – Zurück im Hotel …
Fliehen
Sommer
I – Hört das denn nie auf …
II – Der Zug kam kurz vor neun Uhr …
III – Das Mittelmeer lag still …
Die Wahrheit über Marie
Frühling-Sommer
I – Später, als ich an die dunklen Stunden …
II – In Wahrheit hieß Jean-Christophe d. G. …
III – Zu Beginn des folgenden Sommers …
Nackt
Herbst-Winter
Neben den aufsehenerregenden Kreationen …
I – Anfang September, nach dem großen Brand …
II – Nach unserer Rückkehr von Elba …
Von ihr in einer Weise sprechen,wie noch von keiner je gesprochen.
Dante
Sich lieben
Roman
Aus dem Französischen von Bernd Schwibs
Winter
I
Ich hatte eine kleine Flasche mit Salzsäure füllen lassen und trug sie jetzt immer bei mir, mit der Idee, sie eines Tages jemandem mitten in die Visage zu schütten. Ich brauchte nur die Flasche zu öffnen, eine Flasche aus buntem Glas, die zuvor Wasserstoffperoxyd enthalten hatte, auf die Augen zu zielen und wegzurennen. Ich fühlte mich seltsam ruhig, seitdem ich mir diese Flasche mit bernsteinfarbener und ätzender Flüssigkeit beschafft hatte, die meine Stunden würzte und meine Gedanken schärfte. Marie aber fragte sich, mit einer vielleicht nicht unbegründeten Sorge, ob diese Säure nicht eines Tages in meinen Augen, meinem eigenen Blick landen würde. Oder in ihrer Visage, in ihrem seit so vielen Wochen verweinten Gesicht. Nein, sagte ich ihr mit einem freundlichen verneinenden Lächeln. Nein, ich glaube nicht, Marie, und ohne sie aus den Augen zu lassen, strich ich zärtlich über die anmutigen Rundungen der kleinen Flasche in meiner Jackentasche.
Noch bevor wir uns zum ersten Mal küssten, hatte Marie zu weinen angefangen. Es war in einem Taxi, vor sieben Jahren und mehr, sie saß neben mir im Halbdunkel des Taxis, das Gesicht in Tränen, gezeichnet von den fliehenden Schatten der Seine-Quais und dem gelbweißen Widerschein der Scheinwerfer uns entgegenkommender Autos. Wir hatten uns bis zu diesem Augenblick noch nicht geküsst, ich hatte noch nicht ihre Hand ergriffen, hatte ihr noch nicht die geringste Liebeserklärung gemacht – aber habe ich ihr je eine Liebeserklärung gemacht? –, und ich betrachtete sie, ergriffen, hilflos, sie so weinend an meiner Seite sitzen zu sehen.
Die gleiche Szene hat sich vor einigen Wochen in Tokio wiederholt, aber da trennten wir uns für immer. Wir sprachen nichts in diesem Taxi, das uns ins Grandhotel von Shinjuku zurückfuhr, wo wir am selben Morgen angekommen waren, und Marie weinte still an meiner Seite, sie schniefte und schluchzte leise an meine Schulter gelehnt, wischte sich in weit ausholenden wirren Gesten mit dem Handrücken die Tränen ab, schwere Tränen der Trauer, die sie entstellten und die Wimperntusche verlaufen ließen, während es vor sieben Jahren, als wir uns kennenlernten, reine Tränen der Freude waren, leicht und duftig wie Schaum, die schwerelos ihre Wangen hinunterrannen. Das Taxi war überheizt, und Marie war es jetzt zu warm, sie fühlte sich schlecht, sie zog schließlich unter Schwierigkeiten, neben mir auf dem Rücksitz sich windend und drehend, ihren langen schwarzen Ledermantel aus, schnitt dabei, offenbar wütend auf mich, Grimassen, obwohl ich doch nichts dafür konnte, verdammt noch mal, wenn es so heiß im Taxi war, brauchte sie sich bloß beim Fahrer zu beschweren, am Armaturenbrett hing gut sichtbar sein Name und Passfoto. Sie stieß mich weg, um den Mantel zwischen uns auf den Sitz zu legen, zog ihren Pullover aus und knüllte ihn neben sich. Sie hatte nur noch eine verrutschte und zerknitterte weiße Hemdbluse an, die, oben offen, den Blick auf ihren schwarzen Büstenhalter freigab und über dem Gürtel ihrer Hose ein wenig heraushing. Wir sprachen nichts im Taxi, und aus dem Autoradio schallten pausenlos rätselhafte und beschwingte japanische Schlager ins Halbdunkel.
Das Taxi setzte uns vor dem Hoteleingang ab. In Paris, sieben Jahre zuvor, hatte ich Marie vorgeschlagen, irgendwo in der Nähe der Bastille, wo noch was offen hatte, ein Glas trinken zu gehen, in der Rue de Lappe oder der Rue de la Roquette oder der Rue Amelot, der Rue du Pas-de-la-Mule, ich weiß nicht mehr. Wir waren lange in der Nacht umhergelaufen, waren von einem Café zum anderen, von einer Straße zur anderen im Viertel geirrt, um schließlich an der Île Saint-Louis auf die Seine zu stoßen. Wir hatten uns nicht sofort in dieser Nacht geküsst. Nein, nicht sofort. Aber wer möchte ihn nicht hinauszögern, diesen köstlichen Augenblick, der dem ersten Kuss vorausgeht, da zwei Wesen, die sich zueinander hingezogen fühlen, bereits stumm beschlossen haben, sich zu küssen, ihre Augen es wissen, ihr Lächeln es ahnt, ihre Lippen und Hände es spüren, aber die den Augenblick noch hinauszögern, da ihre Münder sich zum ersten Mal zärtlich berühren?
In Tokio waren wir sofort auf unser Zimmer gegangen, wir hatten wortlos die große menschenleere Hotelhalle mit den erleuchteten Kristalllüstern durchquert, ein Trio gleißender Leuchter, die vor unseren Augen genau in dem Moment, als wir ins Hotel zurückkamen, sachte zu schaukeln anfingen, die Leuchter begannen zu schwingen wie Kirchenglocken, sie schüttelten sich über uns langsam in einem Klirren von Glas und Kristall, das mit einem unwiderstehlichen verzweifelten Grollen der Materie einherging, ein Grollen, das den Boden erzittern und die Wände wackeln ließ, dann, als die Welle vorüber war, als das Licht an der Decke geflackert und das Hotel für Sekundenbruchteile in Finsternis getaucht hatte, waren die Leuchter, noch immer in Bewegung, in verschiedenen Phasen in der Halle wieder angegangen und hatten sich im gegenläufigen Beben Tausender durchsichtiger Glaspailletten, die nach und nach zum Stillstand kamen, wieder in ihre Ausgangsstellung begeben. Die Hotelrezeption war leer, leer auch der Aufzug, der langsam im Hauptschiff des Atriums nach oben schwebte, und schweigend standen wir Seite an Seite in der durchsichtigen Kabine, Marie in Tränen, ihren schwarzen Ledermantel und ihren Pullover über dem Arm, und schauten auf die Leuchter, die immer noch nicht zur Ruhe gekommen waren nach diesem Erdbeben von so schwacher Stärke, dass ich mich frage, ob es sich nicht vielleicht nur in unseren Herzen ereignet hatte. Der Etagenflur war still, endlos, beiger Teppichboden, vor einer Tür stand verlassen ein Wagen des Zimmerservices mit einzelnen Speiseresten, einer zerknüllten Serviette quer über einem schmutzigen Teller. Marie marschierte vor mir, mit hängenden Schultern, kraftlosen Armen, nachlässig eine Hand an der Wand des Flurs entlangschleifend. Vor der Tür holte ich sie ein und schob die Magnetkarte ins Schloss, um ins Zimmer zu treten. Und jedes Mal, an beiden Abenden, in Paris wie in Tokio, haben wir uns geliebt, das erste Mal zum ersten Mal – und das letzte Mal zum letzten Mal.
Aber wie oft haben wir uns nicht schon zum letzten Mal geliebt? Ich weiß es nicht, häufig. Häufig … Ich hatte hinter mir die Tür geschlossen und betrachtete Marie, wie sie vor Müdigkeit schwankend ins Zimmer trat, auf dem Arm ihren schwarzen Ledermantel und ihren Pullover, in ihrer weißen Bluse, die aus der Hose gerutscht war – an diesem verstörenden Detail würde mein Blick haften bleiben, bis sie ihre Bluse auszieht, und dann wären nur noch ihr fest in meine Hände gedrücktes Gesicht, ihre warmen Wangen in meinen gewölbten Handflächen –, Marie, die vor Müdigkeit im Zimmer fast umfiel und wie in Zeitlupe ihre unversieglichen Tränen weinte, und ich dachte bei mir, dass wir uns diese Nacht am Ende trotzdem noch lieben würden und dass es herzzerreißend wäre. Keiner von uns hatte bisher im Zimmer Licht angemacht, weder Deckenleuchte noch Nachttischlampe, und durch das große Glasfenster des Hotelzimmers sah man in der Ferne das in der Nacht erleuchtete Verwaltungsviertel von Shinjuku und, ganz nahe bei uns, fast nicht erkennbar durch die Nähe, die die Proportionen verzerrte, die linke Seite des monumentalen Rathauses von Kenzo Tange. Weiter unten, einige Meter vom Fenster entfernt, war der Schatten eines terrassenförmigen flachen Daches zu sehen, bedeckt mit hohen senkrechten Türmen aus Neonröhren, die pausenlos durch die Nacht blinkten wie Positionslichter, mit periodisch unterbrochenen und sich ausweitenden Reflexen, rötlich, schwarz und blasslila, die ins Zimmer drangen und auf die Wände einen diffusen roten Helligkeitsschein warfen, der die reinen Tränen auf Maries Gesicht erglänzen ließ, infrarot, durchsichtig und abstrakt. Sie ging an der Fensterfront entlang, mit feuchten Augen, die ich im Zwielicht erahnte, das unbefleckte Weiß ihrer Bluse, die sie halb geöffnet hatte, wie bestrahlt in regelmäßigen Abständen von einer Schicht jener unsagbaren rötlichen Helligkeit, die überdeckt wurde von den regelmäßigen Lichtstößen der auf den Dächern blinkenden Neonröhren. Ich trat zu ihr ans Fenster, betrachtete mit ihr einen Augenblick den dichten Strauß von Türmen und Bürogebäuden, die sich in der Dunkelheit vor uns erhoben, verstreut und majestätisch standen sie da, wobei jedes, von seinen obersten Stockwerken aus, persönlich über seinen Verwaltungsbereich von Stille und Nacht zu wachen schien, während mein Blick langsam von einem zum anderen wanderte, Shinjuku Sumitomo Building, Shinjuku Mitsui Building, Shinjuku Center Building, Keio Plaza Hotel. Warum willst du mich nicht küssen? fragte mich plötzlich Marie mit leiser Stimme, den Blick in die Ferne gerichtet, im Gesicht etwas Eigensinniges. Ohne zu antworten, schaute ich weiter nach draußen. Nach einer Weile antwortete ich, mit neutraler Stimme, erstaunlich ruhig, dass ich niemals gesagt hätte, sie nicht küssen zu wollen. Und warum küsst du mich dann nicht? sagte sie und wandte sich mir zu, um mich an die Schulter zu fassen. Ich versteifte mich, stieß ihre Hand so sanft wie möglich weg und begann erneut, das nächtliche Viertel zu betrachten. Mit derselben ruhigen, fast ausdruckslosen Stimme, einer Feststellung gleich, antwortete ich: Ich habe auch nie gesagt, dass ich dich küssen will. (Es war zu spät, Marie, es war zu spät jetzt.) Sie schaute mich lange vor dem Fenster an. Lass uns schlafen gehen, Marie, sagte ich, lass uns schlafen gehen, es ist spät, und ich sah, wie ein lang gezogener Schauer über ihre Schultern glitt, ein Schauer der Niedergeschlagenheit und des Ärgers. Fast hätte ich noch etwas hinzugefügt, aber ich sagte nichts, ich hielt mich zurück, legte sachte die Hand auf ihren Unterarm, und sie zog mit einer heftigen Bewegung ihren Arm weg. Du liebst mich nicht mehr, sagte sie.
Sieben Jahre zuvor hatte sie mir erklärt, dass sie bisher bei keinem ein solches Gefühl empfunden hätte, eine solche Gemütsbewegung, eine solche Woge von süßer warmer Melancholie war über sie gekommen, als sie mich diese so schlichte, so scheinbar nichtssagende Geste habe machen sehen, wie ich während des Essens ganz behutsam mein Stielglas dem ihren näherte, ganz vorsichtig und gleichzeitig so unpassend für zwei Personen, die sich noch nicht richtig kennen, die sich erst das zweite Mal treffen, mein Stielglas dem ihren näherte, um die Rundung ihres Glases zu liebkosen, es neigte, um es sachte an ihres zu stoßen in einem simulierten, ansatzweise ausgeführten wie sofort auch unterbrochenen Akt des Anstoßens, noch draufgängerischer und gleichzeitig taktvoller und eindeutiger zu sein, wäre nicht möglich, hatte sie mir erklärt, ein Konzentrat aus Intelligenz, Sanftheit und Stil. Sie hatte mir zugelächelt, in der Folge gebeichtet, dass sie in diesem Moment sich in mich verliebt hätte. Nicht durch Worte also war es mir gelungen, ihr dieses Gefühl von Schönheit des Lebens und Gleichklang mit der Welt zu vermitteln, das sie so intensiv in meiner Gegenwart empfand, auch nicht durch meine Blicke oder meine Handlungen, vielmehr durch die Eleganz dieser einfachen Geste meiner Hand, die sich langsam zu ihr hinbewegt hatte mit einer solch metaphorischen Feinfühligkeit, dass sie plötzlich innigste Übereinstimmung mit der Welt empfunden hatte, dass sie mir einige Stunden später mit derselben Kühnheit, derselben naiven und frechen Spontaneität sagen musste, das Leben ist schön, mein Liebling.
Marie zog ihre Bluse aus, ließ sie vor dem Fenster des Hotelzimmers zu ihren Füßen fallen und ging mit nackten Schultern, nur noch diesen zarten schwarzen Büstenhalter mit Spitzen tragend, den ich so sehr liebte, zum Bett und schaltete dort eine Lampe an. Erst jetzt bemerkte ich das Chaos, in dem wir das Zimmer hinterlassen hatten, um zu Abend essen zu gehen, Dutzende von geöffneten Koffern standen da im schwachen, durch den Schirm gedämpften Licht der Nachttischlampe auf dem Teppichboden herum, annähernd hundertvierzig Kilo Gepäck, die Marie am Abend zuvor in Roissy aufgegeben hatte, achtzig Kilo Übergewicht, das sie ohne mit der Wimper zu zucken akzeptiert und sofort auf Heller und Pfennig am Schalter der Fluglinie bezahlt hatte, verstreut standen sie da im Zimmer, acht gepolsterte Metallkoffer und vier identische Überseekoffer, mit einem Teil der Kleider ihrer letzten Kollektion, dazu eine Reihe von spitz zulaufenden Reisekoffern, halb aus Korbweide, halb aus Metall, extra für den Transport von Kunstwerken entwickelt, in denen die Experimentalkleider aus Kevlar-Titan waren, von ihr für eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst entworfen, die sie nächstes Wochenende im Contemporary Art Space von Shinagawa eröffnen sollte. Marie war Modedesignerin und bildende Künstlerin in einem, sie hatte in Tokio vor einigen Jahren eine eigene Marke kreiert, Allons-y Allons-o. Ich betrachtete sie, sie hatte sich flach aufs Bett fallen lassen, mitten auf ihre Kleider, die unter dem Gewicht ihres Körpers die Form verloren hatten und nun in trägen Kaskaden zusammenfallenden Stoffs zu Boden rutschten, und sie weinte, mein Liebling, das Gesicht vergraben in einem Kleiderbesatz, der sich mit ihren Haaren vermengte. Vor einigen Monaten war ihr Vater gestorben, und jetzt mischten sich in ihrem Herzen so viele Tränen, die seit Wochen im stürmisch-bewegten Lauf unseres Lebens flossen, Tränen der Traurigkeit und der Liebe, der Trauer und der Befremdung. Um sie herum schienen diese Kleider wie zu einer Vorführung angetreten, steif und bewegungslos in ihren durchsichtigen Hüllen, herausgeputzt, stolz, mit tiefem Ausschnitt, verführerisch und bunt, amarantrot, fleischrot hingen sie an Schranktüren oder auf Behelfsbügeln, waren aufgereiht an den zwei Reiseständern, die sie im Hotelzimmer wie in einer improvisierten Theaterloge aufgestellt hatte, oder lagen einfach nur säuberlich auf Stühlen und Sessellehnen. Ich betrachtete im Halbdunkel des Zimmers alle diese körperlosen, in allen Farben des Feuers und der Finsternis schimmernden Kleider, die um ihren halb nackten Körper einen Kreis zu bilden schienen, und müde, wie ich war, ja, auch ich – sehr müde jetzt, wie zerschlagen von der Zeitverschiebung –, dachte ich erneut an meine kleine Flasche mit Salzsäure, die in meinem Kulturbeutel lag.
Als ich packte, hatte ich mich gefragt, wie ich diese Flasche Salzsäure mit nach Japan nehmen sollte. Es war natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, sie während der Reise bei mir zu tragen, beim Anbordgehen oder beim Zoll wäre sie entdeckt worden und ich außerstande gewesen, ihre Herkunft, ihren Sinn und Zweck zu erklären. Andererseits hatte ich auch Angst, sie im Koffer zu lassen, da sie dort zerbrechen könnte und die Säure sich dann über meine ganzen Sachen ergießen würde. Schließlich hatte ich es ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen – ihr unauffälliges Aussehen eines Fläschchens Wasserstoffperoxyd war wohl doch die beste Tarnung – in einem der drei flexiblen Seitenfächer meines Kulturbeutels untergebracht, die jeweils durch einen abknöpfbaren Lederriemen abgetrennt waren, zwischen einer Parfumflasche und einem Päckchen Rasierklingen. Mein Kulturbeutel hatte des Öfteren schon derart bunt zusammengewürfeltes Zeug beherbergt, Zahnpasta und Nagelzange, Honig und Gewürze, Bargeld in Umschlägen aus Packpapier, ganz zu schweigen von etlichen noch nicht entwickelten Filmen, kleinen schwarzblauen Kompaktrollen Ilford FP4 und schwarzgrünen Ilford FP5, die mehr oder minder heimlich aus diesem und jenem Land herausgebracht werden mussten. Doch ohne irgendjemandes Aufmerksamkeit zu erregen, reiste die kleine Flasche von Paris nach Tokio.
An jenem Tag, da Marie mir vorschlug, sie nach Japan zu begleiten, begriff ich, dass sie bereit war, auf dieser großen Tour unsere letzten Liebesreserven zu verheizen. War es nicht einfacher, wenn wir uns schon trennen wollten, diese seit langem geplante Reise dafür zu nutzen, wechselseitig ein wenig Distanz zu gewinnen? Zusammen zu verreisen, war das wirklich die beste Möglichkeit, um Schluss zu machen? In bestimmter Hinsicht wohl schon, denn so wie die Nähe uns zerriss, so hätte uns die Ferne wieder nähergebracht. Tatsächlich waren wir in unseren Gefühlen dermaßen zerbrechlich und orientierungslos, dass die Abwesenheit des anderen sicher das Einzige war, was uns noch nahebringen konnte, während unser beider Gegenwart Seite an Seite die innere Zerrissenheit nur noch vertiefen und unsere Trennung besiegeln konnte. War ihr das bewusst, als sie mir vorschlug, sie nach Tokio zu begleiten, und hatte sie mich ganz vorsätzlich eingeladen, um Schluss zu machen – ich weiß es nicht, ich glaube es auch nicht. Andererseits argwöhnte ich, dass sie zumindest zwei leicht perverse Hintergedanken hegen mochte, als sie mir vorschlug, sie nach Japan zu begleiten, zum einen, dass sie annahm, ich könnte ihre Einladung ausschlagen (mehrerer Gründe wegen, vor allem aber einem, über den ich jedoch nicht reden möchte), vor allem aber, dass ihr unser jeweiliger Status während dieser Reise nur allzu klar war, sie überhäuft mit Ehrungen, eingedeckt mit Terminen und Arbeit, umgeben von einem Hofstaat von Mitarbeitern, Hostessen und Assistenten, ich ohne Status, in ihrem Schatten, letztlich ihr Begleiter, ihr Gefolge und Geleit.
Ganz leicht den Kopf hebend, drehte sich Marie in der beweglichen Masse ihrer Kleider, die sich unter dem Gewicht ihres nackten Körpers kräuselten und in Falten legten, träge-lasziv um und bat mich mit sanfter und leicht schläfriger Stimme, ihr etwas zu trinken zu geben, Wasser oder Champagner. Nur das, Wasser oder Champagner, sie hatte schon immer diesen einen Geschmack von exquisiter Schlichtheit, mein Liebling, als wir zum ersten Mal die Nacht miteinander verbracht hatten und ich aufstand, um das Frühstück zu machen, und sie fragte, ob sie Tee oder Kaffee wolle, hatte sie nach längerem Zögern mit einem Schmollmündchen eben genau beides genannt. Marie hatte die Schuhe ausgezogen und trug nur noch ihre schwarze, recht weite Hose, deren oberen Knopf sie aufgemacht hatte, sodass ihr durchsichtiger schwarzer Slip zu sehen war. Ihre Augen waren geschlossen, aber offensichtlich nicht völlig, nicht ausreichend versiegelt und abgetrennt von der Welt, das Licht störte sie wohl noch immer, denn sie langte mit dem Arm nach dem Nachttisch und griff sich tastend die lilaseidene Schlafbrille der Japan Airlines, die wir im Flugzeug zum Schutz gegen die Helligkeit erhalten hatten. Ohne die Augen zu öffnen, rückte sie die Brille auf dem Gesicht zurecht und ließ sich dann wieder rücklings aufs Bett fallen, was ihrer Gestalt nun das Aussehen eines geheimnisvollen Filmstars verlieh, einer gebrochenen, ophelianischen Gestalt inmitten ihres aschefarbenen Totenbetts aus trägem Stoff, die Schultern vergraben in der erweichenden aquatischen Weichheit eines ihrer zerknautschten Kleider, in schwarzem Büstenhalter, dessen einer Träger in die Armbeuge gerutscht war, und der über ihrem durchsichtigen Slip weit offenen Hose, der lilaseidenen Schlafbrille der Japan Airlines, die lässig ihr Gesicht umrahmte.
Hinter dem Zimmerfenster wurde die Dunkelheit noch immer von den Neonlichtern in wiederkehrenden langen rötlichen Blitzen durchschnitten, die in das Zimmer drangen und sich mit dem fahlgelben Licht der Nachttischlampe vermischten. Ich griff ein Champagnerglas, füllte es randvoll mit Wasser und ging zu Marie aufs Bett, wobei ich mir in dem chaotischen Haufen von Morgenmänteln und Kleidern, die auf den Decken lagerten, einen Platz suchte. Als ich mich neben sie setzte, glitt mein Blick zu der Einbuchtung ihrer Hose, wo jetzt fast ihr ganzer durchsichtiger Slip sichtbar war, unter dem sich die dichte dunkle Masse ihrer Schamhaare erahnen ließ. Da sie mich neben sich spürte, hob Marie träge den Arm, griff sich das Glas, führte es zum Mund und trank einen Schluck Wasser, ohne dabei die Seidenbrille abzunehmen, bevor sie sich wieder langsam nach hinten gleiten ließ, das Glas noch immer in der Hand, Wasser sammelte sich in ihren Mundwinkeln in einem Reif von kleinen spritzigen Perlen, um dann, da sie noch immer trank, in einer Fontäne längs ihrer Wangen hinabzutröpfeln, auf das Kinn, in ihren Nacken und auf ihre Schlüsselbeine. Nachdem sie ausgetrunken hatte, streckte sie die Hand aus dem Bett, um das Glas abzustellen, das auf dem Teppichboden umkippte, und übergangslos, mit einer sicheren und präzisen herrischen Geste, griff sie sich meine Hand und steckte sie in den Slip, kniff die Schenkel um ihre Beute zusammen. Und nachdem die erste Überraschung, der erste Schauer vorüber war, spürte ich plötzlich unter meiner Fingerkuppe den leicht elektrisierenden, ungemein lebendigen, lockeren und feuchten Kontakt mit dem Inneren ihres Geschlechts.
Es war ein uraltes, instinktives Verlangen, das ich durch die bloße Abfolge von Gesten der Liebe, die wir vollzogen, in mir wachsen und sich entfalten spürte. Marie hatte ihr Becken gehoben, um mir beim Ausziehen ihrer Hose zu helfen, und ich hatte lange ihren nackten Bauch um den Nabel geküsst, genau über der unsichtbaren Naht des Slips, die eine Stoffgrenze zwischen ihrer blendend weißen Haut und der durchsichtigen und leichten Unterwäsche aus schwarzem Lycra bildete. Dann hatte sie selbst Hand angelegt, um mir beim seitlichen Runterziehen des Slips zu helfen, hatte nochmals ihr Becken gehoben, um ihn ganz auszuziehen, und dann hatte sie mehr und mehr aufgehört, sich zu winden und zu bewegen, war ihre Ungeduld zur Ruhe gekommen. Sie blieb rücklings auf dem Bett liegen, den Nacken in ein Kissen vergraben, die lilaseidene Schlafbrille der Japan Airlines über den Augen, mit einer Art Besänftigung in den Gesichtszügen, seitdem meine Zunge in ihr Geschlecht eingedrungen war, und leise und befriedigt stöhnte sie, nur die Bewegungen meiner Zunge begleitend, indem sie unmerklich den Rhythmus des Beckens erhöhte.
Langsam war ich mit der Zunge ihren ganzen Körper hinaufgewandert, hatte auf ihrem Bauch und ihren Brüsten haltgemacht, die feine, dünne Grenzlinie aus Spitze ihres schwarzen Büstenhalters überquert, der auf dem Rücken noch zugeknöpft war, aber dessen Körbchen ich vorsichtig nach unten geschoben hatte, sodass ihre Brüste, vom Korsett befreit, in meine Hände fielen und sich zart und weich zwischen meinen Fingern hin und her bewegten. Nach und nach robbte ich mich hoch zu ihrem Gesicht, meine Handflächen glitten über ihre nackten Brüste und Schultern. Instinktiv hatte sich mein Mund von ihrem Mund und der Verheißung von Küssen magnetisch angezogen gefühlt, doch genau in dem Augenblick, da ich meine Lippen auf die ihren drücken wollte, sah ich, dass ihr Mund geschlossen war, verschlossen und vernagelt in stummer Verzweiflung, ihre Lippen zusammengekniffen und mitnichten auf meinen Mund wartend, verkrampft in der Suche nach rein sexueller Lust. Und als ich innehielt und den Kopf über ihrem Gesicht hob, dessen Ausdruck mir die verbundenen Augen verbargen, da sah ich, wie ganz langsam unter dem schmalen schwarzen Rand der lilaseidenen Schlafbrille der Japan Airlines eine fast regungslose, kaum ausgebildete Träne hervortrat, die traurig auf der Stelle zitterte, unentschlossen, unfähig, weiter die Wange hinabzugleiten, eine Träne, die, da sie an der Stoffgrenze erzittern musste, schließlich auf der Haut ihrer Wange in einer Stille zerplatzte, die in meinem Geist wie eine Explosion widerhallte.
Ich hätte diese Träne von ihrer Wange schlürfen, mich auf ihr Gesicht fallen lassen und sie mit der Zunge auflecken können. Ich hätte mich auf sie stürzen und ihre Wangen, ihr Gesicht und ihre Schläfen küssen, ihr die Stoffbrille wegreißen und ihr in die Augen sehen können, und sei es für einen winzigen Moment, einen Blick wechseln und sich verstehen, mit ihr eins werden in dieser Verzweiflung, die durch den geschärften Zustand unserer Sinne noch verstärkt wurde, ich hätte ihre Lippen mit meiner Zunge gewaltsam auseinanderpressen können, um ihr zu beweisen, welch ungebrochener Schwung mich zu ihr hintrug, und wir hätten uns sicher, schweißgebadet, nicht mehr Herr unserer Sinne, in einer feuchten salzigen cremigen Umarmung aus Küssen, Schweiß, Speichel und Tränen verloren. Aber ich habe nichts getan, ich habe sie nicht geküsst, habe sie diese Nacht nicht ein einziges Mal geküsst, ich habe noch nie meine Gefühle ausdrücken können. Ich habe zugesehen, wie die Träne sich auf ihrer Wange auflöste, und habe die Augen geschlossen – im Gedanken, dass ich sie vielleicht, tatsächlich, nicht mehr liebte.
Es war spät, vielleicht drei Uhr morgens, und wir liebten uns, liebten uns langsam in der Dunkelheit des Zimmers, das noch immer lange Streifen aus rotem Licht und dunklen Schatten durchmaßen, an den Wänden flüchtige Spuren ihres Vorbeigleitens hinterlassend. Maries Gesicht, ins Zwielicht geneigt, die Haare aufgelöst im Aufruhr der durcheinandergeratenen Laken, ihrer Morgenmäntel und wirr um uns herumliegenden Kleider, blieb wie am Rande unserer Umarmung, verlassen an der Ecke eines Kissens, die Lippen zusammengekniffen und sich nicht lösend von jenem schrecklichen Ausdruck schwerer und stummer Verzweiflung, den ich an ihr gekannt hatte. Nackt in meinen Armen, warm und zerbrechlich im Bett dieses Hotelzimmers, an dessen Decke flüchtige Fäden roten Neonlichts vorüberzogen, hörte ich sie im Dunkeln stöhnen, wenn ich mich in ihr bewegte, aber ich spürte kaum, dass sich ihre Hände gegen meinen Körper drückten, ihre Arme sich um meine Schultern schlangen. Nein, es war, als vermiede sie sorgsam jeden überflüssigen Kontakt mit meiner Haut, jede unnütze Berührung, jede andere denn sexuelle Beziehung zwischen unseren Körpern. Denn lediglich ihr Geschlecht schien an unserer Umarmung teilzunehmen, ihr warmes Geschlecht, in das ich eingedrungen war und das auf fast autonome Weise sich regte, hitzig und bissig, gierig, während sie die Beine zusammenpresste, um mein Glied in den Schraubstock ihrer Oberschenkel zu zwängen, und verzweifelt an meinem Schambein rieb auf der Suche nach einem Genuss, den auf immer aggressivere Weise sich zu holen sie spürbar bereit war. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich meines Körpers bediente, um an mir, gegen mich zu masturbieren, dass sie ihre Verzweiflung an meinem Körper rieb, um sich in der Suche nach einem gefährlichen, glühenden und einsamen Genuss zu verlieren, schmerzhaft wie eine lang schwelende Brandwunde und tragisch wie das Feuer des Bruchs, den wir im Begriff waren zu vollziehen, und genau dasselbe Gefühl dürfte sie auch in Bezug auf mich empfunden haben, denn seitdem unsere Umklammerung zu jenem Kampf zweier paralleler Gelüste geworden war, nicht mehr zueinander-, sondern auseinanderstrebend, antagonistisch, als würden wir uns gegenseitig die Lust streitig machen, statt sie zu teilen, hatte auch ich mich schließlich wie sie auf die Suche nach einer rein onanistischen Lust konzentriert. Und je länger diese Umarmung dauerte, je mehr die sexuelle Lust in uns anstieg wie Säure, umso stärker spürte ich die schreckliche unterschwellige Gewalt dieser Umarmung anwachsen.
Wären wir jetzt beide zum Höhepunkt gekommen, hätten sich sehr wahrscheinlich unsere Sinne, durch die nervöse Anspannung und die seit Beginn der Reise angestaute Übermüdung erregt, besänftigen und wir eng umschlungen in diesem großen zerwühlten Bett in Tiefschlaf versinken können. Doch das Begehren wuchs noch immer, die Wollust überwältigte uns, und, mit zusammengepressten Lippen und in den Armen des anderen stöhnend, liebten wir uns weiter in der Dunkelheit dieses Hotelzimmers, als ich plötzlich hinter mir ein winziges Klicken hörte, und im selben Augenblick war das Halbdunkel des Zimmers von einem marineblauen, schweigenden und beunruhigenden Lichtschein erhellt. Ohne äußere Einwirkung und in einer umso überraschenderen Stille, als nichts ihr vorausgegangen war noch ihr folgte, hatte sich der Fernseher im Zimmer von selbst eingeschaltet. Kein Programm war aktiviert worden, keine Musik und kein Ton drangen aus dem Empfänger, lediglich ein feststehendes, verschneites Bild, das auf dem Schirm in einem steten unmerklichen elektronischen Rauschen vor blauem Hintergrund eine Nachricht anzeigte. You have a fax. Please contact the central desk. Marie, die Augen noch immer verbunden mit der Seidenbrille, hatte von dieser Unterbrechung nichts bemerkt und fuhr fort, sich in meinen Armen im bläulichen Halbdunkel des Zimmers zu bewegen. Ich aber war, ungeachtet der brennenden Intensität meines Begehrens, durch den Vorfall wie vor den Kopf geschlagen, ich fixierte stumpfsinnig die stumme Nachricht auf dem Bildschirm und war auf einmal unfähig, unsere Umarmung auch nur einen Augenblick länger fortzusetzen. Außer Atem und schweißgebadet hielt ich inne, und nachdem ich eine kurze Weile regungslos auf ihrem Körper liegen geblieben war, zog ich mich aus ihr zurück, wobei ich ihr, etwas Absurderes gibt es wohl nicht, zuflüsterte, wir hätten ein Fax erhalten. Ein Fax? Ich glaube, sie hörte nicht mal meinen Satz oder verstand ihn nicht, versuchte jedenfalls gar nicht, ihn zu verstehen, so unzweideutig nahm sie mein Innehalten als eine Aggression, als willentlichen Akt, sie ihrer Lust zu berauben, sie um den Genuss, den Höhepunkt zu bringen. Auf dem Rücken im Bett liegend, brach sie schließlich stumm in Tränen aus, aus allen Ecken und Ritzen ihrer Seidenbrille drangen Tränen hervor, nicht nur unten, wo sie zwangsläufig über ihre Backenknochen und Wangen rannen, sondern auch oben, wo sie sich mit den Schweißperlen längs des Haaransatzes vermischten. Ich wollte etwas sagen, mich erklären, ihren Arm nehmen und sie beruhigen, doch meine Bemühungen, sie zu trösten, ließen sie nur noch zorniger, aggressiver werden, die geringste Berührung meiner Hände auf ihrer Haut ließ sie erschauern. Gepackt von Weinkrämpfen auf dem Bett, stieß sie mich mit den Füßen und Händen weg und schrie mich an abzuhauen. Du kotzt mich an, wiederholte sie, du kotzt mich an.
Ich stand im Bad und betrachtete meine nackte Gestalt im halbdunklen Spiegel. Beim Eintreten hatte ich kein Licht angemacht, und so konkurrierten zwei gegensätzliche Lichtquellen um die relative Dunkelheit des Raums, der bläuliche Schimmer vom Bildschirm des Fernsehgeräts, der noch immer im angrenzenden Zimmer glänzte, wo ich Marie leise in die Decken schluchzen hörte, und der schmale goldene Streifen der Nachtbeleuchtung unten am Kleiderschrank, die bei meinem Gehen über den Flur automatisch angegangen war. Ich konnte kaum Züge und Konturen meines Gesichts im großen Wandspiegel oberhalb des Waschbeckens erkennen. Die Badewanne hinter mir spiegelte sich im Halbdämmer, auf dem Wannenrand ein zerknüllter Bademantel, auf dem Boden mehrere Handtücher, andere, noch unbenutzte, gefaltet in ihren metallenen Wandregalen. Auf der Ablageplatte des Waschbeckens stand deutlich sichtbar neben Maries zahllosen Schönheitsprodukten, kleinen Flaschen und Tuben, Puderdose, Lippenstift, Lidstrich, Rouge, Wimperntusche, auch mein Kulturbeutel, den ich kurz zuvor geöffnet hatte. Von meinem Gesicht im Dunklen tauchte nur mein Blick auf, meine fixen intensiven Augen, die mich anstarrten. Ich schaute mich im Spiegel an und dachte an das Selbstporträt von Robert Mapplethorpe, wo aus der finsteren Schwärze der thanateischen Abgründe der Tiefe des Fotos im Vordergrund nur ein Stock aus kostbarem Holz aufscheint, mit einem winzigen ziselierten Elfenbeinknauf in Form eines Totenkopfs, dem, noch immer im Vordergrund, mit derselben perfekten Tiefenschärfe wie ein Echo das Gesicht des Fotografen antwortet, bedeckt bereits mit dem Schleier des Todes. Und doch lag in seinem Blick ein Ausdruck von Ruhe und gelassenem Trotz. In der Dunkelheit des Badezimmers stand ich nackt mir selbst gegenüber, in der Hand ein Fläschchen mit Salzsäure.
Und nach und nach hatte sich die Gefahr konkretisiert.
Hinter mir war die Tür des Badezimmers offen geblieben, und im Schatten waren die Schiebetüren des Wandschranks und der ins Zimmer führende Teil des Flurs zu erahnen. Marie musste eingeschlafen sein, mit dem nackten Körper quer über dem Bett, die Augen umgürtet mit der tränenfeuchten Augenbinde im fahlen bläulichen Licht des immer noch angeschalteten Bildschirms im Zimmer. Ich konnte die Strecke, die mich vom Zimmer trennte, sehr gut in Bilder umsetzen, die wenigen Schritte, die ich längs des Wandschranks im Flur gehen musste, dann die Ecke und der Ausblick aufs Zimmer, Holzkisten kreuz und quer auf dem Boden, die offenen Koffer und das erstarrte Gefolge der trübselig-schlaffen schwarzen Kollektionskleider, die im Dämmerlicht menschliche Formen angenommen hatten und nun, ineinanderverknäult, gemartert, auf Behelfsbügeln der Reiseständer hingen, dazu, in der Ferne, perspektivisch, das große Glasfenster und dahinter Tokio. Im Zimmer war kein Laut zu hören, weder Atmen noch Schluchzen, nicht das leiseste Knistern. Ich hörte keinen Ton, und ich hatte Angst … So viele Stunden hatte keiner von uns beiden geschlafen, so viele Stunden, dass unsere raumzeitlichen Koordinaten sich aus Mangel an Schlaf, Verwirrung der Gefühle und Ausrasten der Sinne verflüchtigt hatten. Es musste jetzt nach drei Uhr morgens in Tokio sein, und wir waren am selben Morgen angekommen, gegen acht Uhr japanischer Zeit, nach einem kurzen morgendlichen Aufenthalt in Paris vor dem Abflug und einer langen Nacht im Flugzeug, wo wir allenfalls ein oder zwei Stunden gedöst hatten, das machte alles in allem fast achtundvierzig Stunden, die wir nicht geschlafen hatten, oder nur sechsunddreißig Stunden, was soll’s, ich stürzte mich in komplizierte und müßige Berechnungen, um meine Gedanken auf irgendetwas Objektives zu lenken und mich von der Woge an Gewalt, die ich in mir hochsteigen spürte, nicht übermannen zu lassen. Ich hätte gern Marie umarmt, um sie zu trösten, sie sanft in meine Arme genommen und ihr, mit der zwingenden Kraft der Geständnisse, die man nicht macht, oder lediglich in Gedanken, in seinem Innersten, gesagt, dass ich sie liebte, dass ich sie immer geliebt hätte, aber dass nun geschlafen werden müsse, dass wir schlafen müssten, dass allein der Schlaf uns jetzt beruhigen könne. Es ist so spät, Marie, schlaf, es ist so spät, sagte ich zu ihr und nahm sanft ihre Hand. Da fuhr sie jäh zusammen, als würde sie aus dem Schlaf auffahren. Hau ab, wiederholte sie leise und befreite ihre Hand, wobei sie mich mit dem Arm zurückstieß, hau ab, lass mich schlafen, wiederholte sie. Und urplötzlich hatte ich nur noch 3en vor meinen Augen, drei 3en, die in meinem Blickfeld auftauchten, 3.33 a.m. sah ich unvermittelt vor mir auf dem Display des Radioweckers blinken, drei 3en in roten Ziffern aus fein gepunkteten flüssigen Kristallen, die mich aus dem Halbdunkel des Nachttischs fixierten. Wo war ich denn eigentlich? Und was war dieses trübe blasslila Halbdunkel, das die langen Strahlen dieses Unglücksscheinwerfers mit schwarzen und roten Reflexen durchmaßen? War ich ins Zimmer zurückgekommen? Ich saß neben ihr, die kleine Flasche mit Salzsäure in der Hand, offen. Und das war’s, was roch, der beißende Geruch der Säure.
Ich schloss die Zimmertür hinter mir, fand mich allein auf dem verlassenen Flur der 16. Etage. Auf dem Stockwerk war kein Laut zu hören, lediglich das Brummen der Klimaanlage und, vielleicht, weiter weg, das Gebläse eines Heizkessels hinter einer Tür für das Dienstpersonal. Bevor ich das Zimmer verließ, hatte ich eilig eine Hose und ein T-Shirt übergestreift, keine Strümpfe, lediglich ein Paar Hotelpantoffeln aus Nylonkrepp. Leicht verwirrt, wie ich war, musste ich in die falsche Richtung gegangen sein, schien es mir doch, als hätte ich mehrfach auf dem Stockwerk eine Runde gedreht, bevor ich endlich auf den Treppenabsatz stieß. Dort drückte ich alle Knöpfe auf einmal, um den Aufzug heranzurufen, und nach einer Weile sah ich, wie ein orangefarbenes Kontrolllämpchen aufleuchtete, verbunden mit einem Tonsignal, das kurz und durchdringend auf dem menschenleeren Treppenabsatz ertönte, um das Nahen eines Lifts anzukündigen. Die Aufzugtüren öffneten sich vor mir. Mechanisch trat ich in die Kabine, drückte auf gut Glück den Knopf vom letzten Stockwerk. Der Lift stieg lautlos nach oben, und ich rührte mich nicht, ich hörte mein Herz schlagen, an der Wange spürte ich ein Kribbeln.
Mehrere Albtraumbilder verfolgten mich, fragmentarische Szenen aus letzter Zeit, die in flüchtigen Blitzen meines Bewusstseins aufschienen, gleißende Halluzinationen, die in rotem Leuchten und schwarzem Schatten zerstoben: ich, nackt in der Dunkelheit des Badezimmers, wie ich mit all meinen Kräften die Salzsäure in die Visage im Spiegel schüttete, um meinen Blick nicht mehr zu sehen, oder ich, noch immer, ruhiger und weitaus beängstigender, die Flasche Salzsäure in der Hand, den nackten Körper Maries betrachtend, wie sie ausgestreckt im Bett liegt, ihre nackten Beine und ihr Geschlecht vor mir, ihr Gesicht zugebunden mit der Seidenbrille, das sanfte Atmen ihrer schlafenden Brust, ich, wie ich innerlich mit mir rang und in einer weit ausholenden Bewegung, schreiend, mich von ihr abwandte und das große Fenster des Zimmers mit einem Säurespritzer besprengte, der auf dem Glas zu brodeln, um den Krater zu knirschen und zu dampfen begann in einer klebrigen Masse aus geschmolzenem und aufschwellendem Glas, das in langen sirupartigen und schwärzlichen Schlieren die Scheibe hinuntertröpfelte.
Im 27. Stock angekommen, stieß ich auf mehrere geschlossene Türen, versperrte Ausgänge. Die Beleuchtung war über Nacht auf dem Stockwerk ausgeschaltet worden, sodass in der Dunkelheit nur noch die fluoreszierenden grünen Sigel der Notausgänge blieben, die in ihren transparenten Masken leuchteten: EXIT, EXIT, EXIT. Ich hörte, wie die Aufzugstüren sich hinter mir schlossen. Ich folgte zu meiner Rechten einem sehr dunklen Gang, in dem da und dort vereinzelt Nachtbeleuchtungen hingen, die ein weißliches Licht ausstrahlten und dem Ort etwas Mond- und Gespensterhaftes verliehen. Am Ende des Gangs stieß ich auf eine doppelte Glastür mit goldenen Türrahmen, über der ein nautisches Wappen und ein bläuliches Schild prangten, auf dem in verwaschenen Neonbuchstaben Health Club zu lesen war. Die Tür gab nicht nach, als ich sie zu öffnen versuchte, doch als ich die Türrahmen näher in Augenschein nahm, bemerkte ich, dass die beiden Riegel mit Bajonettfassung, die die Tür verschlossen hielten, einer oben mit der halbrunden Falle, die nach oben in eine Schließkappe führte, und der andere unten, außen angebracht waren und nicht innen. Ich brauchte also nur die beiden Stifte aus ihrer Schließkappe zu lösen, um die Tür halb zu öffnen und mich ins Innere zu zwängen. Nachdem ich mich umgedreht hatte, aus Furcht, von jemandem ertappt worden zu sein, der auf dem Flur etwas Ungewöhnliches bemerkt hatte, durchquerte ich hastig eine leere Empfangshalle und trat geräuschlos in einen menschenleeren Gymnastikraum, in dem sich meine Augen allmählich an die Dunkelheit gewöhnten, machte ein paar Schritte zwischen den Hanteln und diversen Geräten zur Stärkung von Herz und Kreislauf, Ruder- und Laufvorrichtungen, einer Reihe von radlosen medizinischen Laufrädern, lediglich nackte Rahmen, schlichte vertikale Gerüste, die wie zerbrochene oder amputierte Metallvögel aussahen. Überall an den Wänden hingen große Spiegel in der Dunkelheit, vertikale Triptychen, die meine nicht erkennbare Silhouette ins Unendliche widerspiegelten. Ich zögerte zunächst, welchen Weg ich weitergehen sollte, kehrte um und nahm eine gekachelte Innentreppe, auf der es nach Seife und Chlor roch. Ich hatte keine Ahnung, wo sie hinführte, und stieg langsam die Stufen nach oben, mich dabei am Geländer festhaltend, als plötzlich vor mir Tokio in der Nacht auftauchte, wie ein künstliches Theaterdekor aus Schatten und zitternden Lichtpunkten hinter der Glasfensterfront des Schwimmbads.
Das Wasser des Schwimmbads stand bewegungslos in der Dunkelheit, durchzogen von flüchtigen Lichtschimmern und wechselnden Reflexen. So im Halbdämmer erstarrt, sah es aus wie geschmolzenes Blei, Quecksilber oder Lava, schien wie seit Ewigkeiten da zu ruhen, zweihundert Meter über dem Meeresspiegel, hin und wieder gingen winzig kleine spontane Kräusel darüber hinweg, wie fröstelnde Haut. Um mich kein Lufthauch, nicht das geringste Geräusch von am Beckenrand anschlagendem Wasser. Längs der Fensterfront standen Liegestühle aus durchbrochenem weißen Plastik, nicht alle aufgeklappt, einige noch zusammengelegt, in einer Ecke abgestellt mit anderen zusammengeklappten Strandstühlen, Sonnenschirmen, Rettungsringen, Schaumgummibrettern. Im Umkreis des Beckens war es sehr warm, fast schwül, und in den umherwabernden Dämpfen hing der Geruch von parfümiertem Reinigungsmittel, ein übler Duft nach Andropogon, Ammoniak und Amber. An den Ecken des Beckens standen Holzkästen für Grünpflanzen, Inseln tropischer Vegetation im Dunkeln, hochaufgerichteter Bambus, dessen Halme an den Fenstern hochwuchsen, riesige Farnblätter, die aus den Pflanzenkästen hingen und sich sanft auf die Fliesen bogen. Kein Laut war im Schwimmbad zu hören. Ich ging langsam am Becken entlang, den Blick nach oben gerichtet zum großen beweglichen Glasdach, wo zwischen dem Metallgerüst der gestirnte Himmel zu sehen war. Auf der anderen Seite des Beckens angekommen, ging ich geräuschlos bis zur Glaswand und begann, stumm die vor meinen Augen schlafende Stadt zu betrachten.
Nachts von oben betrachtet, scheint die Erde zuweilen etwas von ihrer ursprünglichen Natur wiederzufinden, stärker in Einklang zu stehen mit dem wilden Zustand des uranfänglichen Weltalls, ähnlich den unbewohnten Planeten, den in der Grenzenlosigkeit der kosmischen Räume verlorenen Kometen und Sternen, und dieses Bild vermittelte jetzt Tokio hinter der Glasfront des Schwimmbads, das einer im Herzen des Weltalls eingeschlafenen Stadt, übersät mit rätselhaften Lichtern, Neonröhren und Straßenlaternen, Schildern, Beleuchtungen der Straßen und Hauptverkehrswege, der Brücken, Bahnlinien, Stadtautobahnen und netzförmig ineinander verwobenen Hochstraßen, ein Glitzern von Juwelen und Armbändern aus Lichterketten, Girlanden und gebrochenen Linien aus goldglänzenden Punkten, die häufig nur winzig waren, ununterbrochen leuchtend oder flimmernd, nah wie fern, rote Signale der Funkfeuer, die auf den Spitzen der Antennen und an den Dachecken in der Nacht blinkten. Ich betrachtete hinter der Glasfront die riesige Ausdehnung der Stadt, und mir war, als hätte ich die Erde selbst vor meinen Augen, in ihrer konvexen Krümmung und zeitlosen Nacktheit, als entdeckte ich vom Weltraum aus dieses in Nebel getauchte Relief, und flüchtig wurde mir da mein Dasein auf der Erdoberfläche bewusst, ein flüchtiger und intuitiver Eindruck, der in dem süßlich-faden metaphysischen Schwindel, in dem ich taumelte, mir konkret zur Darstellung brachte, dass ich mich in diesem Augenblick irgendwo im Weltall befand.
Jenseits der ersten erhellten Fassaden dehnte das gesamte Viertel von Shinjuku sein Schattenprofil in der Nacht vor mir aus. Auf der Linken waren die waagerecht verlaufenden weitläufigen Zonen, fast vollständig in Finsternis getaucht, zu sehen, dann die riesige Lücke aus dunklem Grün des Kaiserpalasts mitten in der Stadt, undeutbar und undurchdringlich, und zum Meer hin, am Horizont, über Shimbashi und Ginza hinaus, die offene See und die Gischt, die Bucht von Tokio und der Pazifik, dessen dunkle Gewässer sich an der Grenze von visueller Schärfe und Einbildungskraft verloren. Ich stand da im Dämmerlicht vor der Glasfront des Schwimmbads im 27. Stockwerk des Hotels, und hoch oben von dieser Senkrechten von nahezu zweihundert Metern, die die Stadt überragte, aufrecht stehend auf dieser privilegierten Landspitze, die direkt ins Leere führte, betrachtete ich Tokio, das sich endlos vor mir ausdehnte und vor meinen Augen die riesige Fläche seines grenzenlosen Ballungsraums entfaltete. Ich spürte auf einmal, wie die Erde erneut zu erzittern begann, wie einige Stunden zuvor, als wir ins Hotel zurückgekehrt waren, und ich dachte bei mir, dass der Stoß, den wir vorhin gespürt hatten, wie alle durch unsere Sinne wahrgenommenen Erdstöße berechtigterweise als Vorzeichen eines viel stärkeren Stoßes gedeutet werden konnte, der seinerseits ein starkes, und warum nicht, ein sehr starkes, das stärkste Erdbeben ankündigen könnte, das berühmt-berüchtigte Big one, das von allen Experten in Tokio erwartet wurde, vergleichbar dem von 1923 oder von 1995 im Kansai und vielleicht sogar noch stärker, mit einer bislang noch unbekannten Zerstörungskraft, unvorstellbar angesichts der gegenwärtigen Urbanisierung Tokios, jenseits jeder Katastrophenfantasie. Und so diese unverbaubare Perspektive auf die Stadt genießend, begann ich, dieses so gefürchtete große Erdbeben herbeizusehnen, in einer Art grandioser Euphorie stieg in mir der Wunsch auf, dass es in diesem Augenblick vor mir sich vollziehe, in dieser Sekunde, und alles vor meinen Augen verschwinden ließe, Tokio in Asche und Ruinen lege und in tiefe Trauer stürze, die Stadt und meine Müdigkeit, die Zeit und meine toten Lieben vernichte.
Das Wasser des Schwimmbads lag bewegungslos da im Halbdämmer, lediglich die geschwungenen Chromgriffe der Treppen zum Becken schimmerten. Ich ging einige Schritte am Beckenrand entlang, zog mein T-Shirt aus und legte es gedankenverloren auf den Arm einer Liege. Ich knöpfte meine Hose auf und streifte sie längs meiner Oberschenkel ab, hob ein Bein, um sie an der Wade hinunterzuziehen, dann das andere, vorsichtig, um mich von dem Kleidungsstück zu befreien. Ich schlüpfte aus den Schlappen und ging, nun völlig nackt, zum Becken, unter meinen Fußsohlen spürte ich das Warme, Feuchte der kautschukartigen Runzeln des Fußbodenbelags. Ich setzte mich auf den Beckenrand, nackt im Halbdunkel, und nach einer Weile ließ ich mich ganz langsam senkrecht ins Becken gleiten – und der Wirbel aus Anspannung und Müdigkeit, der sich seit dem Abflug in Paris in mir angestaut hatte, schien sich beim Kontakt mit dem weichen Wasser im Nu auf meiner Haut zu lösen.
Langsam schwamm ich in der Dunkelheit des Schwimmbads, ruhigen Geistes, wechselte den Blick von der Oberfläche des Wassers, die durch meine langsamen stillen Schwimmzüge kaum verändert wurde, zum riesigen nächtlichen Himmel, der durch die vielen Öffnungen in der Glasfront, die dem Blick unbegrenzte Perspektiven boten, überall sichtbar war. Ich hatte das Gefühl, inmitten des Weltalls zu schwimmen, zwischen fast greifbaren Galaxien. Nackt in der Nacht des Weltalls, streckte ich sachte die Arme vor mir aus und glitt lautlos mit der Welle dahin, ohne Wirbel, wie in einem himmlischen Wasserlauf, inmitten jener Milchstraße, die in Asien Fluss des Himmels genannt wird. Von allen Seiten umspülte das Wasser, warm und schwer, ölig und sinnlich, meinen Körper. Ich ließ den Gedanken freien Lauf in meinem Kopf, schob sanft das Wasser vor mir beiseite, teilte die Woge in zwei einzelne Wellen und schaute ihnen nach, wie sie sich, silbernen Pailletten gleich, in wiegenden Bewegungen bis an den Beckenrand verlängerten. Schwerelos gleichsam schwamm ich im Himmel, atmete ruhig und ließ meine Gedanken in der Harmonie des Weltalls aufgehen. Ich hatte mich endlich von mir gelöst, meine Gedanken stiegen aus dem Wasser auf, das mich umgab, sie waren seine Emanation, hatten seine Evidenz und Flüssigkeit, sie flossen dahin wie die vergehende Zeit und strömten gegenstandslos in der Trunkenheit ihres bloßen Verströmens, der Grandiosität ihres Dahinfließens, wie bewusstloses Pulsieren des Blutes, rhythmisch, weich und regelmäßig, und ich dachte, aber das wäre schon zu viel gesagt, nein, ich dachte nicht, ich wurde jetzt eins mit der Unendlichkeit der Gedanken, ich selbst war die Bewegung des Denkens, ich war der Lauf der Zeit.
Ich verließ das Schwimmbad und ging in mein Zimmer zurück. Ich durchmaß den langen Flur des 16. Stockwerks, beiger Teppichboden, die Türen der Zimmer, eine neben der anderen, geschlossen, lediglich die Nummern aus vergoldetem Metall als Orientierungspunkte, alle fast gleich, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619. Vor der Tür meines Zimmers angelangt und gerade im Begriff, einzutreten und zu Marie zurückzukehren, besann ich mich anders und machte kehrt, um zur Rezeption hinunterzufahren und dort das Fax abzuholen, das wir bekommen hatten. Ich trat aus dem Lift und durchquerte die Halle, ein wenig beschämt wegen meines Aufzugs, der sich vom Luxus des Hotels doch etwas abhob (ich trug ein schlichtes schwarzes zerknittertes und feuchtes T-Shirt, an den nackten Füßen Plastiksandalen). Es musste etwas später als vier Uhr morgens sein, und das Hotel war wie ausgestorben, in der schweigenden und vor sich hin schlummernden riesigen Marmorhalle war keine Menschenseele. An der Rezeption stand lediglich ein Angestellter, der Nachtdienst hatte, schwarz gekleidet, mit dem Rücken zu mir, in die Lektüre eines Schriftstücks vertieft. Die anderen Tresen waren leer, das Pult, das als Sammelpunkt für die einschlägigen Dienste der Airport-Limousine diente, war verlassen, kein Portier in Sicht, kein Mensch auf der überdachten Außentreppe, die hinter der doppelten Reihe von gläsernen Schiebetüren in der Dunkelheit zu erahnen war. Ich ging zum Empfangstresen, und mit fester Stimme, die ein wenig mit der Lässigkeit meines Aufzugs kontrastierte, erklärte ich dem Angestellten auf Englisch, dass ich in meinem Zimmer vom Eintreffen eines Faxes benachrichtigt worden sei. Room 1619, sagte ich ziemlich trocken, de Montalte, ergänzte ich.
Marie hieß de Montalte, Marie de Montalte, Marie Madeleine Marguerite de Montalte (sie hätte ihre Kollektionen so signieren können, M.M.M.M., in sibyllinischer Huldigung an das Haus des Doktor Angus Killiecrankie). Marie war ihr Vorname, Marguerite der ihrer Großmutter, de Montalte der Name ihres Vaters (und Madeleine, weiß nicht, sie hatte ihn sich redlich verdient, kein Mensch sonst hatte ein solches lacrimales Talent, diese angeborene Begabung für Tränen). Als ich sie kennenlernte, ließ sie sich Marie de Montalte nennen, manchmal nur Montalte, ohne das Adelsprädikat, ihre Freunde und Mitarbeiter nannten sie Mamo, was ich zum Zeitpunkt ihrer ersten Ausstellung zeitgenössischer Kunst in MoMA umgewandelt hatte. Dann hatte ich MoMA fallen lassen, zugunsten von Marie, ganz einfach Marie (eben so mal).
Der Angestellte an der Rezeption ließ auf sich warten (just a moment, please, hatte er mir gesagt, bevor er in den Tiefen eines kleinen Nebenraums verschwand), und ich wartete nun an der Rezeption darauf, dass er wiederkam, mit nackten Füßen in feuchten Schlappen. Was war denn nun eigentlich los? Warum kam er nicht wieder? Fand er das Fax nicht mehr? Oder lag da ein Irrtum vor? Sollte uns gar keiner diese Nacht ein Fax geschickt haben? Aber warum hatte ich dann Hals über Kopf mitten in der Nacht das Zimmer verlassen? Und die Säure, fragte ich mich, wo befand sich in diesem Augenblick die kleine Flasche mit Salzsäure? Eine Menge Angst machender Gedanken bestürmten meinen Kopf und ließen mein Herz schneller schlagen. Der Angestellte kam zu mir zurück, unerschütterlich, und nach rascher Prüfung in einem in schwarzes Leder gebundenen Register wies er mit einer stilisierten Geste in die Halle, um mir zu sagen, dass bereits jemand vor mir das Fax geholt habe. Jemand? Ich drehte mich abrupt zur Halle hin um und bemerkte Marie nur wenige Meter entfernt. Marie war da. Zunächst sah ich nur ihre Beine, denn ihr Körper blieb durch eine Säule verdeckt, ihre übereinandergeschlagenen Beine, die ich sofort erkannte, an den Füßen trug sie Pantoffeln aus blassrosa Leder, die zum Hotel gehören mussten und die sie mit einer distanzierten, raffinierten und ironischen Eleganz trug (der eine hing in prekärem Gleichgewicht gerade noch auf ihren Zehen, der andere war bereits zu Boden gefallen). Ich tat einen vorsichtigen Schritt auf sie zu, ich wusste ja nicht, wie sie mich empfangen würde. Sie saß reglos auf einem der eleganten Ledersofas in der Halle, Kopf und Haare nach hinten geworfen, einen Arm über dem Boden schlenkernd, und trug – was mich sofort am meisten überraschte – eins ihrer Kleider aus eigener Kollektion, aus mit Sternen besetzter nachtblauer Seide, Strass und Satin, chinierter Wolle und Organza, das sie irgendwie übergestreift hatte, bevor sie das Zimmer verließ, ohne es an der Schulter zuzuhaken oder in der Taille zu schließen (ich hatte sie noch nie eins ihrer Kleider tragen sehen, das verhieß nichts Gutes). Ungeschminkt, die Haut sehr weiß unter den Kristallleuchtern, über den Augen eine Sonnenbrille, rauchte sie bedächtig eine Zigarette. Du bist da? sagte ich, mich ihr nähernd. Sie betrachtete mich mit einem Anflug von Amüsiertheit, und in ihrem Blick las ich eine Spur von verächtlicher Überheblichkeit, die mir zu sagen schien, dass man mir echt nichts verbergen könne (ja, in der Tat, sie war da), aber die auch sagen wollte, oder deutete ich dieses Lächeln falsch, wenn ich darin Gehässigkeit ausmachte, während es vielleicht nur ein klein wenig zärtlicher Spott war, dass sie mit meinem Durchblick nichts am Hut hatte, dass er ihr sogar herzlich schnuppe war, dieser mein Scheißdurchblick. Was sie jetzt von mir erwartete, das waren keine Intelligenzbeweise, noch weniger irgendwelche Erklärungen hinsichtlich dessen, was wir gerade so Brennendes, Heißes, Heikles oben im Zimmer erlebt hatten, keine Spitzfindigkeiten, Rechtfertigungen oder Räsonnements, das war, dass ich sie umarmte und küsste, mehr nicht – und dafür war Intelligenz keine Hilfe.
Marie schaute mich weiter an, das Gesicht intensiv und reglos, der Körper geschmückt mit dem sternenübersäten nachtblauen Seidenkleid, Strass und Satin, chinierte Wolle und Organza, aus ihrer Kollektion, ihren schwarzen Ledermantel wie einen Schal nachlässig über die Schultern drapiert. Sie rauchte schweigend, in einer verhangenen Aura aus träumerischer Melancholie, die lässig zwischen ihren Lippen hervorzukommen schien, um als Rauch an der Decke zu verschwinden. Hast du dir Sorgen gemacht? fragte ich. Sie antwortete nicht sofort, nickte schließlich, widerwillig, indem sie nur ganz leicht den Nacken bewegte, mit sacht zitterndem Haar. Wo warst du? sagte sie, und als ich erklärte, ich sei ins letzte Stockwerk des Hotels gefahren und habe im Schwimmbad gebadet, sah ich sie gedankenvoll lächeln. Ja, ich weiß, ich hab dich gesehen, sagte sie nach einer Weile zu mir. Du hast mich gesehen? sagte ich. Und da erzählte sie mir, dass sie ebenfalls das Fax an der Rezeption holen wollte und, als sie mich dort nicht antraf, das Hotel verlassen hatte, um mich zu suchen. Ich hörte ihr schweigend zu, mir war nicht klar, worauf sie hinauswollte. Draußen hatte sie den Kopf gehoben, um das Hotel von außen zu betrachten, sie hatte mit den Augen unser Zimmer im 16. Stock gesucht, alle Lichter des Hotels waren ausgeschaltet, alle schliefen. Sie hatte sich in ihrem Kleid aus der eigenen Kollektion in der Nacht entfernt, sie wusste nicht genau, wohin sie ging, aufs Geratewohl irrte sie in der Mitte der Fahrbahn umher, hob von Zeit zu Zeit nochmals den Kopf zur fernen Fassade des Hotels, als ihr Blick schließlich von der Glaskuppel des Schwimmbads im letzten Stockwerk angezogen wurde, wo sie den Eindruck hatte, als sehe sie jemanden flüchtig sich bewegen. Sie hatte dem nicht sonderlich Aufmerksamkeit geschenkt, doch als sie wieder zum Hotel zurückkam, hatte sie nochmals den Kopf gehoben, und da hatte sie mich gesehen, sie hatte mich deutlich hinter der Glasfront gesehen, sie war sicher, dass ich das war, diese reglose Gestalt in der Nacht zwischen den erleuchteten Wolkenkratzern. Du denkst dir da was aus, sagte ich. Nein, ich denk mir nichts aus. Du denkst dir was aus, sagte sie.
Sie lächelte mir zu. Sie hatte ein zweideutiges Lächeln, das ich an ihr nicht kannte, etwas beunruhigend, leicht wahnsinnig. Komm, lass uns gehen, sagte sie und stand auch schon abrupt auf, ich halt das Hotel nicht mehr aus. Komm, wiederholte sie, nahm mich am Arm und zog mich zum Ausgang. Ich schlurfte hinter ihr her, versuchte ihr beizubringen, dass wir fürs Ausgehen nicht angezogen waren, wir könnten wenigstens noch mal ins Zimmer zurückgehen und einen Mantel holen, aber sie wollte nichts davon wissen, sie zog mich zum Ausgang und warf mir dabei ihren großen schwarzen Ledermantel über die Schultern. Da, nimm den, du frierst ja, Weichling, sagte sie, und sie hielt in der Halle inne, um mich zu mustern und mir ein schönes bezirzendes Lächeln zuzuwerfen, in dem zugleich Arglosigkeit und Provokation steckten. Und da, im heftigen Aufblitzen der lustvollen Freude in ihren Augen, war mir, als würde ich sie plötzlich wiederfinden, sie ganz sie selbst, unberechenbar und kapriziös, anstrengend, unvergleichlich.
Wir traten aus den Schiebetüren, die sich automatisch vor uns geöffnet hatten, und fanden uns wieder in der frischen Nachtluft auf der menschenleeren Außentreppe. Ein Dutzend Meter entfernt stand ein Taxi, und wir erwarteten vage sein Kommen, als wir in die Runde schauten, aber es rollte uns nicht entgegen (schlicht deshalb, weil der Fahrer schlief, wie uns einige Augenblicke später klar wurde, als wir seinen liegenden Körper im Halbdämmer sahen, den Sitz nach hinten gekippt). Wir liefen etwas schneller, um die wenigen Meter auf dem Privatweg des Hotels hinter uns zu bringen, überquerten rennend und Händchen haltend die Straße, hüpften über eine winzige Brüstung, um zur anderen Straßenseite zu gelangen, zwängten uns zwischen den Ästen eines Zwergengebüschs hindurch und schürften uns dabei die Knöchel auf. Noch im Laufen hatte ich Maries Mantel übergezogen, der viel zu klein für mich war, und Marie um die Schultern gefasst, um sie zu wärmen (dabei war der Ärmel des Ledermantels bis zum Oberarm hochgerutscht und strangulierte meine Achsel). Marie schmiegte sich an mich, den Kopf an meiner Brust, sodass wir nur noch einen eng ineinandergeschlungenen bizephalen Körper bildeten. In leichtem Trott stiegen wir die Treppen einer großen Metallüberführung hinunter, die gewissermaßen als städtische Schleuse fungierte, die die verschiedenen Stufen der Stadt abtrennte, und fanden uns auf einer tiefer liegenden Ebene, in einer nicht weniger gespensterhaften, menschenleeren Avenue wieder, erhellt von einer Reihe Straßenlaternen, die in der Nacht eine gestrichelte Linie weißen Lichts zeichneten. In Sichtweite des Keio Plaza Hotels angekommen, dessen Eingang weiß und golden illuminiert war, bogen wir in eine düstere Straße ab, und nachdem wir allmählich das Shinjuku der großen Hotels und Bürohochhäuser hinter uns gelassen hatten, gelangten wir in ein belebteres Viertel, mit mehr Läden und kleinen Gaststätten, kleinen Höfen im Dunkeln, Lampions und Ideogrammen auf den Schildern, beleuchteten Kästen im Halbschatten. Manchmal kamen wir an den rosa und weißen Neonlampen eines Nachtlokals oder einer Animierbar vorbei, vor deren Eingang eine Traube von Menschen diskutierte, eine groß gewachsene Rothaarige, bekleidet mit einer überweiten rosafarbenen Seglerjacke und Minirock, die Lippen bleich geschminkt, an ihrer Seite zwei ausgemergelte und miteinander tuschelnde Männer in Dreiteilern, und etwas weiter entfernt, im Schatten, untätig nahe der Mülltonne herumstehend, die magere Gestalt eines in Gedanken versunkenen kahlköpfigen alten Sandwich-Manns mit einem Stapel Prospekte in der Hand. Je weiter wir vordrangen, umso reger wurde das Viertel und umso stärker veränderte es sich, es gab immer mehr Bars und Neonlampen, Autos, die im Schneckentempo längs der menschenleeren Bürgersteige fuhren, Gerüche nach Suppe und Tako-yaki, Sex-Shops, Kellergeschosse, über die Anwerber und Rausschmeißer wachten, Kleinwüchsige in Zweireihern oder breitschultrige Typen mit Zopf, Holzschnittgesichtern und schwarzen wattierten Jacken. Niemand achtete sonderlich auf unser Aussehen, wir gingen auf in der Nacht und den Absonderlichkeiten eines jeden, waren nicht ausgefallener als andere. Marie mit ihrem Kleid aus eigener Kollektion für zwanzigtausend Dollar, ganz schlicht, nackter Rücken, zwei Bleistiftstriche, Rumpf aus schwarzer Seide und einem Bauchpropeller, das sie mit verblüffender Schlichtheit trug, Sonnenbrille auf der Nase und ihre rosa Schlappen vom Hotel an den Füßen, und ich selbst eingezwängt in einen Ledermantel, der mir viermal zu klein war und dessen Ärmel mir bis zur Armmitte reichten, die nackten Füße in feuchten und bereits verbogenen Schaumstoffsandalen, die Sohlen durchgeweicht, abgewetzt, braun geworden. Es wurde immer kälter auf der Straße, wenige Grade über null, unsere Hände waren eisig, und aus unseren Mündern drang dampfender Atem, ich spürte Maries Körper an meiner Brust zittern, ihre Unterarme bedeckte sinnliche Gänsehaut. Ich hab Hunger, sagte sie. Ist dir kalt oder hast du Hunger? sagte ich. Hunger, sagte sie, mir ist kalt und ich hab Hunger (lass uns was essen gehen, sagte sie).