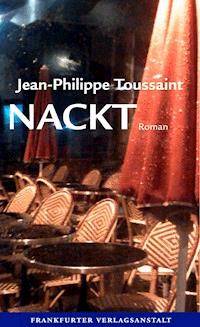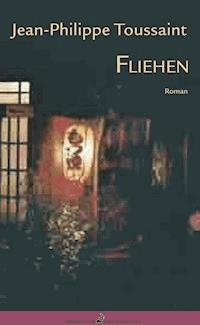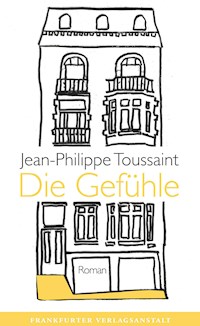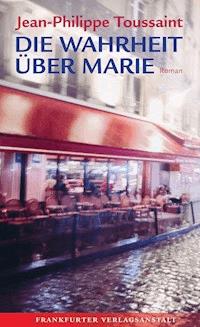Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie schon in seinem ersten Roman, Das Badezimmer, wo der Held das Badezimmer nicht mehr verlässt, spielen im Werk des großartigen Schriftstellers Jean-Philippe Toussaint geschlossene Orte eine große Rolle. Orte, an denen man ungestört über die Welt und deren gebrechliches Gefüge nachdenken kann. Als im Frühjahr 2020 von einem Tag auf den anderen sämtliche Pläne Toussaints über den Haufen geworfen werden, beginnt er, Stefan Zweigs Schachnovelle zu übersetzen, seine erste Übersetzung. Und so beschreibt er auf humorvolle Weise die Fallstricke dieser Übersetzung. Tag für Tag übersetzend entsteht dabei, fast ungewollt, ein Buch. Und was der Autor in dem Moment noch nicht ahnt: Das Buch, das er im Begriff ist zu schreiben, nimmt unter seiner Hand einen autobiographischen Charakter an. Zum ersten Mal spricht Toussaint von sich in der ersten Person: Eine spannende Autofiktion entsteht. Wir treten mit Toussaint in sein Schreibzimmer, blicken ihm über die Schulter, wenn er schreibend zurück in seine früheste Kindheit geht, vom Leben – und vom Tod – erzählt. Wir erfahren, wie sich seine Berufung zum Schriftsteller offenbarte. Eine Reise in 64 Kapiteln beginnt, die den 64 Feldern eines Schachbretts entsprechen. Denn um das Schachspiel dreht sich alles in diesem Buch, Schach ist Dreh- und Angelpunkt seiner ausschweifenden Erinnerungen. Entstanden ist ein »wunderbares und extrem intelligentes Buch mit einer sehr hohen Auffassung von dem, was Literatur sein muss« (Transfuge). »Intelligent und weit davon entfernt, langweilig zu sein.« (Culture de France) Und Frédéric Beigbeder äußerte begeistert: »Ich musste oft an Modiano denken, als ich es las.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wie schon in seinem ersten Roman, Das Badezimmer, wo der Held das Badezimmer nicht mehr verlässt, spielen im Werk des großartigen Schriftstellers Jean-Philippe Toussaint geschlossene Orte eine große Rolle. Orte, an denen man ungestört über die Welt und deren gebrechliches Gefüge nachdenken kann. Als im Frühjahr 2020 von einem Tag auf den anderen sämtliche Pläne Toussaints über den Haufen geworfen werden, beginnt er, Stefan Zweigs Schachnovelle zu übersetzen, seine erste Übersetzung. Und so beschreibt er auf humorvolle Weise die Fallstricke dieser Übersetzung. Tag für Tag übersetzend entsteht dabei, fast ungewollt, ein Buch. Und was der Autor in dem Moment noch nicht ahnt: Das Buch, das er im Begriff ist zu schreiben, nimmt unter seiner Hand einen autobiographischen Charakter an. Zum ersten Mal spricht Toussaint von sich in der ersten Person: Eine spannende Autofiktion entsteht. Wir treten mit Toussaint in sein Schreibzimmer, blicken ihm über die Schulter, wenn er schreibend zurück in seine früheste Kindheit geht, vom Leben – und vom Tod – erzählt. Wir erfahren, wie sich seine Berufung zum Schriftsteller offenbarte. Eine Reise in 64 Kapiteln beginnt, die den 64 Feldern eines Schachbretts entsprechen. Denn um das Schachspiel dreht sich alles in diesem Buch, Schach ist Dreh- und Angelpunkt seiner ausschweifenden Erinnerungen.
Entstanden ist ein »wunderbares und extrem intelligentes Buch mit einer sehr hohen Auffassung von dem, was Literatur sein muss« (Transfuge). »Intelligent und weit davon entfernt, langweilig zu sein.« (Culture de France) Und Frédéric Beigbeder äußerte begeistert: »Ich musste oft an Modiano denken, als ich es las.«
Inhalt
1 – Ich habe auf das Alter …
2 – Im Leben geschieht es …
3 – Während des Lockdowns …
4 – Ich stand reglos …
5 – In Das Leben Gebrauchsanweisung …
6 – Der symbolische Leuchtturm …
7 – Rue Jules Lejeune …
8 – Wir befinden uns …
9 – Ich habe eine Erinnerung …
10 – In den ersten Januartagen …
11 – Soweit ich mich …
12 – Ich hatte keinerlei Erfahrung …
13 – Am 11. März 2020 …
14 – Als ich Anfang der 1990er Jahre …
15 – Später fragte ich mich …
16 – Am nächsten Tag begann ich …
17 – Heute erreichte mich …
18 – Schritt für Schritt …
19 – An diesem Abend …
20 – Bevor ich schlafen gehe …
21 – Am Sonntagmorgen telefoniere ich …
22 – Am 16. März 2020 …
23 – Madeleine und ich essen …
24 – Die Epidemie schreitet …
25 – Seit Beginn des Lockdowns …
26 – Zu Beginn des Schuljahres …
27 – Wir sind jetzt …
28 – In meinen späten Jugendjahren …
29 – Wieder Portugal …
30 – Vor einigen Tagen …
31 – Es gibt, das ist …
32 – Zwischen diesen beiden …
33 – Eine andere Erinnerung …
34 – Jetzt sind wir bald …
35 – Die Novelle von Zweig …
36 – Durch eine gewisse Arglist …
37 – Seit ein paar Tagen …
38 – Die Gesundheitskrise hat …
39 – Mit der Übersetzung …
40 – Ich selbst war nie …
41 – Am 11. Mai 2020 …
42 – Seit einigen Tagen …
43 – Maman hat mir oft …
44 – Am Sonntag darauf …
45 – Wenn man meine Mutter …
46 – Ich weiß nicht viel über …
47 – Die Verflechtungen von Realität …
48 – Die Bekanntschaft …
49 – Im Frühjahr 1993 …
50 – Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis …
51 – Die zentrale Szene …
52 – Heute Morgen ist …
53 – Also ist dieses Buch …
54 – Ich habe mich oft gefragt …
55 – Als ich Ende des Sommers 1979 …
56 – Im Herbst 1979 …
57 – Über mehrere Monate …
58 – Gilles Andruet kam zurück …
59 – Die Zeit verging …
60 – Ich interessierte mich weiterhin …
61 – Im März 1981 …
62 – Die Jahre sind vergangen …
63 – Einige Tage später …
64 – Vier Jahre danach …
1
Ich habe auf das Alter gewartet, ich finde mich im Lockdown wieder.
2
Im Leben geschieht es manchmal, dass die Zeit der Welt, die Zeit der Geschichte – die Zeit der Kriege und Pandemien – in der privaten Zeit unseres persönlichen Lebens einen Widerhall findet. Genau das ist mir im Frühjahr 2020 passiert. Was sich damals während des ersten, die Welt in Starre versetzenden Lockdowns ereignete, war ein nicht erwartbarer Zusammenprall, ein nicht vorhersehbares Zusammentreffen zweier Momente meines Lebens, die nichts hätte einander nahebringen sollen.
3
Während des Lockdowns bin ich eines Tages wieder an meiner Schule in der Rue Américaine vorbeigekommen, die ich als Kind besucht hatte. Die Straßen von Brüssel waren wie ausgestorben, man sah nur sehr wenige Autos im Viertel. Vor dem roten Backsteingebäude meiner alten Schule angekommen, stieß ich die Tür auf und warf einen Blick in die Eingangshalle. Ich erkannte den Ort kaum wieder, nur der Geruch versetzte mich für einen Augenblick in die Zeit von damals zurück, alles andere blieb mir fremd. Hinter einer Flucht von Glastüren und Gängen erahnte ich vage im Hintergrund bodentiefe Fenster und Klassenräume. Einen überdachten Schulhof, einen menschenleeren Pausenhof. Ich betrat die Schule nicht, ich blieb reglos auf der Türschwelle der großen Eingangshalle stehen, die mit schwarzen und weißen Fliesen ausgelegt war, und was im blendend hellen Licht der Sonne dieses Märzmorgens vor mir erschien als eine Art aus den Tiefen der Zeit aufsteigender Widerschein, wie wenn man bei einer Fata Morgana in weiter Ferne Formen erblickt, die sich in der Hitze zu wellen beginnen, das war das schwarzweiße Würfelmuster des Fliesenbodens in dieser großen Eingangshalle, so wie sie Mitte der 1960er Jahre ausgesehen haben musste, oft nass vom Regen, mit Schlieren von Schlamm und halbverwischten feuchten Spuren von Fußabdrücken und Schulranzen. Ich betrachtete diesen alten schwarzweißen Fliesenboden, der jetzt trocken und staubig war und auf dem sich langsam und träge sich bewegende Schatten überlagerten, die von Ästen der Kastanienbäume im Pausenhof oder von viel weiter her, aus den Abgründen der Vergangenheit stammten, und da wurde mir bewusst – nie zuvor war mir das aufgefallen –, dass der Boden der Eingangshalle meiner ehemaligen Schule aussah wie ein Schachbrett.
4
Ich stand reglos vor dem Schachbrett meiner Erinnerung – und dort werde ich über die gesamte Länge dieses Buches stehen bleiben, das ist die Gegenwart dieses Buches, es ist seine unendliche Gegenwart.
5
In Das Leben Gebrauchsanweisung wendet Georges Perec ein von einem alten Problem abgeleitetes Prinzip an, das den Schachliebhabern gut bekannt ist: die Polygraphie des Springers. Es handelt sich um ein mathematisch-logisches Problem, auch das Springerproblem genannt, das darin besteht, für einen Springer auf einem Schachbrett eine Route zu finden, auf der dieser die 64 Felder durchläuft, ohne mehr als einmal auf demselben Feld zu verweilen. Ich beabsichtige selbst nicht eine derartige autobiographische Ausschließlichkeit. Nein. Ich werde mich allenfalls damit bescheiden, auf lässige Weise meinen Springer von Feld zu Feld wandern zu lassen, dem Lauf meiner Erinnerungen folgend, und versuchen, ein paar der flüchtigen und ergreifenden fragilen Schattenbilder, die mein Leben durchquert haben, wieder zum Leben zu erwecken.
6
Der symbolische Leuchtturm des Viertels meiner Kindheit ist das Haus in der Rue Jules Lejeune Nr. 2 in Brüssel, das an der Ecke der Place Charles Graux gelegen ist und durch seine Größe die Rue Washington dominiert. Ein Gebäude aus grauem Stein und roten Ziegeln, das man aus der Ferne sofort wahrnimmt, und wenn ich heute wieder im Viertel vorbeikomme, versäume ich es nicht, einen Blick auf dies Fenster im vierten Stock zu werfen. Ich schaue auf dies Fenster und habe manchmal den Eindruck, dort das Kind, das ich einst war, hinter den Fensterscheiben zu erahnen. Ja, ich sehe mich dort wieder im Schlafanzug auf die Rückkehr meiner Eltern lauern, die nicht nach Hause kommen. Die ersten Erinnerungen banger Momente stammen aus dieser Zeit – und wenn meine Erinnerung daran so lebhaft ist, dann liegt es zweifellos daran, dass ich mir dort, im Alter von sieben Jahren, zum ersten Mal den Tod meiner Eltern ausgemalt habe.
7
Rue Jules Lejeune, Rue Washington, Place Leemans, ich könnte die Landkarte meiner persönlichen Geographie meiner Kindheit aufzeichnen, auf der einige Orte wie beruhigende Schutzzonen auftauchen würden, die Plaine de jeux Renier Chalon, meine Schule in der Rue Américaine, der GB-Supermarkt in meiner Nachbarschaft, der schließlich wegen geschäftlicher Umstrukturierungen, die mir ebenso unverständlich wie gleichgültig bleiben, seinen Namen geändert hat, der »kleine Spanier« in der Chaussée de Waterloo, wohin meine Eltern mich und meine Schwester manchmal zum Abendessen mitgenommen haben. Im Zentrum dieses sicheren und beruhigenden Universums meiner Kindheit stand das Zimmer in der Rue Jules Lejeune, das ich mit meiner Schwester teilte. Ich erinnere mich an die Fantasiewelten, die ich dort mit Anne-Do errichtete, an unsere imaginären Hütten, an die Namen, die wir erfanden, um unsere Traumgespinste auszuschmücken. Ich war Michel, zu Ehren des Helden gleichen Namens aus der Grünen Bibliothek, Michel führt die Ermittlung, Michel geht auf Tauchstation, Michel verfolgt die Schatten. Michel! Jenseits dieser vertrauten Topographie rund um den sicheren Hafen der Rue Jules Lejeune erstreckte sich eine riesige und undeutliche, unbekannte Welt, in der es nur einige vertraute Inselchen gab, Sart-Dames-Avelines, Ostende, Le Coq, wo wir die Ferien mit unseren Großeltern verbrachten und die in der kindlichen Wahrnehmung, die wir damals von der Welt hatten, in transatlantischer Entfernung von Brüssel lagen.
8
Wir befinden uns im September 1963, ein paar Wochen nach meinem ersten Schultag in der Schule in der Rue Américaine. Zu dem vertrauten und tröstlichen Pantheon meiner Eltern und Großeltern kam eine neue wohlwollende Person hinzu, der Lehrer Monsieur Massoul. Wir sitzen hinter unseren Pulten in einem dieser Klassenzimmer der 1960er Jahre, mit schwarzer Tafel und Landkarten, die die Erinnerung in verwaschenen Farben zeigt, wir lernen schreiben, reihen mit einem Federhalter fleißig Buchstaben um Buchstaben in gerundeter Schrift aneinander. In der Klasse herrscht Stille, Schreibfedern aus Metall kratzen über das weiße, leicht auftragende Papier der Schulhefte. Der Lehrer gibt uns die Hausaufgabe für den nächsten Tag, wir sollen Buchstabenreihen schreiben. Nach Hause zurückgekehrt, mache ich in mich in meinem Zimmer in der Rue Jules Lejeune an die Arbeit. Sorgsam male ich einen Buchstaben nach dem anderen in mein Schulheft, eine Reihe mit dem Buchstaben »a«, eine andere mit dem Buchstaben »b«, eine mit dem Buchstaben »c«. Tita, meine Großmutter mütterlicherseits, ist an diesem Tag bei uns zu Hause. Während sie mich hinter ihrem Schleier voller Rührung beobachtet, wie ich meine Buchstaben aufschreibe, trinkt sie eine Tasse Tee – erahnt sie bereits in mir den Schriftsteller, der ich werden sollte? –, und dann, plötzlich, mache ich einen Tintenfleck auf das Blatt. Plopp. Ein richtig dicker Klecks. Meine Brust verkrampft sich, ich bin ohne Kraft, die Welt um mich herum ist gerade eingestürzt. Es ist die erste absolute Katastrophe, mit der ich in meinem Leben als Schriftsteller konfrontiert bin. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Ich bin ein kleiner Junge im Alter von sechs Jahren (nicht einmal sechs, ich war fünfeinhalb bei der Einschulung 1963), und ich bin am Boden zerstört. Tita nimmt sich der Sache an, der Tintenfleck in meinem Schulheft erscheint ihr nicht so dramatisch wie mir, nicht irreparabel. Mit einem Radiergummi versucht sie, den Fleck verschwinden zu lassen. Aber nichts zu machen, die Tinte lässt sich nicht mit der Art von Radiergummi, den sie benutzt, entfernen, es hat nur zur Folge, dass sich das Papier weiter aufreibt, knittert und einzureißen droht. Ich verfolge ängstlich den Ablauf ihrer Unternehmungen. Ich bin am Rande der Tränen. Man muss zu anderen Mitteln greifen, sagt Tita. Eine Rasierklinge. Eine Rasierklinge? Klarmachen zum Gefecht, gemeinsam machen wir uns in der Wohnung auf die Suche nach einer Rasierklinge, wir gehen von Zimmer zu Zimmer, öffnen Schubladen. Schließlich macht Tita im Badezimmer eine Rasierklinge ausfindig. Sie versichert mir, dass ich gerettet sei, dass alles gut werde, dass ich nicht ins Gefängnis müsse. Tita setzt sich wieder vor mein Schulheft, krempelt in Vorbereitung auf den Eingriff die Ärmel ihrer Strickjacke hoch, überprüft die Schärfe der Klinge am Löschblatt auf dem Schreibtisch, streckt, um sich zu konzentrieren, ihre Zungenspitze zwischen die Lippen. Vorsichtig beginnt sie, mit der scharfen Klinge an der Tinte in meinem Schulheft zu kratzen und zu schaben. Der Fleck wird schwächer, wird kleiner, schrumpft – und plötzlich durchbohrt die Klinge das Papier. Da ist ein Loch in meinem Schulheft! Auf ein Drama folgt das nächste, auf eine Katastrophe pfropft sich die nächste, im allgemeinen Sprachgebrauch nennt man das den größten anzunehmenden Unfall. Mitten in meinem Schulheft klafft ein großes Loch, umgeben von winzigen gezackten Resten blauer Tinte. Das ist das Ende für mich, am Schreibtisch lasse ich mich schluchzend auf meinen Arm fallen. Das ist das Exil, die sichere Verbannung. Ich weiß nicht mehr, wie die Geschichte schließlich ausging (wahrscheinlich hat Tita einen Brief an den Lehrer geschrieben, um ihm das Vorkommnis zu erklären). Aber diese traumatische Episode meiner Kindheit offenbart einen Charakterzug von mir, der mein ganzes Leben vergiftet hat, das kräftezehrende Streben nach Perfektion, das sich an diesem Tag umso stärker manifestierte, als ich dessen Ursache nicht erkannte. Ich ertrug die Leiden, ohne deren Ursprung zu kennen.
9
Ich habe eine Erinnerung von ähnlicher Tragweite. Einige Jahre nach diesem Vorfall, ich bin ungefähr zehn Jahre alt, und wir machen ein Diktat. Ich strenge mich an. Unser Lehrer Monsieur Massoul geht durch die Reihen und wirft einen Blick auf die Hefte. Manchmal bleibt er bei einem Kameraden stehen und zeigt mit dem Finger auf ein Wort oder einen Satz, um ihn auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Das Diktat nimmt seinen Verlauf. Der Lehrer bleibt hinter mir stehen, schaut mir über die Schulter und sagt wohlwollend, es gibt da einen Fehler, sagt mir aber nicht, wo, in welchem Satz, an welcher Stelle im Text. Er sagt nur: »Es gibt da einen Fehler« – und mir war, als hätte er gerade ein Damoklesschwert über meinem Kopf aufgehängt. Ich suche, finde aber den Fehler nicht, ich spüre die scharfe Spitze des Schwerts auf meinem Kopf, gnadenlos, nicht auszuhalten. Das Diktat neigt sich dem Ende zu. Der Lehrer sammelt die Arbeiten ein, ich habe den Fehler noch immer nicht gefunden. Ich spüre den zunehmenden Druck der Schwertspitze auf meinem Schädel. Als er zu mir kommt und mein Blatt an sich nehmen will, halte ich es fest, ich will es nicht loslassen. Die Vorstellung, eine Arbeit abzugeben, in der, wie ich ganz genau weiß, ein Fehler steckt, ist mir unmöglich, völlig undenkbar. Wenn ich dieses Blatt loslasse, wie soll ich da hoffen, ein Diktat ohne Fehler gemacht zu haben? Das ist nicht mehr und nicht weniger als die Aussicht auf Perfektion, die in weite Ferne gerückt ist (glückliche Zeiten, in denen Perfektion ein einfaches fehlerfreies Diktat bedeutete).
10
In den ersten Januartagen des Jahres 2020 fuhr ich nach Ostende, um das Manuskript meines Romans Die Gefühle nochmals durchzugehen. Ich kam in einer schlechten Verfassung nach Ostende. Meine Beine schmerzten mich schrecklich. Ich hatte einiges an Gepäck dabei, einen sehr großen Koffer, eine blaue Aktentasche mit meinem Manuskript, einen Rucksack mit Schwimmzeug, Badehose, Plastikbadelatschen, eine Badekappe von Speedo, Duschgel mit Aloe vera. So hatten mich die Jahre schon bearbeitet. Nachdem ich aus dem Zug gestiegen war, nahm ich ein Taxi, ich hatte nicht die Courage, meinen ganzen Kram zu Fuß zum Appartement zu schleppen. Ich holte die Wohnungsschlüssel bei der Agence Lecomte und zog das letzte Stück meinen Rollkoffer über den Deich. Als ich die Eingangshalle des Splendid betrat, kam mir sofort der vertraute Geruch Ostendes entgegen, jene Mischung aus frischer Luft, Wind, Jod und feuchtem Sand. Im siebten Stock stieg ich aus dem Aufzug, steckte den Schlüssel ins Schloss und trat in das leere, stille Appartement. Die Sonne schien ins große Zimmer, in dem ich schreibe, sie hatte einen prächtigen Auftritt.
Ich habe mich eingerichtet. Ich habe das Bett im Schlafzimmer bezogen, meinen Koffer ausgepackt. Ich habe das Manuskript von Die Gefühle sichtbar auf dem großen Tisch des Wohnzimmers platziert. Dann bin ich noch einmal hinausgegangen, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Am späten Nachmittag fühlte ich mich immer noch wie gerädert. Ich zog die Schuhe aus und legte mich im Wohnzimmer auf den Rücken neben den Tisch, an dem ich schreibe. Es war inzwischen Abend geworden. Äußerst behutsam begann ich, lang auf dem Teppichboden ausgestreckt, mit ein paar Turnübungen, vorsichtigen Körperdehnungen mit unter dem Kopf gekreuzten Armen, wobei ich tief ausatmete. Sosehr ich innerlich spürte, wie gut mir diese Übungen taten und ich mich zu entspannen begann, konnte der Schriftsteller in mir nicht umhin, mich von außen zu beobachten und sich gemeinerweise über mich lustig zu machen. Der Schmerz in den Beinen war den ganzen Tag nicht gewichen. Ich überlegte unbestimmt, ob es vielleicht irgendetwas mit Rheumatismus zu tun haben könnte, oder mit Arthritis (ah, wie schön er ist, der Autor dieser Zeilen).
11
Soweit ich mich zurückerinnern kann, hatte Bonne-maman, meine Großmutter väterlicherseits, immer Schmerzen in den Beinen. In den 1960er Jahren hatte Bonne-maman uns, meine Schwester und mich, im August immer in Le Coq aufgenommen. Jeden Nachmittag brachte sie uns an den Strand, anfangs in unseren Kinderwagen, dann, als wir laufen konnten, trotteten wir mit einem im Hörnchen zur Spirale gewundenen Softeis in der Hand zu Fuß hinter ihr her. Bonne-maman, erhobenen Hauptes, mit stolzer Miene und der Gewissheit, mit allem im Recht zu sein (was ihr übrigens auch niemand streitig machte), eröffnete den Marsch über die Bürgersteige von Le Coq, entschlossenen Schrittes und mit einer immer etwas beleidigten Miene, mit Taschen über die Handgriffe des Kinderwagens gehängt, in denen unsere ganze Strandausrüstung war, Schaufeln, Eimer, Bälle, Papierblumen (Bonne-maman konnte wunderbare Papierblumen basteln, manche von ihnen kosteten die unglaubliche Summe von acht Handvoll Muscheln) und natürlich die Thermoskanne (denn wir hatten Anspruch auf ein heißes Getränk, wenn wir aus dem Wasser kamen, das sie uns verabreichte und uns dabei den Rücken abrubbelte, während wir unter dem weiten grauen und windigen Nordseehimmel mit den Zähnen klapperten). Bonne-maman war zu dieser Zeit wohl im selben Alter wie ich heute, vielleicht sogar noch etwas jünger (das Alter erreicht uns an dem Tag, an dem man älter wird als seine Großeltern), und sie hörte nicht auf, sich über ihre Beine zu beklagen, wobei sie es nicht versäumte, auf die besonderen Fähigkeiten hinzuweisen, die ihr diese Behinderung verlieh, denn wenn man ihr Glauben schenkte, war sie in der Lage, jeden Wetterwechsel in ihren Beinen zu »spüren« (ihre Beine waren so etwas wie ihr Barometer, und die Intensität des Schmerzes die Sprossen der Leiter, auf die der Frosch, den sie in ihrem Herzen barg, im Heiligtum ihrer Schenkel hinaufkrabbelte). Und es war immer etwas Verschwörerisches mit dabei, eine Mischung aus etwas Oberlehrerhaftem und versteckt Selbstzufriedenem, wenn sie uns ihre geheimnisvollen Enthüllungen machte. Ich selbst habe übrigens diese Fähigkeit geerbt, Wetterwechsel vorherzusehen, ich kann mich einfach auf meine Beine verlassen. Es genügt ein wenig Anpassungsfähigkeit, mich auf meine Beine zu konzentrieren, wie ein Indianer, der sein Ohr auf das Gleis legt, um einzuschätzen, wie weit der Zug noch entfernt ist. Um keines meiner Gebrechen zu verschweigen, sei hinzugefügt, dass zu meinen chronischen Beinschmerzen zu Beginn des Jahres 2020 noch ein weiteres Übel hinzukam, das Gelenk des rechten Knies, befürchtete ich, war schmerzhaft entzündet, aber ich will meine Situation nicht gleich zu Beginn des Buches dramatisieren. Das Alter ist schon eine schöne Angelegenheit. In seinem herrlichen kleinen Buch Fellini über Fellini, einem Buch mit Interviews, die er mit einem Journalisten aus Florenz machte, erklärt Fellini: »Tja, ich bin vierundsechzig. Ich sage mir das immer wieder, um mich davon zu überzeugen, und dann horche ich gewissermaßen mit gespitzten Ohren in mich hinein, um herauszufinden, was sich eigentlich verändert hat, was da wohl eingerostet ist, verbeult ist, was also einer mit sechzig denkt und empfindet.«
Kurz, es ist, wie es ist, mit schweren Beinen, wackelig und gealtert, mit einer schmerzenden Hüfte und einem schwachen Knie fange ich dieses Buch an. Aber Achtung – derjenige, der es schreibt, bleibt der ewig junge Mann, der ich bin.
12
Ich hatte keinerlei Erfahrung damit, was eine große Gesundheitskrise sein konnte. Die erste konkrete Vorstellung, wie so etwas aussehen konnte, bekam ich – noch sehr vage und aus großer Entfernung –, als ich mir auf ARTE einen Dokumentarfilm über einen französischen Journalisten anschaute, der im Januar 2020 im Lockdown war. In der Reportage konnte man in allen Einzelheiten sehen, was eine harte Quarantäne bedeutet, Kontrollpunkte an jeder Straßenecke, Barrikaden um ganze Häuserblocks herum, zuerst aus allem möglichen Gerümpel, dann mit Ziegeln und Zement gemauert und mit Stacheldraht bewehrt, überwacht durch eine Art Bürgerwehr der jeweiligen Viertel. Lebensmittel wurden auf Distanz übergeben, die Waren wurden vor den Absperrungen sich selbst überlassen, die Straßen waren menschenleer, die öffentlichen Transportmittel geisterhaft, und überall sah man Gestalten in weißen Overalls mit Handschuhen und Gesichtsmasken, die bei den wenigen Passanten die Temperatur maßen, indem sie Laserthermometer, die wie Handscanner oder Wasserpistolen aussahen, auf Stirn oder Handgelenk richteten.
Was ich bei dieser Reportage zum ersten Mal begriff, schien mir aber an einem Scheidepunkt von Realität und Hirngespinst stattzufinden, etwas mir zwar Vertrautes, das aber auf keinen Fall, niemals und unter keinen Umständen in irgendeinem Bezug zu einer Situation stehen könnte, die ich selbst eines Tages in meinem Alltag in Paris oder Brüssel erleben würde. Als hätte ich einen Dokumentarfilm über die Pest im Mittelalter gesehen und dabei ein paar vertraute Landschaften erkannt, Florenz, toskanische Paläste, die grasbewachsenen Wiesen am Ufer des Arno, die sich in der Ferne verlieren. Natürlich erkannte ich die Straßen Pekings wieder, die Sehenswürdigkeiten, die breiten Straßen, die Eingänge der Untergrundbahn, alles Orte, die mir nicht fremd waren, aber was sich dort ereignete, die Dinge, die da gezeigt wurden, hatten nichts mit meinem eigenen Leben zu tun und konnten es auch nicht. Ich fühlte mich nicht betroffen. Ich blieb in einer unüberbrückbaren, unvorstellbaren und unüberwindbaren Weise auf Distanz zu dem Ereignis.
Die Coronakrise schien in diesen ersten Tagen des März 2020 noch in weiter Ferne. Italien befand sich noch nicht im Lockdown und würde es erst am 9. März sein. In Frankreich gab es bis zu diesem Zeitpunkt nur vier Tote und zweihundert infizierte Personen. Die Straßen in Brüssel sahen aus wie immer. Natürlich hatten wir von ersten Sperrmaßnahmen gehört, die waren bekannt und gingen auch schon in den allgemeinen Wortgebrauch über, aber wir waren noch meilenweit davon entfernt, diese neuartigen Bräuche in unsere tägliche Praxis zu übernehmen. Vermeiden, sich die Hände zu schütteln, demonstrativ Abstand halten, das schien noch eine Marotte einiger weniger Paranoiker zu sein, die sich beim Einkaufen mit Wegwerfhandschuhen aus transparentem blauem Plastik ausrüsteten. Die Welt war noch nicht dem alles übergreifenden Noli me tangere erlegen, das die menschlichen Beziehungen in den folgenden Wochen kontaminieren sollte. Aber der Wind begann sich zu drehen, neue Rituale begannen sich im öffentlichen Leben zu etablieren. Das war der Moment, in dem morgens auf allen Bürgersteigen ganz Europas auf eine mehr oder minder orthodoxe Art neue Begrüßungspraktiken die herkömmlichen ersetzten und jene berühmten alternativen Gesten auftauchten, der Gruß mit dem Ellenbogen, das Neigen des Oberkörpers auf Distanz, die Verbeugung oder der Bückling, wobei man sich übrigens nicht damit begnügte, diese Gesten normal auszuführen, sondern sie unbedingt übertreiben musste, wie zum Beweis, dass man sich von diesem Getue nicht hinters Licht führen ließ. Ich erinnere mich, an der Haltestelle der Straßenbahn 93 Place Stéphanie zwei respektable Herren beobachtet zu haben, wie sie sich mit dem Ellenbogen begrüßten. Sie taten es, indem sie diese Geste auf übertriebene und heitere Weise zergliederten (die Heiterkeit schien unabdingbarer Bestandteil dieser neuen Form prophylaktischer Begrüßung zu sein). Dieser ganze Zirkus aber und die allgemeine Heiterkeit würden in den folgenden Wochen verschwinden und mit den ersten Zehntausenden Toten in Ernst und Schrecken erstarren.
13
Am 11. März 2020 wurde in Frankreich ein Expertengremium gebildet, das zur Entscheidung beitragen sollte, mit welchen öffentlichen Maßnahmen die vom Coronavirus ausgelöste Gesundheitskrise bewältigt werden könne. Der etwa ein Dutzend Mitglieder umfassende Wissenschaftsrat war der Überzeugung, dass die Ankunft der ersten Welle der Epidemie nur noch eine Frage von Tagen war.
Zu Beginn des Jahres 2020 erwartete mich ein volles Programm mit Ausstellungen, Konferenzen und Reisen. Aber als die ersten Absagen wegen der Coronakrise eintrafen, ahnte ich bereits, dass auch andere Veranstaltungen abgesagt werden würden und ich von einem Tag auf den anderen ohne Perspektive dastehen würde, gleichermaßen unfähig zu leben (da alles, was ich geplant hatte, annulliert werden würde) wie auch zu schreiben, denn ich plante kein neues Buch. Dieses Gefühl, dass eine erzwungene Untätigkeit unmittelbar bevorstand, war zu diesem Zeitpunkt zwar noch diffus, war noch nicht deutlich ausgesprochen, aber seit einigen Tagen schlich sich in meine Gedanken auf ganz heimtückische Weise eine neue Befürchtung ein, eine neue Beklommenheit. Ich hatte schon immer eine Höllenangst davor, untätig zu sein. Um mir ein Gleichgewicht herzustellen, musste ich immer ein Projekt am Laufen haben, ein neues Buch vorbereiten. Ich musste also unter allen Umständen jetzt in Brüssel ein neues Projekt finden. Daher habe ich beschlossen, um die Stunden der Untätigkeit zu füllen, die ich am Horizont auftauchen sah, mich auf die Übersetzung eines Buchs zu werfen, und meine Wahl fiel auf die Die Schachnovelle von Stefan Zweig.
14
Als ich Anfang der 1990er Jahre in Berlin lebte, hatte ich bereits einmal mit dem Gedanken gespielt, Die Schachnovelle zu übersetzen. In einem alten Computer müssen noch Spuren der Übersetzung der ersten Zeilen in einer ersten Fassung zu finden sein, denn sehr viel weiter kam ich damals nicht, ich fürchte, dass der große Passagierdampfer, der in der Novelle Zweigs New York in Richtung Buenos Aires verlassen sollte, niemals in See gestochen ist, sondern in dem Computer, den ich damals hatte, im Trockendock blieb. Meine Eltern waren schon immer große Bewunderer Zweigs. Ich erinnere mich, mit ihnen damals in Berlin Anfang der 1990er Jahre über Die Welt von Gestern gesprochen zu haben. Zweigs Liebe für Europa, sein Ideal einer Toleranz, die sich jederzeit religiösem oder politischem Fanatismus entgegenzustellen bereit ist, all das hat auch in mir selbst dann persönlichen Widerhall gefunden, der sich noch verstärkt hat, weil die von ihm vertretenen Werte in Beziehung zu unserer Zeit traten. Ich habe am Ende sogar unbewusst Zweig mit meinem Vater gleichgesetzt. Es war also fast natürlich und in gewisser Weise folgerichtig, dass ich in meinem Roman Die Gefühle den Einfall hatte, die Person Zweigs näher an die des Vaters des Erzählers zu rücken. Aber seltsamerweise habe ich nie in Betracht gezogen, dass Zweig jemand gewesen wäre, mit dem ich, hätten wir zur selben Zeit gelebt, befreundet hätte sein können. Ich habe Zweig immer als einen Mann gesehen, der sehr viel älter als ich war, respektabler, gesetzter, ein ernster Mann im reifen Alter, mit seinem Schnurrbart, seinem steifen Anzug, seinem Gehstock und seinem Hut. Selbst heute, wo ich das Alter Zweigs bei seinem Tod erreicht, ja überschritten habe (er hat sich im Alter von sechzig Jahren in Petrópolis das Leben genommen), bleibt er für mich eine ebenso weit entfernte wie unerreichbare Persönlichkeit. Ich betrachte ihn – und werde ihn immer so sehen – als eine mich einschüchternde intellektuelle Figur, als jemand, den man in die undefinierte Reihe derer stellen könnte, die man »Freunde der Eltern« nennt.
Aber auch wenn ich mit den Jahren schließlich Zweig nähergekommen bin, hätte ich mir niemals vorstellen können, wirklich eines Tages Die Schachnovelle zu übersetzen. Und doch habe ich mich beim ersten Vorbeben der Coronakrise dazu entschlossen. Aber warum Zweig? Wenn ich ein auf Deutsch geschriebenes Buch übersetzen wollte, warum fiel dann meine Wahl nicht auf Kafka? Kafka wäre für mich die erste Wahl gewesen. Denn als ich Anfang der 1990er Jahre in Berlin ernsthaft damit begonnen habe, Deutsch zu lernen, dann nur aus dem Grund, Kafka auf Deutsch lesen zu können. Was dagegen einfacher zu erklären ist, ist der Grund, warum unter all den Werken Zweigs meine Wahl auf Die Schachnovelle gefallen ist. Denn für mich waren Literatur und Schach von Anfang an immer auf engste Weise miteinander verbunden.
Das erste Buch, das ich Anfang der 1980er Jahre geschrieben habe, trug den Titel Échecs, Schach. Es handelte von einer Schachweltmeisterschaft, die zehntausend Partien andauerte, die das ganze Leben lang dauerte, die das ganze Leben bestimmte. Natürlich habe ich bei meiner Entscheidung, die Novelle von Zweig zu übersetzen, an dieses erste Buch gedacht. Und noch mehr: Ich habe im selben Moment entschieden, nicht den Originaltitel Die Schachnovelle zu übernehmen, und auch nicht Le Joueur d’échecs – Der Schachspieler –, also den historischen französischen Titel, sondern nahm als Titel Échecs – Schach –, wie das erste Buch, das ich geschrieben habe, das aber nie veröffentlicht wurde. Eine Wahl, die von derselben Natur war wie die Wahl, die Novelle zu übersetzen. Indem ich der Novelle Zweigs denselben Titel gab, den mein eigener, vor vierzig Jahren entstandener Roman hatte, vollzog ich über die Jahre hinweg eine symbolische, intime und persönliche Geste, die ich ebenso als Hommage an den wunderbaren Schriftsteller Zweig verstand wie als Treuebeweis gegenüber dem jungen Mann, der ich einst war. Dazu kam ein weiterer Aspekt, der den doppelten Wortsinn des Wortes »échec« im Französischen betraf, den manche als unglücklich oder nachteilhaft ansehen könnten, der mir ganz im Gegenteil ein Vorteil zu sein scheint, da er auf eine hintergründige Weise den Titel des Buches mit dem Geisteszustand dessen verbindet, der es geschrieben hat. Der Titel Échecs verbirgt nicht die polysemantische Ambiguität des französischen Begriffs, der gleichzeitig Schach wie auch Scheitern bedeutet, also ein Synonym des Misserfolgs ist. Wenn man die Lebensgeschichte von Zweig nach 1933 kennt, die schmerzhafte Flucht aus Wien, die darauffolgenden Irrfahrten, die Umzüge nach London, nach New York, bevor er in Brasilien ankam und sich in Petrópolis niederließ, wenn man weiß, dass er nur wenige Tage nach Vollendung seiner Schachnovelle seinem Leben ein Ende gesetzt hat, dann muss man eingestehen, dass sich der etwaige Hauch von Melancholie, der im Französischen von dem Wort »échec« ausgeht, als Synonym von »Niederlage«, »Untergang« oder »Scheitern« auf bedeutsame Weise angebracht ist, um die geistige Haltung eines Menschen zur Sprache zu bringen, der am Ende seines Wegs angekommen ist und sogar schmerzhaft den letzten Text begleitet, den er geschrieben hat. Zweig selbst übrigens hat über den Misserfolg einmal geäußert, wie sehr er in seinen Biographien und seinen Novellen stets weniger von denen angezogen war, die triumphieren, als von denen, die das Schicksal besiegt hatte, Castellion und nicht Calvin, Erasmus und nicht Luther.