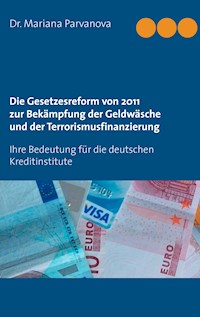
Die Gesetzesreform von 2011 zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung E-Book
Mariana Parvanova
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Gesetzesnovelle zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung von 2011 ist für Compliance-Mitarbeiter, Berater, Juristen und Studenten der BWL und Rechtswissenschaften mit Bezug zur Bankwirtschaft maßgeblich. Die Erweiterung der Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten führte zur Steigerung der Komplexität der Arbeit der deutschen Kreditinstitute. Es entstanden erhebliche Kosten für Arbeits- und Personalmehraufwand. Die Umsetzung dieser Reform führte ebenfalls zu erheblichen Reorganisationen und Restrukturierungen der Compliance-Abteilungen der deutschen Kreditinstitute. Dem interessierten Leser wird hiermit ein unabhängiger Blick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Bankwirtschaft geboten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abstract
Gegenstand der hier vorgestellten Arbeit ist eine Analyse der Gesetzesnovelle zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung von 2011 im Hinblick der Erweiterung der Aufgaben und Pflichten der deutschen Kreditinstitute. Es werden die wirtschaftlichen Folgen der Einführung einer „zentralen Stelle“ für die deutschen Kreditinstitute präsentiert und erklärt. Diese Masterarbeit beschreibt die erheblichen Mehrkosten für Arbeits- und Personalmehraufwand so wie den entstandenen Reorganisations- und Restrukturierungsbedarf zur Umsetzung dieser Gesetzesnovelle.
Darüber hinaus behandelt sie das Thema der Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“ frei von institutionellen Vorgaben und Vorschriften. Die Gesetzesänderungen der Aufgaben und der Pflichten der Kreditinstitute werden frei und unabhängig interpretiert. Dem interessierten Leser wird somit ein mehr oder wenig unabhängiger Blick auf die Gesetzesreform von 2011 geboten.
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Danksagung
1 Einleitung
2 Die Entstehungsgeschichte der Geldwäscheprävention in Deutschland
3 Eine Analyse der relevanten Gesetzesänderungen von 2011 für die deutschen Kreditinstitute und die daraus entstehenden Handlungsfelder
3.1 Der Dokumentations- und Organisationsmehraufwand für die deutschen Kreditinstitute aufgrund der Änderungen der Sorgfaltspflichten
3.1.1 Die Auswirkung der neuen Definition des wirtschaftlichen Berechtigten und die daraus resultierende Mehraufwand bei seiner Identifizierung für die deutschen Kreditinstitute
3.1.2 Die Tragweite der Erweiterung der allgemeinen und der vereinfachten Sorgfaltspflichten für die deutschen Kreditinstitute
3.1.3 Die Bedeutung der Änderung der verstärkten Sorgfaltspflichten und deren Ergänzung im Hinblick von PEP
3.2 Der Mehraufwand für die deutschen Kreditinstitute wegen der Änderung der internen Sicherungsmaßnahmen
3.2.1 Die Bedeutung der Einführung der „sonstigen strafbaren Handlungen“ für die deutschen Kreditinstitute und für die Arbeit deren Geldwäschebeauftragten
3.2.2 Die neue Komplexität aufgrund einer “zentralen Stelle” zur Koordination der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und “sonstigen strafbaren Handlungen” und ihrer Verflechtung mit den Internen Sicherungs- und Kontrollsystemen für die deutschen Kreditinstitute
3.2.3 Die Erleichterung der Arbeit der deutschen Kreditinstitute im Hinblick auf der Offenlegungs-/Mitwirkungspflicht und der Absenkung der Schwelle für Verdachtsmeldung durch die Gesetzesnovelle von 2011
4 Zusammenfassung und Ausblick
Glossar
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Beispiel für ein mögliches Organigramm (Aufbauorganisation) eines Kreditinstituts
Abbildung 2: Beispiel für eine mögliche Ablauforganisation eines Kreditinstituts
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Handlungsfelder und Handlungsbedarf für die Kreditinstitute ab 2011 in Folge der neuen Gesetzesanforderungen
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
Anm.
Anmerkung
AO
Abgabenordnung
BaFin
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
BCBS
Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht
BKA
Bundeskriminalamt
bzw.
beziehungsweise
CDD
Customer Due Deligence (Sorgfaltspflichten)
DK
Die Deutsche Kreditwirtschaft
Ebd.
ebenda
FATF
Financial Action Task Force on Money Laundering
FIU
Financial Intelligence Unit der BKA
ggf.
gegebenenfalls
GwG
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
GwBekErgG
Das Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
GwOptG
Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention
KYC
Know your customer
KWG
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz)
MA
Mitarbeiter
OECD
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PEP
Politisch exponierte Personen
PrüfBV
Prüfberichtsverordnung
RBA
risikobasierter Ansatz
StGB
Strafgesetzbuch
u.a.
unter anderem
Vgl.
vergleiche
VÖB
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands
z.B.
zum Beispiel
ZKA
Zentraler Kreditausschuss (Im August 2011 wurde er in Deutsche Kreditwirtschaft (DK) umbenannt.)
Danksagung
Mein Dank gilt meiner Familie,
die mich vielfältig während des Niederschreibens
meiner Masterarbeit unterstützt hat.
1Einleitung
Gegenstand Die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Wirtschaftskreislauf nennt man Geldwäsche1. Zielscheibe der Geldwäsche sind meistens wegen der Natur ihrer Tätigkeit mit Geld die Kreditinstitute. Aus diesem Grund lässt sich erklären, warum die meisten der Geldwäschepräventionsvorschriften den Kreditinstituten gelten. Neben der Geldwäsche existieren unzählige Arten „betrügerischer Handlungen“ bzw. 2011 neu definiert durch § 25c KWG „sonstigen strafbaren Handlungen“, die der deutschen Wirtschaft jährlich Schaden in Millionenhöhe zufügen. Die Konsequenzen von „sonstigen strafbaren Handlungen“ sind für die Kreditinstitute mittelbare und unmittelbare Schäden wie z.B.: Reputationsverlust, Bußgelder (bei Verletzung gesetzlicher Vorschriften), wirtschaftliche Schaden, persönliche Haftung von Mitarbeitern und aufsichtsrechtliche Maßnahmen. Da die Betrüger erfinderisch sind und keinen Halt vor den neusten Errungenschaften der Technik machen, ist diese Tendenz steigend. Die Geldwäschepräventionsvorschriften tragen dieser Entwicklung Rechnung und fordern von den gesetzlich Verpflichteten (darunter auch Kreditinstituten) die Schaffung von angemessenen Sicherungssystemen, Überwachung, Kontrolle, Risikomanagement und Dokumentation.
Die Gesetzesgrundlagen der Betrug- und Geldwäscheprävention in Deutschland sind vor allem im GwG und im KWG festgelegt2. Diese Gesetze sind die Umsetzung von EU-Richtlinien, von der Beanstandungen und der Empfehlungen der FATF und der Richtlinien und Standards des Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) in Deutschland. Aufgrund dieser Gesetze arbeiten die deutschen Banken und Geldinstitute ihre internen Richtlinien heraus und schulen ihre Mitarbeiter über die bestehenden ggf. geänderten Sorgfaltspflichten. Mit den Gesetzesänderungen im Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GwOptG) und im KWG vom 29.12.2011 wurden umfassende Gesetzesänderungen vorgenommen, die die Beanstandungen der FATF berücksichtigen und die Geldwäscheprävention und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verbessern. Diese Arbeit unternimmt eine Analyse der Bedeutung und der Folgen der Einführung von erweiterten Aufgaben und Pflichten für die deutschen Kreditinstitute durch die Geldwäschegesetzesnovelle von 2011.
Der Grund für die Wahl der Geltwäschegesetzesreform von 2011 zum Gegenstand dieser Arbeit ist die Tatsache, dass ich persönlich zu diesem Zeitpunkt als Geldwäschebeauftragte in einer Bank tätig war. Diese Reform, die neuen Aufgaben und Pflichten, und die dadurch entstandenen Fragen haben damals maßgebend meine Arbeit geprägt. Hiermit komme ich meinem Bedürfnis nach, das Thema frei von institutionellen Vorgaben und Vorschriften nach meinem Verständnis aufzuarbeiten und zu interpretieren. Somit möchte ich dem interessierten Leser einen mehr oder wenig unabhängigen Blick auf die Gesetzesreform vom 2011 anbieten.
Ziel dieser Master-Arbeit ist:
eine Vergleichsanalyse der Novellierungen der GwG und der KWG von 2011 in der Relation neue/alte Fassung im Hintergrund und
die Darstellung der aus der Gesetzesreform resultierenden: Änderungen, erweiterten Aufgaben und Pflichten, und wirtschaftlichen Effekte für die deutschen Kreditinstitute im Vordergrund anzubieten.
Methode Die angewendete Methode ist die Vergleichsanalyse − der Vergleich zwischen den alten und neuen Fassungen der erwähnten Gesetzestexte. Neben den Gesetzestexten von GwG und KWG als primären Quellen ziehe ich bei meiner Analyse auch der Veröffentlichungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Deutschen Kreditwirtschaft (DK)3 und ggf. Drucksachen der Bundesregierung und des Bundesrates hinzu.
Bemerkung Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GwOptG) trat bereits ab dem 29.12.2011 größtenteils und vollständig am 01.03.2012 in Kraft. Die Finanzinstitute haben eine Gratisperiode zur Implementierung der Änderungen und zum Aufbau eines risikoangemessenen, institutsweiten Risikomanagements- und internen Sicherungssysteme bis 31.03.2012 erhalten. BaFin hat bis dahin von aufsichtsrechtlichen Maßnahmen abgesehen.
1 Vgl., Gabler Wirtschaftslexikon (online), „Geldwäsche“, (Zugriff am 13.06.2013)
2 Zusammen mit den EU Verordnungen, die allgemeine Gültigkeit haben und unmittelbarer in den EU-Mitgliedsstaaten wirksam sind.
3 Diese sind zwar unverbindlichen Empfehlungen ohne Rechtsverbindlichkeit. Sie haben sich jedoch in der Praxis als eine Art „hilfreiches Handbuch“ erwiesen, an denen sich alle Finanzinstitute halten.
2Die Entstehungsgeschichte der Geldwäscheprävention in Deutschland
Die Empfehlungen der FATF zur internationalen Geldwäschebekämpfung sowie die Richtlinien des Rates und des Europäischen Parlaments sind die internationalen Normen, die die gesetzlichen Grundlagen zur Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland beeinflussen. Das Ziel der EU-Geldwäscherichtlinien ist die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und zur Terrorismusfinanzierung durch den risikobasierten Ansatz. Dieser Ansatz liegt auch dem GwG und dem KWG zugrunde.
Die FATF ist eine Expertengruppe, die die Geldwäschemethoden analysiert und Strategien zu deren Bekämpfung herausarbeitet. Sie ist in Paris bei der OECD angesiedelt. Deutschland ist eines der Gründungsmitglieder. Als solches beteiligt sich Deutschlandmaßgeblich an der Herausarbeitung und Entwicklung der Grundsätze zur Geldwäschebekämpfung. Diese Grundsätze sind die „40+9-FATF-Empfehlungen“ (40 Empfehlungen als Mindeststandards sowie 9 Sonderempfehlungen). Die Mitglieder der FATF haben die Umsetzung dieser Empfehlungen in nationales Recht und die regelmäßige Kontrolle dieser Umsetzung durch FATF vereinbart.4
Die erste EU-Geldwäscherichtlinie5 vom 1991 befolgt die Empfehlungen der FATF. „Mit dieser Richtlinie wurden die Mitgliedstaaten verpflichtet, Geldwäsche zu untersagen und den Finanzsektor zu verpflichten, die Identität seiner Kunden festzustellen, angemessene Aufzeichnungen aufzubewahren, interne Verfahren zur Schulung des Personals einzuführen und Vorkehrungen gegen Geldwäsche zu treffen sowie den zuständigen Behörden Transaktionen zu melden, die auf Geldwäsche hindeuten.“6
Die zweite Geldwäscherichtlinie7 nimmt außer die Banken und die Finanzdienstleistern Bereiche des Nichtfinanzsektors in der Pflicht der Geldwäschebekämpfung. Die dritte Geldwäscherichtlinie8 ist das zentrale Regelwerk in Deutschland.
Sie enthält u.a. eine Verschärfung der Sorgfaltspflichten, eine Verpflichtung zur Schaffung einer nationalen Zentralstelle für Verdachtsanzeigen und die Integration der Terrorismusfinanzierung in die Geldwäschebekämpfung. Die vierte Geldwäscherichtlinie ist ein Vorschlag vom 05.02.2013 zur Neufassung der Richtlinie 2005/60/EG. Das Ziel dieses Vorschlags ist, die Implementierung der Empfehlungen der FATF vom 02/2012, um auf den neuen Entwicklungen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungen zu reagieren.9
Das Geldwäschegesetz — GwG
In Deutschland fand die Umsetzung der ersten EU-Geldwäscherichtlinie und der FATF-Empfehlungen vom 07.02.1990 in Form des Geldwäschegesetzes vom 29.11.1993 statt10





























