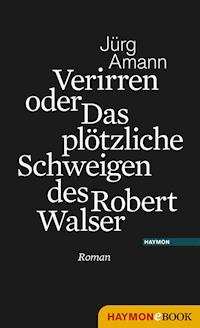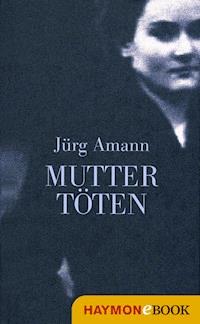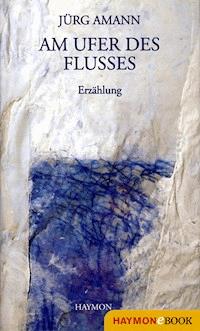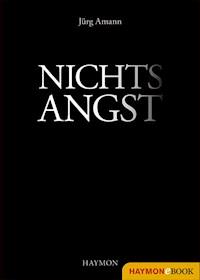18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
42 Jahre, 35 Wachstuchhefte, A5, klein beschrieben: Jürg Amann entführt ein letztes Mal in eine Welt, die gänzlich ihm gehört. Reflektiert, kohärent, berührend – so lesen sich die Tagesbuchaufzeichnungen von Jürg Amann, zweifellos einer der bedeutendsten Schweizer Gegenwartsautoren, der zu früh verstorben ist. Sein Gesamtwerk: Prosa, Lyrik, Theater und Erzählungen. Sein literarisches Schaffen: so vielseitig wie der Verfasser selbst. Ein Schriftstellerleben lang begleiteten die Aufzeichnungen sein literarisches Schreiben. Schon früh begann Amann dabei auch eine biografische Spur zu legen in Tagebüchern, die die Gattungsbezeichnung sprengen: Weltanschauliches, Ästhetisches, Philosophisches findet Eingang in die eng beschriebenen 35 Wachstuchhefte, aber auch Briefe, die er, bevor er sie versandte, abgeschrieben hat. Sie markieren das für ihn biografisch Bedeutsame. "Meine erste Welt ist zerstört. Ob eine zweite mir lebenswert erscheint, muss sich erst weisen." Werkstattbuch und Lebenskontinuum zugleich: Der Autor gibt Einblick in Persönliches und die Poetik seines Schreibens. Seine Tagebücher sind mit größter Sorgfalt verfasst. Sind ernst, nachdenklich – regen zum Nachdenken an – und charakteristisch für das Werk des Autors, das bis heute weit über die Grenzen der Schweiz wirkt. Die Aufzeichnungen, die 1970 in Winterthur beginnen enden Anfang 2012. Amann erhält seine Krankheitsdiagnose und hört – mit wenigen Ausnahmen – auf zu schreiben. Anna Kurth, seine Lebensgefährtin, setzt auf seine Bitte fort, was vom Autor angelegt war. Sie bearbeitet den größten Teil der Hefte nach den Kriterien, die er vorgegeben hatte. Die Aufzeichnungen erscheinen zum 10. Todestag des Autors. Mit einem Nachwort von Corinna Jäger-Trees
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jürg Amann
Die gezählten Tage
Aufzeichnungen
Umschlag
Titel
Vorbemerkung
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tage erzählen – gezählte Tage
Bio-Bibliografie
Über den Autor
Impressum
„Und vieleswie auf den Schultern eineLast von Scheitern istzu behalten.“
Friedrich Hölderlin,Mnemosyne
Vorbemerkung
„Das Tagebuch, über dreissig Bände, denen diese Aufzeichnungen, auszugsweise, aber in sich unverändert, entnommen sind, ist gleichzeitig Werkstattbuch. Gegenüber der Normalschrift in diesem Buch in kleinerer Schriftgrösse gedruckter Text versteht sich demgemäss als Werkteil oder Werkskizze. Kursiv gesetzt sind Ausschnitte aus Briefen, deren Abschriften ins Tagebuch ebenso zum gesamtheitlichen Konzept dieses Lebens- und Werkkontinuums gehören.“
Diese „Vorbemerkung“ hat Jürg Amann seinem Manuskript vorangestellt, als er begann, Auszüge aus seinen Tagebüchern abzuschreiben. Das war ein paar Jahre vor seinem Tod. In seinen letzten Wochen bat er mich, diese Arbeit zu Ende zu bringen, ohne Eile, irgendwann. Dies habe ich getan. 30 Wachstuchhefte A5, klein beschrieben, waren noch zu bearbeiten. Was Jürg Amann selber begonnen hatte, habe ich versucht weiterzuführen.
Eine (auto)biographische Spur zu legen war allerdings kein leichtes Unterfangen in einem Tagebuch, das nur selten über Tagesgeschehen berichtet und in weit grösserem Umfang weltanschauliche, ästhetische und philosophische Gedanken enthält. Sprechend waren da vor allem die Briefe. Sie wurden von ihm – wenn sie ihm wichtig waren – zumindest in Teilen ins Tagebuch abgeschrieben, bevor er sie versandte. Sie markieren das für ihn biografisch Bedeutsame, geben Einblicke in Persönliches.
Das so genannte Biografische und das Werkstattbuch sind für den Tagebuchschreiber also zusammengehörig und zugleich reflektierte Auswahl. Das zeigt sich auch daran, dass die Tagebücher der Jahre 1969/70 von ihm nicht berücksichtigt wurden, weil sie schon in seinen Roman „Wohin denn wir“ eingeflossen waren. (Die „Jugendtagebücher“, wie der Autor die früheren nannte, wollte er ohnehin nicht aufnehmen. Sie gehörten für ihn nicht zum darzustellenden „Lebens- und Werkkontinuum“).
Jürg Amanns Tagebucheinträge enden Anfang 2012. Er hat zwischen seiner Krebsdiagnose und seinem Tod kein Tagebuch mehr geführt. Wie er überhaupt, mit wenigen Ausnahmen, aufgehört hat zu schreiben.
Selbstverständlich habe ich mich an die Vorgaben, die er selber für seine Auswahl bestimmt hat, gehalten. Kein Komma wurde hinzugefügt, kein Wort verändert. Meine Arbeit bestand, in Verlängerung seines eigenen Tuns, in der Auswahl seiner „in sich unverändert[en]“ Passagen, die Einblicke geben in sein Schriftstellerleben und sein poetisches Denken.
Anna Kurth
Folgende Zeichen wurden vom Autor im Tagebuch so notiert: ... und (...)
Wo ich als Herausgeberin Textstellen innerhalb eines Briefes gekürzt habe, wurde das folgendermassen gekennzeichnet: [...]
1970
Winterthur, 21.12. Seltsam, dass das Fehlen eines Tagebuchs auch gleich das Ausbleiben fruchtbarer Gedanken zur Folge hat. Endlich ein neues gekauft.
Sich ohne Nachsicht ausdrücken, um das Bild der Welt zu geben! Ohne Nachsicht!
24.12. Totale Einsamkeit ist totale Freiheit. Warum tönt der Satz, wenn man ihn umkehrt, obwohl dieselbe Identität ausgedrückt wird, um so viel trauriger? Totale Freiheit ist totale Einsamkeit.
26.12. Ich bin die Momentaufnahme eines unendlichen Stromes.
Die Vergänglichkeit begreife ich immer dann ganz, wenn ich in einem uralten Film die Brüste einer jungen Frau betrachte, die nun bereits alt sein muss, sehr alt. Dann frage ich mich, was mit diesen straffen, schönen Brüsten geschehen, und mein Fleisch lehnt sich gegen die Gewissheit auf.
1971
1.1. Warum ist die Welt dann am schönsten, wenn sie am kältesten ist?
Ich muss mir abgewöhnen, mich durch Krankheiten und Schwächen interessant zu machen, die ich gar nicht habe.
10.1. Ehepartner scheinen mir oft nur die eine Funktion zu haben, sich gegenseitig durch Lob, Aufmunterung und Lüge am Leben zu erhalten.
„Dieses Verlangen nach Menschen, das ich habe und das sich in Angst verwandelt, wenn es erfüllt wird, findet sich erst in den Ferien zurecht.“ Kafka, als ob er von mir schriebe.
Ich schreibe wochenlang nichts, aber wenn ich mit anderen Pflichten in Zeitnot gerate, verspüre ich auch plötzlich wieder den Zwang zum Schreiben, als sei es ein Alibi. Vielleicht ist überhaupt alles Alibi, was ich um mich schaffe.
Entwöhnungskur von diesem verdammten Fernseher!
13.1. Im Verhältnis zum Unendlichen ist alles nichts. Im Verhältnis zum Nichts ist alles etwas.
19.1. Es vermehrt das eigene Unglück, andere glücklich zu sehen, obwohl es, wenn die anderen unglücklich wären, auch nicht weiterhelfen würde.
24.1. Ich entkomme meiner Krebsnatur nicht. Immer schaue ich, während ich mich vorwärts bewege, zurück.
27.1. Diese falschen Hoffnungen, die die eigene Natur übersteigen. Überhaupt diese Hoffnungen. Ich muss wieder hoffnungslos werden, damit ich unverletzlich bin.
Du hast Besuch?, fragte er. – Ich habe ihn wieder weggeschickt, sagte sie. – Wie konntest du nur?, sagte er. – Ich wusste doch, dass du kommst, sagte sie.
24.2. Optimismus ist das Opium des Volkes.
Wenn man ohne Kompromiss durchs Leben will, muss man früh genug lernen, allein zu sein.
3.3. Was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist nicht, wie uns weisgemacht wird, seine Willensfreiheit, sondern das Bewusstsein seiner Willensfreiheit: die Illusion.
5.3. Es gibt kein Ziel. Aber perfiderweise gibt es Wege.
6.3. Der Gesündeste, Sensibelste scheitert in dieser Welt. Nicht weil er, sondern weil die Welt krank ist.
9.3. Hätte ich doch den Mut, alles zu verbrennen, was früher war. Aber mir ist, als würde ich damit den Ast absägen, auf dem ich trotz allem noch sitze. Ohne Vergangenheit hätte ich keine Zukunft.
16.3. Wenn schon ich die Welt nicht ändern kann, so will ich wenigstens anders sein als sie.
20.3. Ich halte es nicht mehr aus, dieses kleinbürgerliche Ehedrama zu Hause länger täglich mitanzusehen. Es ist zu jämmerlich. Zu lächerlich und zu traurig zugleich.
26.3. Seltsam, dass man annimmt, man selber sei immer vorhanden gewesen, nur die anderen hätten zeitweise gefehlt.
18.4. Lieber P., eben habe ich ziemlich viel Staub aufgewirbelt, indem ich eine Wespe aus meinem Zimmer vertrieb, die mich daran hindern wollte, Dir zu schreiben. Ich verstehe ja, dass Du Berlin durch eine neue Brille siehst. Aber ich verstehe nicht, dass Du der Stadt die Schuld für Deine Brille in die Schuhe schiebst. Berlin hat sich nämlich nicht verändert. Nur hat es uns und haben wir es nicht mehr nötig. Diese Erfahrung habe ich ja auch machen müssen. Berlin ist jetzt eben eine Stadt wie (nicht ganz) jede andere …
25.4. Ich bin plötzlich schon in ein Alter gekommen, in dem ich meine, ich müsse bestellte Grüsse auch ausrichten.
20.5. Hat meine Egozentrik ihre stärksten Zeiten hinter sich?
27.5. Mythen sind nach rückwärts gewendete Utopien.
8.6. Wie konnte ich vergessen, dass ich immerhin im Tanz meine Hände um M.s seidenumspielte Hüften legte, dass sie umgekehrt etliche Sekunden lang ihren Kopf an meinen drückte – um dann leider zu erwachen und sich verwirrt zurückzuziehen.
19.6. Heute gegen Morgen wieder von M. geträumt. Immer diese helle, selbstverständliche Erscheinung. Wie Seide zu nehmen.
Wir sind von Gott. Aber Gott ist vom Teufel. Und der ist von uns.
25.7. Ob meine krankhafte Ehrlichkeit auf einen Mangel oder auf einen Überschuss an Phantasie zurückgeht?
13.8. Diese Sehnsucht nach Musik, sie befriedigt sich nicht zwischen weiblichen Schenkeln.
Cervia, 16.9. Ich sei manchmal von einer geradezu gemeingefährlichen Höflichkeit, sagte P.F.
Locarno, 23.9. In der Nacht vom 11. auf den 12., in Venedig! C.
Lieber P., … Auch als wir uns liebten, liebte sie durch mich hindurch Vergangenes, Fernes. Ihr verschollener Freund spielte mit. Ich wusste es und leckte doch ihre Tränen fort …
Winterthur, 7.10. Weil ich meine Zukunft immer offen halte, habe ich keine.
5.11. Die einzig gültige Philosophie ist der Relativismus: weil er sich selber aufhebt.
7.11. An K.M.s Hochzeit, mit ihr, der Braut, dem ersten Mädchen meines Lebens (sie hat mich als Kind im Wagen spazieren geführt) getanzt. Etwas wie Liebe, Liebe zu diesem Weissen, Hoffnungsvollen, Blühenden, Traurigen, das die Enttäuschung schon ahnt und doch tanzt. Beim Abschied sagt sie zu mir: Als du klein warst, wolltest du mich immer heiraten: daraus wird jetzt auch nichts mehr.
11.11. Was geschieht eigentlich mit den Menschen, die in meinen Träumen vorkommen, und zwar gerade dann, wenn sie in ihnen vorkommen?
21.11. Liebe C., … Ich glaubte, das sei klar, ich habe es wiederholt deutlich zu machen versucht, dass es sinnlos ist, wo zwei Welten unvereinbar aufeinanderprallen, nach Schuld zu suchen. Wenn Du einen Fehler gemacht hast, dann höchstens in der Nacht in Venedig, in der Du mich missbrauchtest, indem Du mich nicht als den nahmst, der ich bin, sondern als greifbaren Ersatz für das Dir damals ungreifbar Ferne. Deine Tränen haben Dich verraten …
8.12. Wenn ein geliebtes Wesen plötzlich fernbleibt, möchte man immer zuerst glauben, es sei tot, denn Trauer fällt leichter als Liebe.
28.12. Es zeugt von einem falschen Menschenbild, zu sagen: Wenn ich gewollt hätte … Es gehört untrennbar zu meiner Person, dass ich nichts wollen kann, ausser was ich auch wirklich tue. Dieses innere Beharren auf Einsamkeit.
29.12. Das Nichts ist nur denkbar als eigene Abwesenheit. Raum war immer. Zeit gibt es nicht.
1972
Winterthur, 6.2. Lieber U., wie Du oben siehst, verbringe ich die Olympia-Woche vor dem elterlichen Fernseher. Zuerst eine Meldung von unseren Frauen. Nicht von Marie-Theres Nadig, sondern von den Frauen in Zürich: Die Emanzipation ist ausgebrochen! – Bin ich da am Freitag an einem Universitäts-Fest, Jubel, Trubel, Tubel und so, schaue mir die Sache überlegen lächelnd aus gewohnter Distanz an und nehme plötzlich in meinem rechten Ohr, durch die Haare hindurch, ein süsses Flöten wahr. Wie ich mit dem Zeigefinger zum Ohr fahre, um etwas sauberzumachen, merke ich, dass da ein Mädchen dran hängt, das genau weiss, was es will und die ganze Nacht nicht mehr von meiner Seite weichen und mir nicht nur in den Ohren liegen wird. – Überhaupt stehen die Zeichen gut, wir haben allen Grund zum Lachen. Mehr noch: Am Dienstag mischt sich ein rührendes Geschöpf, das noch kaputt zu machen wäre, mit seinem Lächeln in mein Gespräch, am Donnerstag kommt ein blondes Blauäugiges nicht mehr von meinem Anblick los und wird rot, wie ich es frage, was es habe. Aber am Mittwoch gar, an einem Meditations-Abend, rührt mich durch seine blosse Erscheinung ein Wesen an, das stumm bleibt und absolut nicht davon abzubringen ist, dass wir uns in einem anderen Leben schon begegnet seien …
Wahrlich, die Sterne meinen es gut, alles drängt sich um mich, höchste Zeit, dass ich mir wieder einmal ein paar Fallen stelle, damit ich nicht gefangen werde.
Soviel dazu. Den Traum, der an dieser Stelle hätte stehen sollen, werde ich Dir nächstes Mal erzählen.
26.2. Ganz früher, wie ich mich erinnere, als ich zu schreiben begann, waren es Abschiede, vor denen ich mich fürchtete, damals gab es im Dasein offenbar einen Sinn. Heute jagen mir Wiederkehren den grössten Schrecken ein, während ich den Abschieden als längst Abgeschiedener aus weiter Ferne zuschaue.
21.3. Deshalb kann ich so absolute Briefe schreiben, so absolut an andere Menschen herantreten. Weil ich nicht liebe und deshalb nichts verliere, wenn ich Menschen verliere. Weil es mir recht ist, wenn Fremdes fremd ist und Fernes wieder fern von mir geht. Ja, wenn ich einmal wieder nur geringfügig liebte, ich würde in mich zusammenbrechen wie in ein schwarzes Loch …
18.5. Meine Schreibweise ist der Fressweise einer jener Kröten zu vergleichen, die den ganzen Tag mit geschlossenen Glasaugen dumpf und unbewegt auf ihrer Stelle liegen, plötzlich aber, wenn etwas Fliegendes, zur Nahrungsaufnahme sich dem Grunde nähernd und so in ihr Gesichtsfeld kommend, auch erst mit den Beinchen die Erde berührt, gierig ihre Zunge ausschnellen und es sich einverleiben, dann, nach zweimaligem leerem Schlucken und Augeneinwärtsdrehen wieder zu Stein erstarren und warten.
1.6. Es ist schandbar verlockend, der Versuchung nachzugeben und glücklich zu sein.
30.6. Es ist klar, warum ich gerade E. zu lieben beginne. Weil ich weiss, dass sie gar nicht geliebt sein will und also mir nie zur Gefahr wird. Unmögliche Liebe.
Ein für die Liebe verlorenes Mädchen zu lieben, gleicht mir wirklich.
Die Frage ist nur, könnte auch sie mich gefahrlos lieben? Oder böte ich ihr eine Hand?
30.7. Erinnerung an einen klaren Bergbach, als ich noch ein Kind war, und das Gefühl, dass so etwas so nie zurückkehrt. Fast vielleicht auf nächtlichen Fahrten über den See, wenn der Morgenstern schon sichtbar wird.
5.8. Liebe ist paradox. Die Welt ist ihr zu klein, aber die Zeit ist ihr zu lang.
9.8. Lieber P., ich verstehe Deinen Brief, als ob ich ihn selber geschrieben hätte. Deine überraschende kopernikanische Glückswendung gefällt mir. Ich wäre also einer (oder gar der einzige), der es ist und der es aber, wie die andern, die es nicht sind, auch nicht weiss. Ich glaube, zu gewissen Zeiten, ich weiss es sogar. Ich bin, wie ich sein muss und will. Postulieren wir also ruhig einmal, ich sei glücklich, und versuchen wir den Galgen zu vergessen, unter dem jedes Glück wächst. Du hast recht, meine Einsamkeit ist kein eigentliches Unglück. Im Rahmen meiner Einsamkeit ist die Zweisamkeit ein Leiden, mindestens ein artfremdes Unding. (Deine Überlegungen werden mir, wie Du siehst, im Kern gerecht.) Mein Glück liegt, wenn es überhaupt liegt, in dieser unendlichen Trauer, zu der ich fähig bin, um die Liebe, zu der ich nicht fähig bin. (Und wer hat ein Recht, die Trauer geringer zu schätzen?) Und doch: wenn ich am Ende wie der Taugenichts sagen kann: „Und es war alles, alles gut“, dann werde ich es selber glauben, früher nicht.
10.8. Es lag in der Luft. Ich habe einen Sommer lang die Luft geatmet, in der es lag. Es war ein guter Sommer.
19.8. Der erhoffte Sommersturm ist zwar gekommen. Er war auch stark genug, aus den Tiefen alles nach oben zu kehren. Aber er war nicht stark genug, mich mitzureissen. So treibe ich nun, allein mit meiner Berührung, irgendwo hin. Es war ein stiller Sturm. Ein sanfter, grausamer Sturm.
11.9. Zwei Menschen sollen nicht zu einem Wesen verschmelzen. Es genügt, sich bei der Hand zu halten und zu wissen, dass man zusammengehört, wenn jeder seinen Weg geht.
23.9. Selbstschutz vor dem Leben, um zu schreiben – Sehnsucht nach dem Leben, ebenfalls um schreiben zu können: zwei Seiten des Paradoxons Kafka.
10.10. Wie um das Schlankbleiben zu kämpfen mitten im Überfluss, ist es heute auch unabdinglich, arm zu bleiben, wenn man dem Leben nicht zum Opfer fallen will.
Zürich, 29.11. Liebe D., wenn ich mir selbst beim rauschhaften Niederschreiben des letzten Briefes über alles „im klaren“ gewesen wäre, dann hätte ich ihn ja wohl gar nicht geschrieben. Eigentlich ist es ja doch verrückt, aus nichts als einer Erinnerung, einem – zu dem noch ungehörigen – Traum und etwas zu viel Alkohol eine Beziehung aufbauen zu wollen. Aber gerade das Verrückte daran reizt mich so unwiderstehlich. Und vor allem der Gedanke an eine Vergangenheit, die noch nicht stattgefunden hat und die deshalb eines Tages Anlass zur Reue geben könnte, wenn man nur noch von Vergangenem leben und sich aus allem Versäumten mühsam ein Leben zurecht flicken wird.
Konkrete Vorstellungen habe ich allerdings nicht, es ist ja – nicht nur so zu sagen – im Traum über mich gekommen. Im Allgemeinen bringen mich Träume zwar ums Leben, warum sollte aber nicht einer einmal ins Leben führen. Vielleicht zum letzten Mal. Jedenfalls kommen mir jetzt schon die Tränen der Rührung bei der Vorstellung, mit Dir ekstatisch den Lebensabend meiner Jugend etwas zu verlängern. Bald stülpen sie mir ja den Doktorhut über den Kopf, und von da bis zu dem berühmten Brett vor demselben ist es nicht mehr weit.
1973
13.1. Der Mut, den es braucht, einen ersten Satz zu setzen, auf ihn einen zweiten, dritten und schliesslich darauf eine Welt zu errichten.
21.3. Es haben alle Dinge ihren Platz zueinander. Zwischen E. und mir wird sich immer Ferne und Nähe gerade die Waage halten. Da wir nicht nach dem Gesetz der Schwerkraft zusammenfallen, ist unser Verhältnis auch nur insofern vergänglich, als wir selbst vergänglich sind. Wenn einer von uns einschläft ...
24.3. Plötzliche Anwandlung von Glück und Lebensmut spät in der Nacht eben beim Anschauen im Spiegel. Jungenhaftes Lachen übers ganze Gesicht. Schon wieder vorüber.
17.4. Einmal ging es in der Kunst um die objektive Welt, später um das subjektive Erlebnis dieser Welt durch den Künstler. Jetzt geht es um diesen Künstler selbst. Kunst wird zur sich selbst reflektierenden Lebensform. Denn der Künstler ist, wie in keiner Zeit zuvor, der Prototyp der zeitgenössischen Menschen, des Isolierten, Einsamen, auf sich selbst Zurückgeworfenen: eben des Individuums. Er war es schon immer. Heute ist es auch der „normale“ Mensch. Daher die einmalige Bedeutung des heutigen Künstlers: als Vorbild. Als willentlich und wissentlich Vollstreckender einer Lebensform, die die andern noch erleiden.
26.4. Das Schöne ist meine einzige Gottheit. Dass sie sterblich ist, stachelt mich auf zur Unsterblichkeit.
27.4. Leben ist ein einziger gesteigerter Abschied.
30.4. Sinn und Leben schliessen sich aus. Wer also leben will, muss auf den Sinn verzichten. Wer aber sinnvoll sein will, darf nicht leben.
22.5. E. sieht das Alleinsein, nicht gefühlsmässig und gedanklich, aber existenziell, noch immer – im Gegensatz zu mir – vorwiegend negativ, d.h. sie erleidet es. Muss es denn ein Verlies sein? Spürst du nicht den Wind, der in deine Kleider weht, in dein Haar greift? Den Raum um dich? Die Freiheit?
Winterthur, 2.6. Liebe E., ich spüre Trauer in Sehnsucht umschlagen, das Leben damit wieder eintreten in den Kreislauf, aus dem ich seit letztem Sommer für immer ausgetreten zu sein glaubte. Seine Versuchung wächst. Aber auch seine Gefahr, von der ich bisher geschrieben habe. Wirklich: ich sehe dem ängstlich entgegen, was seit Deinem letzten Brief nicht mehr nur in der Luft zwischen uns hängt, von dem ich nicht weiss, ob es mein Leben sein kann. Dass aber Du von ihm träumst, hätte ich nie zu träumen gewagt. – Dennoch: ich beuge schliesslich meine Stirn vor deinem rückhaltlosen Vertrauen und ergreife zögernd die ins Ungewisse entgegengehaltene Hand. Zögernd, weil ich noch immer nicht weiss, ob unsere Freundschaft von der Art ist, die gelebt werden kann, und ob sie, falls sie es nicht ist, dann je wieder das sein wird, was sie jetzt ist, wenn sie einmal missbraucht war. – Zusammenfliessen? Ich weiss nicht, ob ich das kann, ohne mich selbst zu verlieren. Und Selbstverlust? Ich weiss nicht, ob ich das will.
12.6. Die Schöpfung der Welt ist die Todsünde Gottes. Dass es Gott nicht gibt, macht die Welt nicht besser, aber es befreit sie von der Sünde, deren Name „Gut und Böse“ ist.
14.6. Grosse Verlorenheit heute nach dem mühsamen Versuch, mich bei den Behörden abzumelden. Wie werde ich mich trennen können von allem was ist und war? Was soll nun kommen? Gehört nicht jede Klinke in der eigenen Hand zu einer Türe, die, wenn man sie hinter sich schliesst, sich vor dem Leben schliesst?
Mit jedem neuen Tagebuch legt man im alten mehr gezählte Tage zu den Akten. Aber das ewige Buchzeichen tröstet, und schliesslich sind es nur die gezählten Tage, die zählen.
Winterthur, 14.6. Liebe E., mit jedem Brief, den wir uns schrei-ben, wird ein Wiedersehen schwerer, das wird mir immer klarer. Die Plätze, die wir uns zugedacht haben, werden, wie Du gesagt hast, besetzt sein von den Papieren, die wir gewechselt haben, von Worten, die über Lippen kamen, welche sich vielleicht nur gefunden hätten, wenn sie stumm geblieben wären. – Lass uns, wenn ich Dich um etwas bitten darf, dennoch nicht aufhören, uns Briefe zu schreiben. Vielleicht sind sie das einzige, was wir von uns haben werden. Und zudem: ich brauche sie. Gerade auch jetzt, in einer Phase persönlicher Schwäche. Wieder einmal bin ich soweit, an meinem Mut zur Einsamkeit zu zweifeln, umzufallen, die Fassung zu verlieren und mich ganz und gar dem Gefühl des Verlorenseins zu überlassen. Und das nur, weil ich heute meine Abmeldung von der Schweiz in die Wege geleitet habe. Was soll denn nun werden? Ich ertrage Abschiede sehr schlecht, weil sie mit jener Zeit zu tun haben, gegen die ich kämpfe: die sich erbarmungslos von Mal zu Mal hinter uns legt. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass sie, kosmisch betrachtet, nichts anderes ist als umgestülpter Raum. Du, die Du nach eigenem Bericht das Zeitgefühl verloren hast, wirst das verstehen.
Indem ich diesen Brief beende und auf Deinen hoffe, habe ich mich auch schon wieder gefangen. Wie dicht unter durchsichtiger Haut doch unsere Wunden liegen und wie schnell das Gras wächst!
15.6. P. kommt nach Spanien, ist schon da. Werde ich hingehen? – Jedenfalls will ich auch J. in die Camargue noch schreiben und S. nach Stockholm wegen ihres Hauses in Canobbio. Und A. nach Finnland? Oder mache ich mich auf, das Schloss am See zu finden, das ich mit E. bewohnen werde? Und M.? Und Frl. W.? Und meine neue dunkle Liebe? Und, und, und ... Die Additionen von Möglichkeiten heben sich bei mir auf zur einen Unmöglichkeit, die ich bin, zum ewigen Unentschluss! – War ich eigentlich immer so, oder haben mich meine Erfahrungen dazu gebracht? Wahrscheinlich habe ich die mir entsprechenden Erfahrungen gemacht, weil ich schon immer so war.
Winterthur, 12.7. Liebe Freundin, ein kurzer Rausch, dann war es wie Sterben. (...) Ein kleiner unschuldiger Mann hat vor erlauchten Zeugen das Urteil gesprochen: ... und spreche hiermit Ihre Promotion aus! Als ob man vorwärts bewegt werden wollte, als ob man nicht ständig versuchte, Wurzeln zu schlagen in der Tiefe der Erde, die man gerade noch mühsam unter den Füssen zusammenscharren kann! Ich bin fertig. Stell Dir das vor: fertig sein. ...
Winterthur, 27.7. Liebe E., Deine Stimme am Telefon klang – unmerklich – anders als in den Briefen. Meine wohl auch. Und siehst Du, schon dies ängstigt mich. Die Fremdheit nimmt zu, wenn man sich hört, ohne sich dabei zu sehen. Das Telefon ist ein gefährliches Instrument des Todes.
Dass wir alle fortgehen, wie Du es nennst, macht mich nicht nur todtraurig, sondern im höchsten Grade zornig, und ich bilde mir ein, dass es ein heiliger Zorn sei, der mich sonst friedvolle Kreatur in diesem Punkt ankommt. Jedenfalls wird man mich, solange ich lebe, nicht mit tausend Pferden aus diesem Leben schaffen. Ich werde die Klinke, an der ich, von aussen, hänge, nicht loslassen und im Gegenteil meine ganze Kraft daran setzen, dass, wenn ich schon gehen muss, das ganze Weltgebäude, dessen Türe ich festhalte, mit mir ins Nichts zusammenstürzt. Man kann sagen, ich sei ein schlechter Verlierer. Ich halte dem entgegen, dass man mich zur Teilnahme an einem Spiel gezwungen hat, dessen Regeln ich nicht anerkenne und dessen Sinn ich leugne. Und meine trotzige, eigensinnige Natur verbietet mir, aufzugeben. Im Grunde aber, abgesehen von diesem ewigen Zorn, freue ich mich, dass Du an uns glaubst.
27.7. Um das sinnlose Weltgebäude, in dem ich mir selber keinen Sinn zu geben vermag, mit mir einzureissen, schreibe ich.
2.8. Liebe E., ich schreibe Dir schon wieder, weil ich nachträglich fühle, dass ich mich letztes Mal wohl etwas habe gehen lassen. Natürlich habe ich nicht wörtlich die Absicht, das Weltgebäude einzureissen. (Was mir vorschwebt, ist eher ein geschlossenes Weltbild mit Löchern.) Alles, was ich tue, ist schreiben und damit versuchen, den Tod ins Unrecht zu setzen, wenn er sich schon nicht besiegen lässt. (...) Als ich Deine Karte las, dachte ich einen Moment, vielleicht wäre das Gleichgewicht zu zweit wirklich leichter zu halten? Weisst Du, manchmal denke ich, Du bist wohl das einzige Mädchen, mit dem ich vielleicht leben könnte. Aber dann kommt mir wieder in den Sinn, dass es ja gerade deshalb unmöglich ist.
2.8. Sinn: die Überlegenheit eines schönen Irrtums über die schäbige Wahrheit.
29.8. Ich fühle meine Bestimmung: zu sagen, was ich weiss. Aber was ich weiss, sagt mir, dass meine Bestimmung sinnlos ist. So verzweifelt ist das.
7.9. Die Fledermaus, die nach etwas sucht, nicht um ihm zu begegnen, sondern um ihm auszuweichen, müsste mein Wappentier sein.
19.9. Traum: Meine Mutter ist an Cholera erkrankt. Eingefallene Augen. Ich habe Angst vor Ansteckung, bleibe aber mit ihr. – Dann ist sie gestorben, wie ich höre. Ich will eine Rede auf sie schreiben, bin seltsam ruhig bei dem Ganzen, obwohl ich, nach einigen Korrekturen, schreibe, es werde natürlich schwer sein, für mich, die Mutter habe eine grosse Lücke hinterlassen. – Frauen aus meinem früheren Leben starren mich fremd an, als ob sie mich nicht mehr kennten.
3.10. Kernstück meines Selbstmuseums ist mein Tagebuch, in das ich mit der Feder Tag für Tag die Spuren meines Lebens grabe, die Spuren meines einzigen Bemühens, wenigstens eine Spur zu hinterlassen.
Wenn Sie das Kernstück meines Museums sehen, werden Sie schon verstehen, zu welchem Zweck ich es aufbaue und führe.
Ich sammle Tage, auch diesen heutigen werde ich zu den andern legen. Noch bevor die Sonne über den nächsten aufgeht, wird dieser ein Stück Museum sein.
Gezählte Tage legen sich hinter mich und rappeln sich sehr zu meinen Ungunsten zusammen, ich weiss, aber schliesslich sind es nur die gezählten Tage, die zählen.
7.10. Ein Kind, das immer über denselben Baumstrunk strauchelt, steht auf und tritt mit den Füssen den Strunk: so bin ich.
Winterthur, 8.10. Liebe E., die Schallplatte*, die ich Dir schicke, ist nicht neu. Ich möchte, dass Du sie für mich verwahrst, bis ich wiederkomme. Höre vor allem das Lied vom Abschied und denke dabei daran, dass ich es schmerzlich liebe. Wenn es Dich erreicht, werde ich nicht mehr in der Schweiz sein. Ich konnte Dich nicht wiedersehen, nur um Abschied zu nehmen. Wir haben offenbar die Kraft der Sterne nicht, uns – ohne zusammenzukommen – gegenseitig zu halten. Mir scheint, die Entfernung hat zu wachsen begonnen.
* (Gustav Mahler: Lied von der Erde)
10.10. In Berlin. Ich bewohne den Dachstock eines schloss-ähnlichen Herrschaftshauses, das in Auflösung begriffen ist. Zimmer nach Süden, auf den Grunewald. Eigener Park, Butler im Haus, alles. Aber keine Mutter, keine Freundin, keinen Freund. Nun muss sich zeigen, ob ich fähig bin, meine Vorstellung vom Leben wirklich zu leben. Alleinsein ohne zu vereinsamen.
12.10. Wenn sich jetzt ein Mädchen fände, das mich lieben könnte, dann wäre mein Leben hier vielleicht wirklich lebbar.
Aber was mich liebt, habe ich alles zurückgelassen. Und diese Stadt ist so gross, dass die Hoffnung klein wird.
Berlin, 15.10. Liebe E., auch ich bin traurig, glaube mir. Ich fühle mich verloren. Das unwürdige Anbiedern mit dem Neuen, mit dem Durchschnitt, nur um – vielleicht – wieder Wertvolles zu finden. Mit dem rechten Auge bin ich nur allein, wie ich es immer war, auch zu Hause. Aber mit dem linken bin ich schon einsam. Aus ihm weine ich ununterbrochen – während ich mich verbissen an das klammere, was sie Zukunft nennen – um das Vergangene, das Zurückgelassene, Geliebte.
Nach schönen Menschen, dieses Sehnen. Gemeinsam zu Hause sein, in der Fremde. Das ist alles, was man wollen kann.
Ich bin fortgegangen mit der alten Absicht, den Tod zu entrechten. Wenn mir das gelungen sein wird, kehre ich zurück, um zu leben. Vielleicht mit Dir? –
Hier lebe ich im Dachstock eines alten Herrschaftshauses, in Zimmern, die nach Süden gehen, nahe dem Wald in einem schönen Park. Es könnte fast die Mitte sein, die ich meine. Aber es ist die Mitte von nichts. Niemand kommt zu mir mit einem Leben, das er teilen will, mitteilen will? –
Bleibe Du immer meine Freundin!
Berlin, 16.10. Liebe G., (...) Eigentlich ist alles gut. Das Haus kennst Du ja, es ist wie auf mich zugeschnitten, die Umgebung ist schön, ich lerne auch schneller Menschen kennen, als ich es je zuvor getan habe, auch solche, die vielleicht wertvoll sind. Dennoch, es ist schrecklich, ohne den Boden zu sein, auf dem man gewachsen ist, ohne das Klima, in dem man geblüht hat, ohne Euch, z.B.
16.10. J.B. der Bettler. Er verbringt sein Leben damit, betteln zu gehen, damit er leben kann. Aber er kann ja eben nicht leben, weil er statt dessen betteln muss, um zu leben.
So werden wir alle betrogen. Ein Leben lang um ein Leben.
26.10. Verwirrender Traum heute nacht: E. steht mir plötzlich im langen Gewand dicht gegenüber, schaut mir in die Augen und sagt, also jetzt will ich endlich wissen, woran ich mit dir bin. – Ich schaue sie an, schliesse sie in die Arme und küsse sie heftig. Sie entgegnet alles und sagt am Ende, genau das hat mir immer gefehlt. – Kurz vor meiner Abreise. –
Ob das wohl so ist?
Berlin, 26.10. (2. Brief) Liebe E., da hast Du recht, trennend ist es nicht, trennend kann es nicht sein. Trennend ist für Getrennte nur zu grosse Nähe.
Über Berlin kann ich nicht viel sagen. Mein Berlin: Ich lebe hier in der totalen sozialen Bezugslosigkeit nur auf mich selbst bezogen. Wenn alles gut ist, schreibe ich viel, im Augenblick an Theaterstücken. Wenn es mir schlecht geht, gehe ich wie irrsinnig in meiner Dachkammer auf und ab, trete ans Fenster und starre in den grauen Himmel, in die kahl werdenden Bäume, oder auf das feuchtfaulende Laub im Gras des Gartens. Manchmal denke ich an Hölderlin. Dann treibt es mich wieder plötzlich in die Stadt, auf die kalten Strassen, unter die Menschen. Ich versitze stundenlang mein Leben in Lokalen, spreche mit Leuten, die mich nichts angehen, nur damit das Schweigen um mich nicht zu gross wird, suche nach dem Schönen. Wenn ich es finde, verliert es sich in der Grösse der Stadt. Manchmal, vor lauter Angst, berühre ich flüchtig ein Stück Haut. Dann kehre ich unglücklich zurück zu mir und staune im Grunde darüber, dass – bei all dem, was ich über das Unrecht des Lebens weiss – meine Mundwinkel noch immer nach oben ziehen, das Feuer in meinen Augen noch flackert.
Im Grunde ist alles wie anderswo, nur war ich noch nie so allein. Es ist schwer, ganz ohne Freunde allein zu sein. Und wenn ich jetzt auch über den Umweg eines Berufes keine Bindung an diese Stadt bekomme (ich habe mich an zwei Bühnen als Regie- oder Dramaturgieassistent beworben), dann schreibe ich hier noch so lange weiter, als das Geld reicht, und dann kehre ich wohl zurück. Um wenigstens die Zeit genutzt zu haben, will ich jetzt Ballettstunden nehmen, um den erschlaffenden Geist an einem straffen Körper noch etwas stützen und um dem feindlichen Leben mit mehr menschlicher Würde entgegentreten zu können. Es ist mir ernster, als es tönt. (...)
29.10. Ich lese in Canettis neuem Buch. Endlich ein Verwandter gegen den Tod!
Berlin, 2.11. Lieber H., draussen wird es Abend. Tiefblauer Sternenhimmel, kahle Bäume, Sichelmond, vor meinem Fenster sieht es aus wie auf einem Bild von Rousseau. Wenn man allein ist, tauchen fremde Bilder auf oder ferne eigene. Die Sehnsucht nach Schönheit, nach schönen Menschen wird übermächtig an solchen Abenden, aber die Müdigkeit, die zu ihnen gehört, untergräbt langsam den Willen, um sie zu kämpfen und gegen den Tod.
Berlin könnte der ideale Boden sein für einen jungen Schriftsteller, der sich durchsetzen will. Wenn er nach aussen lebte. Da ich nach innen lebe, brauche ich doppelt Kraft, einmal für dieses innere Leben, dann auch gegen das äussere, um es, das ständig lockende, fernzuhalten. (...) Ja, ich bin etwas heimatlos geworden. Vielleicht war es falsch, dass ich als Krebsnatur den Boden hinter mir liess, aus dem ich stamme. Es kann auch sein, dass ich nur zu ungeduldig bin, dass ich die Zeit erwarten muss, in der ich in der Fremde neue Wurzeln schlage. Das sage ich mir und gehe vorwärts. Aber der Kopf ist rückwärts gerichtet, der Blick ruht auf Euch allen, mit denen ich gelebt habe. Es gibt so wenig wertvolle Menschen auf der Welt, dass man sich nicht aus den Augen verlieren darf, wenn man sich einmal gefunden hat. Schön wäre es, wenn Du mich besuchen würdest.
3.11. Das alte Buch ist voll mit Abschied. Jetzt soll es genug sein. Dieses neue soll keine Klagen mehr darüber hören.
Nur die Illusion der Freiheit kann den Gedanken an einen Fehler oder an das Abirren vom rechten Weg hervorbringen (auch an Schuld). In Wahrheit kann man nicht einmal scheitern, nicht einmal neben sein Seil treten. Nicht einmal die Hoffnung eines Fehltritts bleibt. Nein, nein, man wird hinüberkommen, ans andere Ende.
Berlin, 5.11. Lieber U., Freude hat man mit der Waschmaschine. Hätt ich ja nie geglaubt, wie viel Spass man damit hat! Hörte ich heute eine Frau zur anderen sagen. Und Du sprichst von Sinnlosigkeit! Natürlich hast Du recht. Nur hat die Frage nach dem Sinn weniger mit Gott zu tun als mit dem Tod. Da fängt doch der ganze Irrsinn an. Oder vielmehr hört er auf. Um auch mal kurz ein biblisches Gleichnis zu verwenden: Im Paradies standen zwei Bäume. Der Baum der Erkenntnis und der Baum des (ewigen) Lebens. Zwei Chancen hatte die Kreatur angesichts dieser Bäume. Einmal, die Finger von beiden zu lassen und unbewusst und sterblich zu bleiben. Das tat (vielleicht) das Tier. Oder aber, von beiden zu essen und bewusst und unsterblich zu werden. Das wollten wir. Aber auf halbem Weg hat uns der Mut verlassen. Und da sitzen wir nun ganz bös in der Tinte – denn Lebensbäume gibts inzwischen nicht mehr – mit dem Bewusstsein des Todes und der Sehnsucht nach Unsterblichkeit. – Aber dies ist nur ein Bild und verschleiert im Grunde die Wahrheit, indem es dem Menschen die Schuld für seine hoffnungslose Situation selbst in die Schuhe schiebt. In Wahrheit sind wir unschuldig. Schuld an der menschlichen Misere ist der Kosmos, der aus sich in jahrmillionenlanger Kleinarbeit den Menschen hervorgebracht hat, das herrliche Geschöpf mit dem unbedingten Bedürfnis nach dem eigenen Sinn, ohne ihm diesen Sinn mitzugeben, nicht auf den Menschen zielend, sondern über ihn hinaus und durch ihn hindurch wieder nur auf sich selbst, das kosmische Ganze. Und das ertragen wir so schlecht, dass das Ganze, dem wir dienen, einen Sinn hat, an dem wir als Einzelne nicht teilhaben (dass es weiterläuft, während wir sterben). – Was mich trotz alledem am Leben hält, ist eben Trotz, ist das Wissen um meine Unschuld und um die Schuld des Ganzen an mir, dem Einzelnen, das Wissen um das grundsätzliche Unrecht eines Lebens, das zum Tode geht. Dagegen wehre ich mich mit Händen und Gedanken (daher kommt übrigens auch mein Mitleid mit alternden Menschen, vor allem mit den Eltern), nicht etwa in der Hoffnung, doch noch einen Sinn zu finden, nur um ganz klipp und klar zu machen, dass ich gegen meinen Willen dem Kosmos diene, indem ich untergehe. Das nenne ich „Eigensinn“ (mein nächster Roman heisst so), das Beharren des Einzelnen auf seinem eigenen Sinn, den er sich nur noch, negativ, geben kann, indem er sich dem Leben verweigert, das er als sinnlos erkennt. Verweigerung kann nicht Selbstmord heissen. Im Gegenteil, Selbstmord wäre gerade das sichtbare Einverständnis des Selbst mit dem Mord, den das Leben an ihm verübt. Verweigerung heisst: nicht sterben, überleben, wenigstens eine Spur hinterlassen, zeigen, dass es Menschen gab, die schon sinnvoll gewesen wären, wenn ihnen der Kosmos nur Raum dafür gewährt hätte. (Aber das ist es ja, er hat keinen Raum für uns, er braucht unsere Atome wieder, um weiterzulaufen.) – Aber das brauche ich Dir ja nicht zu erzählen. Deswegen sind wir ja Künstler, weil wir Spuren hinterlassen wollen, deswegen lassen wir uns nicht am Boden schon zerstören, wie Du schreibst. Wir stürzen am Ende aus der Höhe ab, damit es alle sehen können, was es heisst, zu sterben, und was es hätte heissen können: leben. Unser aller Ziel ist ja im Letzten: den Tod entrechten, da wir ihn nicht entmachten können.
Sei nicht so zynisch mit den Mädchen, sie können auch nichts dafür, und machs gut.
6.11. Da sich nun im Experiment erwiesen hat, dass z.B. Fliegen, irdisch gemessen, länger leben, wenn man ihren Schlaf-Wach-Rhythmus verlangsamt, warum sollte man annehmen, diese Möglichkeit gebe es für den Menschen nicht. Wir müssen uns, um den Tod zu bekämpfen, gegen die Kreisläufe oder Rhythmen des Lebens stemmen, den Wechsel von Trauer und Sehnsucht verlangsamen, Sehnsucht sich nicht erfüllen lassen, auf der Trauer beharren. Vielleicht haben wir nur eine bestimmte Anzahl von Abschieden zugute, dann bricht uns das Herz. Darum müssen wir sparsam mit ihnen umgehen, langsam leben, wenn wir länger leben wollen.
Berlin, 9.11. Liebe E., vieles steht zwischen uns, wenn wir es Angst nennen, ist das nur der allgemeine Name für Dinge, die sich vermutlich genauer fassen liessen, wenn wir nur wenigstens davor keine Angst hätten, sie auszusprechen.
Da ist einmal meine Angst vor Frauen überhaupt, die es mir z.B. manchmal fast unmöglich macht, ein Auge zuzutun, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Ich weiss nicht, wie sie – vermutlich schon in den Armen der Mutter – entstand, jedenfalls ist sie in meinem Geburtshoroskop als Opposition von Sonne und Mond deutlich genug abgebildet. Das erklärt sie nicht, erweist sie aber als schicksalshaft, Schicksal bildend.
Dann natürlich die Angst vor dem Tod (mit der die Angst vor den Frauen zusammenhängt), der Hass gegen ihn, meine absolute Weigerung, ihm einen Sinn zu geben. Daneben Deine Todessehnsucht, die ich nicht verstehen will, nicht verstehen darf. Ich kenne sie aus meinem eigenen Leben, aber ich halte sie inzwischen für falsch. Wahrscheinlich weil ich den Glauben preisgegeben habe, willentlich, verstehst Du? Weil er meine fundamentale Lebenskraft, die Todesangst, verbagatellisieren wollte.
Dein Glaube, ohne den Du Deine Sehnsucht nicht hättest, das Mit-dem-Tod-Leben ängstigt mich am meisten. Es entzieht mir die Kraft. Menschen mit einem Glauben, wie Du ihn hast, schreibt Canetti, bislang der einzige Verbündete, den ich gefunden habe, „lähmen so die Kraft derer, die sich gegen den Tod zur Wehr setzen könnten. Sie verhindern den einzigen Kampf, der es wert wäre, gekämpft zu werden. Sie erklären zur Weisheit, was Kapitulation ist.“
Dein Glaube wiederum nährt sich aus einer Liebe, die ich – nicht mehr – habe. Daher Deine Sehnsucht, die im Grunde gar nicht eine nach dem Tod ist, sondern eine über ihn hinaus. Da liegt die Gefahr. Nachsterben. Wie gut ich das verstehe. Und wie sehr ich nicht mehr daran glaube. […]
Du hast geliebt, glaubst, geliebt zu haben. Dies vor allem, glaube ich, lässt uns nicht zusammenkommen: Die Angst dessen, der Trauer und Sehnsucht für die wahren Kräfte des Lebens hält, vor derjenigen, die an Liebe glaubt und auf Erfüllung hofft, vor oder nach dem Tod. (...)
E., nicht der Tod selber ist es, der zwischen uns steht, sondern – von meiner Seite gesehen – meine Angst vor dem Tod und damit vor dem Leben, weil es zu ihm führt. Aber lieb habe ich Dich auch wenn ich Angst vor Dir habe.