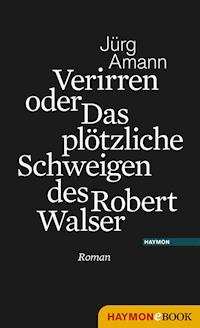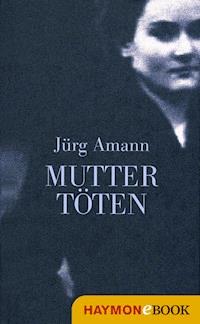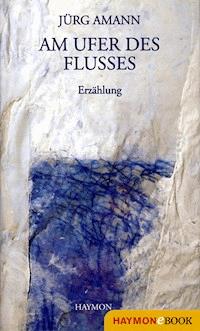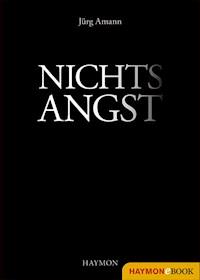Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wir haben ein Schicksal", schrieb Hölderlin an seinen Freund Böhlendorff, einen seiner Leidensgenossen im Scheitern an den eigenen hohen Idealen. Das gilt auch für die Vertreter zweier Generationen, fast zweihundert Jahre voneinander getrennt, die Jürg Amann in seinem Roman zusammenführt: Sie haben ein Schicksal. Unter dem Schlachtruf "Reich Gottes!" schließen die Studenten Hölderlin, Schelling und Hegel einen Freundschaftsbund im Zeichen des Idealismus, unter dem sie die Welt verändern wollen. Jahre später blicken die drei voller Resignation auf ihre großen Ideen zurück, die sich zwischen Erfolg und Scheitern im Beruf, zwischen Karriere und Alltagsnotwendigkeiten verloren haben. Knapp zweihundert Jahre später ziehen drei Studenten aus ihrer Provinzstadt in das Berlin des Jahres 1969. "Paradise now!" ist ihre Devise, doch finden sie von der 68er-Bewegung nur die kläglichen Überreste vor. Jürg Amann erzählt in Wohin denn wir von Aufbruchsstimmung und Entmutigung, von einer Hoffnung, die 1793 die gleiche war wie im Jahr 1968 - und ihrer Enttäuschung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Jürg Amann
Wohin denn wir
Roman
Zitat
Wir bringen aber die Zeiten untereinander
Friedrich Hölderlin
Widmung
Meinen Studienfreunden M. K. und P. S.
und unserem Mentor E. S.
I
Reich Gottes!, hatten sie sich selbst und einander versprochen, als sie im September 1793 auseinandergingen, auseinandergehen mussten, es blieb ihnen nichts anderes übrig. Ihre Zeit war abgelaufen, nach drei Jahren gemeinsamer Studien, drei Jahren geteilten Lebens, geteilten Leidens. Fritz, Fritz und Fritz. Oder Friedrich, Friedrich und Friedrich. Selbst den Namen hatten sie ja geteilt, zumindest den Rufnamen. Und damit gelegentlich auch für Verwirrung gesorgt. Johann Christian Friedrich, Georg Wilhelm Friedrich, Friedrich Wilhelm Joseph. Auf demselben Zimmer hatten sie gewohnt, wie es der Zufall wollte. Oder das Schicksal, oder Gott, je nachdem, wie man es anschaute. In derselben Stube, wie man hier sagte. An derselben Schule waren sie gewesen, Hochschule selbstredend, im Tübinger Stift. Da waren sie zusammengekommen, vor noch gar nicht so langer Zeit, es kam ihnen vor wie gestern, die Jahre waren ihnen im Winde verflogen. Aus Nürtingen, aus Stuttgart, aus Leonberg. Alles ganz in der Nähe. Nahe beisammen wohnen die Gipfel der Zeit. Es tat nichts mehr zur Sache. Alle drei waren sie Tübinger geworden, da hatten sie ihren Bund geschlossen. Der eine, der jüngste, Friedrich Wilhelm Joseph, war später dazugekommen, er musste noch etwas bleiben. Von da gingen die andern jetzt weiter, am Ende der gemeinsamen Zeit, jeder in seine Richtung. Jeder mit dem Versprechen im Kopf, oder im Herzen, oder wie man da sagt, im Rucksack, als Wegzehrung, auch der Zurückgebliebene: das Reich Gottes jetzt auf die Welt zu bringen; jeder auf seine Weise, sie hatten es sich geschworen. Geht hinaus, zu den Völkern, und lehrt sie, so war es ihnen an der Theologischen Fakultät gepredigt worden. Reich Gottes, was immer das sein mochte, jeder hatte seine Vorstellung davon. Sie hatten es ermangelt, seit ihnen das Paradies der Kindheit genommen war, mitsamt seinen Verheissungen, mit seinem Versprechen der Welt hinter der Welt. Jedem das seine, mit seinem je verschiedenen Weihnachts- und Osterschmuck. Nun sollte es endgültig zur Welt kommen, sie hatten es sich in die Hand versprochen.
2
Paradise now!, versprachen sie sich, und wurde ihnen versprochen, von den Plakatwänden, von den Litfasssäulen herab, als sie im September 1969 in Berlin wieder zusammenkamen, alle drei, in der Frontstadt der Weltgeschichte, am Gipfel der Zeit. 69, nicht 68; 68 hatten sie zu Hause, im Schwäbischen, da, wo sie herkamen, verschlafen. Hölderlin, Hegel und Schelling, wie sie sich jetzt nannten. Obwohl es auch dort, in der Provinz, Demonstrationen und sogar ein paar kleinere Strassenschlachten gegeben hatte. Auf der Tübinger Neckarbrücke zum Beispiel, oder vor der dortigen Universität. Sogar unter Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas von Seiten der Polizei. Die strukturelle Gewalt der Institutionen und die repressive Toleranz der herrschenden Gesellschaft waren mit ihrem Bürokratenlatein auch da ans Ende gekommen.
Von Paris her kommend, hatten die Unruhen nach und nach auch auf die deutschen Provinzen übergegriffen. Als Maiaufstand, als Globuskrawalle waren sie durch die deutschsprachige Presse gegangen; aber es hatte sich dabei noch nicht um ein Ergreifen des Globus als Ganzem, sondern nur um die Besetzung eines Warenhauses gleichen Namens in einer der Städte gehandelt, und dies ausgerechnet in der sonst so ruhigen Schweiz.
Auch andere Warenhäuser hatten gebrannt, andere Krawalle hatte es gegeben, mit Toten und Verletzten. Davon hatten sie gehört. Mitbestimmung der Studentenschaft an den Universitäten, Abschaffung der Studiengebühren, mehr Transparenz in den Studiengängen war überall gefordert worden. Davon wurde überall gesprochen. Aber da waren sie politisch noch nicht erwacht.
Als blutige Anfänger hatten sie sich im Phonetiklabor kennengelernt. Gleich in der ersten Stunde hatte ihnen der Professor eine ganze Reihe früher erster Tonträger vorgeführt. Mittels einer Art umgeschnallten Rüssels, einer Gasmaske aus dem ersten Weltkrieg nicht unähnlich, hatte er beispielsweise verschiedene Aspirationen, Mitlaute und Selbstlaute auf eine Russwalze gehaucht. Oder er hatte sie abwechselnd ihr Gaumensegel, von dem sie bis dahin gar nicht gewusst hatten, dass sie es hatten, im Wind ihres Atemstroms flattern und bei Windstille knacken lassen. Virtuos, obwohl er nicht mehr der Jüngste war und schon seine Emeritierung vor den alternden Augen hatte, hatte er es ihnen vorgemacht, mit gutem Beispiel war er seinen willigen Schülern vorausgesegelt.
Sie waren im Auditorium die drei gewesen, die über all das am lautesten gelacht hatten. Daran hatten sie sich gegenseitig erkannt. An der Art ihres Lachens. Das war ihr Erkennungszeichen gewesen. Ihr Ernst im Unernst. Das hatte sie für den Rest ihres Studiums, das doch gerade erst begonnen hatte, und für den Rest ihres Lebens, wie sie es sich dachten, zusammengeschweisst. So weit jedenfalls, als dieser Rest des Lebens für ihre jungen Augen schon absehbar war.
III
In Tübingen hatten sie nicht nur das Zimmer, sondern auch alles andere geteilt: die Ängste, die Trauer, die Freude, die Hoffnung. Die Hoffnung auf die Revolution beispielsweise, wie sie aus anderen, umliegenden Ländern wenigstens gerüchteweise herüber und bis an ihr Ohr drang. Noch im Sommer, am 14. Juli, zum vierten Jahrestag der französischen, waren sie um den Freiheitsbaum getanzt, den sie zusammen mit ihren Mitstudenten im Stiftshof aufgerichtet hatten.
Unsere jungen Leute sind vom Freiheitsschwindel angesteckt, so hatte es Ephorus Schnurrer, der Direktor des Stifts, nicht ohne Sympathie kommentiert. Und mit Schwindel hatte er durchaus keinen Schwindel im Sinne von Betrug, sondern Taumel und Rausch gemeint. Er hatte sich prompt dafür beim Landesfürsten Herzog Karl Eugen den entsprechenden Verweis eingeholt. Wegen der an der Theologischen Fakultät zu Tübingen obwaltenden demokratischen und anarchischen Gesinnung, wie der die Vorgänge kritisierte.
Bei ihnen, in Deutschland, hatte die Revolution ja nicht stattgefunden, und sollte sie auch nicht stattfinden. Da sei Gott vor! Und eben der Fürst und seine Bediensteten. Aber sie, die Studenten, die jungen Leute, hatten sie sich jetzt in den Kopf gesetzt oder ins Herz gepflanzt, und dort wucherte sie. Allerdings nicht als fleischfressende Pflanze, unblutig stellten sie sich ihre Revolution vor, wenn immer möglich, friedfertig, nicht wie in Frankreich, wo sie ja dem Vernehmen nach begonnen hatte, die eigenen Kinder zu fressen, nachdem vorher schon die Köpfe der Herrschaften gerollt waren. Das sollte ihre Sache nicht sein.
Trotzdem hatte der jüngste von ihnen, Friedrich Wilhelm Joseph, die Marseillaise für alle Fälle schon mal ins Deutsche übersetzt. Und in den Ferien, in der Vakanz, wie das im Stift hiess, waren sie, in die Farben der Trikolore, der französischen Fahne, gekleidet, das Land der Griechen mit der Seele suchend, wie sie es bei Goethe gelesen hatten, also die Wiege der Demokratie, um sie aus der Nähe zu sehen, immerhin schon bis in die Schweiz gekommen. Das war nicht weit, es war ein Sprung über die Grenze. Da war sie ihrer Meinung nach schon ein wenig verwirklicht, da wollten sie sie fürs erste ein wenig studieren.
4
Und nun waren sie also nach Berlin aufgebrochen, um dort an der Freien Universität ihr Auswärts- oder Kultursemester zu absolvieren. Das war aber gar nicht so einfach; die Zeiten waren gerade nicht danach. Anderes war jetzt mehr an der Zeit.
Die Amis mussten zum Beispiel raus aus Vietnam. Die Altnazis endlich aus den Institutionen und Ämtern. Die Interkontinentalraketen raus aus Europa. Die Opposition raus aus den europäischen Parlamenten. Für all das war es die höchste Zeit.
Stattdessen musste eine ausserparlamentarische Opposition aufgebaut werden. Die falschen Autoritäten abgebaut. Das Patriarchat endlich abgeschafft. Die freie Liebe erfunden. Und was der anstehenden Dinge mehr waren.
Probieren ging übers Studieren. Was der akademischen Jugend von den bildungsferneren Schichten sonst gerne höhnisch vorgehalten wurde, wenn sie sich im Praktischen allzu unpraktisch anstellte, das hatte die sich jetzt selbst auf die Fahne geschrieben. Schlagt die Germanisten tot, macht die Blaue Blume rot!, das war nun die Losung in ihrem Fach. Da standen sie nun blöd in der Gegend herum und wussten nicht, wie ihnen geschah.
Dozent verstorben, stand als Balken quer über dem Vorlesungseintrag am Schwarzen Brett, an dem sie sich orientieren sollten und wollten. Und hinter dem Namen war dick mit Schwarz ein Kreuz aufgemalt. Momme Mommsen zum Beispiel, der berühmte Hölderlin-Spezialist, von dem sie bis nach Tübingen gehört hatten, dessen Ruf bis in ihre Hölderlin-Stadt gedrungen war, dessen Kurs sie hätten besuchen wollen, der sogar einer der Gründe gewesen war, weshalb sie ausgerechnet Berlin für ihr Semester ausgewählt hatten. Natürlich war er nicht plötzlich gestorben, und er war auch nicht beurlaubt, für weiss Gott oder wer sonst wie lange, wie eine mildere Formel für die Eliminierung eines Dozenten lautete, seine Studenten hatten ihn ganz einfach ausradiert.
Momme Mommsen, den Namen musste man sich allerdings auf der Zunge zergehen lassen, da hatten sie ja recht, der gehörte zu einer anderen Zeit, und diese Zeit war jetzt vorbei. Er war aber nur einer von vielen. Die Studenten waren nun selbst die Dozenten. Sie belehrten sich selber und gegenseitig. Sit-ins und Hearings ersetzten die Vorlesungen und Seminare. Debattieren statt dozieren, war die Parole. Die ganze Welt wurde hier diskutiert. Kein guter Faden wurde an ihr gelassen. Kein Stein blieb auf dem anderen. Sie musste nun endlich anders werden. Besser. Sofort!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!