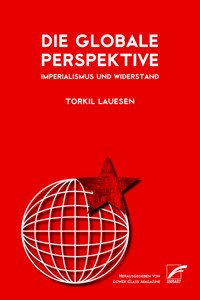
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Kapitalismus ist untrennbar mit dem Imperialismus verbunden. So lautet die Kernthese von Torkil Lauesens Buch "Die globale Perspektive", das nun auf Deutsch vorliegt. Lauesen zeichnet die Bedeutung des Imperialismus für die Geschichte des Kapitalismus nach, analysiert den Neoliberalismus als gegenwärtige Form des kapitalistischen Weltsystems und widmet sich der Frage antikapitalistischen und antiimperialistischen Widerstands. Der Autor sieht sich dabei Karl Marx’ elfter Feuerbach-These verpflichtet: Es geht nicht nur darum, die Welt zu verstehen, sondern auch, sie zu verändern. Das Buch ist leicht verständlich geschrieben. Lauesen arbeitet mit akademischer Genauigkeit, wendet sich jedoch an ein breites Publikum politisch Interessierter und Aktiver. Der Text ist vielfach angereichert mit Anekdoten aus 50 Jahren eigener praktischer Erfahrung in antikapitalistischen und antiimperialistischen Widerstandsbewegungen. Die chinesische Revolution trifft hierbei auf die zapatistische Bewegung, K-Gruppen treffen auf das Weltsozialforum. Schlussendlich geht es Lauesen um die praktischen Möglichkeiten – Visionen und Strategien – antiimperialistischen Widerstands im neoliberal globalisierten kapitalistischen Weltsystem. "Die globale Perspektive" ist Einführungsband, Diskussionsgrundlage und Inspirationsquelle zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Torkil Lauesen lebt in Kopenhagen und ist seit Ende der 1960er-Jahre in internationalistischen Bewegungen aktiv. Er war Mitglied der sogenannten Blekingegade-Gruppe, die 20 Jahre lang Befreiungsbewegungen im Globalen Süden durch Raubüberfälle unterstützte.
Torkil Lauesen
Die globale Perspektive
Imperialismus und Widerstand
übersetzt von Gabriel Kuhn
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
Torkil Lauesen:
Die globale Perspektive
1. Auflage, Oktober 2022
eBook UNRAST Verlag, April 2023
ISBN 978-3-95405-146-5
Titel der Originalausgaben:
Det globale perspektiv, Nemo, Kopenhagen 2016
The Global Perspective, Kersplebedeb Publishing, Montreal 2018
© Torkil Lauesen
Alle Rechte vorbehalten
© UNRAST Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de | [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter
Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: UNRAST Verlag, Münster
Satz: UNRAST Verlag, Münster
Inhalt
Vorwort der Herausgeber:innen: Weltarbeiterklasse und Imperialismus – Für eine globale Perspektive!
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Einleitung: Warum dieses Buch?
Teil eins: Die Geschichte des Imperialismus – eine persönliche Perspektive
1. Eine geteilte Welt
2. Nationalismus und Internationalismus
3. Antiimperialismus und Kalter Krieg
4. Die goldenen Jahre der Imperialismustheorie
Teil zwei: Der globale Kapitalismus
5. Neoliberale Globalisierung
6. Der ungleiche Tausch
7. Die globale Teilung der Klasse
Teil drei: Politik in einer geteilten Welt
8. Ein Fenster öffnet sich
9. Die Gewerkschaftsbewegung
10. Kommunistische Parteien und sozialistische Bewegungen
11. Praxis
12. Visionen und Strategien
Anmerkungen
Weltarbeiterklasse und Imperialismus – Für eine globale Perspektive!
Vorwort der Herausgeber:innen
Am 24. Februar 2022 marschierten Streitkräfte Russlands in der Ukraine ein. Die »Spezialoperation«, wie der Kreml den Krieg nennt, belebte auch in den westlichen Konzern- und Staatsmedien die Debatte um einen Begriff, der zumindest in der bürgerlichen Öffentlichkeit zuvor als ein Ding des 20. Jahrhunderts erschien. »Imperialismus«, allerdings fast ausschließlich in Gestalt des »russischen Imperialismus«, ist nun wieder in aller Munde. Die FDP-nahe Friedrich Naumann Stiftung für Freiheit veranstaltete ein Online-Panel mit »Expert:innen« zum Thema »Russian Imperialism for Dummies«, die US-Regierung versammelte Diskutant:innen zur Frage der »Dekolonialisierung Russlands« und der als Jugendlicher im Stamokap-Flügel der SPD geschulte Bundeskanzler erklärte in einem Gastbeitrag für die FAZ: »Der Imperialismus ist zurück in Europa.«
War er denn je weg? Das kommt darauf an, was man darunter versteht. Olaf Scholz lässt es uns wissen: Die EU sei die »gelebte Antithese zu Imperialismus und Autokratie«. Imperialismus betreiben in dieser Weltsicht zufällig immer die geopolitischen Gegner des Westens. China und Russland agieren »imperialistisch«, die USA und ihre stets willigen Partner dagegen »verteidigen ihre Freiheit« – und sei es Tausende Kilometer entfernt am Hindukusch. Oder sie »helfen« – wie im Jemen, in Mali oder in Libyen. Ob diese »Hilfe« Millionen Tote mit sich bringt und die von ihr beglückten Nationen in Schutt und Asche zurücklässt, spielt dabei keine Rolle. Imperialisten sind immer die anderen.
Das war schon zu Beginn des Ersten Weltkriegs nicht anders. »Mitten im Frieden überfällt uns der Feind«, klagte Kaiser Wilhelm II. in seiner Thronrede am 6. August 1914. Und die SPD sprang ihm bei: »Uns drohen die Schrecknisse feindlicher Invasionen. Nicht für oder gegen den Krieg haben wir heute zu entscheiden, sondern über die Frage der für die Verteidigung des Landes erforderlichen Mittel. (…) Unsere heißen Wünsche begleiten unsere zu den Fahnen gerufenen Brüder ohne Unterschied der Partei«, schwor der Fraktionsvorsitzende der Partei, Hugo Haase, die »Volksgenossen« auf den heiligen Verteidigungskrieg ein. Das Parteiblatt Vorwärts legte nach: »Wenn die verhängnisvolle Stunde schlägt, werden die vaterlandslosen Gesellen ihre Pflicht erfüllen und sich darin von den Patrioten in keiner Weise übertreffen lassen.« Natürlich musste dieser Burgfrieden mit der eigenen Bourgeoisie gerechtfertigt werden und man fand die Beschönigung des eigenen »sozialistischen« Bellizismus im selben moralisierenden Begriff des Gegners, den noch der heutige SPD-Kanzler nutzt: Der russische Despotismus und Imperialismus sei das wesentlich größere Übel als Deutschland und zudem sei man ja aus heiterem Himmel angegriffen worden.
Ganz anders Lenin. Zwei Jahre und Hunderttausende Tote später verfasste der russische Revolutionär in Zürich seine Schrift Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, die 1917 zum ersten Mal erschien. Lenin hatte für die durchaus theoretische Schrift klare praktische Interessen. Es ging darum, die Arbeiterbewegung aus der Krise zu befreien, in die sie geraten war, weil die sozialdemokratischen Parteien der II. Internationale ein Klassenbündnis mit »ihren« nationalen Herren geschlossen hatten und in den Krieg gezogen waren.
Lenin führte den Begriff »Imperialismus« auf Veränderungen in der ökonomischen Basis des Kapitalismus zurück und entwickelte Kriterien für seine Verwendung. Imperialismus ist Kapitalismus in seinem »monopolistischen« Stadium, also einer, in dem die Konzentrations- und Zentralisationstendenz des Kapitalismus zur Herausbildung marktbeherrschender Großkonzerne geführt hat. Er arbeitet die veränderte Rolle der Banken (Verschmelzung von Industrie- und Bankkapital zu Finanzkapital) und die Rolle von Kapitalexporten bei der Aufteilung der Welt in Interessensphären heraus.
Die ökonomische Analyse ist ihm aber zugleich kein Selbstzweck. Der Imperialismus-Schrift voran gingen bereits mehrere kleinere Arbeiten zur Stellung der revolutionären Arbeiterbewegung zum Weltkrieg (z.B. Über die Niederlage der eigenen Regierung im imperialistischen Kriege von 1914, Sozialismus und Krieg von 1915, Der Opportunismus und der Zusammenbruch der II. Internationale von 1916).
Lenin will auf eine Position hinaus, die er im 1921 beigefügten Vorwort zur deutschen Ausgabe der Imperialismus-Schrift so umreißt: »In der Schrift wird der Beweis erbracht, dass der Krieg von 1914 – 1918 auf beiden Seiten ein imperialistischer Krieg (d.h. ein Eroberungskrieg, ein Raub- und Plünderungskrieg) war, ein Krieg um die Aufteilung der Welt, um die Verteilung und Neuverteilung der Kolonien, der ›Einflußsphären‹ des Finanzkapitals usw.« Und er will die Frage klären, warum die vor Kriegsbeginn noch auf Solidarität des Proletariats gegen den Bellizismus der Herrschenden setzenden Parteien der II. Internationale das Bündnis mit ihren nationalen Bourgeoisien eingegangen waren, um Arbeiter:innen anderer Nationen abzuschlachten.
Im Zentrum seiner Erklärung steht der »Parasitismus« der imperialistischen Nationen, die zu Vehikeln der Ausplünderung des Rests der Welt werden. Er zitiert eine erstaunlich prophetische Passage des englischen Ökonomen John Atkinson Hobson: »Der größte Teil Westeuropas könnte dann das Aussehen und den Charakter annehmen, die einige Gegenden in Süd-England, an der Riviera sowie in den von Touristen am meisten besuchten und von den reichen Leuten bewohnten Teilen Italiens und der Schweiz bereits haben: ein Häuflein reicher Aristokraten, die Dividenden und Pensionen aus dem Fernen Osten beziehen, mit einer etwas größeren Gruppe von Angestellten und Händlern und einer noch größeren Anzahl von Dienstboten und Arbeitern im Transportgewerbe und in den letzten Stadien der Produktion leicht verderblicher Waren; die wichtigsten Industrien wären verschwunden. Die Lebensmittel und Industriefabrikate für den Massenkonsum würden als Tribut aus Asien und Afrika kommen. (… ) Mögen diejenigen, die eine solche Theorie als nicht der Erwägung wert verächtlich abtun, die heutigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in jenen Bezirken Südenglands untersuchen, die schon jetzt in eine solche Lage versetzt sind, und mögen sie darüber nachdenken, welch gewaltiges Ausmaß ein derartiges System annehmen würde, wenn China der ökonomischen Herrschaft ähnlicher Gruppen von Finanziers, Investoren, von Beamten in Staat und Wirtschaft unterworfen würde, die das größte potentielle Profitreservoir, das die Welt je gekannt hat, ausschöpfen würden, um diesen Profit in Europa zu verzehren.«
Die in den imperialistischen Zentren beheimateten Monopolkonzerne eignen sich über – so würde man heute sagen – Global Value Chains den Mehrwert aus der ganzen Welt an. Und damit sind sie in der Lage, einen kleinen Teil der Beute an die privilegiertesten Arbeiterschichten der eigenen Nation weiterzugeben, um sich sozialen Frieden zu erkaufen. Diese »Arbeiteraristokratie« bildet die Klassenbasis des sozialdemokratischen Opportunismus und Sozialchauvinismus.
Der politische Inhalt des Opportunismus und Sozialchauvinismus ist für Lenin stets das Klassenbündnis mit der »eignen Bourgeoisie«, auf Deutsch: die »Sozialpartnerschaft«: »Das Bündnis einer kleinen bevorrechteten Arbeiterschicht mit ›ihrer‹ nationalen Bourgeoisie gegen die Masse der Arbeiterklasse, das Bündnis der Lakaien der Bourgeoisie mit ihr gegen die von ihr ausgebeutete Klasse«, wie er in »Der Opportunismus und der Zusammenbruch der II. Internationale« formuliert.
Nun ist aber die Arbeiteraristokratie für Lenin noch eine selbst in den entwickelten kapitalistischen Ländern stets kleine Schicht des Proletariats. Mit dieser Einschränkung brach der dänische Kommunistische Arbeitskreis (KAK) in den 1960er-Jahren und entwickelte die Theorie vom »Parasitenstaat«, die nachzuweisen suchte, dass ohne den Wegfall der globalen Abhängigkeiten die Arbeiterklasse im Westen zu keiner Revolution fähig sei. »Die Arbeiterklasse hat keine Chance, die Kapitalistenklasse zu stürzen und den Sozialismus aufzubauen, bevor das Fundament der Kapitalistenklasse durch den Kampf und zumindest teilweisen Sieg der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas erschüttert wurde«, schrieb der Gründer der Parasitenstaat-Theorie, Gotfred Appel 1966. Die Gruppe, aus der später die sogenannte Blekingegade-Bande hervorging, der auch der Autor des vorliegenden Bandes angehörte, setzte die Theorie konsequent in die Praxis um: Auf Agitation für den »heimischen« Klassenkampf wurde zugunsten von Umverteilungsaktionen in den Globalen Süden verzichtet. Die der Theorie entsprechende Praxis war der Bankraub für Befreiungsbewegungen.
1989/1990 endete diese Praxis mit der Verhaftung mehrerer Genossen, darunter Torkil Lauesen, und mehrjährigen Haftstrafen. 2016 erschien »Die globale Perspektive« zunächst auf Dänisch, ein Jahr später auf Englisch. Der Band liefert nicht nur historisch interessante Passagen zur kolonialen Frage in der Arbeiterbewegung sowie zur Geschichte der Imperialismus-Theorie und des Antiimperialismus. Er knüpft auch inhaltlich an die früheren Arbeiten der Parasitenstaat-Theorie an, wenngleich er deren Spitze, revolutionärer Klassenkampf sei in den Metropolen quasi unmöglich, abschwächt.
Wichtiger ist aber: Er bleibt bei der »globalen Perspektive«, also einer Sicht auf die Klasse, die nicht beim jeweils »nationalen« Proletariat stehen bleibt, sondern Imperialismus als weltumspannendes System begreift, in welchem auch die Klasse nur als Weltarbeiterklasse zu fassen ist. Wertschöpfung hat hier auch immer mit der Unterordnung der Mehrheit der Nationen unter die imperialistischen Big Player zu tun. Und die »nationalen« Arbeiterklassen sind nicht mehr als Sektionen der einen Weltarbeiterklasse. Wer sich dieser Sicht sperrt – etwa in der Frage der Rolle von Migrationsregimen bei der Aufrechterhaltung der Preisdifferenzen der Ware Arbeitskraft – driftet in den Sozialchauvinismus ab.
Daraus ergeben sich weitreichende Fragen: Mit welchen Mechanismen vollzieht sich der Surplus-Transfer aus der Peripherie in die Metropolen? Welche Auswirkungen hat das auf die Lebensrealitäten der Klasse dort wie hier? Und auf welchen gemeinsamen Nenner sind die Interessen der in sich gespaltenen Weltarbeiterklasse zu bringen, um sie als kämpfendes politisches Subjekt zu konstituieren? Wie überhaupt kann das in Ermangelung einer Kommunistischen Internationale und einer global vernetzten revolutionären Gewerkschaftsbewegung geschehen?
Die so aufgeworfenen Fragen sind keine bloß theoretischen Spielereien. Eine revolutionäre Linke, die sich in Deutschland neu aufstellt, wird das nur auf Grundlage einer ausgearbeiteten Imperialismustheorie können. Und dazu kann sie den Input aus internationalen Debatten ganz gut gebrauchen. Schriften wie Die globale Perspektive gibt es auf deutsch sicherlich zu wenige. Im englischsprachigen Raum sind mit Intan Suwandis Arbeiten zu Arbeitsarbitrage und globalen Wertschöpfungsketten, John Smith‘s Imperialism in the 21st Century oder Zak Copes The wealth of (some) nations neben den Werken Lauesens zahlreiche Bücher vorhanden, die geeignet sind, eine Imperialismustheorie auf der Höhe der Zeit zu formulieren. In Deutschland sieht es da magerer aus. Wir hoffen, mit der in diesem Band vorliegenden Übersetzung anzufangen, diese Lücke zu schließen.
Lower Class Magazine, Berlin, August 2022
»Würde die Theorie vom Parasitenstaat in unserem Teil der Welt akzeptiert werden, wäre sie falsch.«
Kommunistischer Arbeitskreis (KAK), 1975
Vorwort zur deutschen Ausgabe
Seit der Publikation der englischen Ausgabe dieses Buches im Jahr 2018 hat sich die Welt in einer Form verändert, die die Bedeutung einer globalen Perspektive noch deutlicher macht. Wir müssen den Hauptwiderspruch im Weltsystem identifizieren, um diese Veränderungen zu verstehen und effektive Widerstandsstrategien zu entwickeln.
Der globale, neoliberale Kapitalismus wurde durch die Finanzkrise 2007 in eine tiefe Krise gestürzt. Die transnationalen Institutionen, die ihn verwalten (Weltbank, Welthandelsorganisation usw.), sehen sich im Globalen Norden einem konservativen und rechtsgerichteten Nationalismus gegenüber. Auch im Globalen Süden gibt es neue Formen des Nationalismus, die von linkem bis zu rechtem Populismus reichen und den ›Sozialismus chinesischer Prägung‹ inkludieren.
In jüngster Zeit wurde freilich alles von der Corona-Pandemie (COVID 19) überschattet.
Die Pandemie
Seit Jahrzehnten warnen Wissenschaftler vor ›Zoonosen‹, das heißt, vor der Übertragung von Viren auf den Menschen durch Tiere. Mit Corona wird die Liste dieser Viren immer länger: HIV, Ebola, SARS, MERS, Zika – alle gehören dieser Kategorie an.
Das Risiko, dass sich Zoonosen entwickeln, wird durch Entwaldung und Urbanisierung erhöht. Wilde Tiere kommen menschlichen Siedlungsgebieten immer näher. Auch die industrielle Tierhaltung, die Tausende Tiere in enge Räume pfercht, lässt Krankheitserreger auf den Menschen überspringen. Zwischen der kapitalistischen Sichtweise auf die Natur und Pandemien besteht ein deutlicher Zusammenhang. Corona wird vorübergehen. Doch wann kommt die nächste Pandemie? Wenn wir die Natur weiter so behandeln wie jetzt, wird es nicht lange dauern.
Corona deckte die Schwäche globaler Institutionen auf. Als sich das Virus zu verbreiten begann, trachteten die Nationalstaaten in erster Linie danach, ihre eigenen Bevölkerungen zu schützen, egal ob es um Masken oder Impfstoff ging. Die Bedürfnisse anderer waren zweitrangig.
Die Widersprüche zwischen dem transnationalen Kapital und der Nation
Corona verschärfte die Widersprüche im kapitalistischen Weltsystem. Jetzt, wo die Pandemie am Abklingen ist, wird das deutlicher denn je. Der Hauptwiderspruch besteht zwischen dem transnationalen Kapital und der Nation, im Globalen Norden wie im Süden.
Der Neoliberalismus bescherte dem Kapitalismus 30 goldene Jahre. Aber im Untergrund wuchs der Widerstand. Die neoliberale Krise spaltet sowohl die Arbeiterklasse als auch das Kapital. Die einen wollen zu einem nationalen Kapitalismus zurückkehren, die anderen mit der Globalisierung fortsetzen. Die größten Unternehmen der Welt (Apple, Google, Amazon, Microsoft, die Elektronikindustrie und die Automobilindustrie) wollen Letzteres. Sie haben globale Produktionsketten, logistische Netzwerke und transnationale Organisationen etabliert, die sie nicht so einfach aufgeben wollen. Doch nationalistische Kräfte fordern einen stärkeren Staat, der als Bollwerk gegen den Neoliberalismus und seine Auswirkungen dienen soll.
Obwohl die Arbeiterbewegung im Neoliberalismus drastisch geschwächt wurde, hat sie noch eine Waffe: die parlamentarische Demokratie. Trotz der vielen transnationalen Institutionen, die in der neoliberalen Ära geschaffen wurden, blieben die nationalen Parlamente immer der grundlegende Rahmen politischer Entscheidungsfindung. Sinkende Reallöhne, der Abbau des Wohlfahrtsstaats und die Migration mit ihrer ›Integrationsproblematik‹ trugen alle zur Sehnsucht nach einem starken Nationalstaat bei. In vielen Ländern sind mittlerweile nationalistische Kräfte an der Macht. Sie übernahmen diese oft in Bündnissen mit den nationalkonservativen Fraktionen des Kapitals. Die nationalistischen Kräfte versuchen, die transnationalen Institutionen der neoliberalen Ära aufzulösen. Diese Institutionen kontrollieren die Produktionsverhältnisse; die ökonomische Macht liegt in ihren Händen. Doch die politische Macht ist im Nationalstaat konzentriert. Das stellt ein großes Problem für die Zukunft der kapitalistischen Produktionsweise dar.
Politisch hat sich der Widerspruch zwischen dem Neoliberalismus und dem Nationalismus mehrfach ausgedrückt: in der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA, im Brexit-Referendum und im Erfolg von Politiker:innen[1] wie Marine Le Pen (Frankreich), Matteo Salvini (Italien), Viktor Orbán (Ungarn) und Scott Morrison (Australien). In Deutschland kann die AfD als Beispiel dienen. Die Klassenbasis für den nationalistischen Kapitalismus findet sich in der alten industriellen Arbeiterklasse und der unteren Mittelschicht – dort, wo die Arbeitsplätze verlagert und Sozialleistungen abgebaut wurden. Diese Klassen fühlen sich von den sozialdemokratischen Zugeständnissen an den Neoliberalismus verraten. Sie erliegen den Versprechungen des nationalistischen Populismus.
30 Jahre Neoliberalismus haben die globalen Machtverhältnisse durcheinandergebracht. Die US-Hegemonie, die durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und die Öffnung Chinas gestärkt wurde, lässt sich heute kaum noch aufrechterhalten. Die Industrialisierung des Globalen Südens, vor allem Chinas, hat das Zentrum der Industrieproduktion verschoben. China dient heute als Schaltstelle der globalen Produktionsketten.
Die USA hatten gehofft, dass Neoliberalismus und Globalisierung denselben Effekt auf China haben würden wie auf die ehemalige Sowjetunion. Man träumte davon, dass sich die Kommunistische Partei Chinas auflösen und sich im Land ein kapitalistisches, prowestliches Regime etabliert würde. Aber China begegnete dem Neoliberalismus auf seine Weise. Es öffnete sich für den Weltmarkt, behielt jedoch die Kontrolle über die Zukunft der Nation.
Die Sowjetunion wurde durch eine liberale Schocktherapie wirtschaftlich zugrunde gerichtet, was nicht nur den Niedergang ihrer Produktion zur Folge hatte, sondern auch den Kollaps des Gesundheitssystems. China hingegen nutzte die neoliberale Globalisierung, um seine Produktivkräfte zu stärken. Die ökonomische Wachstumsrate in China ist hoch. Wie ein Kampfsportmeister nahm China die Kräfte des globalen Kapitals auf, um sie gegen dieses selbst zu richten. Indem sie die politische Macht über die ›neuen Kommandohöhen der Wirtschaft‹ behielt, gelang es der chinesischen Regierung, die polarisierenden Tendenzen des globalen Kapitalismus abzuschwächen. Der Niedergang der US-Hegemonie und der Aufstieg Chinas zur ökonomischen und politischen Weltmacht führen dazu, dass sich zum ökonomischen Wettbewerb nun auch der klassische Kampf um territoriale Kontrolle gesellt.
Ökonomischer Wettbewerb und territoriale Kontrolle
Wie verhalten sich die politischen Parteien zu den wachsenden Spannungen zwischen neoliberaler Globalisierung und Nation? Die traditionellen Großparteien versuchen, zwischen den Forderungen transnationaler Unternehmen nach weiterer Globalisierung und dem Ruf eines großen Teils der Wählerschaft nach einem stärkeren Nationalstaat zu vermitteln – eine sehr schwierige Aufgabe. In Europa hatten linkspopulistische Parteien mit der Übernahme alter sozialdemokratischer Positionen einen gewissen Erfolg. Doch auch sie können den Keynesianismus nicht zurückbringen. Jahrzehnte des Neoliberalismus haben die ökonomischen Werkzeuge des Nationalstaats stumpf gemacht.
Die rechtsnationalistischen Strömungen wollen einen neuen Sozialvertrag zwischen Kapital und Arbeit formulieren. Dabei handelt es sich nicht um einen Kompromiss zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband, sondern um ein Bündnis zwischen nationalkonservativen Kapitalfraktionen und dem autoritären Staat. Letzterer wird auch unter Verweis auf die globale Aufrüstung gefordert. Verteidigungshaushalte steigen überall. Territoriale Kontrolle und militärische Macht haben wieder Bedeutung für den Imperialismus, der sich in der neoliberalen Ära auf die Kräfte des Marktes verlassen konnte. Die NATO spielt mit ihren Muskeln, die USA wollen ihre Kontrolle über Europa behaupten, und gegen China wird AUKUS in Stellung gebracht (ein Militärbündnis Australiens, des Vereinigten Königreichs und der USA). Auch die Ökonomie wird zur Waffe, und zwar in der Form von Sanktionen, Wirtschaftsblockaden und Handelskriegen. Großen Teilen der Welt – China, Russland, Iran, Kuba und Venezuela – wird der uneingeschränkte Zugang zum Weltmarkt verwehrt. Wir werden in den kommenden Jahren zahlreiche (›kalte‹ und ›heiße‹) Stellvertreterkriege erleben und mit der Bedrohung eines Atomkriegs leben müssen.
Ökonomische Krise
Wir befinden uns in einer globalen ökonomischen Krise. Die Pandemie ist nicht der Grund. Sie hat die Probleme, die mit der Finanzkrise 2007 deutlich wurden, nur verschärft. Die von den Regierungen verschriebene Medizin hilft nicht. Es handelt sich nur um Schmerzmittel zur Symptombekämpfung. Die Corona-Hilfspakete, die notwendig waren, um den Kapitalismus trotz Lockdowns am Leben zu halten, ließen die Schulden auf dieser Welt auf astronomische 300 Trillionen US-Dollar steigen. Das entspricht ungefähr 370 Prozent des globalen Bruttoinlandprodukts. Die Schulden lassen sich nicht durch das Wachstum der Realökonomie, also durch Warenproduktion und Dienstleistungen, decken. Diese nahmen während der Pandemie ab. Geld fließt überhaupt nur, weil die Banken ihre Notendruckereien angeworfen und Staatsanleihen vergeben haben. Die riesige Schuldenblase droht, auf eine Weise zu explodieren, die die Weltwirtschaft zum Stillstand bringen kann.
Die ökonomische Krise und die zunehmenden nationalstaatlichen Rivalitäten bestärken einander. Sie führen zu einer Spirale politischer und militärischer Gewalt, die allen Versuchen im Wege steht, die ökologischen Herausforderungen zu lösen oder zumindest abzuschwächen. Politische, ökonomische und ökologische Probleme verschmelzen und leiten den dramatischen Todeskampf der kapitalistischen Produktionsweise ein. Dies birgt große Gefahren für die Menschheit: Naturkatastrophen ebenso wie einen möglichen Atomkrieg.
Ein Krieg zwischen imperialistischen Mächten kann der nächste globale Hauptwiderspruch sein. Zwar sind Atomwaffen primär defensive Waffen, da das Risiko eines Vergeltungsschlags mit enormen Konsequenzen so groß ist, dass ihre Anwendung unwahrscheinlich wird. Gleichzeitig obliegt diese Entscheidung Individuen, die nicht immer rational handeln. Wenn die herrschenden Klassen Krieg fordern, eröffnet der Kampf um Frieden eine revolutionäre Perspektive.
Wir dürfen uns vor der Krise nicht fürchten. Wir dürfen es auch nicht als unsere Aufgabe betrachten, die Probleme des Kapitalismus zu lösen. Das könnten wir auch gar nicht. Die strukturelle Krise des Kapitalismus ist die objektive Bedingung für radikale gesellschaftliche Veränderung. Unsere Aufgabe (die Aufgabe der subjektiven Kräfte) ist es, zu vermeiden, dass der Zusammenbruch des Kapitalismus zu Brutalität und Chaos führt. Wir müssen uns für eine Transformation des Systems und eine demokratischere, gerechtere und nachhaltigere Weltordnung einsetzen.
Wir befinden uns in einer unsicheren, ja gefährlichen Zeit. Die Bedingungen des Kampfes und die politischen Allianzen können sich rasch ändern. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir müssen unsere Organisationen, Methoden und Strategien entsprechend anpassen. Die globale Perspektive ist dafür wesentlich. Die Identifikation des Hauptwiderspruchs ist ein analytisches Werkzeug, dem eine erfolgversprechende Strategie folgt. Nur so können wir wissen, was morgen zu tun ist. Unsere zukünftige Praxis baut darauf auf.
Zum Buch und Danksagung
Die deutsche Ausgabe dieses Buches beruht auf der englischen Ausgabe von 2018. Diese unterscheidet sich leicht von der 2016 erschienenen dänischen Originalausgabe. Für die englische Ausgabe strich ich Passagen, die auf ein dänisches Lesepublikum zugeschnitten waren, und fügte Passagen hinzu, die für eine internationale Leserschaft relevant schienen.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die die Arbeit an dem Buch begleitet und mir wertvolle Hinweise gegeben haben, allen voran Zak Cope. Karl Kersplebedeb, der Herausgeber der englischen Übersetzung, half bei der Aktualisierung der Originalausgabe. Gabriel Kuhn übersetzte die Originalausgabe ins Englische und zeichnet nun auch für die deutsche Übersetzung verantwortlich. Diese wäre ohne die Unterstützung von Lower Class Magazine und Paul Winter nicht möglich gewesen.
Torkil Lauesen, Kopenhagen, Mai 2022
Einleitung: Warum dieses Buch?
Kind des Kalten Krieges
Ich wurde im Jahr 1952 geboren. Meine Mutter arbeitete als Krankenschwester, mein Vater im Fährdienst. Ich wuchs im dänischen Wohlfahrtsstaat auf und erlebte als Kind den Aufbruch in die Konsumgesellschaft. 1956 kauften wir einen Fernseher, ein Telefon und einen Kühlschrank. 1959 kauften wir einen Renault 4CV. 1962 übersiedelten wir von unserer sozialen Wohnbausiedlung in ein Eigenheim. Das Motto der regierenden Sozialdemokraten war: ›Macht gute Zeiten besser!‹
Meine erste politische Erinnerung stammt von der sogenannten Kubakrise 1962. Im Jahr zuvor hatte die US-Regierung die Invasion der Schweinebucht unterstützt. Außerdem hatte sie in der Türkei Atomwaffen stationiert. Nun wollte die Sowjetunion atomare Sprengköpfe auf Kuba stationieren. Die sowjetischen Schiffe, die zu diesem Zweck auf dem Weg in die Karibik waren, wurden vom US-Militär gesichtet. Die amerikanische Kriegsflotte blockierte daraufhin die Seewege zur ›kommunistischen Insel‹. Niemand wusste, was passieren würde, sollten die sowjetischen Schiffe auf die amerikanischen treffen. Ein Atomkrieg zwischen den beiden Supermächten schien möglich.
Obwohl ich erst zehn Jahre alt war, verstand ich den Ernst der Lage. Nur wenige Monate zuvor hatte die dänische Regierung an alle Haushalte eine Broschüre mit dem Titel »Wenn der Krieg kommt« geschickt. In der Broschüre wurde erklärt, dass du unter einen Tisch kriechen sollst, wenn du eine Explosion wahrnimmst. Danach solltest du dich so rasch wie möglich in den Keller begeben, wo du Wasser und Nahrungsmittel aufbewahren musstest. In unserem neuen Fernseher hatte ich Bilder von Atompilzen gesehen. Jeden Mittwoch wurden die Sirenen in unserem Wohnviertel getestet. Viele Menschen bewahrten tatsächlich Wasser und Nahrungsmittel in ihren Kellern auf. Aber alles, woran ich denken konnte, war: »Was tut man, wenn die Nahrungsmittel alle sind?«
Die Kubakrise endete ohne Atomkrieg. Meine Generation durfte sich anderem zuwenden. Wir begeisterten uns für Elvis, die Beatles, die Rolling Stones und lange Haare. Manche wandten sich der Politik zu. Darunter auch ich. Die erste politische Organisation, der ich angehörte, hieß ›Nie wieder Krieg‹. Ich wurde Kriegsdienstverweigerer.
Der Krieg in Vietnam nahm bald meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch, nicht zuletzt, weil täglich über ihn im Fernsehen berichtet wurde. Die Bilder hatten einen enormen Einfluss auf die antiimperialistischen Aktivist:innen meiner Generation. Es war einer der brutalsten Kriege der modernen Geschichte. Von der Operation Rolling Thunder 1965 bis zum Waffenstillstand 1973 warfen amerikanische B-52s pausenlos Bomben über Vietnam ab. Bombardierungen dieser Art hatte es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. In Tonnen gemessen wurden dreimal so viele Bomben über Nordvietnam abgeworfen, wie während des gesamten Zweiten Weltkriegs über Europa, Asien und Afrika zusammen. Nordvietnam ist in etwa so groß wie die ehemalige DDR. In absoluten Zahlen sprechen wir von sieben Millionen Tonnen Sprengmitteln. Die gesamte Sprengkraft war 400-mal so stark wie jene der über Hiroshima abgeworfenen Atombombe. Dazu kam der Einsatz von chemischen Waffen. Zivilist:innen wurden terrorisiert und mehr als 80.000 mutmaßliche Vietcong-Sympathisant:innen getötet. Insgesamt verloren 1,5 Millionen Menschen in Vietnam während des Krieges ihr Leben. Die amerikanische Regierung wurde mehrfach des Völkermords angeklagt, unter anderem vom Stockholmer Russell-Tribunal, das 1967 unter dem Vorsitz von Jean-Paul Sartre tagte. Internationalem Recht zufolge hätten US-Präsident Richard Nixon und US-Innenminister Henry Kissinger als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden müssen.
1969 kaufte ich mein erstes politisches Buch. Es hieß War Crimes in Vietnam. Der Autor war bezeichnenderweise der Philosoph und Nobelpreisträger Bertrand Russell. Bevor ich mich an das Schreiben dieser Einleitung machte, las ich das Buch noch einmal. Ich fand eine Stelle, die ich dick unterstrichen hatte: »Manche können mit dem Begriff ›US-Imperialismus‹ wenig anfangen, weil er nicht Teil ihrer Erfahrung ist. Im Westen profitieren wir vom Imperialismus. Das korrumpiert unsere Wahrnehmung.«[2] Diese Worte machten damals offensichtlich starken Eindruck auf mich. Sie sollten für meine politische Biografie richtungsweisend werden.
Am Anfang meines politischen Engagements standen Emotionen: Empörung über die Napalmbomben der USA und Hoffnung auf Gerechtigkeit für die Menschen in Vietnam. Wahrscheinlich hatte ich auch ein schlechtes Gewissen. Ich hatte ein bequemes Leben. Menschen in der Dritten Welt hatten das nicht.[3] Ich habe immer noch ein bequemes Leben. Ich schreibe diesen Text auf einem der zwei Computer in unserer Wohnung. Diese ist geräumig und hat drei Zimmer. Wir haben ein Tablet, zwei Mobiltelefone und einen Flachbildschirm-Fernseher. In der Küche und im Badezimmer findest du jedes technische Gerät, das man sich dort wünschen kann. Wenn wir Urlaub machen, fliegen wir in Länder, in denen Menschen sich keinen Urlaub leisten können. Dort genießen wir das Klima, die Kultur und das Essen. Mein Gehalt erlaubt es mir, alles zu kaufen, was ich brauche, und vieles, was ich nicht brauche.
Die Tatsache, dass die Lebensbedingungen auf der Welt so unterschiedlich sind, war ein wichtiger Antrieb für mein politisches Engagement. Ich begann, mir Fragen zu stellen, die mich Jahrzehnte lang begleiten sollten: Warum gibt es diese Unterschiede? Wie haben sie sich historisch entwickelt? Durch welche ökonomischen und politischen Maßnahmen werden sie aufrechterhalten? Und warum ist es so verdammt schwierig, sie zu überwinden?
Als Teenager besuchte ich ein Internat in der kleinen dänischen Stadt Holbæk. Dort erlebte ich die Protestwelle von 1968. Diese war so stark, dass wir sie sogar in der dänischen Provinz zu spüren bekamen. Wir kritisierten die Internatsleitung, gaben eine kritische Schülerzeitung heraus und organisierten Diskussionsveranstaltungen zum Vietnamkrieg. Ich besuchte auch einen Lesekreis, in dem wir versuchten, die Ungerechtigkeit in der Welt theoretisch zu fassen und eine effektive politische Praxis zu entwickeln.
Durch einen meiner Freunde kam ich mit dem Kommunistischen Arbeitskreis (KAK) in Kontakt. Dadurch veränderte sich mein Leben. Das theoretische Fundament des KAK war die Theorie vom ›Parasitenstaat‹. Sie stimmte mit meiner Sichtweise überein. Die Theorie vom Parasitenstaat besagt, dass der Reichtum in dem Teil der Welt, in dem ich aufwuchs, direkt mit der Armut in anderen Teilen der Welt zusammenhängt. Verantwortlich dafür ist der Imperialismus. Die Theorie vom Parasitenstaat erklärte für mich auch, warum die Arbeiterklasse in unserem Teil der Welt nicht an einer Revolution interessiert schien. Die Arbeiter:innen waren höchstens an Änderungen innerhalb des herrschenden Systems interessiert, die ihnen einen größeren Teil des imperialistischen Kuchens zugutekommen ließen.
Als ich im KAK aktiv wurde, wich mein individueller und emotionaler politischer Zugang einem organisierten und strategischen. Ich war zunächst KAK-Sympathisant, dann begeistertes Mitglied. Ich machte mich auf Studienreisen in die Dritte Welt auf und half dabei, Befreiungsbewegungen dort materiell zu unterstützen. Das geschah durch legale ebenso wie illegale Mittel. Meine Reisen in den Nahen Osten und nach Afrika sowie die Zusammenarbeit mit revolutionären Kräften in der Dritten Welt befeuerten die Emotionen, die mich ursprünglich zur Politik gebracht hatten, aber sie gaben mir auch ein Gefühl persönlicher Verantwortung. Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt waren jetzt keine abstrakten politischen Größen mehr, sondern sie bestanden aus wirklichen Menschen, aus Genoss:innen, denen ich mich verpflichtet fühlte. Im KAK wollten wir ein kleines Rad in der großen Maschine sein, die für eine andere Weltordnung kämpfte. Unsere Erfahrungen führten zu einem ständigen Hinterfragen von uns selbst und unserer Politik. Es war wichtig, motiviert und engagiert zu bleiben – und andere zu motivieren, sich zu engagieren.
Theorie war für uns immer von großer Bedeutung. Unsere politische Praxis beruhte auf theoretischen, strategischen und taktischen Reflexionen. Das prägte auch unsere Zusammenarbeit mit den Befreiungsbewegungen. Zuerst führten wir immer politische Diskussionen – erst danach entschieden wir, welche Form unsere Unterstützung annehmen sollte. Emotion, Theorie, Organisierung, Praxis – alles hing zusammen. Die Emotion war die Antriebskraft, die Theorie zeigte uns die Richtung an, die Organisierung gab uns eine Struktur und die Praxis brachte konkrete Resultate. Dies sollte in meinem persönlichen Fall 50 Jahre politischen Engagements prägen. Das vorliegende Buch ist der Versuch, die entsprechenden Erfahrungen zusammenzufassen.
Der Parasitenstaat
Ich erwähnte bereits, wie wichtig die Empörung über den US-Krieg in Vietnam für meine politische Entwicklung war. Ebenso wichtig war jedoch die Inspiration durch den vietnamesischen Widerstand. Der Vietnamkrieg bewies, dass ein menschliches Element – der Widerstand des Volkes, ein Volkskrieg – in der Lage war, die größte Supermacht der Welt zu besiegen.
In Dänemark wurde die Solidaritätsbewegung mit Vietnam von Jugendlichen und Student:innen getragen. Die Arbeiterklasse und ihre Organisationen waren größtenteils abwesend. Ihre Sorgen waren andere als jene der Arbeiterklasse in der Dritten Welt. Arbeiter:innen in Dänemark forderten mehr Urlaubstage, eine höhere Pension und einen Lohanstieg von einem US-Dollar pro Stunde. Arbeiter:innen in der Dritten Welt waren am Verhungern, hatten keinen einzigen freien Tag und schätzten sich glücklich, wenn sie einen US-Dollar pro Tag verdienten.
Viele Linke verstehen, dass die Sorgen der Arbeiter:innen in der Dritten Welt andere sind als die Sorgen der Arbeiter:innen in Ländern wie Dänemark. Sie verstehen auch, dass der Grund dafür eine Ungerechtigkeit ist, die unweigerlich Empörung und Forderungen nach einer neuen Weltordnung hervorbringt. Aber sie vermögen es nicht, ihre Politik dieser Realität anzupassen. Sie wagen nicht, offen zu erklären, dass die Arbeiterklasse im Globalen Norden von der gegenwärtigen Weltordnung profitiert und kein wirkliches Interesse daran hat, sie zu ändern (zumindest nicht grundlegend). Der Mangel an internationaler Solidarität, den die Arbeiterklasse in den imperialistischen Ländern zeigt, bestätigt dies. Ein berühmtes Zitat des US-Autors Upton Sinclair fasst das Problem treffend zusammen: »Es ist schwierig, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, es nicht zu verstehen.«[4]
Die Theorie vom Parasitenstaat beruhte auf solchen Einsichten. Aber es war nicht nur die Theorie des KAK, die mich ansprach. Es waren auch die Entschlossenheit und die Integrität der Mitglieder und die politische Praxis. Im KAK bestand Solidarität nicht nur aus Worten, sondern aus Handlungen. Sie war etwas, das man, wie wir zu sagen pflegten, ›in der Hand halten konnte‹. Im KAK gab es eine starke Korrelation zwischen dem, was man sagte, und dem, was man tat.
Die Theorie vom Parasitenstaat stammte von der Führungsfigur des KAK, Gotfred Appel. Er entwickelte sie in einer Reihe von Artikeln, die von 1966 bis zur Spaltung des KAK 1978 in der Zeitung der Organisation, Kommunistisk Orientering, erschienen.[5] Von den drei Gruppen, die zunächst aus dem KAK hervorgingen, überlebte nur ›Manifest – Kommunistische Arbeitsgruppe‹ (M-KA) mehr als zwei Jahre. Manifest war der Name der Zeitung, die die Gruppe herausgab. Bei M-KA verblieben auch die ehemaligen KAK-Mitglieder, die am unmittelbarsten in die illegale Praxis der Organisation involviert waren: die sogenannte Blekingegade-Gruppe.[6]
Einer der Gründe für das Ende des KAK war der leninistische Dogmatismus, der die Organisation prägte. Unter anderem hemmte dieser die theoretische Entwicklung. M-KA bot neue Möglichkeiten. Wir überarbeiteten die ökonomische Grundlage der Theorie vom Parasitenstaat, indem wir ihr Arghiri Emmanuels Konzept des ›ungleichen Tauschs‹ hinzufügten. Emmanuel betonte die Wichtigkeit der Handelsbeziehungen zwischen Ländern mit hohen bzw. niedrigen Löhnen für die Ausbeutung der Arbeiter:innen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Wir studierten auch Immanuel Wallersteins Weltsystem-Theorie, die die Geschichte des Kapitalismus vom Mittelalter bis in die Gegenwart verfolgte. Eine der zentralen Thesen Wallersteins war die Unterscheidung eines ›Zentrums‹ oder ›Kerns‹ im kapitalistischen Weltsystem von einer ausgebeuteten ›Peripherie‹.
1983 veröffentlichte M-KA das Buch Imperialismen i dag: Det ulige bytte og mulighederne for socialisme i en delt verden (Imperialismus heute: Der ungleiche Tausch und die Möglichkeiten des Sozialismus in einer geteilten Welt). Eine englische Ausgabe erschien drei Jahre später unter dem Titel Unequal Exchange and the Prospects of Socialism.[7] In dem Buch fassten wir die Theorie vom Parasitenstaat erstmals systematisch zusammen. Wir skizzierten die ökonomischen Grundlagen, die Konsequenzen für die Klassenpolitik und die Implikationen für eine antiimperialistische Praxis in den imperialistischen Ländern.
Das Ende von M-KA kam im April 1989, als mehrere Mitglieder verhaftet und der Zugehörigkeit zur Blekingegade-Gruppe angeklagt wurden. Sechs Genossen und ich wurden schließlich für mehrere Raubüberfälle und andere kriminelle Aktivitäten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.[8]
Während meiner Jahre im Gefängnis beschäftigte ich mich vor allem mit der Globalisierung und dem Neoliberalismus. Außerhalb der Gefängnismauern kam es zu wesentlichen Veränderungen. Die Sowjetunion und der europäische Staatssozialismus brachen zusammen. Die Nachfolgestaaten wurden vom kapitalistischen Weltmarkt aufgesaugt. Antiimperialistische Kämpfe in der Dritten Welt verloren an Bedeutung. Die Befreiungsbewegungen, die an die Macht gekommen waren, hatten ihre sozialistischen Prinzipien aufgegeben. Das Weltsystem selbst blieb jedoch unverändert. Die Welt war immer noch in reiche und arme Länder geteilt, und es gab keinerlei Anzeichen, dass sich dies in naher Zukunft ändern würde.
Das Verschwinden der Sowjetunion und sozialistischer Befreiungskämpfe in der Dritten Welt erforderten eine neue Orientierung der Linken. Wie ließ sich eine sozialistische Ökonomie aufbauen? Wie konnten Sozialist:innen wieder an die Macht kommen? Welche Strategien und Praxen waren dazu erforderlich?
Nachdem ich 1996 aus dem Gefängnis entlassen worden war, engagierte ich mich in der sogenannten Antiglobalisierungsbewegung. Diese war stark vom Aufstand der Zapatistas in Chiapas, Mexiko, inspiriert sowie vom Widerstand gegen die Welthandelsorganisation. Wenige Monate nach meiner Entlassung besuchte ich das erste von den Zapatistas organisierte ›Interkontinentale Treffen‹ sowie Tagungen, aus denen das Weltsozialforum hervorgehen sollte.
Angesichts der neoliberalen Globalisierung mussten bestimmte Aspekte der Theorie vom Parasitenstaat aktualisiert werden. Es gab nun transnationale Produktionsformen und eine neue globale Arbeitsteilung. Die Grundfesten der Theorie blieben jedoch aufrecht. Das sah nicht nur ich so. Eine andere Neuerung der 1990er-Jahre, das Internet, machte deutlich, dass es weltweit eine Reihe von Individuen und Gruppen gab, die die imperialistischen Formen des Tauschs studierten. Ich freute mich, nicht zu einer vom Aussterben bedrohten Art zu gehören, sondern zu einem aktiven Netzwerk von Menschen, die versuchten, das globale ökonomische System zu verstehen und Strategien für dessen Umsturz zu entwickeln. Notwendig dafür ist eine globale Perspektive.
Die Stärke des Marxismus liegt in der Analyse konkreter Zusammenhänge. Heute gibt es keine Zusammenhänge, die sich auf einzelne Länder oder Klassen beschränken lassen. Der Kapitalismus ist ein Weltsystem, dem jedes Land und jede Klasse angehören. Wir dürfen nicht der Frosch im Brunnen sein, der in Maos Anekdote sagt: »Der Himmel ist nicht größer als die Öffnung des Brunnens.«[9] Der Himmel ist größer als der Teil von ihm, den wir sehen können. Wenn wir uns nicht die Mühe machen, auch die anderen Teile zu sehen, können wir die Umstände unseres eigenen Lebens nicht hinreichend begreifen.
Die Universität und die Politik
Ich hoffe, dass dieses Buch die Mischung aus Emotion, Theorie, Organisierung und Praxis zum Ausdruck bringen wird, die mein politisches Engagement seit jeher definiert. Das war zumindest beim Schreiben mein Ziel. Das Buch ist nicht akademischer Natur, weder in seiner Struktur noch in seinen Absichten. Ich habe mich jedoch vieler akademischer Quellen bedient.
Streng genommen ist dies auch kein politisches Buch. Es wurde von keiner Organisation autorisiert, sondern drückt einzig meine eigenen Ansichten aus. Es ist ein persönlicher Text, der ein Verständnis des Imperialismus präsentiert, das auf meinen eigenen Erfahrungen als marxistischer Militanter basiert. Freilich ist es ein politisches Buch in dem Sinne, dass ich meine Ansichten erklären und für sie argumentieren will, und dass ich Menschen anregen will, selbst politisch aktiv zu werden.
Im Laufe der Jahre habe ich viele akademische Studien über den Imperialismus gelesen, ebenso wie viele Berichte von Menschen, die in antiimperialistische Kämpfe involviert waren. Zwischen diesen Texten besteht ein wesentlicher Unterschied: Akademiker:innen betrachten praktische Erfahrungen als Material, das sie auswerten können. Sie wollen die Welt verstehen und erklären. Wenn es um die Frage geht, wie man die Welt verändert, haben sie wenig zu sagen. Sie wollen nicht mit bestimmten Ideologien, Organisationen oder Methoden assoziiert werden. Sie fürchten, dass sie dies als Akademiker:innen diskreditieren würde. Die Praxis ist nicht ihr Terrain, und sie überlassen diese gerne anderen. Für Aktivist:innen ist die Theorie jedoch in erster Linie ein Werkzeug. Sie solle ihnen helfen, auf effektivere Weise zu kämpfen. Dieser Zugang prägt die Werke von Lenin und Mao sowie aller einflussreichen Figuren in den Befreiungsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg, ob Che Guevara oder Amílcar Cabral.
Die Beziehung zwischen Theorie und Praxis muss dialektisch sein. Eine Theorie, die keine Praxis inspiriert, ist keine gute Theorie. Wir können uns stundenlang über Politik unterhalten und kluge Analysen präsentieren, aber wenn wir am Ende des Tages keine Antwort auf die Frage haben, was zu tun ist, dann fehlt das Entscheidende. Gleichzeitig gibt es keine gute Praxis ohne gute Theorie. Wie sollen wir effektive Formen des Kampfes entwickeln, wenn wir die sozialen, politischen und ökonomischen Umstände nicht verstehen, unter denen wir kämpfen? Wie sollen wir unter solchen Voraussetzungen angemessene Visionen und Strategien entwickeln?
In den 1960er- und 70er-Jahren dominierten die Weltsystem-Theorie (Immanuel Wallerstein) und die Dependenztheorie (Samir Amin, Arghiri Emmanuel, Andre Gunder Frank) die Analyse des globalen ökonomischen und politischen Systems. Diese Theorien standen für die größte Innovation in der Imperialismusanalyse seit den 1920er-Jahren. Von großer Bedeutung waren auch die Ökonom:innen, die regelmäßig in der Zeitschrift Monthly Review publizierten, Leute wie Harry Magdoff, Paul A. Baran und Paul M. Sweezy.
Während die Befreiungsbewegungen in den Kolonien immer stärker wurden, bildeten sich auch immer mehr kommunistische Organisationen in der imperialistischen Welt. Leider blieben die akademischen Diskussionen von den politischen Kämpfen oft getrennt. Der gegenseitige Einfluss war gering. Beispielsweise trug die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) kaum zur Imperialismusanalyse bei, während viele prominente Persönlichkeiten der Befreiungsbewegungen nur ein bescheidenes ökonomisches Verständnis hatten (die bereits erwähnten Che Guevara und Amílcar Cabral waren bedeutende Ausnahmen). Ich weiß, dass Marx’ berühmte elfte Feuerbach-These unzählige Male zitiert worden ist, doch ich bin der Meinung, dass sie nicht oft genug zitiert werden kann: »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.«
Ich wende mich in diesem Buch großen Themen zu: der Geschichte des Imperialismus, der globalen Ökonomie, staatlichen Strukturen und Widerstandsstrategien. Es ist unmöglich, all das auf eine Weise zu beleuchten, die Akademiker:innen zufriedenstellen wird. Zudem vermische ich politische Reflexionen mit persönlichen Erinnerungen. Ich verwende theoretische Konzepte, ohne mich einer bestimmten Ideologie zu verpflichten. Ich folge keiner festgelegten politischen Linie. Mit Dogmatismus habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Der strikte Leninismus des KAK stand theoretischer Innovation im Wege, und unsere Feindseligkeit allen vermeintlichen ›Abweichlern‹ gegenüber verhinderte produktiven intellektuellen Austausch. Es gibt Aspekte der politischen Kultur der 1970er-Jahre, die ich nicht vermisse.
Methodologie und Epistemologie
Sollte es ein akademisches Label für die Methode brauchen, derer ich mich in diesem Buch bediene, dann wäre wohl ›Eklektizismus‹ angebracht. Ich berufe mich auf verschiedene Theorien, manche scheinen sogar miteinander unvereinbar. Was sich als roter Faden durch das Buch zieht, sind meine politischen Überzeugungen.
Im KAK waren theoretische Studien von großer Bedeutung. Wir beschränkten uns nicht nur auf Politik und Ökonomie, wir studierten auch Wissenschaftstheorie und Philosophie. 1975 führten wir einen Lesekreis zum dialektischen Materialismus durch, den ich besonders wertvoll fand. Es ist ein berauschendes Gefühl, wenn du meinst, den Lauf der Welt zu verstehen. Die philosophischen Studien bildeten den Hintergrund für unsere politischen und ökonomischen Diskussionen und unsere Reisen. Am wichtigsten war immer die Entwicklung einer effektiven politischen Praxis.
Es gibt eine wichtige Unterscheidung zwischen der Welt an sich und der Welt für uns, also unserer Interpretation der Welt. Es gibt eine Welt, die existiert, egal, ob wir existieren oder nicht. Doch wir interpretieren die Welt auf je unterschiedliche Weise. Unsere Interpretationen ergeben keine Rangordnung. Es macht keinen Sinn, zu diskutieren, wer der Welt an sich am nächsten kommt. Die Welt für uns ist kein Spiegelbild der Welt an sich, sondern der Rahmen, in dem wir sie wahrnehmen. Es ist wie mit Brillen: Die Form und Farbe ihrer Gläser bestimmt, was wir sehen. Bestimmte Aspekte der Wirklichkeit treten stärker hervor als andere. Jede Form des Wissens beruht auf Interpretation. Das macht Kategorien wie ›wahr‹ und ›falsch‹ nicht bedeutungslos. Aber was ›wahr‹ und ›falsch‹ ist, hängt von der Perspektive ab, die wir einnehmen.
Man könnte meinen, dass, wenn man die Welt nur durch eine Brille wahrnehmen kann, ein Tunnelblick unvermeidlich ist. Aber dem ist nicht so, zumindest dann nicht, wenn wir uns der Brille bewusst sind und bereit sind, die Bilder, die sie uns vermittelt, kritisch zu prüfen. Auf diese Weise können wir sowohl einen unkritischen Universalismus als auch einen willkürlichen Relativismus vermeiden. Diskussion bleibt möglich.
Meine Perspektive ist eine materialistische. Das beinhaltet unter anderem die Überzeugung, dass die Art und Weise, wie wir Waren produzieren und verteilen, unsere Interpretation der Welt wesentlich beeinflusst. Die Bedingungen, unter denen Menschen leben und arbeiten, bestimmen, wie sie denken. Unsere Sozialisierung ist weder mechanisch noch deterministisch, sondern dialektisch.
Die Geschichte lässt sich meines Erachtens am besten mithilfe des historischen Materialismus verstehen. Den Kapitalismus gibt es seit 500 Jahren. Er hatte einen Anfang, und er wird ein Ende haben, wie jedes menschliche System. Wir neigen dazu, das zu vergessen, und können uns kaum vorstellen, dass die Institutionen, die heute unser Leben kontrollieren, eines Tages verschwunden sein werden.
Ein materialistisches Verständnis der Geschichte impliziert nicht nur ein Verständnis der ökonomischen Entwicklungen, sondern auch der Klassenbeziehungen. Die Klassenverhältnisse zwingen den Kapitalismus dazu, ständig seine Form zu ändern. Die Geschichte ist ein fortlaufender Prozess, der nie endet. Die Welt ändert sich nicht graduell, sondern in der Form von Brüchen. Allerdings dürfen wir den historischen Materialismus nicht mit Teleologie verwechseln. Es gibt keinen automatischen Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus. Gesellschaftliche Entwicklungen sind komplex und unvorhersehbar, und wir wissen nicht, wie die Gesellschaft in 50 Jahren aussehen wird. Unter gewissen Perioden sind Gesellschaftssysteme relativ stabil und behaupten sich, selbst wenn revolutionäre Bewegungen versuchen, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Gleichzeitig verändern sie sich. Tritt eine strukturelle Krise ein, werden sie instabil und können sich nicht länger behaupten. Revolutionäre Bewegungen kommt in diesen Momenten eine besondere Bedeutung zu. Es sind diese Momente, in denen ein Schuhputzer, der sich aus Protest das Leben nimmt, zum Schmetterling wird, dessen Flügelschlag in einem anderen Teil der Welt einen Sturm auslöst. Die Beziehung zwischen gesellschaftlichen Strukturen, die Menschen formen, und Menschen, die gesellschaftliche Strukturen formen, ist komplex.
Wenn ich dies in eine kurze Beschreibung der Welt übersetze, in der wir leben, lässt sich Folgendes festhalten: Die Welt ist in reiche und arme Länder geteilt. Diese Teilung hat ökonomische Gründe und wird in den Klassenbeziehungen und politischen Strukturen reflektiert.
An die Leser:innen
Das vorliegende Buch besteht aus drei Teilen. Teil eins skizziert die Geschichte des Imperialismus und der Imperialismustheorie bis 1989. Ich konzentriere mich dabei auf jene theoretischen Beiträge, die von besonderer Bedeutung für mich und den KAK waren. Das Jahr 1989 markierte nicht nur eine geopolitische, sondern auch eine persönliche Wende. Als die Berliner Mauer fiel, stand ich mit mehreren Genossen vor längeren Gefängnisstrafen. M-KA löste sich auf. Mein Rückblick auf die Theorien, die uns beeinflussten, besteht aus einer Mischung von Reflexionen, Anekdoten und Zitaten. Ich hoffe, dass Leser:innen, die sich in diese Theorien vertiefen wollen, auf genug Information stoßen, um dies zu tun.
Es sind vor allem zwei Gründe, die erklären, warum ich bei der Geschichtsbeschreibung des Imperialismus bis zu den Anfängen Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgehe. Erstens ist es wichtig, die Kontinuität des Imperialismus zu betonen. Zweitens ist es wichtig, unterschiedliche Analysen des Imperialismus zu berücksichtigen, zumal diese mit unterschiedlichen Formen politischer Praxis verbunden sind. Das ist von besonderer Bedeutung in den imperialistischen Ländern, wo der Kampf gegen den Imperialismus nie ein zentraler Teil der Linken war. Linke in den imperialistischen Ländern leiden nicht unter dem Imperialismus. Der antiimperialistische Kampf richtet sich gegen Ungerechtigkeiten, die sie nicht selbst erfahren, und hat wenig mit den Konflikten vor Ort zu tun. Linke in den imperialistischen Ländern werden nicht zum Antiimperialismus gezwungen, sie wählen ihn. Dabei kommt es zu unterschiedlichen analytischen Einschätzungen.
Der zweite Teil des Buches widmet sich der gegenwärtigen Form des Imperialismus. Welche Rolle spielt er für den gegenwärtigen Kapitalismus? Wie wirkt er sich auf die weltweiten Klassenbeziehungen aus? Ich werfe dabei auch einen Blick auf die Beiträge zur Imperialismustheorie nach 1989.
Teil drei widmet sich den politischen Konsequenzen unserer Analysen des Imperialismus, sowohl im Globalen Norden als auch im Süden. Wie sehen die politischen Bedingungen aus? Wer sind die wichtigsten Akteure? Was sind mögliche Widerstandsformen? Wie kann antiimperialistische Praxis aussehen? Soll man versuchen, sich von der neoliberalen Globalisierung abzukoppeln und sich auf den eigenen Nationalstaat konzentrieren? Lässt sich dem globalen Kapitalismus mit globalem Widerstand beikommen? Sind nationale Befreiungsbewegungen noch ein Faktor? Was können internationale Gewerkschaftsorganisationen ausrichten? Lässt sich auf soziale Bewegungen setzen? Ist antiimperialistische Politik in imperialistischen Ländern möglich? Das sind einige der Fragen, mit denen ich die Diskussionen in Gang setzen will, die wir meines Erachtens führen müssen.
Teil eins Die Geschichte des Imperialismus – eine persönliche Perspektive
»Ist die Konstruktion der Zukunft und das Fertigwerden für alle Zeiten nicht unsere Sache, so ist desto gewisser, was wir gegenwärtig zu vollbringen haben, ich meine die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden, rücksichtslos sowohl in dem Sinne, dass die Kritik sich nicht vor ihren Resultaten fürchtet und ebensowenig vor dem Konflikte mit den vorhandenen Mächten. ... Wir treten dann nicht der Welt doktrinär mit einem neuen Prinzip entgegen: Hier ist die Wahrheit, hier kniee nieder! Wir entwickeln der Welt aus den Prinzipien der Welt neue Prinzipien. Wir sagen ihr nicht: Lass ab von deinen Kämpfen, sie sind dummes Zeug; wir wollen dir die wahre Parole des Kampfes zuschrein. Wir zeigen ihr nur, warum sie eigentlich kämpft, und das Bewusstsein ist eine Sache, die sie sich aneignen muss, wenn sie auch nicht will.« (Brief von Karl Marx an Arnold Ruge, September 1843)
1. Eine geteilte Welt
Kolonialismus und Kapitalismus
Kolonialismus und Kapitalismus strukturierten die Welt, in der wir leben, und etablierten die Normen, denen wir folgen. Wenn wir ein Geburtsjahr für das kapitalistische Weltsystem angeben müssen, dann scheint 1492 die selbstverständliche Wahl zu sein. Als Resultat der fehlgeschlagenen Suche von Christopher Kolumbus nach einem neuen Seeweg nach Indien begann 1492 die militärische, ökonomische, politische und kulturelle Eroberung der Welt durch europäische Mächte. Gleichzeitig begann in Europa der Kapitalismus den Feudalismus abzulösen. Die Geschichte des Kapitalismus ist also untrennbar mit jener des Kolonialismus verbunden. Der Kapitalismus hat seit jeher eine globale Dimension.
Zwischen 1000 und 1500 war die Welt in drei Blöcke aufgeteilt: China und Indien waren ökonomisch und politisch am weitesten fortgeschritten, der Nahe Osten war der Nabel des Welthandels, und Europa war ein Teil der Peripherie. Die asiatische Produktionsweise war vielfältiger, effektiver und technologisch weiter entwickelt als alles, was Europa zu bieten hatte. Asien war bis ins 18. Jahrhundert die Heimat der fortgeschrittensten Zivilisationen und Staatssysteme. Es gab sogar rudimentäre Formen des Kapitalismus, zum Beispiel während der Song-Dynastie in China oder im arabisch-persischen Abbasiden-Kalifat. Mit der Ausdehnung des Welthandels wurde der Tauschwert von Waren zunehmend wichtiger als ihr Gebrauchswert.
In Europa entwickelten die italienischen Stadtstaaten im 15. Jahrhundert komplexe Finanzsysteme und Handelsbeziehungen. Der Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen, entstand jedoch zwischen London, Paris und Amsterdam. Von dort dehnte er sich schließlich bis in den letzten Winkel der Erde aus. Die frühe Ausbreitung des Kapitalismus basierte wesentlich auf militärischer Macht, vor allem jener der europäischen Kriegsflotten. Von entscheidender Rolle waren die Seefahrernationen Spanien und Portugal. Die herrschenden Klassen Europas vermochten den Osten nicht politisch zu erobern, also konzentrierten sie sich darauf, die ökonomische Kontrolle an sich zu reißen und suchten nach neuen Handelsrouten (Kolumbus dachte bis zu seinem Tod, dass Amerika Teil des asiatischen Kontinents sei).
Die Eroberung der sogenannten Neuen Welt und die Ausbeutung ihrer Reichtümer gab dem europäischen Kapitalismus enormen Auftrieb. Die wichtigsten Produkte, die aus den spanischen Kolonien Lateinamerikas nach Europa gelangten, waren Gold und Silber. Die Zahlungsmittel waren bei den herrschenden Klassen heiß begehrt und stärkten ihre Position als Handelsleute. Die europäischen Könige, Prinzen, Adeligen und Kleriker waren unersättlich.[10] Es wuchs eine neue europäische Bourgeoisie heran, die, ebenso wie die immer zahlreicheren Staatsbeamten, nach Waren aus den Kolonien verlangten.
Gold und Silber kamen in enormen Mengen nach Europa, vor allem aus Mexiko und Peru. In Spanien wurden Gold- und Silbermünzen geprägt, die sich bald in ganz Europa wiederfanden. Sie befriedigten das Bedürfnis des Kapitalismus nach Wachstum, stärkten den innereuropäischen Handel und erlaubten es, Waren aus Asien zu importieren. Europa produzierte zu jener Zeit keine Waren, die für asiatische Handelsleute von Interesse gewesen wären. Leo Huberman, Mitbegründer des Monthly Review, schrieb:
»Von 1500 bis 1520 verarbeitete die spanische Münzanstalt 45.000 Kilogramm Silber. In den 15 Jahren von 1545 bis 1560 versechsfachte sich die Produktion auf insgesamt 270.000 Kilogramm. Und in den 20 Jahren von 1580 bis 1600 lag sie bei 340.000 Kilogramm, beinahe das Achtfache der Produktion zu Beginn des Jahrhunderts. Blieb all das Silber, das aus den Amerikas gekommen war, in Spanien? Keineswegs. Sobald es die Münzanstalt verlassen hatte, zirkulierte es in ganz Europa.«[11]
In Anlehnung an Andre Gunder Frank können wir sagen, dass während der Anfänge des Kapitalismus nicht Europa die Welt formte, sondern die Welt Europa. Es war noch ein weiter Weg bis zur globalen Hegemonie des europäischen Kapitalismus.
Portugiesischer und – vor allem – spanischer Kolonialismus beruhte nicht auf starkem Handelskapital, sondern auf königlicher Macht. Das erklärt, warum die portugiesische und spanische Kolonialherrschaft von Gewalt und Unterdrückung geprägt war, nicht von Handel. Portugal und Spanien hatten wenig, mit dem sie Handeln konnten. Die arabischen Handelsleute, auf die sie an der afrikanischen Ostküste trafen, hatten kein Interesse daran, mit ihnen ins Geschäft zu kommen, da sie bereits lukrative Beziehungen zum arabischen Golf, Indien und afrikanischen Küstengebieten unterhielten. Aber was Portugal und Spanien nicht mithilfe von Handelswaren bekamen, bekamen sie mithilfe von Kanonen. Mit diesen konnten die arabischen Handelsleute nicht konkurrieren. Es waren die Waffen, die den europäischen Mächten die Tore zum globalen Markt öffneten.
In der Kriegsführung war man in Europa erfahren. Der Feudalismus wurde von gewaltsamen Konflikten geprägt, und militärische Strategie und Technologie waren entsprechend weit fortgeschritten. Keine militärische Macht außerhalb Europas (eventuell mit Ausnahme des Osmanischen Reichs) konnte da mithalten. Artillerie etablierte die Herrschaft Portugals im Indischen Ozean, Rüstungen und Schwerter aus Spanien zerstörten die Kulturen der Inka und Maya.
Die kolonialen Expeditionen Portugals und Spaniens Anfang des 16. Jahrhunderts halfen dabei, das feudale Begehren nach Luxus zu befriedigen. Sie waren gut ausgerüstet, kehrten mit reicher Beute heim und brachten enorme Profite. Anfangs war der portugiesische und spanische Kolonialismus eher feudal als kapitalistisch. Doch bald zeigten auch die anderen europäischen Mächte Interesse am Handel mit Afrika, Indien und Amerika. Portugal und Spanien profitierten davon nicht. Die herrschenden Klassen der Länder hatten ihr Gold und ihr Silber dazu verwendet, Waren zu kaufen, die in England, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden hergestellt wurden. Dadurch wurde die Warenproduktion in diesen Ländern gestärkt, nicht in Portugal und Spanien. Während die iberische Halbinsel im Feudalismus steckenblieb, dehnte sich der Kapitalismus in West- und Nordeuropa rasch aus. Es ist kein Zufall, dass die Paläste und Kirchen Portugals und Spaniens so prächtig sind. Adel, Rittertum, Staatsdiener und Kleriker standen an der Spitze der gesellschaftlichen Leiter, Bettler:innen an deren Ende. Als Portugal und Spanien vom Import von Konsumwaren und Nahrungsmitteln immer abhängiger wurden, und die Kolonien immer höhere Kosten verursachten, verloren sie ihre globale Führungsrolle. Eine neue Kraft hatte die Herrschaft übernommen: das niederländische Handelskapital.
Ideologisch drückte sich diese Transformation in einem religiösen Konflikt aus. Wir kennen alle Max Webers Behauptung, dass der Protestantismus der Wegbereiter des Kapitalismus gewesen sei. Aber die Behauptung ist falsch. Der Protestantismus war eine Folge des Kapitalismus. Als der frühe Kapitalismus die feudale Produktionsweise herausforderte, forderte er auch deren ideologische Grundlagen heraus. Die Metaphysik des Mittelalters wurde durch die moderne Wissenschaft ersetzt. Die ideologische Grundlage des Feudalismus war der Katholizismus. Daher mussten antifeudale Kräfte sich auch gegen diesen zur Wehr setzen. Das stärkte wiederum die protestantische Bewegung. 1517 nagelte Martin Luther seine antikatholischen Thesen an das Eingangstor der Kirche in Wittenberg. Nur wenige Jahre später tobten in Europa Religionskriege. Die Reformation in Deutschland war die erste ideologische Attacke des Bürgertums gegen den Feudalismus. In den Städten, aber auch unter der Bauernschaft und den niederen Schichten des Adels war es einfach, Anhänger zu finden. Alle hatten ihre Gründe, gegen die katholische Kirche zu rebellieren.
Die niederen Schichten des Adels waren während des ersten protestantischen Aufstands 1523 federführend. 1525 standen die Bauern an der Spitze. Beide Aufstände wurden niedergeschlagen, aber die protestantische Bewegung überlebte. Mit John Calvin als Anführer wurde sie stärker. Calvin war politischer als Luthers und unterstützte den Republikanismus. Die Werte, die er predigte, entsprachen den Zielen des Bürgertums. Er pries Unternehmergeist ebenso wie Sparsamkeit. Die Wissenschaft sah er als Quelle des Fortschritts, Regierung und Justiz von der Religion getrennt.
Besonders ausgeprägt war die politische Dimension des Calvinismus in den Niederlanden. Hier begeisterte er bürgerliche Handelsleute und erhielt eine deutlich nationalistische Prägung, da die niederländischen Provinzen Unabhängigkeit von Spanien verlangten. Die spanische Regierung versuchte, die Rebellion mithilfe des Militärs und der Inquisition niederzuschlagen; ganze Städte wurden belagert, die Bevölkerung massakriert. Aber der Kampfgeist der Niederländer:innen war nicht zu bändigen, außerdem kamen ihnen 6.000 englische Soldaten zu Hilfe. Dies wiederum weckte den Zorn des Papstes, der in Königin Elisabeth eine ›Häretikerin‹ sah. Als Spanien versuchte, England anzugreifen, wurde die spanische Marine von 130 Schiffen und 30.000 Soldaten im Ärmelkanal aufgerieben. Es war eine fürchterliche Niederlage, die das Ende Spaniens als globale Seemacht markierte. Die Niederlande hatten hingegen das Steuer in der globalen Ausdehnung des Kapitalismus übernommen. Mitte des 17. Jahrhunderts war die niederländische Handelsflotte größer als die Englands und Frankreichs zusammengenommen.
Sklaverei
Der Aufstieg des Handelskapitalismus bedeutete nicht, dass sich die Warenproduktion verringerte. Die Institutionalisierung der Sklaverei bestätigt dies. Nachdem Portugal und Spanien die meisten der leicht zugänglichen Metalle in ihren amerikanischen Kolonien geplündert hatten, waren sie gezwungen, tiefer in die Erde zu graben. Sie zwangen Indigene in den Bergwerken und auf den Feldern zu arbeiten, aber diese waren schwierig zu disziplinieren. Viele von ihnen starben aufgrund der harten Arbeit und an aus Europa eingeschleppten Krankheiten wie den Pocken. Die indigenen Gesellschaften wurden dezimiert, ihre Kultur missachtet. Inka und Azteken hatten zentralisierte Gesellschaftssysteme geschaffen mit Bewässerungssystemen und einer effektiven Produktion und Distribution von Nahrungsmitteln. Nun herrschte Hunger. Innerhalb kurzer Zeit standen die indigenen Bevölkerungen in den portugiesischen und spanischen Kolonien vor der Auslöschung. 1492 lebten etwa 50 Millionen Menschen in Zentral- und Südamerika. Ende des 17. Jahrhunderts waren es vier Millionen Menschen. In Mexiko fiel die Bevölkerungszahl von 25 Millionen im Jahr 1519 auf 1,25 Millionen im Jahr 1605.[12] Für die Kolonialherren bedeutete dies einen Mangel an Arbeitskraft. Die Antwort darauf waren afrikanische Sklav:innen.
Anfangs nahmen die Portugiesen selbst Sklav:innen an der Westküste Afrikas gefangen. Später lagerten sie diese Arbeit aus. Die Sklavenjagd wurde nun von afrikanischen Herrschern übernommen, die Sklav:innen gegen europäische Waren eintauschten. Andere europäische Mächte folgten: England, Frankreich, die Niederlande und Dänemark. Von Senegal bis Angola wurden an der Küste Handelsposten etabliert. Bald wurde es notwendig, tiefer in den Kontinent vorzudringen, um die steigende Nachfrage nach afrikanischer Arbeitskraft zu befriedigen.
Der Sklavenhandel verursachte zahlreiche Konflikte zwischen afrikanischen Gesellschaften aufgrund der Waren, die er auf den Kontinent brachte: Kleider und, vor allem, Waffen. Was wir heute ›Tribalismus‹ nennen, ist das Produkt des europäischen Kolonialismus. Die Jagd nach Gold und Silber hatte die Gesellschaften Amerikas zerstört, nun zerstörte die Jagd nach Sklav:innen die Gesellschaften Afrikas – und nicht nur aufgrund all jener Menschen, die verschleppt wurden und ihr Leben lassen mussten. Auch die europäischen Waren, die nun auf dem Kontinent zirkulierten, wirkten sich fatal auf afrikanische Gesellschaften aus. Sie unterminierten lokales Handwerk und Handel. Einige der afrikanischen Gesellschaften ließen sich auf der Flucht vor Sklavenjägern in völlig neuen Regionen nieder. Die menschlichen Kosten waren enorm: Zehn bis zwölf Millionen afrikanischer Sklav:innen kamen an den Küsten Amerikas an. Schätzungsweise starben dreimal so viele während der Passage. Auch die auf dem afrikanischen Kontinent verbliebenen Gesellschaften wurden dezimiert. Viele Afrikaner:innen fielen europäischen Krankheiten zum Opfer oder starben in Konflikten, die von den europäischen Kolonialmächten provoziert worden waren. Von 1450 bis 1870 gab es in Afrika kein Bevölkerungswachstum.
Im 16. und 17. Jahrhundert musstendie meisten Sklav:innen in Amerika in portugiesischen und spanischen Bergwerken arbeiten, vor allem in den Silberminen Brasiliens. Am Ende des 17. Jahrhunderts gewannen Plantagen immer mehr an wirtschaftlicher Bedeutung. England hatte um 1650 damit begonnen, Zuckerrohr auf Barbados anzubauen. Zuvor war Honig der einzige in Europa erhältliche Süßstoff gewesen. Zucker war anfangs so wertvoll, dass er in Gramm verkauft wurde. Es dauerte jedoch nur wenige Jahrzehnte, bevor er in europäischen Haushalten eine Selbstverständlichkeit und damit eine der wichtigsten Kolonialwaren wurde.
1643 gab es auf Barbados ungefähr 5.000 afrikanische Sklav:innen. 1664 waren es 40.000, die auf 800 Plantagen arbeiteten. Die frühere Subsistenzwirtschaft auf Barbados war praktisch ausgelöscht worden. Die Hälfte der ursprünglichen europäischen Siedler:innen hatte die Insel wieder verlassen. Ähnlich verhielt es sich auf den meisten der karibischen Inseln. Zur Hochzeit des Sklavenhandels im späten 18. Jahrhundert lag das Verhältnis von europäischen Siedler:innen und afrikanischen Sklav:innen in den englischen Kolonien Westindiens bei 1:10, in den französischen bei 1:14 und in den niederländischen bei 1:24. Neben Zuckerrohr pflanzten und ernteten Sklav:innen vor allem Tabak, Kaffee und Kakao. Diese galten als Luxusgüter, waren einfach zu produzieren und komplettierten den Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika. Aus Europa brachten die Schiffe Fertigerzeugnisse wie Kleider, Waffen, Munition und Alkohol nach Afrika, aus Afrika Sklav:innen nach Amerika, und aus Amerika Zucker, Tabak, Kaffee, Indigo, Baumwolle und andere Kolonialwaren nach Europa. Es arbeiteten mindestens so viele Menschen auf den Plantagen in den Kolonien wie in den Fabriken auf dem europäischen Kontinent.
Afrika war zu jener Zeit noch nicht richtig kolonisiert. Es diente primär als Quelle für Arbeitskraft. Die europäische Präsenz beschränkte sich auf Handelsposten an der afrikanischen Küste. Die Kolonisierung setzte ein, als die Handelsposten ausgebaut wurden, um die immer zahlreicheren Handelsschiffe zu versorgen, die zwischen Europa und Asien verkehrten. Die Kapkolonie, ursprünglich in niederländischer Hand, war von besonderer Bedeutung – von so besonderer, dass England Anfang des 19. Jahrhunderts Besitz von ihr ergriff. Viele europäische Siedler:innen ließen sich im Süden Afrikas nieder und errichteten Werkstätten und Fabriken. Nach wie vor drangen jedoch wenige Europäer:innen in das Innere des Kontinents vor.
An der Westküste Afrikas Sklav:innen zu fangen, wurde im 18. Jahrhundert zunehmend schwieriger. Die Brutalität des Sklavenhandels hatte viele der lokalen Gesellschaften ausgelöscht oder vertrieben. Die britische Regierung zeigte nun mehr Interesse an Afrika als Teil eines Imperiums, das das Mutterland mit Rohstoffen und Bodenschätzen versorgen sollte. Auf die Initiative des britischen Bürgertums hin wurde der Sklavenhandel 1806 verboten. Die Sklaverei als solche war damit jedoch nicht zu Ende, da die Plantagenbesitzer sich nun bemühten, die Arbeitskraft der Sklav:innen mithilfe einer höheren Geburtenrate zu reproduzieren.[13]
Ein globaler Markt war entstanden, der die Teilung der Welt in ein Zentrum und eine Peripherie zur Folge hatte. Die fürchterlichen Konsequenzen dieser Teilung für die indigenen Völker Amerikas und Afrikas haben wir bereits skizziert. In Asien nahmen die Niederlande die indonesischen Inseln in Besitz, die britische Regierung machte sich Indien untertan. Nach wie vor gründete sich die Kolonisierung wesentlich auf militärische Gewalt. Doch der Widerstand war groß, und die europäischen Mächte zahlten einen hohen Preis. Sie begannen daher vermehrt auf Bündnisse mit lokalen Herrschern zurückgreifen, die einerseits bereit waren, europäischen Interessen zu dienen, andererseits jedoch die lokalen Gesellschaftsstrukturen und kulturellen Traditionen intakt ließen.
Der niederländische Handelskapitalismus
Das niederländische Handelsimperium gründete sich auf der historischen Rolle des Landes als Handelszentrum, der hoch entwickelten Warenproduktion und der Abwesenheit feudaler Strukturen. Im 14. Jahrhundert war Brügge die wichtigste Handelsstadt Mittel- und Nordeuropas. So richtig blühte das niederländische Handelskapital jedoch in Antwerpen auf. Dort gab es, anders als in Brügge, keine restriktiven Gilden. Beim Eingang zur Antwerpener Börse grüßten die Worte: »Offen für Händler aller Länder!« Antwerpen stand Spanien immer nahe, und von dort kam nach wie vor das meiste Geld. Erst als sich das niederländische Handelskapital über die ganze Welt verbreitet hatte, verschob sich sein Zentrum von Antwerpen nach Amsterdam.
Früh wurden in den Niederlanden Waren verarbeitet. Die Textilproduktion hat eine reiche Tradition in Flandern, das im 17. Jahrhundert einen starken ökonomischen Aufschwung erlebte. Die Papierproduktion war hoch entwickelt, und die Werften waren führend in der Welt. Diese Branchen verlangten eine hohe Konzentration von Kapital.





























