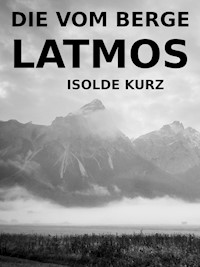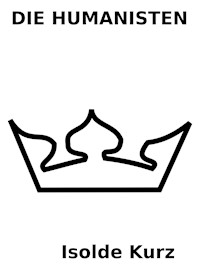Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Glücksnummern ist eine Erzählung von Isolde Kurz. Auszug: Es war ein ungewöhnlich langer und harter Frost über Florenz gekommen. Die Berge trugen ununterbrochen ihr weißes Winterkleid und nun war auch in der Stadt ziemlich starker Schnee gefallen, der allem Brauch zuwider liegen blieb. Am Abend zuvor war Florenz noch wie sonst zu Bette gegangen; beim Aufwachen erkannte es sich selbst nicht mehr. Totenstille in den Straßen, die unter einem weißen Bahrtuch begraben liegen, Omnibusse und Droschkenkutscher haben ihre Fahrten eingestellt, die Schuljugend macht sich Ferien, und wen nicht dringende Geschäfte hinaustreiben, der setzt heute den Fuß nicht vor die Thüre. Die Sonne, die man sonst in solchen Fällen sorgen ließ, versagte diesmal ihre Schuldigkeit, und so wußten sich die Väter der Stadt keinen Rat, als am Nachmittag gegen den Eindringling die Feuerspritzen aufmarschieren zu lassen, aber dieser hatte nun die Bosheit, sich unter den Händen der staunenden Pompiers in Glatteis zu verwandeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 53
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Glücksnummern
Die GlücksnummernAnmerkungenImpressumDie Glücksnummern
Es war ein ungewöhnlich langer und harter Frost über Florenz gekommen. Die Berge trugen ununterbrochen ihr weißes Winterkleid und nun war auch in der Stadt ziemlich starker Schnee gefallen, der allem Brauch zuwider liegen blieb. Am Abend zuvor war Florenz noch wie sonst zu Bette gegangen; beim Aufwachen erkannte es sich selbst nicht mehr. Totenstille in den Straßen, die unter einem weißen Bahrtuch begraben liegen, Omnibusse und Droschkenkutscher haben ihre Fahrten eingestellt, die Schuljugend macht sich Ferien, und wen nicht dringende Geschäfte hinaustreiben, der setzt heute den Fuß nicht vor die Thüre. Die Sonne, die man sonst in solchen Fällen sorgen ließ, versagte diesmal ihre Schuldigkeit, und so wußten sich die Väter der Stadt keinen Rat, als am Nachmittag gegen den Eindringling die Feuerspritzen aufmarschieren zu lassen, aber dieser hatte nun die Bosheit, sich unter den Händen der staunenden Pompiers in Glatteis zu verwandeln.
Freilich Via Calzajuoli und Piazza Signoria hatten gut lachen über diesen Schildbürgerstreich, dort schufen ja der immer weiter fallende Schnee und die Tausende von Menschenfüßen den harten Boden doch bald wieder zu flüssigem Leim, aber die äußeren Stadtviertel waren auf ein paar Tage fast vom Verkehr abgeschnitten. Besonders die Via della Scala glich einem langen Laken, dessen fleckenlose Weiße kaum auf beiden Seiten des Trottoirs durch spärliche Fußstapfen unterbrochen war. Nur von Zeit zu Zeit tauchten ein paar Gassenjungen da und dort an den Ecken auf und versuchten, ob sich das kalte weiße Ding nicht zu festen Klumpen ballen lasse, womit man die wenigen Vorübergehenden belästigen könne. Aber auch diesen wurde der Spaß bald zu frostig, und sie verschwanden wieder, woher sie gekommen.
Aus dem vergitterten Parterrefenster eines unschönen, grauen Hauses tönte ununterbrochenes Rasseln einer Nähmaschine. Wer von den Vorübergehenden zufällig nach jener Seite blickte, der sah einen schwarzen hochgekämmten, mit gelben Metallnadeln besteckten Mädchenkopf über die Maschine gebeugt, hohe, schmale Schultern und den langen, leicht gewölbten Rücken, der die florentinische Rasse kennzeichnet. Richtete sich jedoch der Kopf zufällig gerade in die Höhe, so blickte man in ein paar hübsche, schwarze Augen von rundlicher Form mit stark geschwungenen Brauen darüber und in ein volles, blasses Gesicht von angenehmen Zügen, überflüssig mit grobem Reismehl bestreut. Später als der kurze Tag zu sinken anfing, drückte sich das blasse Gesicht von Zeit zu Zeit an die Scheiben und spähte mit einem Ausdruck von Aengstlichkeit die lange, leere Straße hinab, die heute nicht wie sonst durch das Pfeifen und Rasseln der Straßenbahn belebt war, denn die Tramwaygeleise waren besonders freigebig mit Wasser bedacht worden und deshalb vor Glätte unbenützbar. Dies dauerte aber nur eine Sekunde, dann verschwand der Kopf wieder, und das Rasseln der Nähmaschine begann aufs neue.
Wer nun geglaubt hätte, daß das hübsche Mädchen nach einem Geliebten ausblicke, der würde sich gewaltig geirrt haben. Cherubina besaß zwar, wie es sich für eine zwanzigjährige Florentinerin ihres Standes schickt, den üblichen Bräutigam, aber nach diesem aus dem Fenster zu spähen, wäre ihr niemals in den Sinn gekommen; auch wußte sie ganz gut, daß er um diese Zeit noch in der Schusterwerkstätte seines Meisters saß. Auf wen aber wartete sie denn? Sie spähte die Straße hinab, ob ihre Mutter noch nicht zurückkomme, denn die hübsche Cherubina war allein in der dämmernden Wohnung, und sie fürchtete sich.
Weil sie sich fürchtete, hatte sie die Maschine an das Fenster gerückt und sich selber so gesetzt, daß sie der Thür den Rücken kehrte. Diese Thür ging nämlich auf einen dunklen Gang, der nach einer langen, steilen Treppe führte, und zu dieser Treppe hatten sie vor drei Wochen die tote Cesira heruntergetragen.
Die Cesira war all die Jahre her ihre Freundin gewesen, seitdem Cherubinas Vater aus Gründen, die sich der Oeffentlichkeit entzogen, in der Stille von seinem Posten im Zollamt entfernt und dadurch mit seiner Familie genötigt worden war, diese billige Parterrewohnung in einem der ältesten Häuser der Via della Scala zu beziehen. Die beiden Mädchen hatten gute Nachbarschaft gehalten, obgleich Cherubina nie vergaß, daß der Umgang doch unter ihrem Stande war, denn die Teresa, Cesiras Mutter, die immer ohne Hut ging, mußte sich als Flicknähterin ihr Brot in fremden Häusern verdienen, und des Vaters Name wurde nie genannt, aber deshalb wußte ja doch alle Welt, daß er bei dem berüchtigten Bombenprozeß auf Lebenszeit in das Zuchthaus von Volterra gekommen war und dort Muße hatte, über die Verbesserung der gesellschaftlichen Zustände mittelst Sprengstoffs nachzudenken. Dann hatte die Cesira einen Mann genommen, ein unverhofftes Glück, obwohl er nicht mehr jung und Witwer war. Aber nicht länger als ein Jahr hatte die Freude gedauert, da begann die Cesira zu husten und schwand ihrem Mann unter den Händen weg wie eine brennende Kerze. Auf der Brust war sie von jeher schwach gewesen, und die Ankunft des Kindes hatte ihrer Gesundheit einen Stoß gegeben, von dem sie sich nicht mehr erholte. Da brachte der brave Gioacchino die Cesira zu ihrer Mutter zurück, denn er selber konnte sie nicht pflegen, weil er den ganzen Tag auf dem Kutschbock saß, und vor dem Spital fürchtete sich die Kranke so schrecklich, daß sie lieber auf der Straße gestorben wäre.
In dieser schweren Zeit da zeigte sich's denn, was es heißen will, Hausgenossen zu haben, wie die Cherubina und ihre Mutter. Die beiden thaten für die Unglückliche, was das Evangelium vorschreibt, und sie hatten manche Nacht am Bette Cesiras gewacht, wenn die Teresa vor Erschöpfung sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, und die arme Schwindsüchtige an ihrem Husten zu ersticken glaubte. Das waren schwere Stunden gewesen: so oft die Cesira einen Männertritt auf der Treppe vernahm, klammerte sie sich mit ihren mageren Händen am Bettrand fest und jammerte, daß sie nicht im Spital sterben wolle. Sie werde ihnen ja gewiß die Pflege lohnen, denn sie wolle den lieben Gott im Himmel um ein Terno für ihre Mutter bitten, und die Hälfte davon solle die Cherubina für ihre Aussteuer haben. Dann weinte sie wieder und zählte die Tage bis Weihnachten und flehte, der liebe Gott möchte sie doch nicht vor dem Christfest sterben lassen, obgleich die Kapaunen in Reis, die an diesem Tag auch bei der Teresa nicht fehlten, für ihren armen Magen schon viel zu schwer waren.