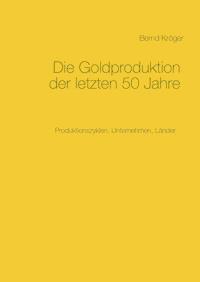
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Goldproduktion - die letzten 50 Jahre beschreibt die Entwicklung der weltweiten Goldproduktion seit Aufhebung des fixierten Goldpreises im Jahr 1968. Seit der Goldpreis mit Angebot und Nachfrage schwankt hat sich eine rasante Erhöhung und Verschiebung der Goldproduktion ergeben. Südafrika, der einstige Champion, fiel dramatisch zurück, andere Länder - USA, Kanada, Australien, Russland und vor allem China, übernahmen die Führung. Abhängig vom Goldpreis ergaben sich fünf große Produktionszyklen. Mit Erreichen eines Allzeithochs des Goldpreises lief der vierte Zyklus 2012 aus. Wir befinden uns mitten im fünften Zyklus, der mit einem Preisrückgang von 30% begann. Der Autor behandelt im Detail die Entwicklung der großen Förderländer und die dort wichtigen Goldbergbaugesellschaften. Eine Übersicht über die Geschichte der fünfzehn Gold-Produktions-Millionäre sowie ein umfangreicher Index der behandelten Minen runden die Darstellung ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Goldproduktion der letzten fünfzig Jahre
Produktionszyklen, Unternehmen und Länder
Bernd Kröger
Inhalt
Prolog
Überblick über die Goldförderung bis zum Jahr 1968
Die fünf Phasen der Goldproduktion seit 1968
Phase 1: Die Befreiung des Goldpreises – Abschwung und Zeiten der Unsicherheit 1968 - 1980
Phase 2: Goldpreis-Rallye und neue Minen 1980–1990
Phase 3: Preisstagnation und Förderwachstum von 1990 bis 2002
Phase 4: Die lange Rallye von 2003 bis 2012
Hedge-Verluste durch steigenden Goldpreis
Mergers und Acquisitions 1996 – 2010
Phase 5: „Cash is King“ - der große Absturz 2012 – 20xx.
Die großen Förderländer: USA, Kanada, Südafrika, UdSSR (Russland), Australien und China
Die Goldförderung in den USA seit 1968
Die Goldförderung in Kanada seit 1968
Die Goldproduktion Südafrikas seit 1968
Entwicklung der Goldproduktion in China
Entwicklung der Goldproduktion in Australien
Entwicklung der Goldproduktion in Russland
Geschichte der 15 „Gold-Millionäre“
Barrick
Newmont
AnglogoldAshanti
Goldcorp
Kinross
Newcrest
Navoi MMC
Goldfields
Polyus Gold
Agnicoeagle
Sibanye
Zijin
Yamana
Randgold
Harmony Gold
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Prolog
Die sogenannte Goldmaske des Agamemnon (ca. 1400 v. Chr.) im Nationalmuseum Athen
Totenmaske des Tut-ench-Amun (ca. 1330 v. Chr.) im Ägyptischen Nationalmuseum in Kairo
Gold wird seit jeher von Menschen aller Nationen begehrt. Seine Farbe, sein Glanz, seine Rarität und seine Kostbarkeit machten es zum Spielball des Interesses der jeweils Reichen und Mächtigen.
In diesem Buch geht es jedoch nicht um diese Eigenschaften, auch nicht um die physikalisch-technischen Möglichkeiten im Umgang mit Gold, seine hohe Duktilität, die Resistenz gegen Säuren und Verwitterung oder seine hohe Formbarkeit. Es geht vielmehr um die Entwicklung der modernen Goldproduktion seit der Freigabe des Goldpreises ab 1968/71.
1968, vor 50 Jahren, kam es beim Gold zum „Big Bang“. Die Schließung des „Goldfensters“ bei der American Federal Reserve Bank, also die Möglichkeit, jederzeit Gold zu einem festen Kurs in Dollar zu tauschen, veränderte alles. Die Aufgabe des Goldstandards war nicht nur eine Revolution, sie veränderte das Wesen von Gold im Wirtschaftsgeschehen vollständig. Von einem Moment zum nächsten sank Gold auf den Rang eines gewöhnlichen Wirtschaftsgutes, einer im englischen Sprachgebrauch sogenannten „commodity“, wie Kupfer, Silber oder auch Weizen. Gold war kein Geld mehr!
Beschäftigt man sich mit der Entwicklung des Goldes seit dieser Zeit, fällt eine Diskrepanz besonders ins Auge: es gibt viele Bücher, die sich mit der Rolle des Goldes im Geldsystem nach der Aufgabe des Goldstandards beschäftigen, so z. B. von Globalizinge Capital: a History of the international monetary System von Eichengreen, Kleine Geschichte des Geldes von North oder The golden constant – The English and American Experience 1560 – 2007 von Jastram und Leyland. Das World Gold Council, die Marketingorganisation der Goldproduzenten, liefert zudem umfangreiche Materialien und Statistiken über den Goldmarkt (zu finden unter www.gold.org). Vereinzelt finden sich historische Betrachtungen einzelner bedeutender Gold-Bergbauunternehmen wie über Goldfields Battlefields of Gold – How Goldfields fought for survival and won von Gibson, Going for Gold – The History of the Newmont Mining Corporation von Morris oder Passion to succeed: Barrick Gold at 25 von Stoffman. Ebenfalls nur gelegentlich gibt es Biographien einzelner Unternehmer-Persönlichkeiten wie Romer’s Abhandlung über den Gründer von Barrick, Golden Phoenix: A Biography of Peter Munk.
Einen guten Einstieg in wichtige Literatur zum Thema Gold liefert die Sammlung LBMA Bibliography of Books on GOLD and SILVER von Timothy Green, die im Auftrag der London Bullion Market Organisation herausgegeben wurde. Leser, die Fragen zum Thema Gold als Investment haben, sei das Buch der Finanzjournalistin Gabriele Reckinger empfohlen.
Es fehlt aber eine zusammenfassende Darstellung der Entwicklung der weltweiten Goldproduktion in Abhängigkeit vom Goldpreis, gegliedert nach Ländern, Unternehmen und der wichtigen Minen.
Dieses Buch versucht diese Lücke zu schließen. Die Entwicklung der weltweiten Goldproduktion wird in drei großen Kapiteln beschrieben, die zwar zusammenhängen, aber unabhängig voneinander gelesen werden können.
Das Kapitel „Die fünf Phasen der Goldproduktion seit 1968“ behandelt die weltweite Entwicklung der Goldförderung in Abhängigkeit von der Goldpreisentwicklung. In Zyklen von jeweils ca. 10 Jahren zeigen sich die Einflüsse, die ein zunächst nur zögernd steigender Goldpreis auf die weltweite Produktion hat. Diese Phase wird abgelöst von raschem Wachstum, als Gold als lohnendes Investment durch die Unternehmen angesehen wurde. Nach einer langen Phase der Stagnation und Niederganges des Goldpreises sah dann der Beginn des neuen Jahrtausends einen bisher nicht dagewesenen Boom sowohl im Goldpreis wie in der Produktion des Edelmetalls. Wie lange der neue Abschwung-Zyklus, der 2012 begann, dauern wird, ist im Augenblick noch nicht abzusehen.
Das zweite Kapitel widmet sich den sechs großen Gold-Förderländern Südafrika, USA, Russland, Kanada, Australien und China. Es bietet einen Überblick über die länderspezifischen Aktivitäten, Unternehmen und Goldminen in Zeitschnitten von jeweils ca. zehn Jahren.
Das abschließende Kapitel stellt die Geschichte der „Gold-Millionäre“ vor, also die Unternehmen, die im Jahr 2016 mehr als eine Million Unzen Gold produziert haben. Es fällt auf, dass sich darunter sehr viele Unternehmen finden, die erst in den letzten zwanzig Jahren entstanden sind.
Noch ein Wort zu den Mengenangaben: In den Länder-Statistiken (und damit in unseren Grafiken) wird die Produktion meist in kg bzw. in Tonnen Gold angegeben. Unternehmen bevorzugen die Angabe in (Fein-) Unzen, was für sie auch Sinn macht, da der Goldpreis in US-Dollar pro Unze notiert und bezahlt wird. Der Zusammenhang ist
1 Feinunze (oz)
31,1035 g (Gramm)
1 Kilogramm Gold
32,15 oz
1 Tonne Gold
32.150 oz
1 Million oz
31,1 Tonnen Gold
Überblick über die Goldförderung bis zum Jahr 1968
Abb. 1: Historische Entwicklung der Goldproduktion seit dem Mittelalter bis 1970 (in Tonnen Gold) (nach (Officer & Williamson, 2015))
Ein kurzer Rückblick auf die Gewinnung von Gold ab dem 19. Jahrhundert gibt ein besseres Verständnis für die dramatischen Veränderungen, die sich in den letzten 50 Jahren ergeben haben.
Erste Hinweise auf die Gewinnung von Gold finden sich schon in der griechischen Literatur. Homer berichtet von der Reise der Argonauten auf der Suche nach dem Goldenen Vlies in den Bergen des Kaukasus. Dies wird von vielen Historikern als Beleg für die Nutzung von Schaffellen bei der Gewinnung von alluvialem Gold angesehen. Aufgrund seines hohen Gewichtes bleibt Goldstaub, wenn er aus goldhaltigen Sanden ausgewaschen wird, in den Zotteln des Schaffells hängen. Die Schwere des Goldes machten sich über viele Jahrhunderte die einfachen Goldschürfer mit ihren Schwenkpfannen zunutze, auch wenn die damit erzielbaren Ausbeuten extrem gering waren. Doch nicht nur alluviales Gold (also ausgewittertes Gold, dass sich, von Flüssen verfrachtet, im Laufe von Millionen Jahren in Geröll und Sandablagerungen unterhalb einer Goldquarzader angesammelt hat) wurde gefunden, Gold wurde schon seit vielen Jahrhunderten bergmännisch im Tage- und Untertagebau gefördert. Die vielleicht bekannteste historische Beschreibung ist das Werk von Georg Agricola „De re metallica libri XII“ aus dem Jahr 1556. Wegen des großen Aufwandes bei seiner Gewinnung waren Gold und Silber stets Metalle, die dem jeweiligen Herrscher des Landes gehörten.
Dies änderte sich erst, als Gold in entlegenen Regionen entdeckt wurde. Hunderttausende machten sich auf den Weg, um ihr eigenes Glück zu suchen. Die Zeit der Goldräusche hatte begonnen, zuerst in Brasilien im Jahr 1693, als Gold im Gebiet des heutigen Bundesstaates Minas Gerais gefunden wurde. Zehntausende Goldsucher strömten ins Land und machten Brasilien zum größten Goldproduzenten des 18. Jahrhunderts. Die geförderten Mengen beliefen sich auf jährlich ca. 300.000 oz, ca. 10 Tonnen, ein Wert, der ab Mitte des 18. Jahrhunderts langsam abnahm.
Über die bis Mitte des 19. Jahrhunderts jemals produzierten Goldmengen gibt es nur sehr unzuverlässige Schätzungen. Sie bewegen sich zwischen 10.000 – 20.000 Tonnen. Dies entspricht nur einer vierfachen Jahresproduktion von 2016. Ab 1850 setzte dann ein deutlicher Aufschwung ein.
Der die Welt am stärksten verändernde Goldrausch begann ab 1848 in Kalifornien. Nach Goldfunden in der Sierra Nevada setzte eine wahre Völkerwanderung ein. Der beschwerliche Weg führte für die von Osten kommenden Goldsucher entweder über die endlosen Weiten des mittleren Westens oder mit dem Schiff (es gab noch keinen Panama-Kanal) entlang der Küsten Südamerikas und um Kap Hoorn nach San Francisco. Die Bevölkerung Kaliforniens wuchs in wenigen Jahren von ca. 50.000 Menschen auf über eine halbe Million. Schließlich wurde Kalifornien 1850 als 31. Staat in die Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen. Auch bei weiteren Goldräuschen im 19. Jahrhundert in Australien, Alaska und Neuseeland wiederholten sich die Muster: ein starker Zustrom von Goldsuchern beschleunigte die Bevölkerungsentwicklung des Landes, so vor allem in Australien. Doch nur wenige Prospektoren wurden reich. Und nachdem das mit weniger Aufwand zu gewinnende alluviale Gold gewonnen war, versiegte die Produktion schnell.
Eine Ausnahme von dieser Regel bildete Südafrika. Die Goldfunde des Witwatersrand ab dem Jahr 1886, die zur Gründung von Johannesburg führten, zogen nur wenige ausländische Einwanderer an. Die Minen wurden von großen Bergwerks-Syndikaten ausgebeutet, die neben Gold auch andere Metalle und Diamanten förderten. Allerdings waren die Arbeitsbedingungen der nahezu ausschließlich schwarz-afrikanischen Arbeiter katastrophal und menschenunwürdig. Dessen ungeachtet führte der Goldreichtum des Witwatersrand schon nach kurzer Zeit dazu, dass Südafrika zum größten Goldproduzenten der Welt wurde und diese Rolle das ganze 20. Jahrhundert über behielt.1
Durch die neuen Goldfunde, vor allem in Südafrika, und eine verbesserte Technik der Goldgewinnung durch das Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte Cyanid-Laugungsverfahren, stieg die jährlich Goldproduktion bis zum Anfang des 1. Weltkrieges auf über 600 Tonnen jährlich (entsprechend ca. 20 Millionen oz).
Der Erste Weltkrieg veränderte den Goldmarkt deutlich. Nachdem zunächst, wie häufig in unsicheren Zeiten, Gold von Privatpersonen gehortet worden war, beschränkten die Staaten zusehends den Goldverkauf. So suspendierten zum Beispiel die USA 1917 den Export von Gold für zwei Jahre und auch viele andere Länder füllten ihre Goldreserven auf. Durch die Kriegswirren reduzierte sich zudem die Förderung stetig und sank bis 1922 auf nur noch 480 Tonnen pro Jahr. In den zwanziger Jahren wuchs dann die Goldproduktion wieder moderat auf jährlich ca. 600 Tonnen, wobei etwas mehr als die Hälfte aus Südafrika stammte.
Abb. 2: Goldproduktion von 1931 bis zum Ende des 2. Weltkrieges
Die Situation änderte sich nachhaltig, als Anfang 1934 der neue US-Präsident Franklin D. Roosevelt den Goldpreis von 20$ auf 34$ anhob, was einer Abwertung des Dollar um 40% entsprach. Ein wahrer Verkaufsrausch des bisher gehorteten Goldes setzte ein und resultierte in der Tatsache, dass die USA bis 1949 ca. 22.000 Tonnen Gold als Reserve aufgebaut hatten, etwa 50% allen bis dahin jemals weltweit geförderten Goldes.
Der neue Preis für eine Unze Gold war auch ein wahres Konjunkturprogramm für die Minengesellschaften. Die Produktion von Gold erhöhte sich bis 1940 sprunghaft von ca. 600 Tonnen auf in der Spitze 1.200 Tonnen. Insbesondere die USA und Kanada, aber auch viele andere Länder steigerten ihre Förderung auf Werte, die erst wieder Ende der achtziger Jahre erreicht oder übertroffen werden sollten. Da Südafrika aufgrund seiner tiefreichenden Bergwerke die Förderung nicht so schnell ausweiten konnte, sank sein Anteil an der Weltproduktion von über 50% auf nur noch 34% Anfang der vierziger Jahre.
Der Zweite Weltkrieg führte dann zu einem starken Rückgang der Goldförderung, da jetzt strategisch wichtige Metalle für die Kriegsführung Vorrang besaßen. In einigen Ländern, so z.B. in den USA, wurden alle Goldminen geschlossen und die Mitarbeiter bei anderen Minengesellschaften zur Förderung von Eisen, Kupfer und Bauxit eingesetzt. Nach dem Ende des Krieges verharrte die jährliche neue Goldproduktion aus Minen für die nächsten 10 Jahre bei ca. 800 – 900 Tonnen. Der weltweite wirtschaftliche Aufschwung verlangte nach Eisen, Stahl, Kupfer, Öl und Kohle und nicht nach Gold.
Mit dem Bretton Woods Abkommen lebte der Goldstandard wieder auf, d.h. der Wert von Gold wurde mit dem Wert des US-Dollars fest verknüpft. Die amerikanische Notenbank verpflichtete sich, jederzeit Gold gegen Dollar zum Kurs von einer Unze Gold für 35 Dollar einzutauschen. Auf längere Sicht hatte dieses Vorgehen jedoch einen entscheidenden Fehler. Für die gleiche Menge an Gold erhielten die Unternehmen immer die gleiche Summe Dollar. Über die Jahre stiegen aber die Kosten der Produktion durch hohe Inflationsraten stark an, so dass der Gewinn rasch schrumpfte. Daher war die Goldförderung schon sehr bald nicht mehr kostendeckend, sondern ein Verlustgeschäft.
Dies drückt sich am besten in der Entwicklung der realen Kaufkraft des Goldpreises in den zwanzig Jahren zwischen 1950 und 1970 aus. Während eine Unze Gold 1950 noch einer Kaufkraft im Wert von 35$ entsprach, betrug die reale Kaufkraft im Jahr 1968 nur noch ca. 25$.
Die Folgen für die Gold-Minengesellschaften waren dramatisch. Viele Minen mussten aus wirtschaftlichen Gründen schließen. Die großen Förderländer Südafrika, Australien und Kanada richteten Hilfsprogramme mit Subventionen ein, um wenigstens eine minimale Förderung von Gold in einige Minen aufrecht zu erhalten. In Kanada geschah dies ab 1948 mit dem Emergency Gold Mining Assistance Act, der bis 1976 insgesamt 306 Millionen kanadische Dollar an Unterstützung für den Ankauf von 61,8 Millionen Unzen Gold bereitstellte.
Abb. 3: Entwicklung der realen Kaufkraft von 1 oz Gold in den Jahren 1950 bis 1970 (Officer & Williamson, 2015)
Sechs Jahre später, ab 1954, führte Australien ebenfalls Unterstützungszahlungen für die Goldproduktion ein, den Gold Mining Industry Assistance Act, der bis 1975 wirksam war. Südafrika reagierte erst relativ spät und unterstützte seine „marginalen“ Goldminen von 1968 bis 1980 ebenfalls mit einem Gold Mining Assistance Act.
Wenn schon die Produktion von Gold nur im Grenzkostenbereich möglich war, so verwundert es nicht, dass nur wenig Kapital für die Exploration und Entdeckung neuer Goldvorkommen vorhanden war bzw. ausgegeben wurde. Warum sollte man auch in ein nicht-lukratives Geschäft investieren. Die Folgen des fixierten Goldpreises für die Förderung waren also desaströs. Nur noch wenige Minen, in denen das Gold in hohen Konzentrationen im Erz vorkam, konnten wirtschaftlich betrieben werden. Der Aufbau neuer Minen, verbunden mit hohen Investitionen, lohnte sich nicht. Dies führte letztlich dazu, dass die Goldproduktion aller Länder stagnierte und in den 20 Jahren von 1949 bis 1969 sogar von ca. 12 Millionen Unzen jährlich auf nur noch 9 Millionen Unzen abnahm. Die große Ausnahme war Südafrika, dessen Produktion in diesem Zeitraum von 12 Millionen Unzen auf über 32 Millionen Unzen Gold anstieg.
Abb. 4: Der Produktionsaufstieg Südafrikas von 1945 bis 1970 (Quelle: World Mineral Statistics)
Das Wachstum hatte mehrere Gründe, vor allem die Besonderheiten der Witwatersrand Goldfelder. Diese Lagerstätten entstanden vor über 2 Milliarden Jahren, als enorme Mengen von Verwitterungsgesteinen, mit hohem Gold- und anderen Metallanteilen, in einem riesigen See abgelagert wurden. Durch Überlagerung mit Geröll, Tonen und Sanden, anschließender Verfestigung sowie späteren tektonische Verwerfungen entstand eine riffartige Lagerstätte. Einige Teile der goldführenden Schichten dieses Riffs reichen heute zwar bis an die Erdoberfläche. Doch da die goldhaltigen Quarzadern in steilem Winkel bis in Tiefen von über 5000 m hinabreichen, sind die Goldvorräte Südafrikas nur sehr schwer zu gewinnen. Allerdings trat die Dimension dieses Problems erst im Laufe der Zeit zu Tage.
Zunächst war Gold rund um Johannesburg im sogenannten Ost und West Rand gefunden und abgebaut worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen dann die Goldfelder im Oranje Free State (Welkom Goldfields) und Evander sukzessive die Produktion auf.
Abb. 4: Die Lage der Goldfelder des Witwatersrand in Südafrika
Diese zusätzlichen Minen erhöhten die jährlich verfügbare Goldmenge um über 15 Millionen Unzen. Zudem liess sich in den Jahren 1953 bis 1968 die Fördermenge über 14 Jahre stetig weiter steigern, so dass im Jahre 1970 schließlich 75% der weltweiten (nicht-kommunistischen) Goldproduktion aus Südafrika stammte. Eine verbesserte technische Ausstattung, neue und tiefere Förderschächte mit wirkungsvollerer Ventilation und höhere Goldgehalte im Erz hatten dies möglich gemacht.
1 Siehe auch Kapitel „Goldförderung in Südafrika“ ab Seite →
Die fünf Phasen der Goldproduktion seit 1968
Die Entwicklung der weltweiten Goldproduktion seit der Freigabe des Goldpreises im Jahre 1968 lässt sich grob in fünf unterschiedliche Phasen aufteilen, die jeweils etwa zehn Jahre umfassen.
Abb. 5: Die weltweite Goldproduktion im Zusammenhang mit der Goldpreisentwicklung 1968 bis 2016
Ausgehend von einer Produktion von 1500 Tonnen im Jahr 1970 reduzierte sich die Förderung im Jahrzehnt von 1970 bis 1980 nochmals um 20% auf nur noch 1.200 Tonnen jährlich. Der Rückgang betraf alle großen Förderländer, bis auf die damalige Sowjetunion. Der Goldpreis bewegte sich anfangs nur wenig und war nicht dazu angetan, die Explorationsaktivitäten nach neuen Goldlagerstätten anzuregen.
Dies änderte sich nachhaltig, als der Goldpreis1980, ausgelöst durch weltweite politische Spannungen und den Ölpreisschock, auf über 850 Dollar emporschoss und dann bis 1990 auf einem Niveau von ca. 400 Dollar verharrte. Während Südafrika Marktanteile verlor, setzte in den kapitalkräftigen Ländern Kanada, USA und Australien eine Renaissance der Goldförderung ein.
Die dritte Phase war ein schwieriges Jahrzehnt für die Minengesellschaften. Zwar stieg die Produktion durch die bereits initiierten und im Ausbau befindlichen Minen zunächst weiter an, aber viele Unternehmen kamen dennoch in den 1990er Jahren in Liquiditätsschwierigkeiten. Der Grund war, dass die Produktions-kosten weiter stiegen während der Goldpreis verfiel und sich der 250 Dollar Marke näherte. Finanzstarke Firmen nutzten die Situation für Aufkäufe geschwächter Wettbewerber aus.
Eine ungeahnte und so von niemandem vorhergesehene Goldhausse kennzeichnete die vierte Phase im „langen Jahrzehnt“ von 2001 bis 2012. Der Goldpreis versiebenfachte sich von 250 Dollar auf kurzzeitig über 1.800 Dollar. Im Ergebnis führte dies zu umfangreichen weltweiten Explorationsaktivitäten, sowie zu hektischen Unternehmenskäufen und Fusionen. Oftmals wurden dabei überhöhte Preise gezahlt, die sich negativ in den Bilanzen der Käufer niederschlugen.
Als der Goldpreis 2013 zurückging und die fünfte Phase des Abschwungs begann, saßen viele Unternehmen auf hohen Schulden und mussten existenzgefährdende Abschreibungen vornehmen. Das Schlagwort vom „cash is king“ wurde zum dominierenden Motto unternehmerischen Handelns. Nachdem die Börsenkurse der Gold-unternehmen sich mehr als gedrittelt hatten, wurde die Sicherstellung der Liquidität zum obersten Gebot. Nur die notwendigsten Investitionen wurden noch getätigt und die Goldexploration, insbesondere in unbekannten Gebieten, stark zurückgefahren.
Phase 1: Die Befreiung des Goldpreises – Abschwung und Zeiten der Unsicherheit 1968 - 1980
Die Funktion des Goldes änderte sich mit der Aussetzung der Einlösepflicht der US-amerikanischen Notenbank durch ein Dekret von US-Präsident Nixon vom 15. August 1971. Jetzt konnte auch keine ausländische Notenbanken mehr bei der Federal Reserve Bank Gold gegen Dollar beziehen. Privatpersonen war dies schon seit 1968 nicht mehr möglich. Über Jahrhunderte hatte der Goldstandard gegolten, der den Wert einer Währung mit dem Wert einer Unze Goldes verknüpfte: ab dem Jahr 1934 war der Wert einer Feinunze Gold auf 35 US-Dollar festgesetzt. Nach Nixons Dekret schwankte der Goldpreis dagegen täglich. Gold war ein Edelmetall wie Silber oder Platin, hatte aber keinen fest definierten Wert mehr.
Abb. 6: Welt-Goldproduktion im Zeitraum 1968 bis 1980
Die Besitzer von Gold und die Bergbau-Unternehmen waren sehr verunsichert, denn es war ungewiss, welche Rolle Gold in Zukunft spielen würde. Industrieller Verbrauch und der Bedarf für Schmuck-herstellung waren deutlich geringer als die jährliche Produktion. Und Goldhortung, also privater Goldbesitz, war zum damaligen Zeitpunkt in vielen Ländern, vor allem in der kommunistischen Welt und in den USA, verboten.
Zuviel produziertes Gold hatten die Notenbanken zuvor immer zum fixen Preis von 35 Dollar aufgekauft und in ihre Tresore gelegt. In den Jahren 1948 bis 1964 waren dies ca. 8.000 Tonnen oder fast 50% der Gesamtproduktion dieser Jahre. In den Speichern der Notenbanken lagerte somit fast die Hälfte allen jemals geförderten Goldes. Die große Frage war nun: was würde mit diesem Gold geschehen? Falls die Notenbanken ihre Vorräte schnell auf den Markt werfen würden, bestand die Gefahr, dass der Goldpreis ins Bodenlose abstürzen konnte. Also alles in allem keine gute Perspektive, um neue Goldlagerstätten zu suchen und zusätzliche Minen zu planen und zu errichten. Aufgrund dieser Unsicherheit bewegte sich der Goldpreis von 1968 bis 1972 zunächst in sehr engen Grenzen und schwankte bis 1972 zwischen 39 Dollar und 74 Dollar.
Abb. 7: Variationsbreite des Goldpreises in US-$ zwischen 1968 und 1980 (Quelle: USGS Jahresberichte)
Einen Schub für den Goldpreis gab es, als die US-Regierung Mitte 1974 das Verbot des Goldbesitzes für amerikanische Bürger mit Wirkung zum Jahresende aufhob. Der Preis zog bis 1975 zwar deutlich bis auf 160 Dollar an, fiel dann aber in den folgenden beiden Jahren wieder zurück, als die Federal Reserve Bank 2 Millionen Unzen verkaufte, um die Spekulation zu dämpfen und den Goldpreis zu stabilisieren.
Als nicht hilfreich erwies sich zudem die Ankündigung des Internationalen Währungsfonds 25 Millionen Unzen – das entspricht einer Menge von rund 770 Tonnen Gold - aus seinen Beständen in den folgenden vier Jahren verkaufen zu wollen. Dieser Wechsel im Verhalten der Notenbanken schockte die Märkte und wird anschaulich in der folgenden Grafik 8.
Waren die Notenbanken bis 1965 immer als Nettokäufer aufgetreten, so flossen im Zeitraum von 1966 bis 1979 nicht weniger als 3.000 Tonnen Gold in den Markt zurück. Im folgenden Jahrzehnt von 1980 bis 1990 hielten sich Käufe und Verkäufe der Notenbanken annähernd die Waage, während danach die Verkäufe wieder deutlich anzogen.
Abb. 8: Nettogoldkäufe und -verkäufe der Notenbanken von 1948 bis 1980 (nach GFMS 2017)
Woraus resultierte der große Einfluss der Notenbanken auf den Goldpreis? Ein kurzer Blick auf die Minen-Jahresproduktion in den siebziger Jahren von ca. 1.200 bis 1.300 Tonnen und die vorhandenen Bestände der Notenbanken von ca. 36.000 Tonnen verdeutlicht das Dilemma der Investoren. Sollte auch nur ein Teil dieser gewaltigen Reserve plötzlich auf den Markt kommen, wäre ein Rückgang des Goldpreises nahezu sicher unvermeidbar. Dieses Risiko machte eine langfristige Investition in neue Minen zu einem va banque Spiel und führte zu einer nachhaltigen Investitions-Zurückhaltung.
Die mangelnde Attraktivität von Neuinvestitionen bis Ende der siebziger Jahre reduzierte die Goldförderung bis 1980 kontinuierlich. Südafrika hatte im Jahre 1970 noch 1.000 Tonnen produziert und war auf 675 Tonnen im Jahr 1980 zurückgefallen. Ähnlich sah es auch in den anderen Hauptförderländern UdSSR, USA, Kanada und Australien aus. Die UdSSR verloren fast 100 Tonnen, nahezu ein Drittel ihrer Produktionsmenge. Selbst die USA schafften es 1980 nicht mehr über eine Million Unzen Gold zu produzieren, das sind nur noch ca. 30 Tonnen.
Land
Goldproduktion 1970
Goldproduktion 1980
Veränderung
Südafrika
1.000 to
675 to
-32%
UdSSR
347 to
258 to
-26%
USA
54 to
30 to
-44%
Kanada
75 to
51 to
-32%
Australien
19 to
17 to
-10%
China
2 to
45 to
restliche Welt
126 to
155 to
+23%
Summe
1.623 to
1.231 to
-24%
Tab. 1: Goldproduktion der größten Förderländer im Vergleich der Jahre 1970 und 1980 (nach GFMS)
Phase 2: Goldpreis-Rallye und neue Minen 1980–1990
In den Jahren 1979/1980 war die weltpolitische Lage von großer Unsicherheit geprägt. Die Sowjetunion marschierte in Afghanistan ein, der Iran erlebte den Sturz des Schah-Regimes und im Irak übernahm Saddam Hussein die Macht. Kurz danach kam es zum Ersten Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak, der nahezu ein ganzes Jahrzehnt andauern sollte. Die Zweite Ölkrise dauerte nur einige Monate an, dennoch führten diese Ereignisse zu einem zunächst stark ansteigenden Goldpreis, der sich danach auf relativ hohem Niveau um die 400 Dollar stabilisierte. Da die Weltwirtschaft sich in einer Rezession befand, wurden Stahl, Kupfer und fossile Energieträger nicht mehr so stark nachgefragt. Dies führte, zusammen mit dem relativ hohen Goldpreis, zu weltweit stark ansteigenden Explorationen nach Gold.
Abb. 9: Entwicklung der Welt-Goldproduktion 1970 - 1990
Vorreiter waren die US-amerikanischen und kanadischen Bergbauunternehmen. In den USA entwickelte sich der Carlin Trend im Bundesstaat Nevada zu einem Hotspot der Goldproduktion. Angeführt von Newmont und seiner Carlin Mine, die durch die Gold Quarry Mine erweitert wurde, gefolgt von Barrick mit der Goldstrike Mine, steigerten die USA ihre Goldproduktion in nur sechs Jahren um das Dreifache, - von 30 Tonnen auf 116 Tonnen. Die eingesetzten fortschrittlichen Technologien machten die neuen Minen, - Enfield Bell, Jerritt Canyon, Mercur, Golden Sunlight, Fortitude, McLaughlin und die Cannon Mine etwa - sofort zu Produktions-Spitzenreitern der Vereinigten Staaten. Die USA stiegen Mitte der 80er Jahre zum drittgrößten Goldproduzenten der Welt auf, direkt hinter Südafrika und der Sowjetunion.
Auch die kanadischen Unternehmen waren sehr aktiv und erfolgreich. Der hohe Goldpreis erlaubte es, stillgelegte Minen wieder zu eröffnen bzw. goldhaltige Abraumhalden mit neuer Technik nochmals auszubeuten. Aber auch Explorationen hatten Erfolg, insbesondere in den Regionen Ontario und Quebec.
Neue Unternehmen wurden gegründet, so z.B. 1983 Barrick Resources. Zum Ende des Jahrzehnts gab es erste Fusionen. Der Zusammenschluss von Placer Development Ltd., Dome Mines Ltd. und Campbell Red Lake Mines Ltd. zur Placer Dome Inc. ließ die größte Goldbergbaugesellschaft außerhalb Südafrikas entstehen. Mit der Steigerung der Goldproduktion von 50 Tonnen im Jahr 1980 auf 170 Tonnen im Jahr 1990 rückte Kanada auf Platz fünf der größten Produktionsländer vor.
Übertroffen wurde Kanada nur noch von Australien. Dort schlummerte der Goldbergbau Ende der siebziger Jahre in einem Dornröschenschlaf; Explorationen nach Kupfer, Kohle, Öl und Gas sowie anderen Buntmetalle hatten Vorrang, da deren Nachfrage viel höher war. Erst mit einer Zeitverzögerung, auch aufgrund des hohen Kapitalbedarfes, setzte der Aufschwung der australischen Produktion ein. Ab Mitte der achtziger Jahre explodierte er geradezu. Im Zeitraum von drei Jahren, zwischen 1984 bis 1987, gingen nicht weniger als 30 neue Goldminen in Betrieb.
Schließlich lag Australien dann 1990 mit 242 Tonnen an vierter Stelle der weltweit größten Förderländer.
Abb. 10: Wachstumstreiber der 80er Jahre waren die USA, China, Kanada und Australien
Allerdings lief der Ausbau der Produktion überwiegend sehr national und länderspezifisch ab. Nur wenige Unternehmen beschäftigten sich in der Goldförderung mit Vorkommen außerhalb ihrer Heimatländer. Die dortigen bürokratischen Hemmnisse erwiesen sich als noch zu hoch. Es waren nur die wenigen, breit aufgestellten Bergbau-gesellschaften wie Newmont, Anglo American oder Rio Tinto Zinc, die sich in Weltregionen außerhalb ihres Heimatmarktes engagierten. Wie Abbildung 10 zeigt, startete der Aufschwung der Goldproduktion in den „klassischen“ Förderländern USA, Kanada und Australien, während es Anfang der achtziger Jahre in den später wichtigen Staaten wie Mexiko, Peru, Chile, Indonesien oder Ghana noch hohe Hürden gab. Rechtliche, finanzielle und „Know how“ Hemmnisse mussten erst überwunden werden.
Während die Förderung der führenden Länder Südafrika und Sowjetunion in den achtziger Jahren nahezu konstant um 900 Tonnen lag, steigerten vier Länder - USA, Australien, Kanada und China - ihre Produktion von unter 150 Tonnen auf über 800 Tonnen. Die Produktion in anderen Teilen der Welt kam ebenfalls voran, von 140 Tonnen auf über 400 Tonnen. Eine echte Dynamik in diesen Gebieten setzte erst gegen Ende des Jahrzehnts ein, als die massiven Explorations-Anstrengungen neue Minen erschlossen.
Vor allem der sogenannte „Pazifische Feuerring“ mit seinen epithermalen Gold- und Kupfervorkommen rückten in den Fokus der großen Konzerne. Indonesien, Papua Neu-Guinea, Neuseeland und selbst Japan wurden eingehend untersucht. Allein in Papua Neu-Guinea wurden fünf große und ergiebige Gold und Kupfer/Gold Lagerstätten in den achtziger Jahren entdeckt. Die letzten drei gingen erst in den neunziger Jahren in Produktion: Bougainville, OK Tedi, Porgera, Misima und Lihir. Die beteiligten Konzerne Kennecott, Rio Tinto und BHP zählen zu den erfahrenen weltgrößten Kupfer-produzenten. Nur die australische Placer Pacific (nach Fusion später Placer Dome) war fast ausschließlich auf Goldsuche spezialisiert. In Japan entwickelte Sumitomo die Hishikari Goldmine, während in Indonesien British Petroleum (BP) mit einem indonesischen Partner versuchte das Masuperia Vorkommen zu entwickeln.
Südamerika erlebte diverse Goldräusche, vor allem in Brasilien, dann auch in Kolumbien, Peru und Venezuela. Allein in den Jahren 1981/82 sollen in der Serra Pelada fast 500.000 Garimpeiros mit Goldwäsche alluvialer Bestände beschäftigt gewesen sein. Für kurze Zeit wurden jährlich ca. 50 Tonnen Gold produziert. Die Goldsucher in Kolumbien, Peru und Venezuela, konnten mit ihren primitiven und umweltschädlichen Methoden jeweils nur wenige Jahre die leicht zugänglichen oberflächennahen alluvialen Goldsande ausbeuten. Auf lange Sicht angelegte kapitalintensive Minen gab es außer der El Indio Mine nur in Chile und in Brasilien. Hier wurden in den achtziger Jahren von den großen Bergbauunternehmen die Minen Morro Velho und Jacobina (Anglo American), Crixas (Kennecott/International Nickel), Sao Bento (Gencor), Morro Paracatou (Rio Tinto) und Aruci (BP) betrieben bzw. neu entwickelt. Gegen Ende des Jahrzehnts konnte Brasilien mit knapp 100 Tonnen kurzzeitig in die „Topliga“ der goldproduzierenden Länder aufsteigen, erlebte in den neunziger Jahren dann aber wieder einen deutlichen Rückgang.
Die in den achtziger Jahren auf über 2.000 Tonnen gesteigerte Goldproduktion löste bei den Minengesellschaften aber auch Ängste aus. Vor allem beschäftigte die Manager der Goldunternehmen die Frage, wer denn diese gewachse Menge kaufen sollte. Die Notenbanken waren seit der Freigabe des Goldpreises nicht mehr nennenswert als Käufer aufgetreten. Im Gegenteil, sie hatten zunächst durch Verkäufe von über 3.000 Tonnen eher das Goldangebot weiter verstärkt. Auch wenn dieser Trend gebrochen schien, so war die Nachfrageseite, insbesondere der Bedarf bei Goldschmuck und Gold als Investment nicht abzuschätzen. Denn noch bis 1973 war der private Goldbesitz in mehr als 120 Ländern verboten bzw. mit großen Einschränkungen versehen.
Abb. 11: Nettokäufe und –verkäufe der Notenbanken 1980-1990
Der Goldabsatz profitierte daher davon, dass die USA ab 1975 ihren Bürgern wieder den Goldbesitz erlaubte. Als dann die bevölkerungsreichsten Länder China 1982/83 und Indien 1990 die Beschränkungen zum Besitz von Gold ebenfalls aufhoben, nahm die Goldnachfrage deutlich zu.
Der Besitz von Gold für jedermann wurde auch durch die Ausgabe von Goldmünzen (bullion coins) mit einem Goldgehalt von 1 Unze stark gefördert. Den Anfang hatte Südafrika im Jahre 1967 mit dem Krugerrand gemacht. Diese Münze war ein voller Verkauserfolg.Bis Mitte der achtziger Jahre wechselten auf diesem Weg über 1 Million Unzen Gold (z. Teil auch in kleinerer Stückelung als 1 oz) jährlich den Besitzer. Kanada zog 1979 mit dem Maple Leaf nach und China kurbelte den Goldverkauf ab 1982 mit dem Gold Panda an.
Als die Europäische Union und die Vereinigten Staaten 1986 die Einfuhr des Krugerrands aufgrund von Sanktionen gegen das Südafrikanische Apartheitsystem verboten, führten die USA im Gegenzug den American Gold Eagle ein, der sich bald großer Beliebtheit erfreute. Andere Länder folgten bald nach, wie etwa Österreich mit der Münze Wiener Philharmoniker (1989) oder Großbritannien mit der Britannia (1987).
Neben den staatlichen Stellen, die die bullion coins herausgaben, waren auch die großen Goldminengesellschaften an einer systematischen Vermarktung des Goldes interessiert. Sie gründeten im Jahre 1987 in London das World Gold Council, dessen Aufgabe darin besteht, den weltweiten Goldabsatz kontinuierlich zu fördern.
Phase 3: Preisstagnation und Förderwachstum von 1990 bis 2002
Der Beginn des letzten Jahrzehnts im vorigen Jahrhundert ist geprägt von großen Veränderungen in der geopolitischen Landschaft. Mit dem Fall der Berliner Mauer, der deutschen Wiedervereinigung und dem Zerfall der Sowjetunion in Einzelstaaten wurde das Ende des Kalten Krieges eingeläutet. Für die Goldproduktion wichtig waren zudem die Befreiung Nelson Mandelas aus der Haft und das Ende des Apartheidsystems in Südafrika. Eine neue Verfassung, neue Minengesetze und die Black Economic Empowerment Bewegung führten zu einer Konsolidierung der dortigen weltgrößten Goldindustrie. Und in China zeigten die von Deng Xiaoping eingeleiteten pragmatischen Wirtschaftsmaßnahmen erste Erfolge, die den regionalen Verantwortlichen mehr Handlungsspielraum ließen.
Abb. 12: Welt-Goldproduktion und Goldpreis von 1970 - 2001
Der Goldpreis blieb von diesen politischen Entwicklungen zunächst relativ unbeeindruckt. Er oszillierte bis 1996 knapp unterhalb dem Wert von 400 Dollar pro Unze. Erst danach begann er zu fallen und gab schließlich zum Jahrtausend-wechsel auf 270 Dollar nach. Dies führte, bei ständig steigenden Kosten der Produktion, zu finanziellen Engpässen bei vielen Goldminengesellschaften.
Abb. 13: Wachstumstreiber der Produktion in den 90er Jahren
In der ersten Hälfte der neunziger Jahre erhöhte sich die Gold-produktion nur wenig. Erst ab 1996 änderte sich dies, als neue Minen ihre Produktion aufnahmen und den stetigen Rückgang der Goldförderung in Südafrika überkompensierten. Während die Produktion in Südafrika um ca. ein Drittel, von jährlich 600 Tonnen (1990) auf nur noch 400 Tonnen (2002) verringerte und die Förderung in den klassischen Goldländern USA, Kanada, Australien, Russland und





























