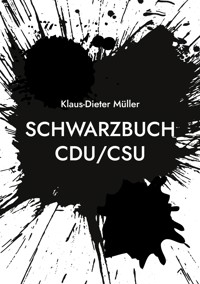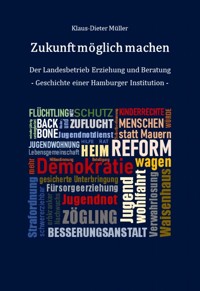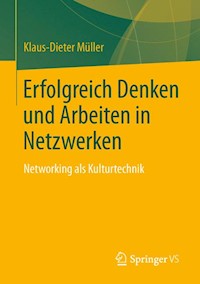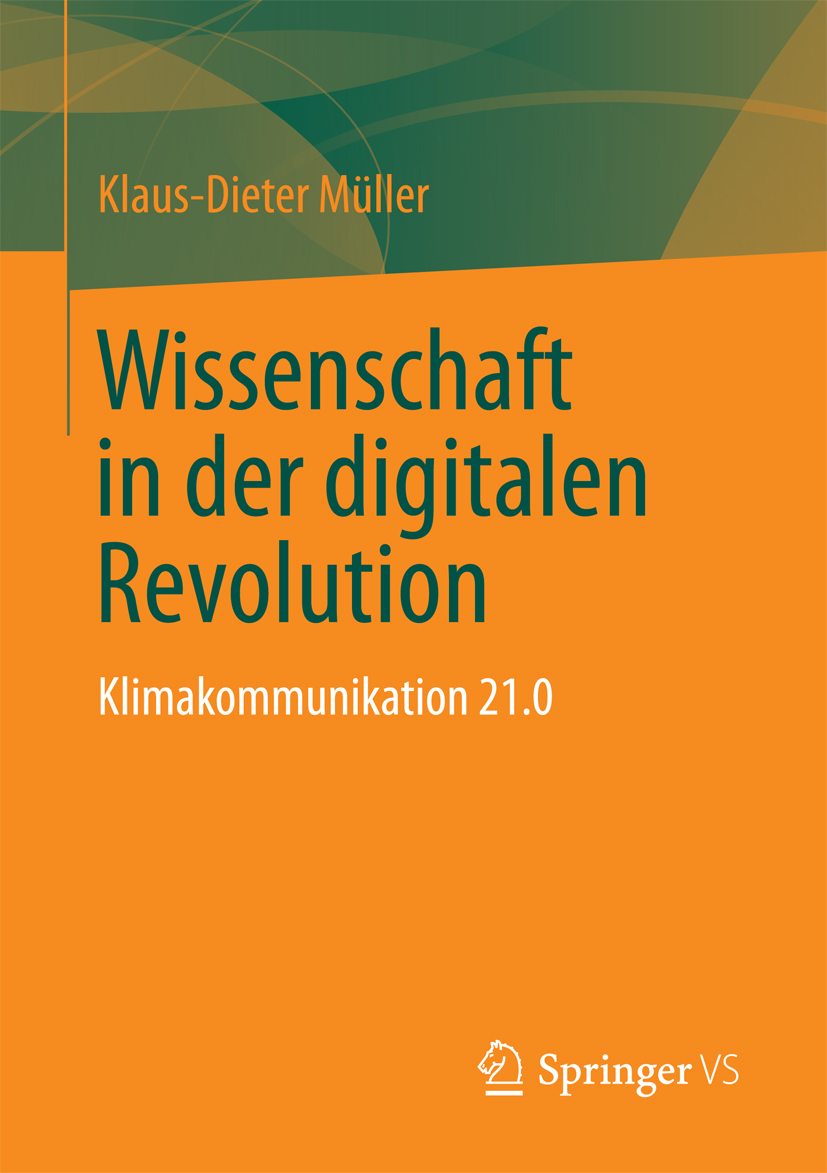Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Politik- und Medienwissenschaftler Prof. Dr. Klaus-Dieter Müller ist seit 56 Jahren aktives Mitglied der SPD, war von 1996-2005 Abgeordneter im Schleswig-Holsteinischen Landtag, 25 Jahre Landesvorsitzender der AGS Arbeitsgemeinschaft Selbständige in der SPD in Schleswig-Holstein und 11 Jahre stellvertretender AGS- Bundesvorsitzender. Von 2004-2019 war der Professor an der Filmuniversität Babelsberg. Der Zustand dieser großen Volkspartei, die in Deutschland stets das soziale Korrektiv in der Politik war, ist in der schwersten Krise seit ihrer Gründung vor 162 Jahren. Zur Bundestagswahl 2025 erhielt die SPD insgesamt nur 16,41 Prozent der Zweitstimmen, also der Stimmen für die Partei. Nur 12 Prozent der 18-24Jährigen wählten sozialdemokratisch. Die SPD hat darüber hinaus keine 10 Prozent Mitglieder unter 35 Lebensjahren mehr. Müller nennt die Gründe für die mangelnde Akzeptanz der Volksparteien im Allgemeinen und der SPD im Besonderen, um sodann aufzuzeigen, was die SPD in den kommenden Jahren leisten muss, um ihrem Untergang zu entgehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Das Ende der Volksparteien?
Das Problem der Zuwanderung
Der sterbende Planet
Der Populismus und die Wähler/innen in den neuen Bundesländern
Wenn Google uns den Krieg erklärt
Die USA als unverzichtbare Nation?
Kennedy war ein Berliner
Die Herrschaft der Bürokraten
Das Nebenstrafrecht.
Wissen und Wertschöpfung.
Die Vision einer humanen Gesellschaft
Was die SPD tun muss, um zu überleben
Das Personal wechseln
Der Kapitalismus muss ethisch und politisch gebremst werden
Nur eine ausgeglichenere Vermögensverteilung sichert die Identifikation der Bevölkerung mit dem demokratischen Staat
Die Chancengleichheit ist in unserem Land nicht realisiert.
Nicht das quantitative Wachstum und die Kostenminimierung dürfen der Antrieb der Ökonomie bleiben, schon gar nicht die Lohnkosten.
KI-Systeme können eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden darstellen.
Die Heterogenität der Arbeitswirklichkeit schafft neue Ausbeutungstatbestände, die verhindert werden müssen.
Eigentum verpflichtet
Unternehmen sollten sich am Wertewandel vieler Start-ups orientieren.
Der Lobbyismus muss weiter in seine Schranken verwiesen werden..
Die Europäische Union ist eine Scheindemokratie.
Die Sicherheit in der humanen Gesellschaft darf nicht zu Lasten unserer Freiheit gehen
Regierungshandeln mit CDU/CSU und das sozialdemokratische Profil – Der Koalitionsvertrag
Die wirtschaftliche Entwicklung
Die Renten.
Die Migrations- und Flüchtlingspolitik
Staatsmodernisierung: Digitale Verwaltung als Leitbild.
Infrastruktur-Zukunftsgesetz, Förderpraxis und Vergaben.
Unsere Sicherheit.
Die Steuer- und Einkommenspolitik
Klimaschutz.
Das Bürgergeld.
Fazit
Leitlinien für die neue SPD als Zukunftspartei
Literaturhinweise.
Der Autor
Lebenslauf.
Veröffentlichungen seit 2007
Vorwort
Zur Bundestagswahl 2025 erhielt die SPD insgesamt 16,41 % der Zweitstimmen, also der Stimmen für die Partei. Davon entfielen auf die Altersgruppe der 18–24-Jährigen 12 %. Die SPD hat darüber hinaus keine 10 % Mitglieder unter 35 Lebensjahren mehr.
Das Parteimanagement ist desaströs: Der Parteivorstand hat den gescheiterten Bundeskanzler Olaf Scholz nicht davon ab- bringen können, nochmals zu kandidieren, obwohl klar war, dass die SPD mit ihm als Spitzenkandidaten untergehen würde. Es braucht also ein neues Management, jedenfalls an der Spitze. Wer eine Partei an den Rand des Ruins bringt, muss ausgewechselt werden. Ich gehe davon aus, dass Lars damit rechnet, der Parteitag im Juni werde ihn nicht wieder zum Parteivorsitzenden wählen und hat sich deshalb erst zum Fraktionsvorsitzenden wählen lassen, um jetzt als Bundesfinanzminister eine neue Chance zu bekommen. Saskia Esken hat selbst die Konsequenzen gezogen. Der nominierte Generalsekretär entspricht der von mir vorgeschlagenen Zusammensetzung.
„Die Demokratie braucht Charisma“, hatte uns schon Max Weber ins Stammbuch geschrieben. In seiner Herrschaftssoziologie ist das Charisma eine von drei idealtypischen Legitimitätsquellen, durch die eine Herrschaftsordnung von den Beherrschten als rechtmäßig anerkannt wird. Nach Steven Turner kann ein/e charismatische/r Anführer/in deswegen Anhänger/innen an sich binden, weil er/sie zum Beispiel durch unkonventionelles Auftreten neue Handlungsmöglichkeiten demonstriert und so einen Wahrnehmungswechsel des Handelns bei den Anhänger/ innen herbeiführt, das zuvor als risikoreich bewertet wurde. Nur eine solche Persönlichkeit kann grundlegende Veränderungen, zum Beispiel den Wechsel zu einer nachhaltigen Wirtschaft, glaubhaft verkörpern. Hoffen wir auf den Parteitag.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ignoranz diese Partei beherrscht.
Ich möchte in diesem Buch zunächst versuchen, einige grundlegende politische Forderungen zu beschreiben, für die die SPD nachhaltig wahrgenommen werden muss, um sodann aufzuzeigen, was die SPD in den kommenden Jahren leisten muss, um der politischen Bedeutungslosigkeit zu entgehen.
Klaus-Dieter Müller, im Mai 2025
Mail: [email protected]
Mobil: 01714317765
Einleitung
Die beiden zentralen Säulen des Selbstverständnisses der sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien in Europa sind ihr Verhältnis zur Erwerbsarbeit und zum Wohlfahrtsstaat. Parteibezeichnungen wie „Labour Party“ oder „Partij van de Arbeid“ zeugen noch heute von diesen Wurzeln, die einst in einer gesellschaftlichen Klasse gründeten. Aber die Arbeit ändert auf ganz wesentliche Weise ihre „Struktur“, und auch die Klasse ist nicht mehr ohne weiteres sichtbar, sie wählt jedenfalls nicht notwendigerweise sozialdemokratisch. Die sozialdemokratische Antwort auf den Kapitalismus in Europa war der Wohlfahrtsstaat, der seit einigen Jahren unter einem erheblichen Rechtsfertigungsdruck steht. Ist er in eine Sackgasse geraten? Oder stehen wir gar vor der Wendeschleife des sozialdemokratischen Weges?
Der kontinentaleuropäische Typus des sozial integrierten Kapitalismus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von Sozialdemokraten, aber auch von Christdemokraten, entwickelt und versteht sich als Gegenentwurf zum amerikanischen Modell des Kapitalismus des Individuums, des kurzfristigen Gewinnstrebens und der fehlenden sozialen Absicherung. Insoweit bricht Friedrich Merz mit christdemokratischer Tradition des sozial integrierten Kapitalismus. Die „Agenda 2010“, die Gerhard Schröder favorisierte, scheiterte, weil bildgestützte performative Kommunikation nur durch symbolisches Handeln à la Schröder für die Sozialdemokratie keine angemessene Strategie ist, um für Einschnitte ins soziale Netz eine breite Unterstützung zu finden. Der Politikwissenschaftler Thomas Meyer formuliert es so:
„Der Diskurs über die Gründe und Ziele einer Kürzung von Sozialleistungen, wie sie in der ,Agenda 2010‘ skizziert wurde, fehlte nicht wegen organisatorischer Probleme die Unterstützung, sondern weil politische Schlüsselakteure, wie Gerhard Schröder, der Ansicht waren, ein breiter integrativer und motivierender öffentlicher Diskurs sei für eine regierende sozialdemokratische Partei kein notwendiger Teil einer erfolgreichen politischen Strategie, auch nicht in einer Situation, in der sich die strategischen Parameter grundlegend verändern. Offenbar war Schröder der Meinung, dass sich eine Politik der Kürzung sozialer Leistungen durch ihre konkreten Erfolge zu rechtfertigen habe und deshalb nicht durch triftige Gründe, moralische Appelle an Grundwerte und Visionen untermauert werden müsse.“ 1
Die SPD verfügt über erhebliche Traditionsreserven, um Krisen zu überstehen, allerdings nimmt der Verschleiß des über Jahrzehnte kumulierten Identitätskapitals zu. Der Prozess der Verständigung innerhalb der SPD leidet, weil die Wirklichkeit als solche nicht mehr einfach zu beschreiben ist. Die weltanschaulichen Interpretationen haben sich eingeebnet, die politischen Perspektiven sind nivelliert. Zwar leben wir nach wie vor im Kapitalismus, aber seine Qualität ist undeutlich. Vieles spricht dafür, dass mit den Begriffen der Informations- und Wissensgesellschaft ein neues Verständnis für die Grundlagen wirtschaftlicher und politischer Prozesse gewonnen werden könnte. Für die Sozialdemokratie veränderten sich die Rahmenbedingungen ihrer Politik radikal. Die SPD verlor den Ort für ihre politischen Steuerungsbemühungen, das Spielfeld hat auf einmal keine Seitenlinien und keine Eckfahnen mehr, und das Publikum verlässt das Stadion. Die Entgrenzung von Politik und die Heterogenität der Wähler/innen berühren den Traditionshaushalt der SPD. Es ist die Diskrepanz, um die es geht: Tradition, Vergangenheit, Gründungsmythos, Werte, Ziele – dem stehen gegenüber Zukunft, Veränderung, Modernisierung. Die SPD leidet. Sie leidet in ihrer Seele, sie tut sich sehr schwer damit, das Streben nach Kontinuität und stabiler Identität aufzugeben, sie will Vermittlungsagentur des Wandels sein und ändert sich selbst nur schwer.
Die SPD zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr das, was sie gut 130 Jahre lang war. In einer gewissen Weise hat sich die SPD von sich selbst verabschiedet. Sie ist Opfer der soziologischen Transformation des Parteiensystems.
Wo aber sind Sinn, Werte, Überzeugungen in einer globalisierten Welt zu finden? Hat die Sozialdemokratie noch eine Zukunft, die sich irgendwie inhaltlich bestimmen lässt, also nicht nur Etikette einer völlig gewandelten Organisation ist? Genau darum soll es in diesem Buch gehen.
1 Thomas Meyer (2007): Nachzügler Deutschland – der fehlende Diskurs über die Neuausrichtung des Sozialstaats, in: Becker u. a. 2007, a.a.O., S. 53–64
Das Ende der Volksparteien?
Fast alle deutschen demokratischen Parteien suchen ihren Platz heute in der sogenannten politischen Mitte. Darin habe auch ich zu lange kein Problem gesehen, es viele Jahrzehnte sogar für richtig und verantwortungsbewusst gehalten. Geprägt vom Glauben an die Soziale Marktwirtschaft und den Wohlfahrtsstaat, den diese Wirtschaftsordnung für mich ausmacht, schien mir lange Zeit der Kompromiss das lohnende Ziel. Zunehmend aber wird deutlich, dass die Parteien bis zur Austauschbarkeit an Profil verloren haben und Politik zum Flickwerk verkommt.
Die Politikwissenschaftler Bernd Guggenberger und Klaus Hansen fragten schon 1993:
„Ist politische Mitte nur ein Reflex von Establishment? Die denkmüde, reflexionsarme Ausrede in einer Situation allgemeiner Erschöpfung all jener Kräfte und Energien, die Politik aus dem Geiste des Utopischen entwarfen und sich vom Prinzip Hoffnung leiten ließen? Ist Mitte nur die jüngste Maske der Ratlosigkeit einer übergeschäftigen Welt, der vorläufig letzte jener Rückzüge, die sich so beharrlich als Offensive tarnen? Ist sie nur eine Chiffre für allzu geschmeidige Anpassung, für die Saturiertheit des Status quo, für die Hartnäckigkeit der Unbeirrbaren und Verblüffungsfesten?“ 2
Der Politologe Kurt Lenk nennt eine plausible Erklärung:
„Gerade die Leerformelhaftigkeit der Berufung auf eine imaginäre Mitte verbürgt deren ideologisch-politische Funktion. Ist doch heutzutage fast ein jeder von einer gewissen ,Randangst‘ getrieben, sich in einer Mitte zu verorten, die Solidität und Normalität symbolisiert. Die in der bundesrepublikanischen Politik von Beginn an herrschende ,Magie der Mitte‘ ist auch Resultat traumatischer geschichtlicher Erfahrungen. (…) Von dieser Optik her erscheinen die Extreme links und rechts der Mehrheit der Bürger als gefährliche Schwarmgeisterei, als Wege hin zu Intoleranz und Gewalt.“ 3
Dieses Muster wurde zur Bundestagswahl 2025 durchbrochen:
Quelle: ZDF Bundeswahlleiterin
Fast 21 % der Wähler und Wählerinnen wählten die rechtsradikale AfD, fast 14 % die linksradikalen Parteien. Die Linke und das Bündnis Sarah Wagenknecht, das aber die 5 %-Hürde sehr knapp verfehlte. Dennoch: 35 % der Wähler/innen haben radikal gewählt. Das hat sicher damit zu tun, dass die demokratischen Parteien zu oft miteinander koaliert haben, provokante Forderungen und Ziele gemieden wurden und die Parteien an Trennschärfe verloren. Hinzu kam die unglückliche Ampelkoalition und der schwache Kanzler Olaf Scholz, der die Wähler/innen nachgerade in die Hände der Radikalen trieb. Da wir jetzt wieder von einer sog. Großen Koalition regiert werden, da unser Land anders nicht mehr demokratisch zu lenken ist, kommt es sicher wieder zur Politik der kleinen Schritte, denn in Fragen der Asylpolitik, des Mindestlohnes und einer Vermögensabgabe für Reiche, einer Deckelung der Mieten und beim Abbau des Bürgergeldes wird es keine Gemeinsamkeiten der Koalitionäre geben, was den Populisten erneut in die Hände spielen wird. Auch weiterhin wird gelten: „Schleichend frisst die GroKo die eigenen Kinder.“
Die belgische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe sieht in der Sucht nach Konsens schon 2008 eine Gefährdung der Demokratie:
„Die Besonderheit der modernen Demokratie liegt in der Anerkennung und Legitimierung des Konflikts und in der Weigerung, ihn durch Auferlegung und Legitimierung einer autoritären Ordnung zu unterdrücken. (…) Daher sollten wir uns vor der heutigen Tendenz hüten, eine Politik des Konsenses zu glorifizieren, die sich rühmt, die angeblich altmodische Politik von rechts und links ersetzt zu haben. (…) Sobald politische Grenzlinien verschwimmen, wird die Dynamik der Politik gebremst und die Erzeugung distinktiver Identitäten behindert. Entfremdung von politischen Parteien setzt ein und entmutigt Partizipation am politischen Prozess.“ 4
Wie wir gerade bei uns beobachten können, führt das Negieren gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Gegensätze nicht zu Sicherheit und Harmonie, sondern zu Misstrauen, Frust und Politikverdrossenheit und schließlich zur unsäglichen Suche nach Alternativen, die zu viele in den rechts- und linksradikalen Partien zu finden glauben.
Hinzu kommt, dass die Globalisierung und die Digitalisierung die Arbeitswelt komplett verändert haben. Arbeitsplätze sind latent gefährdet. Insbesondere der vermehrte Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird sehr viele Arbeitsplätze wegrationalisieren, was heute auch Gutverdienende empfindlich treffen kann. Der Verdienst bleibt aus, der Kredit kann nicht mehr bedient werden, und der soziale Abstieg ist Realität.
Die Mitte zerfällt in Gewinner und Verlierer, wie der Berliner Politikwissenschaftler Herwig Münkler konstatiert:
„Solange die Mitte die Vorstellungswelten der Gesellschaft beherrschte, relativierte sich das Gewinner-Verlierer-Modell; die Hegemonie enthielt das Versprechen, dass sich die zufälligen Gewinne und Verluste in der Gesamtbilanz ausglichen und für Aufstieg und Abstieg in der Gesellschaft letzten Endes die individuelle Leistung den Ausschlag gab. Diese wiederum lieferte den Maßstab, um den herum sich die gesellschaftlich vorherrschende Idee der Verteilungsgerechtigkeit bilden konnte. Die von einigen politischen Parteien ausgegebene Parole, wonach sich Leistung wieder lohnen müsse, hat angesichts der jüngsten Entwicklung einen durchaus zynischen Unterton. Sie beruft sich auf einen Maßstab, der durch die kapitalistische Dynamik zertrümmert worden ist. Die Folge ist, dass Leistung kurzerhand mit Einkommen gleichgesetzt wird. Das zu Messende wird selbst zum Maßstab. Die Bedrohung der Mitte und der Verlust des Maßes gehen Hand in Hand. 5
Und Sozialdemokraten erklären erneut die Beteiligung an der aktuellen Regierung mit der mangelnden Regierbarkeit der Republik und werden das Opfern von sozialdemokratischen Grundwerten auf dem Altar der Mitte mit Erfolgen beim Mindestlohn rechtfertigen.
Wenn Politik die Fantasie ausgeht und ihr nur noch der Inkrementalismus bleibt, wenn unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse mit Hilfe einer Wir-sind-doch-alle-Mitte-Ideologie verkleistert werden, können sich immer mehr Menschen nicht mehr mit dem politischen System identifizieren. Hochmut kommt vor dem Fall. Vor mehr als fünfzig Jahren schon hat der US-Politikwissenschaftler Robert Alan Dahl auf die Langzeitwirkung von Volksparteien hingewiesen:
„Volksparteien müssen eine Politik der Kompromisse und des Verhandelns betreiben, eine Politik, die von Experten und Parteispitzen mit geringer Bindung an die Basis bestimmt wird und betont moderierend daherkommt. Im Ergebnis steht ein politischer Prozess, halb pragmatisch, halb technokratisch. Vielen Wählerinnen und Wählern ist das zu wenig an ihren Problemen orientiert und zu bürokratisiert. Ein solcher Prozess wird als Instrument politischer Eliten zur Wahrung der eigenen Interessen wahrgenommen.“ 6
Wahlprogramme dürfen künftig nicht mehr mit „mittigen Konsensformeln“ überfrachtet werden, die Wähler und Wählerinnen müssen wissen, wer wessen Interessen vertreten will bei der Lösung der großen und weitreichenden Probleme unserer Zeit. Da gibt es keinen sicheren Weg im Schongang.
2 Bernd Huggenberger, Klaus Hansen Hrsg. (1993): Die Mitte. Westdeutscher Verlag Opladen, S. 9
3 Kurt Lenk (2009): Vom Mythos der politischen Mitte, in: http://www.bpb.de/apuz/31749/vom-mythos-derr-politischen-mitte?p=all
4 Chantal Mouffe (2008): Das demokratische Paradox, Verlag Turia + Kant, Wien, Berlin. S. 112
5 Herfried Münkler (2010): Mitte und Maß. Der Kampf um die richtige Ordnung, Rowohlt Verlag Reinbek, S. 67 f.
6 Michael Zürn zitiert Robert Dahl in Liberale Eliten als Hassobjekt, Der Tagesspiegel vom 21.10.2028, S.8
Das Problem der Zuwanderung
Unsere Kulturen haben de facto längst nicht mehr die Form der Homogenität und Abgeschiedenheit, sondern sind bis in ihren Kern hinein durch Mischung und Durchdringung gekennzeichnet. Die Kulturen sind hochgradig miteinander verflochten. Die Lebensformen enden nicht mehr an den Grenzen der Nationalkulturen, sondern überschreiten diese und finden sich ebenso in anderen Kulturen. Die neuartigen Verflechtungen sind eine Folge von Migrationsprozessen sowie von weltweiten materiellen und immateriellen Kommunikationssystemen (internationaler Verkehr und Datennetze) und von ökonomischen Interdependenzen. Einige Daten zum Problem: