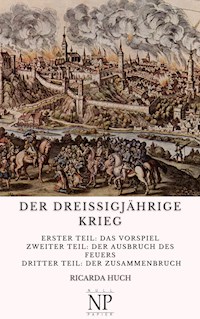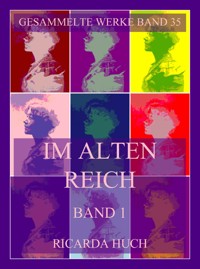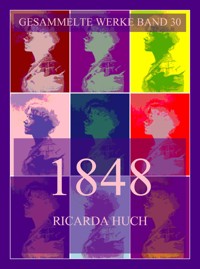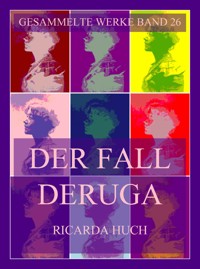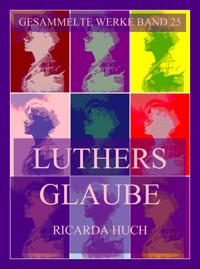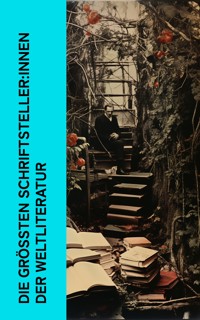
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Entdecken Sie die beeindruckenden Lebenswege von herausragenden Persönlichkeiten. Vertiefen Sie sich in das Schaffen dieser einzigartigen Denker und Künstler und lassen Sie sich von ihren Erlebnissen und Werken begeistern. Diese Sammlung gewährt tiefe Einblicke in das künstlerische Schaffen, das die Literaturwelt maßgeblich beeinflusst hat. Diese Sammlung enthält die Lebensgeschichten von: Goethe (Geschrieben von Gundolf Friedrich) Friedrich Schiller (Geschrieben von Otto Harnack) Stendhal (Geschrieben von Stefan Zweig) Balzac (Geschrieben von Stefan Zweig) Tolstoi (Geschrieben von Stefan Zweig) Dostojewski (Geschrieben von Stefan Zweig) Edgar Allan Poe (Geschrieben von Hanns Heinz Ewers) Annette von Droste-Hülshoff (Geschrieben von Thekla Schneider) Ludwig Tieck (Geschrieben von Rudolf Köpke) Bettina von Arnim (Geschrieben von Konrad Alberti) Clemens Brentano (Geschrieben von Ricarda Huch) Marceline Desbordes-Valmore (Geschrieben von Stefan Zweig) E. T. A. Hoffmann (Geschrieben von Eduard Grisebach) Scheffel (Geschrieben von Johannes Proelß) Mark Twain (Autobiographie) Charles Dickens (Geschrieben von John Forster) Friedrich Hölderlin (Geschrieben von Stefan Zweig) Kleist (Geschrieben von Stefan Zweig) Nietzsche (Geschrieben von Theodor Lessing) Gerhart Hauptmann (Geschrieben von Paul Schlenther) George Sand: Geschichte meines Lebens (Autobiographie) Romain Rolland (Geschrieben von Stefan Zweig) Hermann Hesse (Geschrieben von Hugo Ball) Maxim Gorki (Autobiographie)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die größten Schriftsteller:innen der Weltliteratur
Inhaltsverzeichnis
Gundolf FriedrichGoethe
EINLEITUNG
DAS nachfolgende Buch ist betitelt »Goethe«, ohne weiteren Zusatz. — Es ist daraus schon zu entnehmen worauf es wesentlich ankommt: auf die Darstellung von Goethes gesamter Gestalt, der größten Einheit worin deutscher Geist sich verkörpert hat. Die bloße Biographie hätte es nur zu tun mit einer Bewegung, einem Ablauf, falls sie nicht etwa gar, wie es gewöhnlich geschieht, ein bloßes Nacheinander von einzelnen Bakten gibt: jedenfalls ist der Schwerpunkt einer Goethe-biographie nicht seine Form, sondern seine Entwicklung, nicht was sich entwickelt, sondern wie sichs entwickelt. Die Werke aber haben als abgelöste Gebilde ihre eigenen Formen, ihre eigenen Gesetze, sie haben keine darstellbare Entwicklung. Was man meist Entstehungsgeschichte eines Werkes nennt, ist etwas völlig anderes als Entwicklung. Was wir an Werken fassen und geschichtlich darstellen können ist ein Machen, ein Hervortreten, nicht das Werden eines Gebildes: wir müssen uns bei den Werken an das Sein halten. Nur der Mensch selbst, die menschliche Gestalt ist uns zugleich als Werden und als Sein, als geprägte Form und als lebendige Entwicklung faßbar: denn der geistige, vor allem der schöpferische Mensch tut und erleidet nichts, bewegt und entwickelt nichts was nicht ein Bild von ihm machte, was nicht seine Gestalt ewig festlegte, und er hinterläßt kein Gebild, kein Werk, kein Bild von sich worin nicht seine Lebensbewegung fühlbar und wirksam wäre. Für den Biographen sind die Werke Zeugnisse eines Ablaufs, Mittel zu seiner Erkenntnis, für den Ästhetiker ist das Leben Stoff zum Aufbau der Werke, für den Betrachter der Gestalt sind Leben und Werk nur die verschiedenen Attribute einer und derselben Substanz, einer geistig leiblichen Einheit, die zugleich als Bewegung und als Form erscheint.
Für diese Betrachtungsart gibt es nicht ein Vorher und ein Nachher zwischen Erlebnis und Werk. Sie fragt nicht doppelt: was hat der so und so beschaffene Mensch erstens erlebt und zweitens daraus gemacht? Man kann zweifellos die Dinge so ansehen, und muß es sogar, sobald man die Kunst als eine individuelle, willkürliche Beschäftigung betrachtet, als einen Gegenstand menschlicher Betätigung. Wem aber die Kunst nicht Gegenstand, Folge oder Zweck menschlichen Daseins bedeutet, sondern einen urprünglichen Zustand des Menschentums, der wird auch in den Werken der großen Künstler nicht die Auslösungen, die Abbildungen, die Erläuterungen ihres Lebens sehen, sondern den Ausdruck, die Gestalt, die Form ihres Lebens selbst, d. h. also nicht etwas das diesem Leben folgt, sondern etwas das in und mit und über ihm ist, ja was dies Leben selbst ist. Die Werke sind dann nicht die Zeichen welche ein Leben bedeuten, sondern die Körper welche es enthalten. Der Künstler existiert nur insofern er sich im Kunstwerk ausdrückt.
Man hätte also kein wissenschaftliches Recht das Leben der großen Künstler außerhalb ihrer Kunst zu erforschen? Nun, man hat gar nicht die Möglichkeit es zu tunl Denn das was man gemeinhin das Leben eines Künstlers nennt, oder neuerdings das Erleben, ist bereits von vornherein eingetaucht in seine Kunst, ist derselbe Trieb und dieselbe Kraft wie sein Werk. Der nichtkünstlerische Mensch glaubt, der Künstler, der Dichter erlebe ungefähr dasselbe wie er und auf dieselbe Art, vielleicht ein bißchen abenteuerlicher oder fremdartiger, nur habe er außerdem als ein zufälliges Akzidens die Gabe diese Erlebnisse in Bildern, Gedichten, Musikstücken herausstellen zu können: das sogenannte „Talent“. Das gilt auch für die überwältigende Mehrzahl der Hersteller von Bildern, Gedichten, Musikstücken — es gilt nicht für den wirklichen Künstler, den wirklichen Dichter, der alle hundert Jahre einmal auftritt. Dieser erlebt schon in einer so völlig anderen Sphäre und in einer so völlig anderen Form als der unkünstlerische Mensch (in unserer Welt also, als der Bürger aller Stände) daß sein Erleben und der Ausdruck seines Erlebens (beides ist wesentlich eines) von diesem nie verstanden werden kann, auch wo es ihn überwältigt und beherrscht durch seine größere Wirklichkeit. Es ist einer der Unterschiede zwischen Dichtkunst und Literatur, daß jene Ausdruck einer eigenen, von der fertigen Welt unabhängigen Wirklichkeit, diese Abbild, Nachbild einer fertigen Wirklichkeit ist, einerlei ob ein naturalistisches, romantisches oder idealisierendes Abbild. Da der Banause nur eine Wirklichkeit, seine eigene kennt, so meint er überall wo er Wirklichkeit spürt seine eigene wiederzufinden, auch wenn es eine völlig andere ist. So hält er zum Beispiel Shakespeare für einen guten Schilderer der Wirklichkeit. Darauf beruht auch die ganze Theorie von der Kunst als Nachahmung oder die neuere der Einfühlung. Kunst ist weder die Nachahmung eines Lebens noch die Einfühlung in ein Leben, sondern sie ist eine primäre Form des Lebens, die daher ihre Gesetze weder von Religion, noch Moral, noch Wissenschaft, noch Staat, anderen primären oder sekundären Lebensformen, empfängt: keinen anderen Sinn hat der Satz l’art pour l’art.
Goethe ist das größte verewigte Beispiel der modernen Welt, daß die bildnerische Kraft eines Menschen, mag sie als Instinkt oder als bewußter Wille wirken, den gesamten Umfang seiner Existenz durchdrungen hat; Goethes Bildnerkraft hat alle seine zufälligen Begegnisse in Schicksal, d. h. in ihm zugehörige, sinnvolle, notwendige Wendung seiner Lebensbewegung verwandelt.. und eben diese Bildnerkraft hat alle seine Eigenschaften, alle von der Natur ihm als Rohstoff mitgegebnen Anlagen, in Kultur, in lebendige Bildung verwandelt, in Lebensgestalt: seine Vitalität in Produktivität. Über Goethes Schicksal waltet das was er selbst das Dämonische genannt hat. . das ist vielleicht von Gott aus gesehen oder gedeutet dasselbe was vom Menschen aus gesehen eben jene heimlich bildende Gewalt ist, jene Bildnerkraft die eine Gestalt schafft und den Raum, das Gesetz für diese Gestalt: dieser Raum und dies Gesetz der Gestalt ist bei den größten Menschen nichts anderes als ihr Schicksal. Das Schicksal ist die Atmosphäre ihrer Natur, und die schöpferische Kraft der großen Mensehen gehört deshalb nicht ihnen allein, ist nicht in ihnen beschlossen, sondern reicht über sie hinaus. Das Gefühl daß dem so sei, daß er selbst nur das Zentrum einer überpersönlichen Gewalt sei, Gottes, des Schicksals oder der Natur, daß sein Wesen selbst nicht ein Schicksal habe, sondern ein Schicksal sei, all das drückt Goethe mit dem ahnungsvollen Wort vom Dämonischen aus (wie Cäsar von seinem Glück und Napoleon von seinem Stern spricht). Das Dämonische ist nicht eine von außen eingreifende Macht, es ist mit dem Charakter des Menschen untrennbar verknüpft, ähnlich wie der verwandte Begriff Genie. Auch mit diesem Wort wird eine Begnadung durch irgendein Überpersönliches ausgedrückt, nur scheint das Dämonische mehr dem Schicksal anzugehören, d. h. dem was der Mensch erleidet und tut, und das Genie mehr der Natur, dem was er lebt und ist. Aber je höher ein Mensch steht, desto weniger sind sein Schicksal und seine Natur zu trennen: das Schicksal gehört zum Charakter, wie ja auch der Charakter schon ein Schicksal ist, das unentrinnbarste aller Schicksale.
So ist denn auch Goethes bildnerische Kraft und das Dämonische das über seinem Leben waltete untrennbar, es sind zwei Formen der einen Kraft (mag man sie nun seinem Glück oder seinem Charakter, seinem Schicksal oder seiner Natur zuschreiben) jener einen Kraft die aus seiner Zeit alles ihn Hemmende, Verkümmernde ausschied und wählerisch umbildete, daß aus fremden ZufällenGoethische Schicksale werden, und aus seinem Raum, seinem Wirkungskreis, alles Widerspenstige, Stockige, Unreine ausschied und wählerisch umbildete, so daß daraus Gestalt und Form wurde. Denn der Zufall ist für das Leben in der Zeit, was der Rohstoff für das Gestalten im Raum ist, das Fremde, Unnotwendige, Willkürliche, Unfreie und Unfreimachende, was ausgeschieden, bewältigt, geformt, angeeignet, anverwandelt werden muß. Das Resultat das hervorgeht aus der Anverwandlung der Zufälle ist das Schicksal des Menschen das Resultat das hervorgeht aus der Anverwandlung des räumlichen Rohstoffs, wie ihn die Natur bietet, ist Gestalt oder Werk.
Wie nur große Menschen wirklich eine eigene Gestalt und ein eigenes Werk haben, so haben auch nur große Menschen ein eigenes Schicksal. Der gewöhnliche Mensch hat bloße Eigenschaften, Meinungen, Beschafftigungen und Erfahrungen die von außen bedingt, nicht von innen erbildet sind. Ebenso hat der gewöhnliche Mensch nur Zufälle, Ereignisse, Begebenheiten von denen er sich treiben oder beeinflussen läßt. Je weiter die umbildende auswählende Kraft eines Menschen in das Chaos der Zeit und des Raums hinausreicht, desto weniger ist in seinem Leben Zufall, desto weniger in seinem Werk Rohstoff, desto weniger in seiner Gestalt bloße vitale Privateigenschaft, desto schicksalhafter, desto produktiver, desto vorbildlicher ist er. Das Zusammenstimmen dieser drei Fälle, so daß sie nur einer sind — eigenes Schicksal, eigene Schöpferkraft, eigene Gestalt — macht erst den klassisch großen Mann: sonst bleibt bloße Laufbahn, bloße Leistung, bloßes Genie übrig, wo der Hintergrund nicht zum Charakter, das Schicksal nicht zum Genie, das Werk nicht zum Leben gehört.
Goethe ist der einzige Deutsche der jene Harmonie völlig erreicht hat, er ist deshalb unser vorzugsweise klassischer Mensch. Darum ist bei ihm weniger als bei irgendeinem anderen modernen Menschen nötig, seine Werke aus seinem Leben zu erklären, hinter seine Werke zu greifen, um sein Leben zu erfassen: denn sie selbst sind sein Leben. Was er als eine Mahnung für Naturforscher aufstellt das gilt auch für den Goetheforscher: „Man suche ja nicht hinter den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre.“ Und weil er das wußte, hat er sein Leben selber als Werk, sein Werk selber als Ausdruck seines Daseins, als Form seines Lebens dargestellt, sein eigenes Wesen als Gestalt zu fassen und zu verewigen gesucht: kurz, die Lehre seiner Existenz selbst als Phänomen gegeben. Dies, und gerade dies bedeutet Dichtung und Wahrheit. Und doch hat man es fertig gebracht, dies Werk als die Begründung und Rechtfertigung für die sogenannte Goethephilologie in Anspruch zu nehmen, für denjenigen Teil der Goethe-philologie welcher durch Aufzeigen von Modellen und Quellen der Genesis Goethischer Werke und Erlebnisse näher kommen will. Es gibt dafür mancherlei Begründung und Rechtfertigung, aber gerade auf Dichtung und Wahrheit dürfen sich die Vertreter dieses Verfahrens nicht berufen, überhaupt nicht auf Goethes eigenen Vorgang bei der Deutung seines Lebens und seines Werkes. Denn Dichtung und Wahrheit ist nicht als Quelle für Goethes Leben, nicht als Kommentar zu Goethes Dichten gemeint, und wenn man sich gewöhnt hat es so aufzufassen und zu benutzen, so können Enttäuschungen und sogar törichte Stoßseufzer oder stupider Entdeckerjubel über Goethische „Irrtümer“ und „Fälschungen“ nicht ausbleiben. Dichtung und Wahrheit gibt Goethes Leben nicht als Stoff seines Werks, sondern als eine selbstgenugsame Form. Darum gibt es zwar von Goethes Leben, welches zugleich Gestalt und Produktivität war, eine klarere Anschauung als alle Kommentare zusammen, aber keine Erklärung. Denn eine Anschauung ist keine Erklärung, wie ein Wesen nie sein Begriff ist.
Goethes Worte über sein Leben sind selber Formen dieses Lebens, sie treten nicht daraus heraus. Er gibt uns immer nur verschiedene Sprach- und Denkstufen desselben Erlebens, und zwischen seiner Produktivität und seiner Betrachtung, seiner Erlebens- und seiner Denkart sind nur Iniensitäts-, aber keine Artunterschiede.
Um seine Selbstzeugnisse als Erklärungsmittel zu benutzen, müßten wir sie selber wieder erklären und so in infinitum. Was uns seine Selbstzeugnisse, von unwillkürlichen Gesprächen und Briefen angefangen bis hinauf zu dem bewußten Umformen seines Lebens in ,Dichtung und Wahrheit‘ bieten können ist immer nur Anschauung, nie Analyse dieses Daseins. Wir haben es bei ihm immer mit Sachen von Goethe, nicht mit Sachen über Goethe zu tun. Wir haben es immer mit derselben bildnerischen Kraft zu tun, ob er nun aus seinem Erlebnis heraus Sprache formt, oder von außen her über sein Erlebnis berichtet: sein Leben äußert sich immer als formendes, ob er es nun als Stoff unmittelbar aus seiner Gegenwart gestaltet, oder als ein vergangenes, bereits geformtes gedanklich spiegelt.
Wenn wir nun einen Wesensunterschied zwischen Goethes Erlebnis und Goethes Produktion nicht anerkennen mögen, und bei ihm nicht nur den Zusammenhang zwischen Leben und Dichten betonen, sondern die Einheit beider, die wir ja nur hinterher begrifflich trennen, so werden wir freilich zugeben daß sein Erleben und sein Dichten in den mannigfaltigsten Stufen und Graden waltet, und daß zwar in allem was von ihm ausgegangen ist die nämliche geprägte Form die lebend sich entwickelt wahrzunehmen ist, aber keineswegs überall in der gleichen Stärke, keineswegs überall mit der gleichen Dichte und Deutlichkeit, oder der gleichen sinnlich faßbaren, sinnbildlichen Gewalt.
Wir müssen die Punkte fassen wo Goethe am meisten seine Gestalt gibt, und wir sollen, eh wir darüber urteilen können wo er das tut, eh wir wählen und werten können an den unermeßlichen Schichtungen seines Schaffens, zunächst selber einen festen Punkt außerhalb seines Werkes haben, der es uns gestattet sein Werk als ein Ganzes, eben als einen Goethe zu überschauen. Man muß Goethe als ein Ganzes erlebt haben, eh man es wagen darf seine einzelnen Leistungen einzureihen, zu deuten oder zu benutzen als Formen seines Lebens. Ich wende mich damit ausdrücklich gegen den psychologischen Relativismus der in jede Äußerung hineinzukriechen versucht und sie als psychologisches Bekenntnis ausbeuten will, verführt durch Goethes eigenes Wort daß seine Werke Beichten seien. Goethe hatte das Recht seine Werke so zu empfinden, denn er lebte in ihnen und löste die Fülle die ihn bedrängte zu seiner Erleichterung als sprachliche Gebilde von sich ab. Wenn er sie „Beichten“ nannte, so drückte er damit nicht das Wesen der Werke, nicht ihren Gehalt aus, sondern nur sein Verhältnis zu ihnen, unter dem Gesichtspunkt eines ganz bestimmten Erlebens, das die Produktion ihm verschaffte: nämlich das Gefühl der Erleichterung. Beichten ist ein Akt, kein Gebild, und von seinem Schaffen als einem Akt allein sprach er, ohne damit über das Erlebnis selbst etwas auszusagen um dessentwillen er beichtete. Keinesfalls haben wir das Recht die Goethischen Werke unter dem Gesichtspunkt der Beichte zu werten. Das ,Beichten‘ verhält sich zum Werk, wie das Gebären zum Kind. Wenn Psychologie Seelenkunde heißen soll, so kann sie für den Historiker keinen anderen Sinn haben als aus dem was uns in der Geistesgeschichte allein gegeben wird, aus Person, Gebärde, Gebild, Wort die darin verkörperte Seele, das heißt die geheime, unsichtbare, wirkende und einheitliche Kraft wieder zu vernehmen, in unserer Sprache zu vernehmen. Das geschieht nun und nimmer, indem wir hinter die Dinge greifen, wie der Affe hinter den Spiegel, oder sie zerschlagen: denn der Leib selber ist Seele. Es geschieht dann und dadurch daß wir mit den Begriffen und Ordnungen welche unsere eigenen geistigen Voraussetzungen und unser Erlebnis der Urdinge uns ausgebildet haben, uns gedanklich klarmachen, in Wissen verwandeln was uns dort als Sein, als stummgestaltes Leben ergreift: daß wir als Bildung, als Eindruck auffangen was als Schöpfung, als Ausdruck gegeben ist.
Dies gilt selbst den Gebilden der Sprache gegenüber: denn die Sprache ist nicht nur das Arsenal der Begriffe und Gedanken, sie ist auch der Quell der Laute und Rhythmen, also eine unmittelbare Natur: sie gehört dem Denken und dem Leben, dem Geist und der Natur zugleich an. Sie ist als Kunstmaterial allerdings von dem Material der anderen Künste dadurch unterschieden daß nur sie dem Menschen allein angehört: Marmor, Klänge, Farben sind außermenschlich, die Dichtersprache ist wesentlich der menschliche Geist als Kunstmaterial. Dem Dichter Goethe gegenüber also haben wir insbesondere die Aufgabe seine in Sprachform gegossene Gestalt als Denkform zu erfassen. Die Aufgabe des Bildungshistorikers ist der des Übersetzers verwandt, nicht der des Grammatikers, wenn er auch die des Grammatikers beherrschen muß. Er muß eine lebendig bewegte Urform mühsam und gewissenhaft, mit aller Kenntnis jedes Sinns und jedes Gewichts nachbilden in einem anderen ihm angeborenen Material. Das Material des Schöpfers ist das Leben in irgendeinem seiner Urstoffe, Sprache, Klang, Farbe, das Material des Historikers ist das Denken, und die Aufgäbe des Literarhistorikers ist deswegen, wenn nicht schwieriger, so doch heikler, weil scheinbar sein Material und das Material der Schöpfer mit denen er zu tun hat dasselbe ist: die Sprache.
Aber nur scheinbar: der Literarhistoriker hat als Sprachbegriff zu deuten was Goethe als Sprachgebild gibt. Das schließt einen sehr hohen Anspruch in sich und eine sehr tiefe Resignation. Der Anspruch ist der: daß man überhaupt des Erlebnisses Goethe als eines Ganzen fähig sei und einen Sinn für Sprache als Gebild, als Dichtung habe: sonst bleibt man immer an analysierten oder psychologischen Einzelheiten hängen und hat nur Teile in der Hand. Die Resignation ist die: daß man niemals meinen darf mit einer begrifflichen Ordnung oder Deutung den lebendigen Goethe eingefangen oder eingereiht zu haben. Wenn wir unser Amt nicht mit der keuschsten und bescheidensten Ehrfurcht betreiben, so ist es eine anmaßende Torheit. Unsere Begriffe sind im besten Fall der farbige Abglanz an dem wir das Leben haben, unser armes Mittel uns selbst vor dem Großen zu behaupten, unser Behelf mittelbar uns anzueignen, was unmittelbar erlebt uns zersprengen müßte.
Vergessen wir nie daß all unsere Methoden nur Mittel sind und daß auch in der Literaturgeschichte das Beste die Ehrfurcht und der Enthusiasmus bleiben den sie erweckt. Hüten wir uns vor dem Dünkel zu meinen, mit dem Verstehen, der Kennerschaft und dem Beherrschen der Methode an sich sei schon viel erreicht, man habe dann den Dichter in der Tasche, sei gewissermaßen Herr über ihn, oder er sei nur Material für unsere Forschung. Das kleinste Meistergebild ist immer unendlich mehr als der weiseste Traktat darüber. Was die Brücke zwischen uns und dem Genius schlägt ist die ehrfürchtige Liebe die uns treibt uns in seine Äußerungen mit Fleiß, Ernst und Gewissen zu senken, nicht die Gescheitheit die aus beruflichen oder anderen Zwecken uns veranlaßt uns mit ihm auf Grund vorgegebener Methoden oder Kenntnisse zu befassen.
Ich will nicht der schöngeistigen Schwärmerei das Wort reden: die Exaktheit und Reinlichkeit ist selbstverständliche Voraussetzung jeder wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Werk des Genius, sie vor allem ist das Siegel einer ernsten Hingabe an ihn: aber die Methode darf nie Selbst zweck werden, und philologische Kritik nie übergreifen von der Reinigung der Papiere und Drucke zum Gebild und Geist selbst. So wichtig wie die Freiheit des Blicks für die Tatbestände ist die Ehrfurcht vor dem Gestalteten, und wir sollen uns durch keine noch so großen begrifflichen und philologischen Fertigkeiten einreden lassen, wir könnten vom Wesen eines Dichters mehr erfahren als unsere eigene Erlebnisfähigkeit, d. h. zuletzt: Liebefähigkeit hergibt. Fragen wir uns von Zeit zu Zeit: warum erforschen wir des Dichters Werk, aus äußerem Zufall oder aus einem inneren Bedürfnis? so werden wir uns auch über die Grenzen unserer Mittel, d. h. über die richtige Methode klar.
Daran zu erinnern ist vielleicht bei Goethe, der wohl jedem irgendetwas bedeutet, nicht so dringlich als bei manchem Engem, aber nicht Geringem, z. B. Hölderlin .. große Dichter sind keine Versuchskaninchen für methodische Zufalls-experimente. Und wenn Wissenschaft dem Trieb nach Erkenntnis entspringt, so ist doch auch der Trieb nach Erkenntnis nicht voraussetzungslos, sondern er entspringt von Fall zu Fall einem bestimmenden Erlebnis primärer oder sekundärer Art. Schon um der Wissenschaftlichkeit selber, gerade um der Exaktheit und Reinlichkeit willen muß man daher, eh man die Hebel der Erkenntnis in Bewegung setzt, sich fragen welches Erlebnis unser Erkennen in Bewegung setzt. Auch deshalb wird über keine Einzeläußerung Goethes der richtig urteilen können der nicht ein Gesamtbild in der Seele trägt. Nur ein solcher hat die erforderliche Fähigkeit überhaupt ein unübersehbares Material, wie es in Goethes sämtlichen Werken angehäuft ist, zu sichten und zur Herausarbeitung seiner Gestalt zu ordnen. Wer den Wert und das Wesen Goethes in seiner Vitalität, in seiner puren Fülle sieht der wird ihn dort am liebsten aufsuchen wo er diese Fülle am meisten als Rohstoff empfindet, in den unwillkürlichsten Äußerungen, in Gesprächen und Briefen. Wem seine Gestalt vor allem als Gestalt, sein Werk als der größte Bildner- und Bildungskomplex der neueren Zeit weltgeschichtlich ist der wird die Mitte Goethes in den Dichtungen finden die am dichtesten, am konzentriertesten seine Bildnerkraft verkörpern: in seinen eigentlich klassischen Gebilden.
Wir bekennen, daß wir selbst die Vitalität dort am stärksten finden wo ihre Macht zum Formen am stärksten ist, daß wir Lebensstoff am Menschen nur als Lebenskraft ehren und Kraft vor allem als Gestaltung. Goethe selbst wollte Gestalter sein, und gab nichts auf das bloße Ausströmen des seelischen Rohstoffs.
Aus einergroßenNatur schöne Kultur(Bildung) zu werden, das ist Goethes Instinkt, dann sein bewußtes Streben, dann seine Leistung gewesen. Daß selbst in den scheinbar unwillkürlichsten Ausbrüchen seines Sturms und Drangs, in allem was er brausend hinwarf oder spielerisch fallen ließ, in seiner gärenden Dumpfheit selbst schon jener Bildnertrieb wirkt, jener Wille durch Ausstoßung oder Herbeiraffung gestalter und reiner zu werden, das unterscheidet ihn mehr noch als seine Genialität von den Stürmern und Drängern. Es gibt keine Zeile von Goethe die nicht näher oder ferner, mittelbar oder unmittelbar, positiv oder negativ seiner Selbstgestaltung zu dienen hätte, die nicht Gestalt wäre oder erstrebte. Und mit diesem Begriff von Goethe, als dem gestalterischen Deutschen schlechthin, dem einzigen Begriff unter den ich sein Gesamtschaffen zu bringen wüßte, den einzigen der mir auf alle Seiten seiner Tätigkeit anwendbar erscheint, mit diesem Vorblick versuche ich die Äußerungen seiner Existenz in Gruppen zu bringen und damit zugleich den Gruppen die Bedeutung zuzuweisen welche sie für uns als Zeugnisse von Goethes Leben, als Mittel zur Darstellung seiner Gestalt haben können.
* * * * *
Drei Hauptzonen Goethischer Äußerungen kreisen konzentrisch von außen nach innen für den Betrachter die Mitte seines Wesens ein, in verschiedenen Dichten der Gestaltung: seine Gespräche, seine Briefe und seine Werke.
Jede dieser Gruppen enthält wieder Unterkreise nach der Mitte hin. Alle drei Gruppen enthalten den gleichen Lebensstoff und die gleiche Lebensrichtung, aber in verschiedenen Intensitätsgraden oder gewissermaßen Aggregatzuständen. Die Gespräche sind das scheinbar Unmittelbarste, vom Hörer oder Leser her betrachtet, weil sie unsere unmittelbarste Berührung mit der momentanen Oberfläche Goethes sind. Von Goethe aus gesehen sind sie aber die mittelbarste, d. h., die bedingteste, die von seinem gestalterischen Zentrum am meisten entfernte, die von seinem bewußten ordnenden Willen am wenigsten abhängige seiner sämtlichen Äußerungsformen. (Ich will hierbei von der methodisch und quellenkritisch bedeutsamen Nebenerwägung absehen, daß wir allerdings gar nicht Goethes unmittelbare Hörer, sondern nur die Leser seiner Hörer sind, also selbst hier auf eine vermittelnde, d h. trübende Überlieferung angewiesen sind.) In den Gesprächen ist Goethe am wenigsten aktiv, also gestaltend, am meisten passiv, d. h. beeinflußt, am wenigsten Formkraft, am meisten bloßer Lebensstoff, bloße Vitalität. Wem es am meisten um Goethes Vitalität zu tun ist, der findet hier ihre vorderste Quelle, ihren momentansten, d. h. oberflächlichsten Ausdruck. Das Gespräch wird mehr als alle anderen Lebensäußerungen erzeugt recht eigentlich durch die äugenblickliche Verfassung des Redenden, durch jede noch so momentane Gegenwart, in der die unberechenbarsten Elemente sich mischen.
Wir können bei Goethes Gesprächen indes wiederum zwei Gruppen unterscheiden, nach dem Maß der Bewußtheit womit er sie führte: die eine Gruppe der uns überlieferten Gespräche kommt aus seinem Bedürfnis sich auszusprechen unter dem Drang des Moments und stammt meistens aus seiner Jugendzeit. Später ist die vom Kanzler Müller vermittelte Sammlung unser Hauptzeugnis für diese Art Gespräche. Die andere Gruppe, die weitaus überwiegende Zahl, umfaßt diejenigen Gespräche in denen er seine Mitunterredner belehrt oder erzieht oder sein eigenes Bild mehr oder minder bewußt in die Seele des Hörers prägt. Goethe ließ sich, bei seinem entschiedenen Verantwortungsgefühl, durch den Menschen bedingen zu dem er sprach. Er achtete darauf was für diesen heilsam sei und suchte bei längerem Verkehr an ihm auszubilden was der Ausbildung bedürftig und fähig war. Wo er nichts auszubilden fand suchte er aus dem anderen herauszuholen was ihm, Goethe, selbst zu neuen Kenntnissen verhalf und ihm den Einblick und Ausblick erweiterte.
Aber gerade durch diese Bedingtheit, durch die notwendig einseitige Beziehung sind die Gespräche Goethes — selbst die unmittelbarsten, selbst die erwogensten — nur zufällige und momentane Zeugnisse für Goethes Wesen, auch wenn wir nicht dabei die bewußten und unbewußten Fälschungen abziehen müßten welche durch die Überlieferung entstanden. Schon in Goethe selber waren, wenn nicht fälschende, so doch einschränkende Faktoren die ihm den runden, freien Ausdruck seines Wesens verwehrten: sein erzieherisches Verantwortlichkeitsgefühl und der immer wechselnde Kontakt mit dem Hörer.
Dazu kommt noch eins: schon äußerlich erkennen wir die Gespräche als die oberflächlichste, die zufälligste, die unvollkommenste Zeugnisgruppe für Goethes Wesen: sie ist, verglichen mit den Briefen schon, geschweige mit den Werken, durchaus fragmentarisch. Wohl nicht der tausendste Teil dessen was Goethe gesprochen hat ist auf uns gekommen, von seinen Briefen wohl über die Hälfte, und von seinen Werken fast alles. Schon das deutet an daß von der Überlieferung über Goethe die Gespräche am meisten zufälligen Rohstoff enthalten, am weitesten von dem entfernt sind was Goethes tiefstes Wesen bedeutet: Gestalt. Aber da Goethe auch in seinen unbedachtesten flüchtigsten Augenblicken unter seinem gestaltenden Dämon steht, da er, besonders in seiner späteren Zeit, sein Ich zu solch erwogener Monumentalität durchgebildet hatte, daß keine seiner Äußerungen ganz zufällig war, so sind uns freilich auch seine Gespräche unschätzbar schon als Zeugnisse dafür wie diese ewige Gestalt zum und im Augenblick selber stand.
In ihrer Gesamtheit geben sie ein deutlicheres Bild als irgendein noch so selbstbekenntnishaftes Einzelgespräch Goethes. Fruchtbar für die Erkenntnis Goethes ist uns daraus nicht die besondere Erfahrung: wie war Goethe in dem und dem Moment, zu dem und dem Menschen? sondern die Gesamterfahrung: wie setzte sich sein Unwandelbares, Unveräußerbares auseinander mit dem Vorübergehenden, Zufälligen, Fremden? Web ches war seine Art, seine Geste des Reagierens? Denn Goethes Reagieren überhaupt, d. h. nicht sein Wesen, sondern seine Beziehungen können wir aus den zufälligen Dokumenten, aus den Gesprächen und dann aus vielen Briefen allerdings bequemer erfahren als aus den Werken. Denn Werke sind kein Sichinbezugsetzen. In seinen dichterischen Werken reagierte Goethe nicht auf einzelne Individualitäten, auch nicht auf sein zeitgenössisches Publikum: sie formten sich aus seinem Innern mit einer Notwendigkeit herauf die über seine Absichten hinausreichte, und selbst in seinen wissenschaftlichen Büchern, die allerdings Zwecke und Beziehungen nach außen hin hatten, galt Goethes Hinhorchen und Hinreden nur einer unsterblichen Geistergemeinschaft,’in der ein Gleichgewicht zwischen den besonderen Menschlichkeiten immer hergestellt war. Nur von Goethes Werk aus haben für uns die Gespräche und Briefe einen Sinn. Statt der Werke dürfen sie keinem gelten: sie sind das lebensvollste Zeugnis für den zeitlichen Goethe, d. h. nicht für sein Schaffen, sondern für seine Wirkung, nicht für den Seher, sondern für den gesehenen Goethe, für seine Stellung unter den Zeitgenossen und deren mannigfaltige Verhältnisse zu ihm.
Goethes Briefe sind nicht nur zuverlässigere Zeugnisse als die Gespräche, weil wir nicht auf die Glaubwürdigkeit der Vermittler angewiesen sind, sondern sie sind auch von Goethe selbst aus betrachtet minder bedingt. Zwar: sie sind gleichfalls die Auseinandersetzung mit einem bestimmten, soundso beschaffenen Gegenüber, von dem Goethe in gewissem Sinn abhängig wurde, indem er sich mit ihm in Bezug setzte. Denn wir gestatten jedem einen Anteil an uns, einen Eingriff in uns mit dem wir uns auseinandersetzen — das liegt schon in dem Wort. Aber in Wegfall kommen dabei die unwägbaren Einwirkungen des Moments, die Apprehension durch die Gegenwart des anderen. Der Briefschreiber steht dem Empfänger ferner und also freier gegenüber als der Sprecher dem Hörer: er sieht ihn zusammengefaßter, geistiger, und wird minder durch das vordergründliche Bild des momentan Gegenwärtigen befangen, er selbst ist kon zentrierter . . und so sind wir auch in den Briefen Goethes Zentrum um eine Zone näher als in den Gesprächen. Wir haben einen Goethe vor uns, der sich minder sub specie momenti gibt, einen gespannteren, konzentrierteren, dauerhafteren. Auch die Briefe unterliegen der Scheidung die wir bei den Gesprächen vornehmen konnten: in impressionistische und pädagogische — wovon abermals der weitaus größte Teil der ersten in die voritalienische, der größte Teil der letzteren in die spätere Zeit fällt.
Nun ist nicht ein für allemal das für Goethe bezeichnender was er bewußter geäußert . . nicht etwa ein wohlerwogenes Gespräch mit Eckermann an und für sich Goethischer als ein unwillkürlicher Ausbruch den ihm Müller entlockte. Seine fliegenden leidenschaftlichen Zettel an Charlotte von Stein enthalten nicht weniger Goethische Substanz als die Briefe an Schiller oder Zelter, worin er fast theoretisch gedrängte Überblicke über ganze Landschaften des Lebens oder der Kunst wirft. So echt, so lebendig, so sehr Goethischer Ausdruck sind seine unwillkürlichsten Äußerungen gewiß, denn auch der zufälligste Goethe unterscheidet sich von dem geformtesten nicht durch den geringem Grad der Echtheit, des Goethetums, sondern nur durch die geringere Komplettheit und Rundheit. Wir sind hier wieder an einen Punkt gestoßen worin Goethe einzig ist und ein eignes Gesetz für sich fordert: das Verhältnis von Instinkt und Bewußtsein in seinem Leben. Die bewußteren Äußerungen sind durchaus nicht bei jedem Menschen, und am wenigsten bei jedem genialen Mensehen die kompletteren und bezeichnenderen und als solche bei der Bewertung und Darstellung seines Lebens vorzuziehen. Es gibt Menschen die gewissermaßen nur in unbewachten Momenten ihre Mitte offenbaren, deren ganzes Bewußtsein nur eine einzige Umdeutung und Mißdeutung ihres Lebens ist, die um so zufälliger, unwahrer, unwesentlicher reden, je bewußter und absichtlicher sie sich kundgeben. Es ist das Schicksal fast aller romantischen Naturen, und aller schauspielerischen Naturen: Richard Wagner ist ein großes Beispiel. Bei solchen Menschen arbeitet der eigentliche Lebenstrieb, sei es nun ein produktiver oder ein aktiver, in einer völlig anderen Richtung als ihr Bewußtsein, ihr Bewußtsein weiß gewöhnlich nicht was ihr Instinkt will, wohin er will, und nur durch Momente der höchsten Erregung, bei Erlebnissen die die Geleise ihres gewöhnlichen Denkens überfluten oder zersprengen, vernehmen wir von ihnen Sprachtöne die aus derselben Welt zu kommen scheinen wie ihre rein genialisch instinktiven Hervorbringungen.
Es ist ein wesentliches Zeichen der klassischen Naturen daß bei ihnen Instinkt, Genie und Denken in derselben Richtung arbeiten. Ihr Denken ist nur die bewußte, hell gewordene Verlängerung des dunklen Lebensstroms der aus ihrer Mitte bricht, nur der genaue und gewissenhafte Vollzieher dessen was der Grundtrieb ihres Lebens ihm befiehlt, ihr Denken hat nicht, wie bei den Romantikern, Mystikern, Musikern eine eigene gesetzgebende oder gesetzstürzende Gewalt, sondern nur eine exekutive. Bei solchen Naturen sind die Äußerungen des formenden Bewußtseins nur der getreue Index dessen was in der dunklen Mitte und Tiefe vorgeht, die Helle ihrer Glut, der Logos ihres Eros . . Denn Logos und Eros sind dann nicht notwendige Gegensätze, es sind nur verschiedene Helligkeitsgrade desselben Zustandes. Für diese klassische Geistesart, welche im Altertum uns immer wieder als Norm bezaubert, ist in der neuen Welt Goethe das größte, sicher das deutlichste Beispiel.
Wenn auch das was er über sich wußte nicht das Ganze dessen ist was er war, sondern sich dazu verhält wie die Oberfläche der Kugel zum Inhalt der Kugel, so zeigt es doch für uns, die nicht Goethe sein können, sondern nur ihn denken können, seine Gestalt genau so deutlich an wie die Oberfläche der Kugel uns die Gestalt und den Umfang der Kugel anzeigt. Das Bild das Goethe von sich in die Welt werfen wollte entspricht wirklich dem was er war, und darum widersprechen auch niemals seine bewußten Kundgebungen (nicht einmal im sachlichen und begrifflichen Inhalt, geschweige in der seelischen Haltung) seinen unwillkürlichen Ausbrüchen, nur geben sie dasselbe deutlicher, ausgeprägter, mit einem Wort, vollkommener. Darum ist der Werther ebenso echt Goethisch wie die Briefe an Lotte Buff und ihren Bräutigam, aber zugleich intensiver und monumentaler Goethisch. Und vielleicht ist es, bei dieser Anlage Goethes, sein dumpfstes Leben sofort in hellsten Sprachausdruck — das heißt doch Denkausdruck — umzusetzen, überhaupt heikel und unerlaubt eine strenge Grenze zwischen seinen unwillkürlichen und seinen bewußten Äußerungen zu ziehen: auch ist es nur ein ordnendes Hilfsmittel, in der Wirklichlceit fließt diese Grenze. Was zur Sonderung berechtigt, ist auch nicht der Unterschied beider Äußerungsarten, wie er in Goethes Charakter und Genie begründet ist, von innen her, sondern ihre verschiedene Begrenzung von außen her oder nach außen hin. Die unwillkürlichen Äußerungen sind solche die von außen her durch augenblickliche Umstände bedingt werden, durch die Person des Hörers oder Adressaten, oder was an Drang und Enge jeder Augenblick sonst mit sich bringt: das fälschende, den Willen Bedingende liegt hier also im Momentanen.
Ein fälschendes und einschränkendes Moment liegt auch in den sögenannten bewußten Äußerungen: das ist der Zweck, der pädagogische, po litische, wissenschaftliche Sinn der dem Willen Goethes Richtung gibt und Grenzen setzt. Nur ist der Sinn mehr in der Gewalt Goethes, mehr seinem Wesen angehörig, insofern also seiner Willkür mehr unterstellt als die äußeren Umstände, und insofern sind seine zweckmäßigen Äußerungen, seine bewußten Hinwendungen seiner Mitte näher, für ihn bezeichnender als seine unwillkürlichen. Denn Goethe konnte schon keine Zwecke haben die außerhalb seines Lebenstriebes lagen, eben weil er ein klassischer Mensch war, bei dem Trieb und Denken einheitlich wirkten. Wenn uns seine unwillkürlichen Äußerungen in ihrer Gesamtheit zeigen wie sein Ich auf das Nichtich reagierte, so erfahren wir aus seinen bewußten, zweckbedingten Äußerungen welche Grenzen und Ziele er sich selbst steckte: Beide Äußerungen geben seine Beziehung zur Welt, die unwillkürlichen seine passiven, die bewußten seine aktiven: die unwillkürlichen Gespräche, die hingeworfenen Zettel, zeigen Goethe leidend, die überlegten Unterredungen und Briefe, die Rezensionen, die wissenschaftlichen Traktate und die Dokumente zu seiner Amtstätigkeit zeigen ihn tuend — beides Beziehungen, Bedingtheiten, nicht selbstgenugsames Wesen.
Wollen wir erfahren, nicht was Goethe litt und tat, sondern was er war und schuf, kraft seiner angeborenen Entelechie, so wenden wir uns an die innerste Sphäre seiner Welt, an seine dichterischen Werke. Nur Goethes Dichtungen geben seine unbezogene, in sich vollendete, autonome Gestalt, ohne Rücksicht auf das zeitlich beschränkte Dasein, ohne Rücksicht auf äußere Zwecke, — den produktiven Menschen. Sie sind die gestaltete Fülle seines Wesens das sich nach innerem Gesetz herauf formt, in diesen Formungsprozeß jeweils alles Augenblickliche als Stoff hereinzieht, verzehrt, verwandelt, wie der Formtrieb, das Wachstum einer Pflanze seine Nahrung aus Luft, Erde und Feuchtigkeit — also den äußeren Umständen und Zufällen ihrer Existenz — sich aneignet, in ihr Wachstum, ihr Pflanzentum, ihre Form verwandelt. Innerhalb der Werke selbst sind die Wirksamkeitsgrade dieses inneren Formgesetzes der Goethischen Gestalt ebenfalls verschieden. Wie sind die tausend mannigfaltigen Dichtungen alle als Ausprägungen einer und derselben Gestalt zu begreifen? Wie kann uns ein Zeitliches, nämlich Erleben und Schaffen, als Räumliches, nämlich als Gestalt, erscheinen? Der Widerspruch löst sich, wenn wir uns die zeitliche Entwicklung nicht vorstellen als das Abrollen einer Linie die von einem Punkte weiter geht, bis sie äußere Widerstände findet, sondern als die kugelförmigen Ausstrahlungen von einer Mitte her, Ausstrahlungen die im Maß als sie Vordringen zugleich die Atmosphäre, den Stoff den sie vorfinden, verwandeln mit ihrer spezifischen Kraft. Bei einer solchen Anschauung, die für den schöpferischen Vorgang das bezeichnendste Gleichnis gibt, ist kein Widerspruch zwischen dem Räumlichen und dem Zeitlichen einer Gestalt, zwischen der geprägten Form und der lebendigen Entwicklung. Denn im Vordringen, im Ausstrahlen, im Verwandeln ist die zeitliche Funktion, im Kugelartigen die räumliche Funktion der Gestaltung. Es ist die Rede von einer Kräftekugel. Dies Gleichnis verdeutlicht zugleich das Verhältnis von Gehalt und Stoff im Goethischen Schaffen: der Gehalt ist die lebendige, ausstrahlende Kraft, der Stoff ist die Atmosphäre dem diese ausstrahlende Kraft auf ihrem Vordringen begegnet und den sie durch ihr Vordringen verzehrt, verwandelt, der Goethischen Kräftekugel einbezieht.
Die einzelnen Werke sind die sichtbaren Schichten dieser strahlenden Kraft, als die Zonen der Gesamtkugel immer Goethisch, immer Zeugnisse der gleichen Gestalt, aber von verschiedenem Umfang und verschiedener Dichte und Struktur, wie die verschiedenen Jahresringe an Bäumen: gleichfalls Zeugnisse wirkender flüssiger Kräfte, gleichfalls raumgewordene Zeugnisse für zeitliche Vorgänge. Goethes Werke sind also Jahresringe, Jahreszonen der Goethischen Entwicklungskugel, nicht Stationen einer Goethisehen Entwicklungslinie.
Wenn sich nun Goethes dichterische Werke als die Verkörperung seiner eigentlichen ewigen Gestalt abgrenzen gegen die Gespräche als gegen die Äußerungen seiner unwillkürlichen Augenblicke, gegen die Briefe und die theoretischen Werke als gegen die Äußerungen seiner zweckhaften Tätigkeit, wenn ich dort den passiven Goethe, hier den aktiven, in den Dichtungen den produktiven Goethe suche, so wird das verdeutlicht durch drei seiner Orphischen Urworte, worin er Grundmächte des Menschtums formuliert hat: Δαιμων, Τυχη, Αναγxη. Goethes Gestalt und Dichtung steht unter dem Dämon. Aber die Art wie diese Gestalt, die von innen her sich nach einem notwendigen Gesetz auswirkt, in die fremde äußere Wirklichkeit tritt, sich mit ihr durchdringt, sich ihr anpaßt oder ihr ausweicht, — denken wir immer an den Weg der Pflanze vom Samen bis zur Reife — wird bezeichnet durch Tyche, das Zufällige: es ist das Ab und Zu seines Lebens, wir sehen gleichsam hier die Splitter und Schnitzel die dabei abfielen, wenn er an dem Block seines Lebensstandbildes arbeitete. Die Niederschläge dieses Zufälligen sind in Goethes Produktion alles was Experiment, Kompromiß, Gelegenheitsdichtung, Festpoesie ist, was die äußeren Fluktuationen seines Lebensganges begleitet und flach festhält.
Der dritte Begriff, Anangke, Nötigung, unter den Goethe im Gegensatz zu dem inneren Gesetz die äußere Bedingtheit des Lebens, das von außen gegebene Müssen oder Nichtdürfen, die Bestimmung durch eine Gewalt die nicht sein eignes Wesen ist, das Verhängnis, begreift, ist freilich nicht ohne weiteres in der Produktion wiederzufinden. Denn es liegt im Wesen der Nötigung daß sie nicht produktiv macht, sie ist ja gerade das dem Dämon entgegengesetzte Prinzip: Produktion aus der Anangke wäre zum Beispiel alles was ohne innere Not um des Gelderwerbs, um des Lebensunterhalts willen geschrieben ist — und dergleichen gibt es bei Goethe nicht. Anangke, äußere Nötigung, widerspricht dem Prinzip des Schöpferischen selbst, welches innere Notwendigkeit ist. Wir mögen daher den Einfluß der Anangke bei Goethe eher in dem suchen was er verschweigt, was er in seinem langen Leben alles herunterschlucken mußte, in dem worauf er verzichten mußte, wie sehr immer er Götterliebling war .Wenn er als alter Mann den Satz aussprach, daß alles im Leben uns zum Entsagen mahne, so dürfen wir in dieser Weisheit einen Niederschlag seiner Anangke finden. Aber mittelbare Zeugnisse dafür daß Goethe selbst ein auch von außen bedingter, gezwungener Mensch war, sind noch diejenigen Auße« rungen in denen sein Verantwortungsgefühl gegenüber fremden Menschen spricht, seine vielen auf Amtstätigkeit gerichteten, aus Berufspflichten hervorgegangenen Dokumente, in einem gewissen, allerdings entfernten Sinn noch diejenigen seiner Äußerungen die sich an ein empirisches Publikum wenden und damit nach einem Publikum richten. Insofern gehören also seine Gespräche hierher, aber auch seine Briefe, und selbst seine Rezensionen. All solche Äußerungen tragen die Spuren außergoethischer Wirklichkeiten und Bedingungen an sich und sind mehr Beiträge zu Goethes Geschichte als Zeugnisse für Goethes Wesen.
Unter Goethes Dichtungen sind gleichfalls mehrere Zonen zu unterscheiden, und zwar nach dem Grade der Unmittelbarkeit womit Goethes Erlebnis in diesen Werken dargestellt wird, besser: sich selbst darstellt: die lyrischen, die symbolischen und die allegorischen Dichtungen. Zuerst sei erklärt warum ich diese Einteilung der gangbaren nach Gattungen vorziehe, in Lyrik, Epos, Drama. Die gangbare Einteilung hat ihren Grund, wenn man das Material einer ganzen Literatur zu ordnen hat und dabei Grundformen wahrnimmt die unabhängig von den einzelnen Individuen, vom spezifischen Gehalt und selbst vom Stoff, begriffliche, sachliche, außermenschliche Merkmale gemeinsam aufweisen. Wer Gesetze sucht, losgelöst vom einmaligen so und so beschaffenen Menschen, wer Proportionen oder Dimensionen in der Dichtung abziehen will von der konkreten Gestalt dem ist mit den Merkmalen der Gattung viel geholfen. Wer vom konkreten. Menschen ausgeht und die Formen erforschen will worin sich ein bestimmter Lebensgehalt entfaltet, der kann nichts anfangen mit den vorgezimmerten, von seinem konkreten Fall unabhängigen, allgemeinen Begriffsfächern: denn gerade das worauf es ihm ankommt, das spezifische, neue, noch nicht Dagewesene, den Gehalt eines Lebens kann er nicht einfassen in Schachteln die zu anderen Zwecken hergestellt sind.
Eine Frage für sich, eine ästhetische Nebenfrage wäre: wie setzt sich ein neuer Gehalt mit den alten Begriffen und Ordnungen auseinander die er als gültig vorgefunden hat, wie werden die alten Gattungen durch den neuen Gehalt modifiziert? werden sie gefüllt durch ihn, gesprengt oder wesenlos? Aber diese Frage gehört gleichfalls in die Geschichte der Gattungen, nicht in die Geschichte Goethes. Die Frage die wir uns bei der Darstellung Goethes vorlegen müssen ist: in welche Formen hat sein Gehalt sich entfaltet, welche hat er sich geschaffen, welche waren ihm gemäßer Ausdruck? nicht die: in welche Schachteln hat er gepaßt?
„Gattung“ bedeutet in der modernen Welt nicht mehr (wie im Altertum γενος) Formen mit immanenten Gesetzen, welche sich selbst aus jedem spezifischen Gehalt ihre Verleiblichung schaffen, durch jeden Gehalt hindurch, durch alle Individuen hindurch wirken, sondern nur noch begriffliche Einteilungsprinzipien mit denen die Gelehrten der Stofffülle Herr zu werden suchen (nicht Formen, sondern Formeln). Der Begriff γενος, Gattung, stammt aus dem Altertum und hat dort einen beinah religiösen Sinn: denn die antike Menschheit, so vielfältig und -spältig sie sein mochte, fühlte sich jederzeit und an jedem Ort religiös gebunden, unter ein göttliches, magisches Gesetz gestellt dem gegenüber auch das stärkste Einzelwesen wohl Existenz hatte, aber keine Geltung. Dieses Gesetz wurde nicht nur begrifflich gedacht, sondern leibhaft gefühlt, von Leibern getragen, in Leibern dargestellt, bluthaft durchgelebt und in allen Funktionen menschlichen Daseins ausgewirkt. Ein anderer Name für dies Gesetz ist „Tradition“. Der Einzelne, und wär es ein Äschylus oder Plato, ein Alexander oder Cäsar, hatte dieser Tradition, diesem göttlichen Gesetz gegenüber wohl eine Macht, aber kein Recht: d. h. er konnte sie, und das war schon tragische Hybris, umbiegen, bereichern, ihren Formenkreis erweitern — (denn die Tradition ist ein Komplex von lebendigen Formen und Riten, nicht ein Kodex geschriebener, erdachter Satzungen) aber es kam auch dem Titanischsten nicht in den Sinn, auf das Recht des großen Individuums pochend, dies göttliche Gesetz zu durchbrechen oder aufzuheben, vielmehr glaubte jeder es erst recht zu erfüllen. Gerade wie es heute auch dem kühnsten Revolutionär nicht einfallen würde die Naturgesetze zu vernichten, sondern hochstens sie anders zu deuten oder anders zu nutzen. Unser Begriff „großes Individuum“ „große Persönlichkeit“ als selbständiger Wert war der An tike unbekannt, und wird nur fälschlich von uns in sie hineingetragen: der antike Heros ist ein göttlicher Mensch, d. h. entweder ein Verkörperer des göttlichen Gesetzes oder sein Verkünder, und nur um dieses Gesetzes willen hat er Geltung. So ist auch im antiken Glauben nicht das große dichterische Individuum der eigentliche Gehalt und Träger der Kunstgebilde, sondern die Tradition, das göttliche Gesetz, von dem die Kunst nur eine Funktion ist . Wie das Gesetz seine Riten und Formen ausgebildet hatte, so war das Verhältnis der schöpferischen Geister zu ihrer Kunstübung etwa so wie das des Priesters zu den magischen Bräuchen: beide sind nur Exekutoren göttlichen Gebots, nicht Expressoren persönlicher Erlebnisse. Wie die Priester wohl Riten erweiterten oder neue fanden, sei es unter göttlicher Eingebung oder unter Anpassung an Ereignisse und Verhältnisse, so müssen wir uns auch Entstehung, Ausbildung, Verwandlung, Zerfall und Erstarrung der Kunstgattungen vorstellen: auch die antiken Gattungen sind nur die heiligen Formen einer heiligen Tradition, welche wie jede Tradition natürlich als Vertreter und Träger Menschen hat und demgemäß modifiziert wurde. Wie die Kunst selbst nur eine Funktion des Göttlichen war, so auch die Gattungen. Solcher Gesinnung mußten also die Gattungen etwas Tief lebendiges, Gestaltetes, Leibhaftes, Bluthaftes bedeuten. Sie waren der eigentliche Sinn, der Gehalt, die Träger, die Kontinuität, das Weiterzeugende und Bewahrende der ganzen Kunstübung: daher auch der geheimnisvolle, aus dem Mysterium der Zeugung selbst genommene Name γενος, Gattung, der für uns freilich schon zu abgegriffen und schulbuchmäßig mißbraucht ist, um jenen Schauer noch emporzurufen den der antike Mensch dabei empfand. Diese Bedeutung, als lebendige Riten und Formen einer göttlichen Tradition, mußten die Gattungen verlieren, sobald nicht mehr das göttliche Gesetz, sondern die große menschliche Persönlichkeit der gültige Sinn des Lebens und der Träger der Kunst wurde. Das heißt freilich nicht daß das große Individuum vorher keinen Einfluß, keine Macht hatte — nur daß es keine Geltung als solches, keinen Sonderwert hatte.
Mit der Renaissance aber wird die Ausbildung des großen Menschen und sein Ausdruck der Sinn der Kunst, also die Ausprägung eines immer neuen Gehalts ohne bewußte Rücksicht auf göttliches Gesetz. Der erste gewaltige Mensch der derart seinen Gehalt ausprägte, Dante, ist zugleich der erste dem gegenüber die Frage nach der Gattung unmöglich und absurd ist, der seine neue Form aus einem neuen unerhörten Gehalt hervortrieb, und dessen Form zum erstenmal nichts anderes ist als seine sprachgewordene Gestalt selber. Nun übernahmen allerdings die Renaissance-poeten und humanistischen Literaten mit der Wiedererweckung des Altertums zugleich seine nachträglich festgelegte Poetik und damit den Begriff Gattung, ohne das antike Lebensgefühl das diesen Begriff geprägt und gefüllt hatte. Es gab Poeten die in die erstarrten, begrifflich ausgeschälten Gattungen hineindichteten, im Wahn, einfach die antike Tradition fortzusetzen. Aber eine Tradition ist nur fortzusetzen wo derselbe Glaube, dasselbe Weltempfinden, dieselbe Religion noch waltet: und die Religion des Humanismus war durch mehr als ein Jahrtausend der ungeheuersten seelischen Wandlungen von der Religion der Antike getrennt, als die Humanisten in die alten Schläuche den neuen Wein füllten. So ist denn auch eine bloß sekundäre Philologen-poesie geblieben, wenn nicht gar eine unlebendige Mache, was von den antiken Gattungen her, in die antiken Gattungen hinein gedichtet wurde. Die lebendige moderne Poesie, Dante und Petrarka, Ariost und Tasso, Rabelais, Cervantes und Shakespeare, hat sich, wo sie ihrem ursprünglichen Impuls folgte, zunächst nicht um Gattungen gekümmert. Erst als die Bildungsflut die mit der Renaissance über Europa hereinbrach selber anfing zu erstarren und bestimmte feste Konventionen und Traditionen gesellschaftlicher, literarischer, bildungsmäßiger Art (nicht religiöser Art, wie die antiken) sich festsetzten, begann auch jener begriff liche Kult der Gattung die Ästhetik zu beherrschen und die Produktion zu lähmen, der Klassizismus aller Länder. Ja, es ist dann beinahe das Zeichen und die Aufgabe der schöpferischen Genien geworden, dem menschlich-individuellen Gehalt gegenüber den Gattungen immer wieder und wieder zum Durchbruch zu verhelfen, immer neue, unerwartete Formen zu schaffen, oder, wie es die Ästhetiker hinterher nannten, nachdem der neue Gehalt gegen ihre begrifflichen „Muster und Regeln“ sich dennoch durchgesetzt hatte, neue Gattungen, neue Muster und Regeln aufzustellen.
Während im Altertum der Schöpfergeist vor allem Vollender der Gattung war, ist er in der modernen, individualisierten Welt vor allem Zersprenger der Gattung. Während im Altertum die Gattung das Maß des großen Menschen war, ist seit der Renaissance der Mensch das Maß, der Richter oder der Vernichter der Gattung. Das liegt nicht daran daß sich das Wesen und die Funktion des schöpferischen Menschen an sich seitdem geändert hätte, sondern der Sinn der Gattung hat sich geändert - das antike Genus und die moderne Gattung sind zwei völlig verschiedene Dinge geworden — sie sind so verschieden wie eine Substanz von einer Relation, wie eine Gestalt von einem Begriff. In einer modernen Dichtung fängt das Wesentliche erst an wo die Gattung auf hört, und ein neuerer Dichter ist, im Gegensatz zu den antiken Dichtern, umso wertvoller, je hinfälliger bei ihm die Frage nach seiner „Gattung“ wird. Ich habe deshalb das alte Einteilungsprinzip — Lyrik, Epos, Drama — bei Goethe aufgegeben, weil es ihm gegenüber, wenn nicht falsch, so doch gleichgültig ist, nichts Spezi fisches faßt, seinem Gehalt und seinen Formen nicht gerecht wird. Durch dies Prinzip würden nämlich Werke zusammengerückt die so wenig miteinander zu tun haben wie etwa des Epimenides’ Erwachen und Iphigenie: wovon das erste kaum zu Goethes Dichtung, sondern zu seinen Amtspflichten gehörte, ähnlich wie seine Singspiele und Maskenzüge, die er als weimarischer Hofmann und maître de plaisir abzufassen hatte. Durch dies Prinzip würden Werke auseinandergerissen die so eng zusammengehören wie der Werther und der Urfaust. Der Faust selbst würde nicht recht unterzubringen und von den Gattungen her als ein schiefes und mißratenes Werk anzusehen sein: denn die Gattungen tragen zugleich Gesetze und Wertmaßstäbe in sich, und zwar solche die nicht dem Werk entnommen, mit dem Werk gewachsen, durch das Werk gegeben sind, sondern von einem allgemeinen Prinzip aus richten.
Die Einteilung nach dem Gehalt macht nun zwar auch nicht den Anspruch das Werk einzufangen oder zu umschreiben, ja es ist gerade ihr Vorzug vor jener dogmatischen Gattungs-einteilung, daß sie keine festen Schachteln mitbringt, sondern nur die Richtung angibt in der sich ein Werk bewegt, oder den Dichtigkeitsgrad der Gestaltung: kurz, daß sie nicht statisch, sondern dynamisch ist.
Ich gebrauche dabei „lyrisch“ in einem besonderen Sinn. Man versteht unter „Lyrik“ gemeinhin die kurze Ichdichtung welche das Gefühl, die Stimmung, den Gedanken des Dichtenden als gegenwärtig ausspricht, einerlei ob in und aus dem Erlebnis oder ob über dem Erlebnis, ob mit oder ohne Maske, ob vom Einzelnen oder der Gemeinschaft aus. Das Hauptmerkmal der Lyrik ist dabei das sich selbstdarstellende Ich, im Gegensatz zu der Epik, als der Erzählung einer fremden vergangenen Begebenheit, und dem Drama, als der Vorstellung eines fremden, gegenwärtigen Geschehens. Das Ich, Hauptmerkmal der „Lyrik“ im alten Sinn, stellen wir in einen anderen Gegensatz als dieser. Vom Gehalt aus gesehen kann der bezeichnende Unterschied der Lyrik nicht mehr das Ich sein: denn der Gehalt aller wirklichen Dichtung kann immer nur das Ich des Dichters sein, einerlei ob dieses Ich, wie in der Antike, nur als der unbewußte oder bewußte Vertreter einer Gesamtheit oder Gottheit redet, oder, wie seit der Renaissance, mehr und mehr den Anspruch auf eine selbständige Geltung erhebt. Der Stoff freilich kann dem ganzen Bereich des Nicht-ichs, der fremden, vergangenen oder gegenwärtigen Welt angehören. Mein Einteilungsgrund für Lyrik, Symbolik, Allegorik ist das verschiedene Verhältnis von Gehalt und Stoff im Werk, oder was dasselbe ist, vom Dichter aus gesehen, von Ich und Welt, vom Betrachter aus gesehen, vom Gestaltenden zum Gestalteten. Lyrik, Symbolik und Allegorik bezeichnen drei verschiedene Arten der Stoffgestaltung, drei verschiedene Distanzen des gestaltenden Ich zu seinem Stoff, drei verschiedne Stufen der Stoffdurchdringung. In der Lyrik ist dem Dichter sein Stoff unmittelbar durch sein Dasein und sein Erlebnis gegeben: Stoff und Gehalt sind eines. Hier liegt eine Verwechslung nahe, man kann fragen: Ist etwa der Frühling, die Geliebte, das Vaterland, Gott und die Gegenstände sonst denen der Lyriker sein Lied weiht —sind diese alle ihm unmittelbar gegeben? Ist dies alles kein Nichtich? Ja, dies ist auch nicht der Stoff seiner Lyrik, sondern nur der Anstoß durch welchen der Stoffgestaltungsprozeß bei ihm erst ausgelöst wird. Nicht den Frühling, die Geliebte usw. hat der Lyriker zu gestalten, sondern das Erlebnis, die Schwingung in welche er durch diese äußeren Dinge versetzt wird. Das Erlebnis des Frühlings ist sein Stoff, nicht der Frühling selbst. Die Verwechslung dieser beiden grundverschiedenen Inhalte, eines Gegenstandes mit dem Erlebnis eines Gegenstandes, ist ein Grundirrtum der alten Ästhetik. Die Art wie der so und so beschaffene Mensch bei dem oder jenem Anstoß schwingt ist immer wieder verschieden, nach Tempo und Umfang, Intensität und Maß: aber das ändert nichts daran daß die Schwingungen eines Instruments, eines Ichs, wie verschiedenartig sie auch sein mögen und von was sie auch herrühren mögen, als erste von vornherein gegebene Grundlage doch immer dies Ich mit seiner besonderen Struktur haben, und daß sie zweitens untereinander alle nach einem bestimmten Gesetz verwandt sind, von den Schwingungen aller anderen Instrumente wesenhaft unterschieden. Die Rhythmik und Melodik eines Lyrikers ist die sprachliche Darstellung, Verkörperung dieser Schwingungsart, und was man den „eigenen Ton“ eines Lyrikers nennt, ist jenes einheitliche, in seinem Ich gegebene Gesetz, nach dem er überhaupt schwingen kann, einerlei durch welchen Anstoß er ins Schwingen gerät. Der Anstoß ist nicht der Stoff: Lyrik ist diejenige Dichtungsart in der Gehalt und Stoff von vornherein identisch sind, nämlich das Wesen des dichtenden Ich. Lyrische Form ist die Darstellung der Erlebnisse dieses Ich in den Schwingungen dieses Ich. Das einzige Sinnbild dessen das Gesamt-Ich sich bedient zur Darstellung seines Gehalts ist die jeweilige in Rhythmus oder Melodie verkörperte Bewegung dieses Ich.
In der Lyrik ist die Bewegung, die Schwingung, selbst schon die Gestaltung: d. h. das bewegte Ich bedarf keines anderen Materials, keiner Aus einandersetzung mit fremdem Material, um sich auszudrücken und zu verkörpern als sich selbst. Indem es sich bewegt, gestaltet es sich schon. Insofern ist Lyrik die unmittelbarste Dichtkunst, aber eben daraus ergibt sich daß wirkliche Lyrik nur einer ursprünglich gestalteten, bildnerischen, formhaften Seele möglich ist, nur einer Seele deren Gehalt selbst schon Form ist. Denn Lyrik ist alles andere als bloßes empirisches Aussprechen jedes beliebigen Ich, Erguß der Seele um jeden Preis, Sprechen wie einem der Schnabel gewachsen ist. Nur wem der Schnabel wirklich zum Singen, zu rhythmischer und melodischer, also gesetzlich geformter Äußerung gewachsen ist, wird, wenn er singt wie ihm der Schnabel gewachsen ist wirkliche Lyrik hervorbringen. Niemals kann ein chaotischer Mensch ein ursprünglicher Lyriker sein, nur ein primär formhafter Mensch kann das. Der primär chaotische Mensch kann ein großer Symboliker und Allegoriker werden, weil aus dem Ringen eines chaotischen Ich mit fremdem Stoff, aus der heiligen Ehe zwischen Ich und Welt Gestaltung hervorgehen kann: aber gerade beim Lyriker ist ja ein solcher Weg vom Chaos zur Gestalt, welcher das Wesen des künstlerischen Prozesses ist, nicht möglich, es gibt in der Lyrik keine Vermittlungzwischen Ich und Welt, da ja die einzige Welt des Lyrikers sein Ich selbst ist — es gibt keinen Umweg von der Bewegung zur Gestalt, da ja die Bewegung hier selbst schon Sprachgestalt sein muß.
Es gibt Menschen bei denen die Vitalität die Produktivität überwiegt, die eine größere Lebensfülle haben als sie gestalten können: bei solchen ist die Gefahr des Chaotismus, wie bei Jean Paul z. B., auch bei Novalis. Es gibt andere bei denen es umgekehrt ist, bei denen der Wille zu gestalten immer wach und gespannt ist, aber das innere Leben nicht Material genug bietet um diesen Gestaltungswillen immer zu beschäftigen: er wendet sich dann leicht gegen sich selber und erstarrt in einem Formen des Formenden . Manches von Klopstock kommt daher, manches bei Platen . Das ist die Gefahr solcher bildnerisch angelegten Menschen deren angeborenes Ich einerseits nicht reich und tief genug ist um ein langes Leben zu nähren und andererseits nicht die Gabe hat überzugreifen und fremden Weltstoff sich gestaltend anzuverwandeln. Dies ist eine Schicksalsgabe für sich, die mit dem angebornen Adel und der angebornen Großheit einer Seele noch nichts zu tun hat, obwohl es freilich wahrscheinlich ist daß den allerreichsten und schicksalsvollsten Naturen am ehesten auch diese übergreifende expansive Gewalt innewohnt — unbedingt nötig ist es nicht: Hölderlin ist eine sehr große Seele und ihm fehlte die übergreifende Gewalt.
Goethe besaß diese übergreifende, weltverwandelnde Gewalt im hochsten Maße, seine Kraft fremden Stoff sich anzueignen und zu verdauen ist nicht geringer als die formende Stärke seines angeborenen Ich — das heißt: er erlebte die Welt nicht minder gestaltet als er sein Ich erlebte. Dies leitet uns zu der zweiten Gruppe seiner Dichtungen: den symbolischen. Unter symbolischen Dichtungen verstehe ich solche welche den Gehalt des dichterischen Ich nicht in den Bewegungen dieses Ich selber ausdrücken, sondern in einem ihm ursprünglich fremden, erst durch den Gestaltungsprozeß ihm anverwandelten Stoff. Dieser Stoff kann der Natur, der Geschichte oder der Gesellschaft entnommen sein: wesentlich ist daß er nicht von vornherein mit dem Lebensgesetz, mit dem Dasein, und der Erlebensart des Dichters gegeben ist, nicht ihm angeboren ist. Während also in der Lyrik der einzige Ausdruck, der einzige Leib, die einzige Form des Gehalts — eben des Ichs — dieses Ich selbst ist, prägt es sich hier aus in einem neu hinzukommenden Stoff: seine Bewegung empfängt Gestalt, Leib, Form durch ein anderes welches nun zu ihm selbst gehört: das nennt man Symbol . . Symbol oder Sinnbild ist jede Gestaltung welche einen bestimmten Gehalt verkörpert, ausdrückt, darstellt. Der Prozeß durch den ein Dichter fremden Stoff zum Ausdruck eignen Wesens macht ist demjenigen verwandt durch den er seine eigene Schwingung als lyrische Sprachgestalt widergibt: oder vielmehr, er ist eine weitere Funktion derselben Kraft durch welche er schon rhythmisch gestaltet lebt und schwingt. . es ist das Übergreifen des angebornen Formtriebs aus dem Bereich des Ichs in die umgebende Welt, und die Folge davon ist entweder die Erweiterung des Ichs durch vorgelagerte Schichten, oder auch die Füllung vorgelagerter Welt durch das Ich . . das sind nicht nur verschiedene Definitionen, sondern hängt ab von zwei verschiedenen Grundtypen des Gestaltungstriebs: den einen kann man den attraktiven nennen, den anderen den expansiven. Der höchste Typus des ersten in der Dichtung ist Dante, der höchste Typus des anderen ist Shakespeare. Der attraktive Schöpfer hat den Trieb die ganze Welt in sein Ich zu verwandeln, nach seinem Grundbilde zu formen. Er fühlt sein Ich als Mitte und Sinnbild der Welt, wie es Dante getan hat. Der expansive Schöpfer hat den Trieb die ganze Fülle seines Inneren auszugießen in die Welt, bis sein Ich selbst zur Welt erweitert, in die Welt investiert ist, die Welt angefüllt ist mit den Kräften seines überströmenden Ich. Er will nicht die Welt in sich verwandeln, sondern sich in die Welt. Er will nicht das Sinnbild der Welt sein, sondern die Welt soll sein Sinnbild sein, wie die Welt Shakespeares es ist. Der attraktive Schöpfer leidet an der unvollkommenen Welt, welche seinem Ideal d.h. der Projektion seiner seelischen Form, seinem angebornen inneren Gesetz nicht entspricht. Er befreit sich durch die Gestaltung von dieser Disharmonie mit der Welt. Der expansive Künstler leidet an der Überfülle seines Ich und befreit sich, indem er ihr Raum, Gefäß und Gestalt schafft in dem grenzenlosen Weltstoff.
Beide Typen hat es in den neueren Zeiten immer wieder gegeben, wenngleich keine so vollkommenen wie die beiden größten Weltdichter Shakespeare und Dante. Viel häufiger sind die Ansätze, die Mischformen und die Karikaturen beider seelischen Anlagen: denn beide haben ihre Gefahren. Ist der attraktive Geist nicht sehr rund und harmonisch, weit und groß, so wird er die Welt vergewaltigen und verzerren nach den Verbiegungen seiner eigenen Natur. Ein Beispiel für diese Art Vergewaltigung ist Byron. Ist der expansive Geist nicht wirklich überreich, überströmend genug um, wie Shakespeare, die Welt in die er sich einläßt bis zum letzten Rand zu füllen, das heißt, völlig zu durchbluten, zu durchseelen, so entsteht entweder ein Hohlraum in der Mitte, wo das Ich ausgeflossen ist, und es bleibt nur eine zuckende Peripherie von zusammenhangslosen Lebendigkeiten, oder es bleibt ein nicht ganz vermenschlichter, unbeseelter Komplex bloßer Sachlichkeiten, Schilderungen, Rohmaterial von Sachbeobachtungen. Ein Beispiel für diese Art ist etwa Balzac. Beim Attraktiven der kein Dante ist scheint es an Welt zu fehlen, beim Expansiven der kein Shakespeare ist scheint das Ich verkümmert. Der Symboliker attraktiver Art, bei dem die Welt zu kurz kommt, grenzt an den Lyriker, der Symboliker expansiver Art, bei dem das Ich zu kurz kommt, grenzt an den AIlegoriker. Denn lyrisch ist es, wenn es keine Welt, kein Nicht-ich gibt, symbolisch ist, wenn Ich und Welt zusammenfallen zur Einheit, allegorisch, wenn Ich und Welt auseinander fallen und hinterher miteinander verbunden, aufeinander bezogen werden.
Goethe gehört ursprünglich zu den Attraktiven, ist neben Dante der größre, aber ein weit gemischterer Vertreter dieses Typus, und zwar nicht aus Gründen die in seinem Ich gelegen hätten, in einem Mangel an gestaltender und weltzwingender Urkraft, sondern aus Gründen die in seiner Welt lagen, und die ihn, wenigstens unter dem Gesichtspunkt der Gestaltung, in ungünstigere Bedingungen stellten als den Florentiner. Dantes Welt war noch eine zusammengehaltene, begrenzte, nach Gesetzen die für unverbrüchlich gehalten, als unabweichbar erlebt wurden, geordnete, überschaubare . . die Goethes war bereits auseinander gebrochen, unübersehbar, und ihre Grundlagen vielfach fragwürdig geworden. Dante konnte mit einem ungeheuren Griff von seinem Zentrum aus seine Welt an sich heranzwingen, in sich hineinzwingen. Für Goethe war das, bei einer ebenbürtigen Kraft, seiner Welt gegenüber nicht mehr möglich: er mußte über haupt erst sich gegenüber dieser unübersehbar zerfahrenen Welt orientieren, sich seinen Platz und die Materialien suchen die er zur Darstellung und Ernährung seines Ich brauchen konnte. Daher hat sein Gesamtschafen, verglichen mit dem Dantes und Shakespeares, etwas Experimentierendes, Tastendes — und sein Suchen und Streben, im Faust und im Wilhelm Meister selbst zu Symbolen nicht nur eines Menschen, sondern eines Zeitalters zusammengefaßt, ist gegenüber der unerschütterlichen, gemessenen Sicherheit Dantes und Shakespeares gewiß eine Not, wenn Goethe auch eine Tugend daraus gemacht hat . „Der gute Mensch in seinem dunklen Drange“ ist ein relativ modernes und schwächeres Produkt als der Renaissance-mensch, dessen oberste Aufgabe ist „in Bereitschaft sein“, dessen Problem nicht Streben, sondern „Sein oder Nichtsein“ lautet. Wie aber die Welt damals war, ist jene faustische Losung und Lösung allerdings die höchste und heilsamste des geistigen Menschen gewesen.