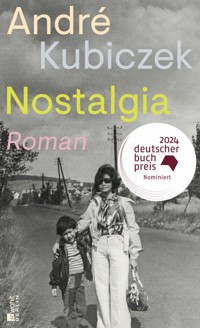7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gründet Berlin auf einem gigantischen Schwindel? Ein Privatdetektiv soll einen Wendezeitroman für seine Kusine Nadine schreiben, eine schwarzafrikanische Verschwöruung bedroht die neue Hauptstadt, und zwei Anarchisten planen den Untergang des Abendlandes: ein Fest für Medienmenschen. Doch in einer allseits gefährdeten Gesellschaft kann das Fest leicht zur Totenfeier ausarten. «Der Autor ist brillant. Sein Roman urkomisch.» (Der Tagesspiegel) «Mit Witz und literarischer Einbildungskraft wird der Berlin-Roman im Breitwandformat reaktiviert.» (Die Zeit) «Kubiczeks zweites Buch übertrifft das erste noch an Witz und Einfallsreichtum. Grell, spannend, böse und komisch.» (Süddeutsche Zeitung) «Erzeugt einen ähnlichen Suchteffekt wie Balzacs ‹Menschliche Komödie›.» (WDR) «Halb Spitzweg, halb der Dude aus ‹The Big Lebowski›.» (Frankfurter Rundschau) «Berlin brennt! Wurde ja auch Zeit. Ein Riesenvergnügen.» (Kreuzer, Leipziger Stadtmagazin) «Ein hochvergnüglicher Parforceritt durch die Metropolen- und Geisteslandschaften Berlins, mit ungeheurem Sprachwitz und sprühender Fantasie.» (Titel Magazin) «Kubiczek hat einen sprachlich ungeheuer dichten Berlinroman geschrieben, der sein Sujet nicht allzu ernst nimmt.» (Zitty)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
André Kubiczek
Die Guten und die Bösen
Roman
and if the ground’s not cold everything is gonna burn –
Black Francis
Börries Freiherr von Stammler, 45, Soziologe und Kolumnist
der Wochenzeitung Die Zeitgeist
Dr.Roberto Schwarzhaupt, 36, Assistent am afrikawissenschaftlichen Institut der Humboldt-Universität
Vanessa Schwarzhaupt, 34, seine Frau
Raymond Schindler, 30, Frührentner und schwarzarbeitender Privatdetektiv
Nadine Dunkel, 29, Cousine von Raymond Schindler und Ehefrau von Zampano Dunkel
Zampano Dunkel, 48, Chef der Berliner Seiten der Die Zeitgeist
Bolèmia Hetschel, 24, Redakteurin des Fernsehmagazins Flashpixxx
Kuno Neppes, 63, Abgeordneter der SPPD
Zeus, 19, Kind vietnamesischer Vertragsarbeiter, Hacker und Kellner im Bamboomtown Shanghai
Zigmund Fraud, 18, 120 Kilo schwerer Mitbewohner von Zeus, Abwäscher im Bamboomtown
Nike Müller, 25, Studentin von Schwarzhaupt, Urenkelin des Afrikapioniers Holm von Prinz
Dr.Nyerere, 42, Stipendiat des Deutschen akademischen Austauschdienstes
Leit Wolf alias Sergej Eisenfaust alias Günther P., 52, Newsmaker und Vorsitzender der K.A.H.-Gruppe
Lord Nelson, 5, Wellensittich
EIN KONTINENT BRICHT AUF
«Der Himmel wird sich verfinstern, und der Boden der Stadt bricht auf», hackte Börries Freiherr von Stammler in seine Tastatur und verfolgte gespannt, ob sich die Buchstaben in sein Makro$pott-Texter-2000-Dokument einordnen würden, das er «Untergang (Berlin)» genannt hatte. Zu seiner Erleichterung taten sie es diesmal und leiteten derart das Resümee von Stammlers wöchentlicher Fatalismuskolumne Soziologie: unterwegs ein, von deren Honorar er zurzeit sein Leben als unbestechlicher Chronist des Verfalls bestritt. Im Übrigen: ein Verfall auf allen Ebenen, der es einem nicht gerade einfach machte, ihm auf der Spur zu bleiben. Nach dieser, wie er zugeben musste, leicht alttestamentarisch wirkenden Drohung verharrte er und versuchte, sich die Ereignisse auszumalen, die ein Brechen des Bodens und eine so plötzliche wie immense Dunkelheit mit sich brächten. «Kälte» notierte er auf einen Schmierzettel, der stets neben seiner Tastatur bereitlag, darunter schrieb er ohne zu zögern «Dunkelheit», um es sofort wieder auszustreichen und darüber «schlecht für den Ackerbau» zu krakeln.
Seine Konzentration war jetzt am gleichen Punkt angelangt wie seine Phantasie schon Stunden zuvor: Unter Null. Doch es half nichts, er musste den Artikel noch heute beenden, denn sein Chef Zampano Dunkel und die gesamte Berliner Redaktion von Die Zeitgeist waren nicht gut auf ihn zu sprechen, erst recht nicht mehr, seit er sich unter dem schnell aufgeflogenen Pseudonym Boris F. Stümmler in einer Konkurrenzpostille über den vermeintlichen Imagewechsel seines Stammblattes mokiert hatte, der darin bestand, dass man dem bisherigen Namen seinen zweiten Teil Schrift genommen und kurzerhand durch das Substantiv Geist ersetzt hatte, ohne sich um das nunmehr veränderte grammatische Geschlecht des Derivats zu kümmern und den alten, folglich falschen Artikel, der es noch immer bestimmte. Und zwar in voller Absicht. Die Mitarbeiter ihrer neuen Marketingagentur hatten behauptet, es sei diese Art Tabubruch, die neue Kunden ködern würde, moderne Typen von heute, human resources, eine Zielgruppe, frisch und flexibel, ganz anders eben als diese sozialneidischen Hippies und Kulturpessimisten aus den Siebzigern des vorigen Jahrhunderts, die die Auflage ja erst in den Keller hatten sacken lassen und denen egal war, in welcher Verpackung sie irgendetwaskauften, Hauptsache es war düster, ökologisch korrekt oder egalitär, je nachdem. Dieselbe Agentur hatte in einer anderen Kampagne für vitaminreiche Hundenahrung geworben. In dem Fernsehspot konnte man vor dem Hintergrund eines Abbruchhauses eine lange Tafel à la Leonardos Abendmahl sehen. Elf auf obdachlos getrimmte Männer saßen dort, um die eine Kamera hektische Runden drehte. Vor jedem der Penner standen geöffnete Büchsen Hundefutters, die neuen Sorten, Dorschleber, französisches Maishähnchen und der Clou, ein vegetarisches Menü, aus denen sie sich mit großen Löffeln und unglaublichem Appetit bedienten. Das Ganze war unterlegt mit der Ode an die Freude, wobei man Beethovens Musik um einige elektronische beats per minute beschleunigt hatte, und gipfelte in dem Slogan: «Was für Menschen gut ist, kann für Hunde nicht schlecht sein.» In der nächsten Fassung war lediglich dieser Spruch gegen den alten Nietzsche-Kalauer ausgetauscht worden: «Seit ich die Menschen kenne, liebe ich Hunde.» Oder war das Schopenhauer?
Degoutant, wie Börries fand, zumal dieser Hundefraß in seinem Supermarkt viermal so teuer war wie eine Büchse Linsensuppe mit Würstchen. «Wahrscheinlich», hatte er, derart auf die Palme gebracht, geschrieben «wird ein neuerlicher Imagewechsel der Nation demnächst ein Periodikum namens Die Geist-Reich bescheren: nicht voller Esprit, sondern: ein Reich der Geister.» Er war nicht besonders gut im Erklären von Pointen und auch nicht im Erfinden einer rhetorischen Klimax. Deshalb notierte er jetzt «gefährdete Statik» auf seinen Schmierzettel, setzte einen Doppelpunkt und malte dahinter in Großbuchstaben «Erdbeben». Schon als Kapitulation durfte ein windschiefer «Sturm» gelten, bevor er endlich beschloss, die Metapher Metapher sein zu lassen und das Fazit seiner wöchentlichen Analyse zu ziehen.
Das Ende seines schriftstellerischen Elends in Sicht, schlurfte Börries zum Bücherregal, Abteilung Kompliziertes & Komplikationen, um sich einen prominenten Zeugen für die Abschlussthese zu suchen. Er schloss die Augen, streckte den Zeigefinger vor, ließ ihn eine Weile in der Luft kreisen, um ihn dann zackig wie einen Blitz auf die Buchrücken niedersausen zu lassen. Mit geschlossenen Augen versuchte er zu erraten, wen es heute erwischt hatte. Hoffentlich keinen von diesen altmodischen System-Antisystem-Fuzzis. Das würde ihn nötigen, in seine nächste Kolumne eine Verteidigungsrede einzubasteln. Er kannte das nur zu gut, doch fiel es ihm nicht im Traum ein, sich von irgendwelchen nörgelnden Leserbriefschreibern oder klugscheißenden Kollegen sein demokratisches Prinzip der Theoriefindung vermasseln zu lassen. Diesmal allerdings hatte er Glück, denn er hielt den dünnen Band eines wilden jungen Mannes in der Hand, der den Titel «Das Ende des Endes oder wie man mit dem Plasmaschweißer philosophiert» trug, ein Werk, das vor nicht allzu langer Zeit für einige Aufregung gesorgt hatte. So sah es zumindest aus der Perspektive von Die Zeitgeist aus, die ja zeitweilig auch Stammlers war, dessen Blatt flugs nach Erscheinen des Buches eine seiner legendären Debatten vom Zaun gebrochen hatte. Auch auf diezeitgeist.de hatte man zwischen Pro und Contra klicken dürfen und dabei noch die Chance gehabt, eine Mikrowelle mit integriertem Modem und 15-Zoll-Leuchtkristall-Display zu gewinnen, und in Die Zeitgeist-TV war eine TED-Umfrage gelaufen, deren Ergebnis darin bestand, dass von 136 Anrufern 12 Prozent dagegen, 16 dafür und der Rest ich weiß nicht stimmten, ein Zeichen für die vorsichtige Neugier des Publikums, wie der Moderator befand. Das Beeindruckende, möglicherweise aber auch Gefährliche an dem zornigen Denker war, dass er Papier mit Stahl, Eis mit Wasser und Äpfel mit Birnen zusammenschweißen konnte, ohne dabei wirklichen Schaden anzurichten, das heißt, er schaffte zwar etwas Neues, doch ohne das Alte, aus dem es bestand, zu verleugnen. Das hatte Courage und war trotzdem respektvoll. Hut ab! So stellte sich Börries auch sein eigenes theoretisches Werk vor, an dem er bereits seit fünf Jahren werkelte, das Eigentliche, wie er es unter Freunden gern nannte.
Gut gelaunt wegen seines nahen Endes schwang er sich an den Schreibtisch zurück. Er tippte den Namen des jungen Philosophen ein und jubelte ihm anschließend ein paar Statements unter, die dieser zwar nicht von sich gegeben hatte, die aber durchaus zu ihm gepasst hätten. Und darauf kam es schließlich an. Vielleicht hatte er ja nur vergessen, gerade diese Gedanken aufzuschreiben. Börries jedenfalls kannte die Vergesslichkeit beim Schreiben besser, als ihm lieb war. Doch nun kam er noch einmal richtig in Fahrt und orakelte seine finale Erkenntnis auf den Monitor: «Die einzelnen Kasten haben ihre Claims abgesteckt. Die Mitte ist nicht mehr als eine entvölkerte Geldmaschine, der soziale Mob haust am Rand. Die Magistralen, die sie einst verbanden, sind heute die Demarkationslinien eines schleichenden Klassenkampfes, Arm gegen Reich, Ost gegen West, Dritte gegen Erste Welt und dazwischen die mafiösen Elemente der Zweiten. So könnte er also aussehen: der Anfang vom Ende. Und dann bricht nicht nur Berlin, nein, ein ganzer Kontinent bricht dann auf.»
«Boom!», machte Börries Freiherr von Stammler und schlug auf die Return-Taste, als sei er Zeus der Allmächtige und wollte seinen Zorn entladen.
GEFAHR IN VERZUG
«Pffft» zischte es am Ohr von Dr.Roberto Schwarzhaupt vorbei. Unmittelbar darauf streifte ein Lufthauch seine Wange und zog weiter in die Dunkelheit, dieselbe Straße hinauf, die auch Schwarzhaupt auf seinem Heimweg vom Institut nehmen musste. Wie er es in seiner NVA-Grundausbildung gelernt hatte, stellten sich ihm die Nackenhaare auf, nein, halt: blieb er angewurzelt stehen und duckte sich ab, um das feindliche Projektil zu fixieren und eventuell Gegenmaßnahmen einzuleiten. Den Bruchteil einer Sekunde erkannte er nichts, dann aber, als er die Troika aus Laut, Luftzug und ihrer unbekannten Ursache bereits seinen überarbeiteten Sinnen zuschreiben wollte, sah er ihn doch: einen gleißenden Feuerball, der wie ein Stealth-Bomber aus dem Nichts auftauchte und aufs Pflaster schlug, einen Feuerball, aus dem sich kleine flammende Partikel lösten wie abgeschossene Schleudersitze und auf dem Kopfstein eine brennende Landebahn-Illumination bildeten, eine fackelmarkierte, provisorische Einflugschneise. Schwarzhaupt ging nun endgültig in die Knie. Sein Herz raste und seine Instinkte … o Gott, wo waren seine Instinkte bloß? Vermutlich noch im Handbuch der militärischen Taktik. Er sah sich vorsichtig um, ohne dabei den Feuerball aus den Augen zu lassen. Niemand außer ihm war auf der Straße. Es musste jetzt gegen Mitternacht sein. Der Kugelblitz war unterdessen vom Boden abgeprallt und hatte einen Sprung gemacht, als sei der Stealth-Bomberin ein riesiges Trampolin gestürzt. Während des Aufstiegs setzte plötzlich ein Geräusch ein, spitz, hochfrequent, markdurchdringend, ein Heulen zwischen Stuka und Hundepfeife. Die abspritzenden Flammen prasselten auf den Gehsteig, ein wahrer Feuerhagel, der Schwarzhaupt einige Fernsehbilder aus den siebziger Jahren ins Gedächtnis hievte.
Und in diesen Bildern herrschte Krieg. Das bedeutete nichts Gutes, im Gegenteil, es bedeutete Agent Orange und Napalm, es bedeutete Tod. Der beinahe kopfgroße Feuerball setzte zu einer weiteren unsanften Landung an, doch noch bevor er aufklatschte, pfiff Roberto Schwarzhaupt auf seine Instinkte und probierte die Flucht nach hinten. Die Aktentasche unter den Arm geklemmt, rannte er, auch wenn er sich dabei ein bisschen dämlich vorkam, um sein Leben. Am Alexanderplatz ging ihm die Puste aus. Er nahm seine Sonnenbrille ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann winkte er ein Taxi heran und dirigierte den Fahrer, wohlweislich die Stelle des Feuerballs meidend, bis vor seine Vierzimmerwohnung, die sich in einem aufgemotzten Altbau der vorletzten Jahrhundertwende befand, Bötzowviertel, Prenzlauer Berg.
«Du siehst blass aus, Blondie», begrüßte ihn seine Frau Vanessa im Flur, «Stress gehabt?»
«Haha», sagte Schwarzhaupt, «sehr komisch «, aber sie beachtete ihn nicht weiter, sondern ging in die Küche und nahm sich ein Glas Prosecco, wohl nicht das erste.
Seit sie einander zum ersten Mal begegnet waren, in jenem Einführungsseminar «Rassismus als Spieltheorie» vor gut zehn Jahren, machte sie Witze über seine helle Haut und die weißblonden Haare, die noch in voller Pracht auf seinem Kopf leuchteten, in günstigem Licht sogar golden. Vanessa hatte schon damals behauptet, er würde nur das studieren, was er studierte, um seine rassischen Merkmale zu kompensieren – rassische Merkmale nannte sie seine Melanin-Unregelmäßigkeit – und zwar derart, dass er sich von seinen Studienobjekten, den Negern, Strategien des Überlebens abschaute, des Überlebens in einer Welt, die eigentlich oder sogar besser ohne sie auskam, von der Sklaverei mal abgesehen. Und dergleichen Quark.
Mein Gott, ist die Frau dumm, dachte Schwarzhaupt des Öfteren. Nicht, dass sie solche Sachen ernst meinte, jedenfalls nicht alle, nein, so dumm war sie dann doch nicht. Aber sie bestand darauf, Tabus zu brechen, und das hatte sich seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes eher verschlimmert. Er konnte nicht sagen, warum sie dies tat oder vielmehr, wer ihr eingeredet hatte, dass man dergleichen tun solle. Fest stand nur, dass sie es nicht von ihrer protestantischen Familie haben konnte, die zu einfältig war für diese Art von Bosheiten, ein Pfaffenhaushalt in der Mark Brandenburg, der mit Gebeten und abendlicher Kammermusik das Schwarze, Dunkle, Satanische von der Welt fern zu halten gedachte, Mümmeln und Fiedeln fürs Seelenheil sozusagen. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus Die Zeitgeist-Lektüre, die sie, wie Roberto annahm, ihm zuliebe oder besser: ihm zum Gefallen, auf sich nahm, und einem Destillat aus den Fernsehshows, die vormittags liefen, wenn er am Institut seine Seminare hielt, und die zu sehen sie als junge Mutter durchaus das Recht hatte, wie sie fand, wenn sie schon daheim bleiben musste und den ganzen Haushaltsscheiß erledigen. Jedenfalls hatte sie ihm eines Tages eröffnet, dass sie von nun an auf die Konventionen der Gutmenschen verzichten würde.
Gutmenschen, was ist denn das nun wieder?, hatte Roberto sie gefragt. Na all die linken Spießer, hatte Vanessa geantwortet, die politisch Korrekten mit ihrer political correctness: Pie-ßie. Die zum Beispiel, die Neger nicht «Neger» nennen, sondern «Schwarzafrikaner». Ob er denn hinter dem Mond lebe?
Roberto hatte gehofft, dass ihr dieser Spleen irgendwann langweilig werden würde. Vergeblich. Mittlerweile nannte sie Türken «machistische Kameltreiber» und Vietnamesen «Fidschis». Dagegen war «Blondie» geradezu ein Kosename.
«Du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist», sagte Schwarzhaupt und dimmte das Flurlicht herunter.
«Na dann lass stecken», sagte Vanessa, ein gefülltes Sektglas in der Hand, und ging ins Wohnzimmer zurück, wo der Fernseher röhrte. «Übrigens: da ist ein Anruf für dich auf dem Ah Beh.»
Roberto hasste es, wenn sie den Anrufbeantworter Ah Beh nannte, oder wenn sie O-Saft sagte oder Anti-Pie-ßie.
«Danke, Schatz», schrie er gegen den quadrophonischen Sound des Fernsehers. Er ging in sein Arbeitszimmer und schloss die Tür. Dann hörte er den Ah Beh ab.
«Äh … Hetschel ist mein Name», meldete sich eine weibliche Stimme, «ich bin Journalistin und habe recherchiert, dass Sie eine Trophäe … ’tschuldigung: Ikone auf dem Gebiet des Afrika …, der Afrika … also der Wissenschaft von Afrika sind. Es gibt da eine merkwürdige Sache, über die ich mich gern mit Ihnen unterhalten würde. Sie müssen wissen, ich bin zwar zurzeit noch beim Fernsehen, aber … na ja, ist ja jetzt auch egal. Und zwar geht es um Folgendes. Ich habe Zeugen, die mit eigenen Augen beobachtet haben, wie –»
«Beep», schnitt die Zeitautomatik Frau Hetschels Rede ab.
«Pech gehabt», sagte Roberto Schwarzhaupt.
Nebenan im Kinderzimmer begann sein kleiner Sohn zu schreien.
BORN TO BE RAY
Um eines vorwegzunehmen: Schon immer habe ich Bücher, in denen der Held den Mut hat, Ich zu sagen, und trotzdem alles weiß, jenen vorgezogen, in denen es anders ist. Also:
Es war einer dieser Tage, die wie Ziegelsteine auf dem Gemüt liegen. Die Zeit schien stehen geblieben und das mitten in der Nacht, während eines Wolkenbruchs mit Orkanböen. Aber ich wunderte mich schon lange nicht mehr über irgendwas und schon gar nicht übers Wetter. Schließlich hatte ein neues Jahrtausend begonnen, und was man in den Zeitungen so las, deutete nicht darauf hin, dass es eine gute Idee sei, öfter als nötig das Haus zu verlassen.
Ich, Raymond Schindler, lag auf dem Bett, rauchte und betrachtete die Lichtspiele, die der Verkehr der Schönhauser Allee an meine Decke warf. In regelmäßigem Takt bretterte die Hochbahn am Fenster vorbei, schnitt eine größer werdende Kerbe in meinen Schädel, und ich kam mir langsam vor wie ein proletarischer Lord Usher. Zugegeben, das war nach den Ereignissen, die hinter mir lagen, nicht besonders originell. Zumindest aber hatten mir diese Ereignisse geholfen, eine Zeit lang Ruhe zu finden. Das Attest, das ich stets bei mir trug wie einen Jagdschein, sicherte mir ein kleines Einkommen, von dem ich zwar nicht gut, aber irgendwie unkomplizierter leben konnte als die, von denen die Zeitungen sprachen.
Gerade wollte ich mir einen Drink genehmigen, als das Telefon klingelte. Das hatte es lange nicht mehr getan, deshalb nahm ich den Hörer ab.
«Raymond?» Die Stimme am anderen Ende war mir nur allzu bekannt.
«Mit wem spreche ich?», fragte ich, um Zeit zu schinden.
«Komm schon, du weißt, wer ich bin», sickerte es mir zuckersüß ins Ohr. O ja, ich wusste, wer sie war, vor allem hatte ich nicht vergessen, dass sie einmal anders gewesen war.
«Hilf mir auf die Sprünge, Darling. Ich hol mir eben ’nen Drink.» Ich legte den Hörer auf den Tisch, atmete durch und goss mir ein Glas voll. «So», sagte ich nach einer halben Minute Stillsitzen, «da bin ich wieder.»
«Du solltest andere Bücher lesen», sagte sie.
«Das tut nichts zur Sache», wiegelte ich ab. «Mit wem spreche ich?»
«Also gut: hier ist Nadine.»
«Hallo, Nadine. Hab dich gar nicht erkannt.»
«Können wir uns treffen?», fragte sie, «morgen vielleicht?»
«Wozu?», fragte ich.
«Nicht am Telefon», sagte sie.
«In Ordnung», lenkte ich ein. Sie haspelte den Treffpunkt herunter und einen Termin, den ich um drei Stunden nach hinten verschieben konnte, in den Abend hinein, der mich wach vorfände. Dann legte sie auf, und ich hatte den Eindruck, sie tat es erleichtert.
Obwohl ich mich um Fassung bemühte, waren meine Gedanken zerwühlt wie die Betten eines Stundenhotels. Da mich ein wenig fröstelte, beschloss ich, mich von innen zu wärmen, mit Erinnerungen an die kurzen Wochen, in denen wir ein Paar gewesen waren, Nadine und ich, und falls das nicht reichen sollte, mit Gin aus dem Angebot, der mir den Magen umdrehte.
Zerknirschter als eine alte Elvis-Platte wachte ich am nächsten Tag auf. Ein kurzer Blick aus dem Fenster sagte mir, dass die Sonne am Untergehen war und nicht umgekehrt, wie ein hysterischer Aussetzer meiner Biouhr mich im Halbschlaf hatte fürchten lassen. Ich warf mich in meinen Anzug, brühte eine Kanne Kaffee und überlegte, wie ich am besten zum Wir-Gefühl käme, jener Kneipe, die Nadine für unser Wiedersehen auserkoren hatte. Sie lag zwar nur drei Straßen entfernt, und doch gab es ebenso viele Wege, komfortabel dorthin zu gelangen. Eine sinnlose Vergeudung von Möglichkeiten. Aber ich war nicht zum Philosophieren aufgelegt und machte, dass ich rauskam.
Im Hausflur roch es muffig, ein paar Gören schrien sich hinter ein paar Türen die Lungen aus dem Hals, und der Ölanstrich des Putzes hing in schlaffen Fetzen von den Wänden: es hatte sich also nichts verändert seit letzter Woche. Im Briefkasten fand ich den Werbezettel einer Pizzeria. Die Rechnungen ignorierte ich.
Dann stand ich auf der Straße, über meinem Kopf zog die Hochbahn entlang, zu meinen Füßen wimmelten Hunde im Laub. Alles war irgendwie feucht und glitschig, und um meine Laune zu heben, summte ich einen alten Schlager vor mich hin: Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Als ich bei Briefe schreiben angelangt war, merkte ich, dass ich mich verlaufen hatte, ein ziemliches Kunststück, wenn man nur drei Straßen passieren muss. Ich hatte wohl den Fehler begangen, das jeweils Angenehmste der drei Wege zu isolieren, die schönen Fassaden, die den einen säumten, das glatte Pflaster des anderen, das Spalier der Bäume, das dem dritten ein Dach war, um aus diesen Ingredienzien die ideale Route zu basteln. Ein Kombinationsfehler erster Kajüte, den ich heftig bedauerte, als ich gut eine Viertelstunde zu spät vor dem Wir-Gefühl ankam und schon durch die Scheibe das gepuderte Gesicht meiner Cousine sah, die in ihren Charlottenburger Pastelltönen einen schweren Stand hatte gegen die Abgerissenheit des restlichen Publikums. Ich kannte die Gegend, in der sie jetzt wohnte, flüchtig: Vorgärten, Stechpalmen und Sushi-Bars. Dazwischen die Boutiquen von Nachwuchs-Couturiers.
Das hier aber war Prenzlauer Berg und zwar tiefster. Ich mochte das Viertel, mehr jedenfalls, als ich seine Bewohner mochte.
«Da bin ich», schrie ich im Hereinspringen und täuschte Atemnot vor.
«Und wo ist dein Hut?», fragte Nadine kühl.
«Was für ein Hut?» Ich war verblüfft.
«Kleiner Scherz», sagte sie, ohne zu lachen, und wir schwiegen. Der Kellner kam und blaffte, was ich trinken wolle? Ein Seitenblick auf Nadine genügte, und ich wusste, dass sie Sekt trank.
«Scotch mit Soda», sagte ich, «aber doppelt.»
«Johnny Walker also», sagte er.
«Wenn es Ihnen hilft», sagte ich.
«Und mit Eis», sagte er.
«Dito», sagte ich. Wahrscheinlich bekam er acht Mark die Stunde plus Trinkgeld, das hier niemand gab.
Nadine machte keine Anstalten, sich zu äußern, also sah ich mich um. Das matte Glänzen schwarzer Lederjacken lag im Raum, dessen stehende Luft ein monströser Deckenventilator in Bewegung brachte. Die meisten der Gäste blickten finster in die Runde. Einige unterlegten ihre Mimik mit einer expressiven Gestik, der sie Worte beigaben, die ich nicht verstehen konnte. Sie sahen aus wie große fuchtelnde Fische. Aus den Boxen dröhnte eine absonderliche Spielart des Rock ’n’ Roll, der sich während der letzten zwei Jahre mit Marschmusik zu einem rhythmischen Stampfen vereinigt hatte.
«Worum …», setzte ich im selben Moment an, als Nadine «Ich habe …» sagte. Ein flüchtiges Lächeln zuckte um ihren Mund, während ich einfach abwartete.
«Also», sagte sie nach einer weiteren Minute, in der sie die Worte erneut mühsam zusammenzuklauben schien, die mir unsere Verabredung plausibel machen sollten, «du wunderst dich bestimmt, warum ich dich hergebeten habe.»
«In der Tat», sagte ich, lehnte mich zurück und ließ mein Zippo aufspringen, während ich mit der linken Hand eine Zigarette aus dem Jackett fingerte.
«Die Angelegenheit ist etwas heikel», fuhr Nadine fort, «eigentlich müsste ich weiter ausholen.»
«Dann hol aus», sagte ich angesichts des Whiskys, den der Kellner vor mir abstellte. Ich nahm einen Schluck, saugte an meiner Zigarette und stellte mich auf schlecht formulierte Nichtigkeiten ein, die dennoch den Eindruck eines wichtigen Ganzen erzeugen sollten.
Um es kurz zu machen: Sie hatte ein persönliches Problem, vielmehr ein Problem mit ihrer Persönlichkeit oder besser gesagt damit, dass sie annahm, ihrer Person fehle jenes Quäntchen intellektuellen Chics, das sie zu einer der Wasserträgerinnen verwaschener Bedeutungen machen könnte, die sich in ihren Kreisen auf Empfängen und Partys die Begriffsklinken in die Hand gaben und die sie mit dem bewundernden Neid eines Teenagers anhimmelte.
Sie war jetzt bald dreißig, sah ganz passabel aus und hatte einen Ehemann, der auf den seltsamen Namen Zampano Dunkel ansprang. Dunkel war vor einigen Jahren aus dem Süden Deutschlands, das heißt: aus dem Westen, nach Berlin gezogen, wo man ihm die Stelle eines Ressortleiters angeboten hatte, bei einer Wochenzeitung, die mittlerweile den idiotischen Namen Die Zeitgeist trug.
Wenn ich mich recht entsinne, war es auf der zweiten Hochzeitsfeier, die für all jene gegeben wurde, von denen Zampano wohl annahm, dass sie auf die offizielle nicht gepasst hätten. Dort erst erfuhr ich überhaupt, wie es zu der Beziehung zwischen ihm und Nadine gekommen war, eine Beziehung, die mir noch nie einleuchtend erschien. Immer wenn ich daran dachte, musste ich im nächsten Moment an Nadine denken, wie sie früher war, ein Reflex, der etwas von einem Staubwedel hatte, mit dem man die störenden Partikel der Gegenwart von der Anrichte seiner Erinnerung wischt. Ich hatte es aufgegeben, mich zu fragen, wodurch sie anders geworden war, oder warum sie damals anders war, ob es am repressiven System lag oder an dem Alter, in dem sie das System durchlebt hatte. Diese Frage zu stellen blieb müßig, zumal ich von Nadine keine ehrliche Antwort erwarten durfte. Ich beschränkte mich also darauf, ihr früheres Bild aus meinem Gedächtnis heraufzuholen, um damit das feiste ihres Mannes zu erschlagen, wann immer es auftauchte. Mit wechselndem Erfolg. Nicht, dass ich eifersüchtig war, aber irgendetwas störte mich an ihm.
Er habe sie gleich auf seiner ersten Fahrt nach drüben kennen gelernt, wie er mir kumpelhaft gestand, als er merkte, dass mit den anderen Gästen, hauptsächlich Leuten, die Nadines Vergangenheit bevölkert hatten, noch weniger zu reden war. Ein Vorstellungsgespräch war der Grund seiner Reise gewesen. Er hatte darauf verzichtet, sich ein Hotelzimmer in der westlichen City reservieren zu lassen und war mit der Neugier des Ethnologen in den Osten gefahren. Als er die Rücklichter des Taxis in der Nacht verglimmen sah, war ihm allerdings doch etwas mulmig geworden.
Das Hotel, in dem er abstieg, hieß AST, wie er zunächst dachte, bis er sah, dass die anderen Neonbuchstaben lediglich defekt waren. Besser hätte er sich gefühlt, wenn die fehlenden Zeichen Oria gelautet hätten. Am besten freilich wäre eine funktionierende Leuchtschrift gewesen, selbst mit der Botschaft Deutsches Haus. Doch der Eintritt in das Foyer ließ ihn von diesen Grübeleien Abstand nehmen. Egal ob in Kuala Lumpur oder L. A.: Mit dem Betreten eines jeden Hotelfoyers hatte er sich immer schlagartig heimisch gefühlt. Selbst in Absteigen wie der KASTANIE bewahrte er sich diese grundversöhnliche Haltung, die ihm schon manches Mal die Widrigkeiten einer Gegend relativiert hatte.
Und im nächsten Moment geschah es dann. Es war weit nach Mitternacht, und es herrschte gespenstische Ruhe. Das Foyer war eher ein Wohnungsflur mit Tresen, von dem eine Treppe nach oben führte. Das Licht surrte im Stromsparmodus, niemand war zu sehen. Er beugte sich über das verkratzte Holz der Rezeption und – da sah er sie, Nadine, zusammengekauert, schlafend und schön wie ein Engel. Hätte er nicht selber das dringende Bedürfnis nach Schlaf verspürt, wäre es ihm im Traum nicht eingefallen, sie zu wecken und das reizende Bild, das sie bot, zu zerstören. Doch zum Vorstellungstermin musste er fit sein, damit war nicht zu spaßen. Also drückte er die Klingel.
Das Schellen ließ sie hochschrecken, und zu seiner Überraschung war die wache Nadine von ganz anderem Temperament, als es die schlafende hatte vermuten lassen, kaum weniger reizend als gereizt. Im ersten Moment ging ihm durch den Kopf, dass er ihr Vater hätte sein können, doch verflüchtigte sich dieser moralinsaure Skrupel wie von selbst. Ihre Erscheinung war einfach hinreißend: Die Haare ihrer Punkerfrisur hatte sie nur mühsam zu einem Zopf diszipliniert, sodass das Strenge der Dienstuniform kaum eine Chance hatte, seriös zu wirken. Eine so natürliche, unverbrauchte Frau hatte er im Westen lange nicht mehr getroffen. Sogar die Aggressivität, mit der sie auf seinen Zimmerwunsch reagierte, turnte ihn noch an. Ihm war sofort klar: die oder keine.
Und letztendlich, schloss er mit wohlwollendem Blick auf Nadine, die während seiner kleinen Rede, ohne zu wissen, worum es ging, zu uns herangetreten war und es dann nicht gewagt hatte, sich zu entfernen, nunmehr dastand und verzweifelt lächelte, letztendlich hätte sich ja bestätigt, dass sie zusammenpassten wie der Arsch auf die Brille, wie er sich ausdrückte, um dann lauthals und als hätte er einen guten Scherz gemacht zu lachen.
Ich wusste, dass Nadine eine Zeit lang an der Nachtrezeption eines Hotels gearbeitet hatte, schwarz, versteht sich. Es war die Zeit, in der sie viel Geld brauchte, weil sie viel ausging. In der östlichen Innenstadt hatten Dutzende halb- und illegaler Klubs in miefigen Kellern und abgewrackten Fabriken aufgemacht. Nadine hatte versucht, auch mich auf diese Partys mitzunehmen. Das sei die neue Avantgarde, hatte sie mich zu überzeugen versucht, und ihre universelle Sprache sei die Musik. Sie wusste, dass ich früher sofort auf Avantgarde angesprungen wäre, doch in diesen Tagen war mir selbst ein obszöner Fluch als Entgegnung zu viel.
Wer tanze, könne nicht Krieg führen, hatte sie beharrt. Eben, hatte ich gesagt. Nachts in den Klubs seien alle gleich, war sie unbeirrt fortgefahren. Und am Tage?, hatte ich gefragt und noch irgendwas von Nivellierung gefaselt.
Und jetzt saß mir die einstige Partyqueen in einem pfirsichfarbenen Blazer gegenüber und beklagte sich über den, der ihr die Geldsorgen abgenommen hatte, und das in einer Ausführlichkeit, die sowohl von der Fülle als auch der Vergeblichkeit ihrer Emanzipationspläne zeugte.
«Geld allein macht eben nicht glücklich», schloss sie.
«Haha», machte ich. Der Kellner, der in diesem Moment vorbeikam, warf ihr einen vernichtenden Blick zu.
«Nochmal dasselbe», signalisierte ich ihm, denn noch hatte sie nicht gesagt, was sie von mir wollte. «Und was soll daran heikel sein?», fragte ich Nadine, die wirkte, als ertrinke sie gerade in einer Marmorwanne voller Ungerechtigkeit.
«Du weißt doch, dass Zampi bei der Zeitung ist.» Zampi! Mein Gott.
«Weiß ich», sagte ich.
«Und da hat er gewisse Beziehungen.»
«Wahrscheinlich», sagte ich.
Sie schwieg erneut, und mir schien, sie wusste selbst nicht, was sie von mir wollte, schlimmer noch: sie hatte nicht mal eine Vorstellung von ihrer eigenen Rolle in dem wie auch immer gearteten Plan, der durch ihr hübsches Köpfchen spukte. Ziemlich sicher allerdings war ich mir, dass sie an die Möglichkeit eines Planes glaubte und an eine Ausführbarkeit.
Wenn ich richtig kombinierte – und noch konnte ich eins und eins zusammenzählen, ohne auf elf zu kommen: Das Ergebnis, das sie sich von ihren Anstrengungen erhoffte, war nicht mehr und nicht weniger, als in die Liga der Mittelmäßigkeit aufgenommen zu werden. Stehen auf Stehempfängen, Chablis trinken auf Vernissagen, August Macke bunt finden und Kapitalisten für kulturvoll halten, wenn sie Thomas Mann sagten. Mag sein, dass Zampano an diesem absurden Wunsch nicht schuldlos war, schließlich hatte er sie wegen ihrer Punkerfrisur geheiratet, um sie anschließend in das Pfirsichkostüm zu drängen. Eine ähnliche Wandlung musste wohl ihre Vorstellungswelt durchgemacht haben.
«Zampi hat mir angeboten, ein Buch zu schreiben», sagte Nadine in meine tristen Grübeleien hinein und das in einem Ton, als habe er ihr angeboten, einen Revolver zu besorgen, damit sie sich erschießen könne.
«Worüber?», fragte ich.
«Das ist es ja eben», sagte sie, «aber er würde es auf jeden Fall herausbringen lassen. Er ist befreundet mit einem Verleger.»
«Wie kommt er darauf, dass du ein Buch schreiben kannst?»
Sie überhörte meine Frage und sagte: «Er meint, ich hätte doch einiges erlebt. Früher im Osten die Diktatur und dann auf den Partys die Freiheit und so. Er meint, dass die Leute das lesen wollen. Weil es authentisch ist. Ihn zum Beispiel würde brennend interessieren, was unsere Generation so denkt und fühlt, was für Wünsche wir haben und Träume, jetzt nach dem Ende der Utopien. Von der 1.-Mai- zur Liebesparade, sozusagen, verstehst du?»
«Nein», sagte ich, «das heißt: ja.»
«Dass wir fertig sind mit den Achtundsechzigern und ihren Parolen. Dass wir wieder Lust am Leben haben und es uns nicht von alten, sentimentalen Spießern vermiesen lassen.»
«Wie Zampano?», entfuhr es mir.
«Lass das», sagte sie leicht gekränkt. Deshalb schob ich schnell nach: «Und wo liegt das Problem? Wenn du Lust am Leben hast, brauchst du doch keine Bücher zu schreiben und Lustlose mit deiner Lust zu behelligen. Ich dachte, man schreibt Bücher, um sich nicht aufhängen zu müssen.»
«Du willst mich nicht verstehen», sagte sie.
«Ich fürchte, ich kann es nicht, Baby», sagte ich.
«Nenn mich nicht Baby», sagte sie.
«Cool, Baby», sagte ich, «wie im Film.»
«Du verstehst nicht», sagte sie, «das ist meine Chance.»
«Verstehe», sagte ich.
Meine Befürchtungen begannen also, Gestalt anzunehmen. Sie wollte ein Buch über das wilde Leben schreiben, um es als Eintrittskarte für das halbmondäne zu benutzen, ein Leben, in dem es weder genug Geld noch Geist gab, als dass eines von beiden stilbildend wirken konnte, ein Leben des abgesicherten Geplappers.
«Lass mich raten …», sagte ich.
«Nein, jetzt bin ich dran», unterbrach sie meine Bemühung um Konstruktivität.
BLITZKRIEG
Eigentlich mochte Bolèmia ihren Job nicht besonders, doch was sollte sie machen. Er verhalf ihr immerhin zu einem ansehnlichen Einkommen und konnte außerdem das Sprungbrett sein, das sie später in eine bessere Stelle katapultieren würde, eine Stelle, sie sah das durchaus ein, mit mehr Niveau.
Jetzt war es kurz vor neun. Sie quälte sich aus dem Bett und warf einen Blick aus dem Fenster ihrer Hotelsuite. Ein typischer Provinzmorgen: auf dem Marktplatz herrschte bereits geschäftiges Treiben, Trauben von Touristen, die sich durch die barocke Altstadt drängten. Es gab Stände, an denen Obst und Gemüse verkauft wurde.
Bolèmia und ihr Team residierten im ersten Haus am Platz, allerdings nicht zu ihrem Vergnügen, weshalb sie auch nur für eine Nacht gebucht hatten, sondern im Dienst der Wahrheit. Zugegeben: im Dienst einer kleinen Wahrheit, doch woraus, wenn nicht aus kleinen Wahrheiten, setzte sich die große Wahrheit zusammen.
Nach einem flüchtigen Frühstück und der Morgentoilette machte sie sich an die Arbeit. Eine halbe Stunde blieb ihr noch, um die Reportage vorzubereiten, denn um zehn kam schon die Putzkolonne. Sie entnahm ihrer Reisetasche eine Spraydose, die der Produktionsleiter besorgt hatte und die eine unsichtbare Farbe enthielt, nicht direkt eine Farbe, irgendeine Substanz oder chemische Verbindung, die man nur unter Schwarzlicht sehen konnte, dann aber phosphoreszierend. Damit bewaffnet, begab sie sich ins Badezimmer, überlegte einen Moment, schüttelte die Dose und machte sich ans Werk. Sie sprühte einen unsichtbaren Smiley auf den Klodeckel, verzierte die Duschkacheln mit unsichtbaren Blümchen und malte ein unsichtbares Peace-Zeichen ans Bidetporzellan. Dann kam der Mikrokameramann, der in der Redaktion den Spitznamen Argus trug. Er hatte zwei dieser Sonden dabei, die sonst Leuten mit Magengeschwüren durch den Schlund gedrückt wurden und die das Team als Schweigegeld anlässlich einer Recherche in einem medizintechnischen Mittelstandsbetrieb bekommen hatte. Es war irgendwie um Sterilität gegangen beziehungsweise um deren Fehlen. Argus baute eine der Kamerasonden in den Spülkasten ein und versteckte die andere im Gitter des Entlüftungsschachtes. Damit war ihre Arbeit vorerst erledigt, und Bolèmia beschloss, vor dem abschließenden Showdown noch etwas shoppen zu gehen. Sie war ziemlich scharf auf eines dieser Unterwäscheteile, die seit neuestem in Mode waren, eine Art Overall aus Seide mit integriertem Wonderbra, der die unsinnige Aufsplitterung der herkömmlichen Unterwäsche in revolutionärer Weise aufhob und über deren erotische Wirkung auf Männer sie bereits zwei Reportagen für Flashpixxx gedreht hatte. Das war nicht mehr ein Hauch aus Nichts, das musste man schon als ein Nichts aus Hauch bezeichnen, hatte sie beide Beiträge abmoderiert. Und so war es tatsächlich.
Eine Stunde später und um zweihundert Mark leichter, trug sie ihr neues Dessous unter dem Hosenanzug aus Leinen und kam sich einigermaßen verrucht dabei vor. Nun gut, es kniff und zwickte zwar, aber das zumindest an den richtigen Stellen. Vielleicht hatten die Designer ja noch andere, verborgene Funktionen eingebaut. Sie hatte da neulich den Beitrag eines Kollegen gesehen, der eine solche Vermutung nicht ganz abwegig erscheinen ließ. Gewisse Nähte, Druckknöpfe, Gummizüge, Reißverschlüsse waren darin entlarvt worden als das, was sie in Wirklichkeit darstellten: geheime sexuelle Stimulatoren. Ein Aufschrei war anderntags durch die Presse gegangen: «Aus Versehen: Orgasmus in Straßenbahn!» Zugegeben, nicht gerade die Presse, die Bolèmia für seriös hielt wie Die Zeitgeist, aber sie wünschte sich dennoch, dass auch auf einen ihrer Beiträge mal mit einer Schlagzeile dieser Größe reagiert würde.
Bolèmia schlenderte zurück zum Hotel und sichtete das Material, das Argus aufgenommen hatte, zuerst jenes mit versteckter Kamera und anschließend das mit der Steadycam unter Schwarzlicht. Was sie sah, überraschte sie nicht, denn der Job heute war der letzte einer ganzen Reihe gleichartiger Recherchen, die sie im Namen der Bürgerrechte – schließlich waren auch Konsumenten auf eine vertrackte Art Bürger – in diversen Hotels des Landes durchgeführt hatten. Dann erledigte sie das finale Kreuzverhör, stieg gut gelaunt und leicht erregt in ihr Sportcoupé und fuhr Richtung Autobahn, die sie endlich zurück nach Berlin bringen würde.
Die Provinz war schon ein riesiger Misthaufen, wenn sie es sich recht überlegte, Inzest, Kindesmissbrauch, Ritualmorde, Korruption auf allen Ebenen und terroristische Nachbarn, ein Sumpf des geduckten Bösen, den es in den Tagen ihrer Kindheit dort noch nicht gegeben hatte. Denn auch Bolèmia war in der Provinz aufgewachsen, in einem westfälischen Dorf, das vor kurzem durch einen handfesten Skandal erschüttert worden war. Ausgerechnet Reporter ihres Senders hatten mittels versteckter Kamera herausgefunden, dass der Koch des einzigen Gasthauses «Zum Schwan» gewohnheitsmäßig in die Gulaschsuppe urinierte. Gäste hatten sich schwärmerisch über den ungewöhnlich pikanten Geschmack der Suppe geäußert und in einem Zuschauerbrief die Redaktion der Kochsendung Mampf! aufgefordert, das Rezept zu veröffentlichen. Der Koch allerdings hatte sich mit Hinweis auf die familiäre Tradition geweigert, es preiszugeben, woraufhin Argus seine Sonden installierte und der Beitrag nach Auswertung der Bilder nicht wie geplant in der Kochsendung, sondern in Flashpixxx ausgestrahlt wurde. Es schmerzte Bolèmia außerordentlich, dass selbst jene Gegend, in der sie die glücklichste Zeit ihres Lebens verbracht hatte, moralisch so heruntergekommen war, dass sie in ihrer Sendung auftauchen konnte. Gleichzeitig aber war sie Magazinen wie Flashpixxx dankbar, da diese das ganze Elend aufdeckten und somit den Kampf dagegen erst ermöglichten.
Seit kurzem allerdings hatte sie ein zweites Eisen im Feuer, eine heiße Sache, die ihr die Weihen des höheren Journalismus einbringen konnte, eines Journalismus für Akademiker, wie Argus all die abfällig bezeichnete, die ihre Art der Berichterstattung für ambivalent hielten, wie es ihr Produktionsleiter formulierte. In Berlin würde sich die Sache entscheiden, vielleicht heute noch, und damit auch Bolèmias weitere Karriere. Nicht zuletzt deshalb bretterte sie jetzt mit hundertachtzig Sachen über die A2 in Richtung Hauptstadt. Ein Leben auf der Überholspur, dachte sie in ihrer Lieblingssentenz, die jeder zweiten ihrer Moderationen das dynamische Etwas verlieh, für das es keine besseren Worte gab als eben diese, während die niedersächsische Steppe an ihr vorüberflog mitsamt der unsagbar hässlichen Städte darin, Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, voll gestopft mit Amokläufern und Sozialhilfebetrügern. Dann ging es weiter über die ehemalige Zonengrenze, hinein in den Osten, voll von noch widerlicheren Städten mit Plattenbauten und Neonazis und toten Babys in Kühltruhen. Gott sei Dank hatte sie jetzt 120 PS unterm seidenumspielten Hintern.
Doch kurz hinter Magdeburg stürzte Bolèmias erotisches Hochgeschwindigkeitsgefühl jäh auf den Boden der Tatsachen zurück, genauer gesagt, kam es auf der Standspur zu stehen. Ein leichtes Knirschen im Gebälk des Motors hatte die Panne bereits an der Zonengrenze angekündigt. Bolèmia stieg fluchend aus dem Wagen und durchwühlte den Kofferraum nach dem Warndreieck. Mit schnittigem Geräusch zog der intakte Verkehr der Autobahn an ihr vorbei. Es nieselte, es war dunkel und kalt, und sie befand sich im gefährlichen Niemandsland zwischen alter und neuer Heimat. Scheiße, dachte sie, von wegen Überholspur. Sie nahm das Warndreieck und lief gegen den Wind gebeugt los. Zweihundert Meter weiter begann sie, das Ding auszuklappen, als sie plötzlich sah, wie eines der Scheinwerferpaare aus dem Verkehr ausscherte, auf den Seitenstreifen schwenkte und in rasanter Geschwindigkeit auf sie zuschoss. Den Bruchteil einer Sekunde starrte sie ungläubig auf das größer werdende Lichterpaar, dann sprang sie zur Seite und kam im nassen Gras des Seitenstreifens zu liegen. Im selben Moment hörte sie Bremsen quietschen und sah, wie die breiten Reifen eines Sportwagens das Warndreieck zermalmten, das sie vor dem Sprung hatte fallen lassen. Sie hatte keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Ein Anschlag? Verstehen Sie Spaß?
Wie in Zeitlupe ging das getönte Fenster des Beifahrersitzes herunter. Sie drückte sich tiefer ins Gras. Im Fenster erschien eine Faust, aus der sich der Zeigefinger löste und sie heranwinkte, kurz darauf tauchte das freundliche Gesicht eines älteren Mannes auf, um die sechzig vielleicht, das ihr irgendwie bekannt vorkam. Bolèmia gab ihre unbequeme Stellung auf, fügte sich dem Schicksal und stieg in den Wagen.
«Tut mir Leid wegen des Warndreiecks», sagte der Mann. «Darf ich mich vorstellen: Kuno Neppes.» Er reichte Bolèmia seine behaarte Hand.
«Bolèmia Hetschel», sagte Bolèmia und schlug ein, «vielleicht kennen Sie mich aus dem Fernsehen.» Den Namen ihrer Sendung erwähnte sie lieber nicht.
«Vielleicht kennen Sie mich ja auch aus dem Fernsehen. Oder aus Presse und Funk», sagte Neppes. «Ich bin Abgeordneter der SPPD. Nach Berlin?»
Bolèmia nickte. «Mir ist da allerdings ein kleines Missgeschick passiert.»
«Holen Sie Ihr Gepäck, aber lassen Sie den Schlüssel stecken», sagte Neppes und fischte ein Handy aus dem Handschuhfach, «das mit Ihrem Wagen regle ich sofort.»
Als Bolèmia mit ihren Koffern zurückkam, reichte ihr Kuno Neppes eine Karte mit einer Berliner Adresse: «Sie können Ihr Schmuckstück morgen dort abholen. Keine Sorge.»
«Danke», sagte Bolèmia, ohne weitere Gedanken an ein Wie oder Warum zu verschwenden, und ließ sich erschöpft in das Leder des Schalensitzes sinken.
«Gern geschehen, kleines Frollein», sagte Kuno Neppes, schnalzte mit der Zunge und trat das Gaspedal durch, dass die Reifen qualmten.
Wenig später war es wieder zurück: das Leben auf der Überholspur, auch wenn Bolèmia diesmal nur schlafend an ihm teilhatte.
NOTORIOUS B.L.O.E.D.
Tonking, außen, Tag.
Zwischen tropischen Bäumen auf einer Lichtung stehen zu einem Halbkreis angeordnet ein Dutzend Pfahlhütten mit Bambusdächern. In der Mitte dieses Kreises brennt ein offenes Feuer. Darüber hängt ein Topf, der aufsteigende Dampf vermischt sich mit dem Morgennebel. Einige Frauen waschen Wäsche in einem angrenzenden Bach und singen ein schwermütiges Volkslied. Die Männer sitzen vor der Hütte des Dorfältesten, beobachten die Frauen bei der Arbeit und blinzeln in die tief stehende Sonne. Kinder spielen ausgelassen mit Hunden und Katzen. Ab und zu durchdringt der Schrei eines Tieres aus dem nahen Dschungel die plätschernde Geräuschkulisse des friedlichen Tagesbeginns. Die Kamera zoomt auf eine der Hütten.
Hütte, innen, Tag.
Durch die Ritzen der Wände fällt scharfes Sonnenlicht, in dem Staubpartikel tanzen. Die Geräusche von draußen werden allmählich leiser, ein sanftes, konstantes Brummen tritt an ihre Stelle, zuweilen überlagert von einem höheren Sirren. Zunächst denken wir, dass es von dem großen Ventilator herrührt, dessen kaltes Messing gravitätische Runden an der Decke dreht. Dann jedoch kommt die wirkliche Ursache ins Bild, zunächst nur in Form einiger Reihen grüner und roter Leuchtdioden, die hektisch flackern. Die Kamera fährt zurück und wir sehen, dass die Leuchtdioden Teil eines babylonisch anmutenden Bauwerks aus Computerkomponenten sind: diverse Racks und Gehäuse und Laufwerke, ein Wust von Kabeln, der alles miteinander verbindet, ein Kontrollmonitor schließlich, auf dem in der unklaren Syntax eines textbasierten Betriebssystems unentwegt neue Strophen binärer Lyrik erscheinen: Insgesamt ein Bild des technischen Fortschritts, das in hartem Kontrast zur idyllischen Archaik der Eingangssequenz steht.
So oder so ähnlich stellte sich Der Allmächtige Zeus, den seine Freunde aus Bequemlichkeit einfach Zeus nannten, die Umgebung seines Kumpels und Werkzeugs Notorious B.L.O.E.D. vor, obgleich er wusste, dass Notorious B.L.O.E.D. im Büro einer winzigen Lebensmittel-Export-Firma in Ho-Chi-Minh-Stadt seinen Dienst tat und lediglich aus einem einzigen Turmgehäuse bestand, in dem drei 20-Gigabyte-Festplatten rotierten, angetrieben von zwei 800-Megahertz-Prozessoren.
Zeus war Anfang der achtziger Jahre in Ludwigsfelde geboren, einem Kaff südlich von Berlin, dessen Zentrum ein Automobilkombinat bildete, in dem der legendäre W50 produziert wurde. Bis ins vietnamesische Hinterland war der Ruf dieses Lkws gedrungen, hatte dort einen jungen Mann auf dem Reisfeld erreicht und einige Kilometer weiter südlich eine junge Frau. Beide hatten dem Reiz nicht widerstehen können, an dieser Legende eines Nutzlastfahrzeugs mitzuschrauben und waren ins kalte Osteuropa aufgebrochen, um wenig später miteinander verheiratet zu sein und kurz darauf Eltern eines Sohnes zu werden, der sich ab seinem siebzehnten Lebensjahr Der Allmächtige Zeus nennen würde.
Doch noch bevor Zeus richtig denken konnte, war die DDR im Eimer gewesen. Seine Eltern, die von nun an ehemalige Vertragsarbeiter der Ex-DDR hießen, saßen auf der Straße und mussten ihr Glück als fahrende Händler versuchen. Sie zogen nach Berlin-Marzahn, auf den ehemaligen Wohnolymp der ehemals werktätigen Massen, wo Zeus an seinem Abitur laborierte, während seine Eltern damit beschäftigt waren, billige Textilien und Nippes aus der ehemaligen Volksrepublik Polen nach Berlin zu bringen, um sie auf Wochenmärkten einer nagelneuen subproletarischen Kundschaft anzudrehen, Leuten, die nicht genug Geld besaßen und folglich auch nicht genug Geschmack, als dass sie es sich leisten konnten, nicht zuzugreifen. Dank dieser Einkünfte kam die Familie einigermaßen über die Runden. Klagen jedenfalls hatte Zeus seine Eltern nie gehört, was aber daran liegen mochte, dass er ungern Vietnamesisch sprach und sie des Deutschen nur bedingt mächtig waren.
Zu dieser Zeit wimmelte es auf den Straßen und Plätzen der einstmals utopischen Neubaustadt von komischen kahl geschorenen Typen mit schillernden Jacken, und da Zeus nur wenig Lust hatte, sich blaue Schatten auf seine Schlitzaugen hauen zu lassen, zog er sich in sein Zimmer zurück. Anfangs saß er nur herum, kuckte aus dem Fenster, ging zum Kühlschrank und dann aufs Klo, um mit vollem Magen und leerer Blase erneut aus dem Fenster zu kucken. Später, als er den Stumpfsinn dieser Abfolge erkannt hatte, las er wahllos und in berauschender Geschwindigkeit alles, was ihm zwischen die Finger geriet, Romane, Gedichte, Frauenzeitschriften, selbst philosophische Essays, und er war gerade dabei, sich aus dem Chaos von Lektüren und spärlichen Erlebnissen am Fenster eine Weltanschauung zu zimmern, als ihm sein Onkel Cuong, der einen kleinen Lebensmittelladen im Prenzlauer Berg führte, eines Tages einen ausrangierten Personalcomputer vorbeibrachte samt Modem. Eine lahme Krücke zwar, aber immerhin gewann er mit dem Monitor ein zweites Fenster hinzu, hinter dem sich interessantere Dinge ereigneten als auf den Straßen des real existierenden Marzahner Alltags: Pornographie, Anarchie und Kommerz.
Zeus brachte sich das Programmieren in verschiedenen Sprachen bei, legte ein überdurchschnittliches Abitur ab und zog anschließend in eine Zweizimmerhinterhofwohnung im Prenzlauer Berg, die er von seinem Lohn als Aushilfskellner in einem Chinarestaurant bezahlte und in der er bleiben wollte, bis ihm einfiel, was er studieren könnte. Irgendetwas zwischen Philosophie und Mathematik schwebte ihm vor.
Selten nur, aber dann umso mächtiger, meldete sich das asiatische Blut und gemahnte ihn, dass er keiner von diesen Ariern war, mit denen er täglich zu tun hatte und denen er sich gewöhnlich ohne nachzudenken zuordnete, es sei denn, es war ein Spiegel in der Nähe. Meistens ignorierte er diese Anfälle oder ließ sie mit dem Rauch einer großen Tüte verpuffen. Einmal aber hatte er der irrationalen Stimme doch nachgegeben und war zu einem bekannten Treffpunkt der vietnamesischen Gemeinde nach Charlottenburg gefahren. Er konnte sich noch an Feste im Ludwigsfelder Wohnheim erinnern, bei denen ein Haufen Vietnamesen und einige Afrikaner auf dem Fußboden um Schüsseln mit Essen gesessen und sich die Kante gegeben hatten. Aus Heimweh, Liebeskummer, Trunksucht. Das, was er in Charlottenburg erlebte, war das krasse Gegenteil. Hier trafen sich die Edelvietnamesen der Stadt, katholisch, aus dem Süden, gebildet, die nichts so sehr zu fürchten schienen, als mit den ehemaligen Vertragsarbeitern oder den freischaffenden Zigarettenhändlern verwechselt zu werden. Zum ersten Mal wurde Zeus klar, dass er in vierfacher Hinsicht – wenn er die Bedeutung des Wortes ein wenig dehnte – dem Proletariat entstammte, als Sohn von Arbeitern sowieso, als Vietnamese unter Deutschen, als Ossi unter Westlern und nicht zuletzt als Kind der sozialistischen Republik unter emigrierten Südvietnamesen. Auf den Bildern, die die Südvietnamesen geprägt hatten, kämpften Flüchtlinge in seeuntüchtigen Nussschalen gegen das offene Meer, während seine Bilder die von entlaubten Bäumen und napalmverbrannten Menschen waren. Oder es zumindest hätten sein können, wäre er nicht, weiß Gott warum, in Ludwigsfelde geboren. Schon kurz nach Beginn des Treffens hatte Zeus den Eindruck, dass ihn jeder zweite der Exilvietnamesen für einen Vietcong hielt, und war bald auf einem der Ho-Chi-Minh-Pfade des öffentlichen Nahverkehrs zurück in den Osten Berlins geschlichen. Seitdem trug er eine blaurote Fahne mit fünfzackigem gelbem Stern auf seinem Nato-Parka, der ihm im Zusammenspiel mit Schnürstiefeln und einer schwarzen Wollmütze ein Aussehen verlieh, das er seiner inneren Verfassung adäquat fand.
Die plötzliche Einsicht, dass eine Hand voll biographischer Zufälle jemanden zu einem notorischen Underdog machen konnte, hatte Zeus noch in derselben Nacht den Plan zu einer rebellischen Webseite entwerfen lassen, auf der er diese und andere Ungerechtigkeiten zur Sprache bringen und gleichzeitig rabiate Möglichkeiten des Umgangs damit anbieten wollte, einschließlich der unkonventionellen Nutzung von Computern und Netzwerken. Da er es sich nicht leisten konnte, Platz auf einem kommerziellen Server zu mieten, griff er auf ein Angebot zurück, das jedem Besitzer einer E-Mail-Adresse zwei kostenlose Megabyte Speicherplatz garantierte und da ihm das zu wenig schien für die Menge Zorn, die sich in ihm angestaut hatte und die er gedachte, auch in voller epischer Breite wieder loszuwerden, richtete er sich bei einem anderen kostenlosen Anbieter zehn verschiedene E-Mail-Adressen ein, sodass ihm schließlich ein zwanzig MB großes Forum zur Verfügung stand, zu dessen Startseite man durch die Eingabe eines simplen «goto://bastard.org» in die Befehlszeile des Browsers gelangte.
«Du dreckiger Niggerfreund», begann eine E-Mail, die Zeus eine Weile später in dem Postfach fand, das für Leserkommentare reserviert war, «der Tag wird kommen, an dem wir dir und deinen Halbaffen die Eier abschneiden und darauf rumtrampeln, bis gelbe Soße rauskommt. Wir reißen euch den Arsch auf und kacken euch in den Hals. Es lebe der weiße arische Widerstand!»
Wahrscheinlich bezog sich das Ganze auf eine Rubrik, in der Zeus zur Einheit der Rassen im Klassenkampf aufgerufen hatte, frei nach dem bewährten Motto, dass die Grenze nicht zwischen den Völkern verlaufe, sondern zwischen oben und unten, und in deren Postskriptum er einige Tips zur kreativen Modifizierung von Webseiten global agierender Unternehmen gegeben hatte, vorzugsweise solcher, von denen er annahm, dass sie Schweinereien in der Dritten Welt begingen.
Hoppla, dachte Zeus, das schreit nach Vergeltung, aber nach einem kurzen Blick ins Kleingedruckte der Nachricht stellte er fest, dass sein Gegner nicht satisfaktionsfähig war, wenn er sich nicht einmal die Mühe gemacht hatte, seine E-Mail