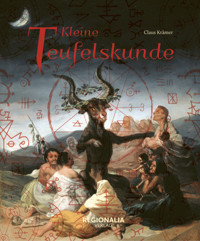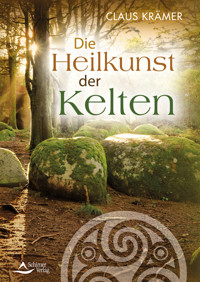
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schirner Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Entdecken Sie das reiche Heilwissen unserer Vorfahren! Es ist erstaunlich, welche hochwirksamen Methoden die Kelten bereits vor Hunderten von Jahren anwandten. Sie wussten um die heilsamen Kräfte der Natur, und ihre enge Verbundenheit mit Mutter Erde erlaubte ihnen Einblicke in die Zusammenhänge allen Seins. Sie arbeiteten mit Kräutern und Bäumen, Steinen, Symbolen, Klängen, Berührungen und reisten in die Anderswelt, um Körper und Geist in Balance zu bringen: ganzheitliche Techniken, die heute wieder an Bedeutung gewinnen. Claus Krämer schlägt mit diesem Klassiker eine Brücke zwischen dem Wissen unserer europäischen Ahnen und den Erkenntnissen der Moderne darüber, wie man gesund wird und bleibt. Gehen Sie den Weg der Druiden! Dank leicht umsetzbarer Anregungen und Übungen können die Kräfte alter Zeiten in Ihnen wirken – als hätten Sie ein Schlückchen vom berühmten Zaubertrank der Gallier probiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Ratschläge in diesem Buch sind sorgfältig erwogen und geprüft. Sie bieten jedoch keinen Ersatz für kompetenten medizinischen Rat, sondern dienen der Begleitung und der Anregung der Selbstheilungskräfte. Alle Angaben in diesem Buch erfolgen daher ohne Gewährleistung oder Garantie seitens des Autors oder des Verlages. Eine Haftung des Autors bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Dieses Buch enthält Verweise zu Webseiten, auf deren Inhalte der Verlag keinen Einfluss hat. Für diese Inhalte wird seitens des Verlages keine Gewähr übernommen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
ISBN Printausgabe 978-3-8434-1575-0
ISBN E-Book 978-3-8434-6554-0
Claus Krämer:
Die Heilkunst der Kelten
© 2004, 2015, 2020, 2025
Schirner Verlag GmbH & Co. KG
Birkenweg 14 a, 64295 Darmstadt
E-Mail: [email protected]
Umschlag: Simone Fleck & Anna Twele, Schirner,
unter Verwendung von # 1006218052 (© nvphoto), # 120963046 (© art_of_sun) und # 248021107 (© MSSA), www.shutterstock.com
Print-Layout: Simone Fleck & Anna Twele, Schirner
Lektorat: Katja Hiller & Bastian Rittinghaus, Schirner
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt, Germany
www.schirner.com
1. E-Book-Auflage Mai 2025
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen und sonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabe sowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten
Inhalt
Vorwort zur Neuauflage
Auf Merlins Fährte
Römer, Hexen und Schamanen
Die Rückkehr der Eichenpriester
Druidenspuren auf dünnem Eis
Geheimes Wissen für alle
Damals aktuell wie heute: die Sinnsuche
Druiden – Schamanen aus den Alpen
Mit den Augen der anderen
Zauberwort Achtsamkeit
Kühne Punks
Könige und Seher
Die Kunst des Überlebens
Der Klügere gibt nach
Retter der Kultur
Europäische »Natives«
Aller Anfang – Schamanismus
Schamanismus praktisch
Von Elfen und Krafttieren
Kontakt mit Schutzgeistern
Die ganzheitliche Heilkunst der Kelten
Druiden als Allround-Genies
Religion – Balsam für die Seele
Nicht das Ende – Sterben und Tod
Tod und Sterben
Der wiedergeborene Druide
Die Meister der Weisheit
Gesetz und Strafe
Druidentum heute
Praktiker und Spezialisten
Gesund und krank – so sahen es die Kelten
Am Anfang steht die Diagnose
Die mentale Heilkunst der Kelten
Gesundheit beginnt im Kopf
Psychischer Selbstschutz
Der Schutzkreis
Mit beiden Beinen auf dem Boden – die Erdung
Verbindung mit allem – der Atem
Meditation: Reise zum inneren Druiden
Die magische Heilkunst der Kelten
Heilende Worte
Ein Vaterunser für alle
Die heilende Kraft magischer Zeichen
Die schützende Kraft von Amuletten und Talismanen
Die Pflanzenheilkunst der Kelten
Der Schatz der keltischen Heilkräuter
Die Mistel – Lieblingspflanze der Druiden
Die Pflanzen der Götter
Der rechte Umgang mit heiligen Pflanzen
Das keltische Baumbewusstsein
Ahorn: der Klang der Anderswelt
Apfelbaum: die Liebe in Avalon
Birke: Brigids umhüllender Glanz
Birnbaum: der zähe Mann
Buche: die große Kommunikation
Eberesche: der hölzerne Kompass
Eibe: der immergrüne Widerspruch
Eiche: der heilige Baum der Druiden
Esche: der Tanz im Licht
Erle: wo der Elfenkönig wohnt
Fichte: stolz gewachsen
Haselnuss: der Baum der Zauberer
Holunder: Frau Holles Haustür
Kiefer: die Freundin des Windes
Lärche: Sinnbild der Vergänglichkeit
Linde: der Baum der Begegnung
Pappel: der Baum der Heilung
Schlehdorn: der Baum des Kampfes
Wacholder: der Wehrhafte
Walnuss: ein Symbol der Fruchtbarkeit
Weide: der Baum der Keuschheit
Was die Druiden einst wussten … kehrt wieder zurück
Mit dem Mond zu innerer Harmonie
Die Heilkraft der Klänge
Die Heilkraft von Licht und Farbe
Essen wie die Kelten
Die Heilkraft der Edelsteine
Die Heilkraft von Düften und Räucherstoffen
Keltische Massage
Heilende Zuwendung – Anam Cara
Geistiges Heilen
Bewusstes Träumen
In die Zukunft schauen
Magische Steinkreise und heilende Erdenergie
Das Energiefeld von Mutter Erde
Sonnenuhren und Kalender
Die Wiederentdeckung der Kraftorte
Im Blickfeld der Wissenschaft
Starke Plätze für die Gesundheit
Robert Graves und die Weiße Göttin
Von der Heiligen zur Hexe
Artus, Merlin und der Heilige Gral
Ein Plädoyer für die Hochsensiblen
Extrateil: Heilung für das Reich der grünen Freunde
Der schamanische Umgang mit der Pflanzenwelt
Wo die Pflanze ihre Seele hat
Kommunikation mit den Naturgeistern
Gute Gedanken für den Garten
Pflanzen lieben Bach
Die Heilung des Parks
Die heiligen Druidentürme
Den Ort heilen
Mond, Wasser, Licht und Luft
Astrologische Pflanzenpflege
Magische Daten nutzen
Das geheime Wissen aus Klostergärten
Gärtnern wie im keltischen Kloster
Von Naturvölkern lernen
Farben für die Seele
Elemente im Einklang
Ein paar Worte zum Schluss
Wi(e)der die Dummheit
Literatur
Über den Autor
Bildnachweis
Vorwort zur Neuauflage
Auf den ersten Blick mag der Titel dieses Buches rückwärtsgewandt wirken. Die Heilkunst eines Volkes, das seit langer Zeit als »verschwunden« gilt – interessiert das Thema jemanden? Zumal es ein »keltisches Volk« im Sinne einer Nation oder eines Staats niemals gegeben hat. Zwar existierten im Europa der Antike Volksstämme, die wegen ihrer kulturellen und religiösen Merkmale heute als »keltisch« bezeichnet werden. Ein homogenes medizinisches System lässt sich jedoch nicht erkennen und beschreiben. Wohl aber finden wir Hinweise auf zeitlose und kulturübergreifende Heilmethoden, die schon im antiken Mitteleuropa verbreitet waren. Und einige davon werden in diesem Buch näher betrachtet.
In der inselkeltischen Symbolik Irlands und Britanniens gibt es einen Hund, der nach vorne läuft und aufmerksam zurückblickt. Dieses Tier möchte uns daran erinnern, dass man sich der Zukunft zuwenden soll, ohne das Vergangene außer Acht zu lassen. Dass wir altes Wissen sinnvoll in neues integrieren können. Das wollen wir tun!
Inhaltlich begeben wir uns in diesem Buch auf »Merlins Fährte«, schauen in die Zeit von vor 2000 Jahren zurück und danach, was von damals heute noch anwendbar ist. Wir werfen ein paar tiefergehende Blicke auf die uns oft als mysteriös erscheinenden Druiden und den von ihnen gelebten Schamanismus, der in seiner praktischen Form vorgestellt wird. Die Heilkunst zur Zeit der keltischen Kultur war mehr oder weniger ganzheitlich. Daher betrachten wir genauer, welche Aspekte wesentlich waren: die Polarität von Gesundheit und Krankheit, Religion, »richtiges« und »falsches« Denken und Handeln, mentale und meditative Techniken, Magie und Symbolik. Schließlich wird es grün, denn wir tauchen in die Welt der Kräuter und Bäume ein mit zahlreichen Porträts der wichtigsten Pflanzen und deren damals wie heute hochwirksamen Kräften. Bei alldem beschäftigen wir uns damit, wie die alten Weisheiten und Erfahrungen ins Heute transportiert werden können. Dies gilt auch auf einer gesellschaftlichen und globalen Ebene, denn wir als Menschheit, die den Raubbau an der Natur nicht nur stoppen, sondern umkehren muss, um für alle Wesen eine gesunde, freie und zufriedene Zukunft zu ermöglichen, stehen vor großen Aufgaben. Jede und jeder Einzelne hat in seinem persönlichen Bereich Anteil daran. Für den Schluss dieses Buches habe ich ein neues Kapitel geschrieben, in dem nach meiner Meinung das Grundübel aller Zivilisationen – damals wie heute – dargestellt wird: »Wi(e)der die Dummheit« soll deutlich machen, dass der Mensch sich zu allen Zeiten viel zu oft selbst im Weg gestanden hat und immer noch steht. Auch hier gilt wie für alle anderen Kapitel, dass meine Aussagen, Tipps und Übungen Anregungen und Vorschläge sind – für ein achtsames Leben mit dem doppelten Blick zurück auf eine lehrreiche Vergangenheit und nach vorn in eine hoffentlich lebenswerte Zukunft für uns alle.
Bevor ich es vergesse: Der Einfachheit halber benutze ich durchgehend die männliche Schreibweise. Mit »Druiden« sind auch immer »Druidinnen« gemeint. Die keltischen Frauen waren recht selbstbewusst und emanzipiert, sie hatten Zugang zu fast allen Berufen und Ämtern. Die Gewährsmänner aus der Antike berichten von Druidinnen, und auch unsere Historiker tun dies.
Claus Krämer
Auf Merlins Fährte
Wie wär’s mit einem kleinen Abenteuer? Sie sind herzlich eingeladen. Eingeladen zu einer Reise in die Vergangenheit, in die Zukunft und in die Gegenwart. Viel Gepäck ist nicht nötig. Vielleicht ein wenig Fantasie, etwas Neugier und die Bereitschaft, ausgetretene Pfade zu verlassen. Lassen Sie uns gemeinsam die Stufen hinabsteigen in eine verborgene Welt unterhalb des menschlichen Alltagsbewusstseins. Dorthin, wo Druiden, gute Hexen und Magier, Elfen und Feen noch immer höchst lebendig sind. Lassen Sie uns zusammen einen Ausflug unternehmen und die Ahnen besuchen, deren unsterbliche Seelen uns heute wie gestern und vorgestern zur Seite stehen, auch wenn wir sie nicht mit unseren Augen wahrnehmen.
Als die Anfrage kam, ob ich Lust hätte, ein Buch über keltische Heilkunst zu schreiben, habe ich zunächst gezögert. Beim Stichwort Kelten tauchten in meinen Gedanken die langbärtigen Druiden auf: mysteriös, übernatürlich, fast unheimlich – und einer vergangenen Zeit zugehörig. Was konnte denn schon interessant sein an einer Heilkunde, die vermutlich längst tot war? Tote Medizin ist unbrauchbar wie ein Päckchen Kopfwehpillen, dessen Haltbarkeitsdatum überschritten ist. Die Keltenmedizin jedoch, so stellte sich heraus, ist nicht gestorben. Sie schwebte nur wie ein unsichtbarer avalonischer Nebel durch die Jahrhunderte und durchwob die europäische Volksmedizin mit verbindenden Fäden. Sie hat im Untergrund überlebt, nachdem die Römer weite Teile Europas unterworfen hatten und das Christentum zur bestimmenden religiösen Macht aufgestiegen war. Die Wohnungen von weisen Männern und Frauen, die immer mit einem Fuß auf dem Scheiterhaufen standen, weil man sie mit Schwarzmagiern und Schadenszauberern in eine Schublade steckte, waren ein Schlupfwinkel. Ein anderer Hort des Wissens sind uns die Überlieferungen, Sagen, Lieder, Bauern- und Lebensweisheiten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden.
Römer, Hexen und Schamanen
Über keltische Heilkunde schreiben heißt, über etwas berichten, was eigentlich nie aufgeschrieben worden ist. Die Druiden, Mitglieder einer gesellschaftlichen und spirituellen Elite, haben ihr Wissen bewusst nur mündlich an Auserwählte weitergegeben. Das bedeutet für uns auch: Mosaiksteinchen aus dem Staub der Geschichte auflesen, blank polieren und wie Vorschulkinder damit Puzzle spielen. Männer aus Rom und Athen liefern uns zusätzliches Material. Gelehrte Südeuropäer spazierten in den beiden Jahrhunderten vor und nach Beginn unserer Zeitrechnung zur Genüge speziell über die gallische Erde, man weiß es aus Geschichtsbüchern und dem Lateinunterricht. Aber Vorsicht: Was die Herren Cäsar, Plinius, Diodor und Co. da notiert haben, war nicht selten waschechte Kriegspropaganda! Es galt, die zu bekämpfenden und zu besiegenden Kelten in einem negativen Licht erscheinen zu lassen. Nur ja keine Sympathien aufkommen lassen für ein »barbarisches« Volk. Trotzdem sind sie als Augenzeugen für uns wichtige Mittelsmänner. Deshalb fußt auch einiges, was Sie in diesem Buch lesen werden, auf den Aufzeichnungen römischer und griechischer »Frontreporter«. Sachliche Fakten, deren Deutung aber immer Spielraum lässt. Von Nutzen sind uns diese Quellen, wenn wir sie mit einem anderen Bereich zusammenbringen: den Mythen, Märchen, Sagen und Legenden, den Liedern, die überlebt haben, den Volksbräuchen und den religiösen Ritualen. Denn deren keltische Wurzeln sind unter der dünnen Farbschicht eines christlichen Anstrichs auch heute noch gut auszumachen, wir müssen nur richtig daran kratzen.
Wir wollen natürlich die schon genannten weisen Frauen und Männer nicht außer Acht lassen, die wohlwollenden unter den Magiern, die Hexen, Hebammen und Kräuterkundigen. Sie sind mehr oder weniger die Nachfolger der mysteriösen keltischen Druiden. Sie haben das alte Wissen gehütet, als es im ersten nachchristlichen Jahrtausend für lange Jahrhunderte mit dem kirchlichen Bann belegt worden war. Wichtig sind für unsere Reise auch die heutigen Kelten. Denn ähnlich dem Comic-Dorf von Asterix und Obelix sind manche Regionen »römerfrei« und damit von einer Umerziehung durch die Sandalenträger verschont geblieben. Aus diesem Grund finden sich heute deutlich mehr kulturelle und sprachliche Spuren der Kelten in Irland und Wales, in Teilen Schottlands, in Cornwall, auf der Insel Man und in der Bretagne als in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.
Eine Rolle spielen ebenso die »Neo-Druiden«, die Neuheiden und Pagans. Auch wenn die meisten von ihnen, zumindest vom historischen Standpunkt aus, nicht in der Lage sein werden, es ihren antiken Vorbildern gleichzutun, halten sie zumindest das Bild vom Druiden als Mittler zwischen den Welten aufrecht. Wir werfen in diesem Zusammenhang natürlich einen Blick auf die aktiven Schamanen der naturnäheren Völker, denn auch hier lassen sich überraschende Parallelen entdecken. Wir dürfen auf diesem Weg einen roten Faden spinnen von den Zeiten der Misteln schneidenden Eichenpriester bis heute.
Die Rückkehr der Eichenpriester
Die keltische Medizin ist nicht tot. Sie war nur verborgen, weil lange Zeit bedroht. Heute lebt das Wissen der oft als »Eichenpriester« bezeichneten Druiden wieder auf. Jedoch nicht als überliefertes und fortwährend praktiziertes System wie die chinesische und tibetische Medizin, der Ayurveda oder andere östliche Heilweisen. Vielmehr als ein Schlüssel zum Verständnis dessen, was Heilkunde einst war und wieder werden kann.
Als ein Schlüssel zur Wieder-ganz-Werdung: Die Druiden als keltische Ärzte scheinen sich dessen bewusst gewesen zu sein, dass Heilung mehr ist als das in der modernen, westlichen Medizin praktizierte Wegnehmen von Symptomen und/oder Beschwerden. Der gravierende Unterschied zwischen keltischer Heilkunde und moderner Medizin ist der, dass die druidischen Heiler einem kranken Organismus und dem ihm innewohnenden Geist Energien, Schwingungen und Informationen zufügten, um auf diesem Weg psychische und körperliche Disharmonien auszugleichen und damit eine Selbstheilung einzuleiten, während heutzutage meist Arznei als Gegenmittel verordnet wird.
Schauen wir zurück: Hätten die römischen Legionen vor 2000 Jahren die keltischen Völker nicht besiegt – wahrscheinlich sähe unsere Welt heute ganz anders aus. Möglicherweise hätte sich ein männlich-rationales Denken und Handeln, kalt, berechnend und auf das Erlangen und Erhalten von Macht und die Vermehrung von Besitz ausgerichtet, nicht in einer Form in Europa ausgebreitet, die heute noch im Wesentlichen unser Leben prägt. Und wie sähe unsere Welt aus, wenn Kaiser Konstantin der Große im 4. Jahrhundert nicht aus pragmatischen Gründen das Christentum gefördert und ihm damit den Weg zur römischen Staatsreligion geebnet hätte? Wären dann die Anwender und Bewahrer der überlieferten (magischen) Heilkunde auch als teufelsnahe Zulieferer des Bösen unterdrückt, später verfolgt, gefoltert und verbrannt worden?
Wäre das alte Wissen wie selbstverständlich eine Verbindung mit neuen Erkenntnissen medizinischer Forschung eingegangen? Das Christentum als amtlich verordnete, ja, aufgezwungene Religion hat es fertiggebracht, eine Heilkunde, die handwerkliche Medizin und Spiritualität vereint, in Europa für viele Jahrhunderte gründlich zu verhindern. Dieses Buch will versuchen, diese bislang verhinderte Synergie zu rekonstruieren – theoretisch und praktisch, als gedankliches und spielerisches Abenteuer. Welchen Wert das Wissen der Druiden, ihrer Vorgänger und Nachfolger für den Jetztmenschen hat, welche Richtung uns die Heilkunde der Vorfahren weisen kann und wie sie sich eingliedern lässt in eine globale Ganzheitsmedizin, deren Entstehen vielerorts herbeigesehnt wird und sich zunehmend auch abzeichnet, wird die Zukunft zeigen. Es liegt erst einmal an uns, den Eichenpriestern wieder Einlass in unsere Welt zu gewähren.
Druidenspuren auf dünnem Eis
Wer waren diese rätselhaften Männer mit den geschwungenen Schnauzbärten und ihren durchsetzungsfähigen, walkürenhaften Frauen, denen René Goscinny und Albert Uderzo mit den Asterix-Comics so wunderbar detailgetreue Denkmäler setzten? Wo kamen sie her? Und wo gingen sie hin? Wer waren die mysteriösen Kollegen des Druiden Miraculix, der mit seiner goldenen Sichel Misteln für seinen Zaubertrank erntete? Jeder Autor, der über das Keltentum und seine Spiritualität schreibt, bewegt sich in historischer Hinsicht auf sehr dünnem Eis. Heilige Schriften der Kelten existieren nicht. Die Druiden als Hüter der Heilkunde haben ihr Wissen niemals aufgeschrieben. Die von Römern erwähnte Tradition, den Druidennachwuchs in 20 langen Lehrjahren in sämtliche Zuständigkeitsbereiche (nicht nur Heilkunde, Religion und Magie, sondern auch Recht, Musik und politische Beratung) einzuweisen, ist mit dem schleichenden Verschwinden der keltischen Hochkultur nach der römischen Eroberung ebenfalls von der historischen Bildfläche abgetreten.
Anders als bei Völkern, in denen schamanische Traditionen noch lebendig sind, können wir in der Mitte Europas keinem praktizierenden Nachfolger des sagenumwobenen Magiers Merlin über die Schulter, geschweige denn auf die Finger schauen. Dies gilt selbstverständlich auch für die selbst ernannten neuen Druiden der Gegenwart.
Über Kelten und Druiden zu schreiben, bedeutet deshalb, zwischen den Zeilen zu lesen und zu interpretieren. Es heißt, sich den Vorfahren der meisten Mitteleuropäer über andere Wege als den einer rein faktenorientierten Geschichtsschreibung zu nähern. In der Tat – es ist heute unser Pech, dass die Druiden ihr Wissen nur mündlich weitergegeben haben. Aus vorrömischer Zeit existieren keine schriftlichen Aufzeichnungen. Man hat zwar keltische Skelette untersucht, aus denen Rückschlüsse auf Krankheiten und Verletzungen gezogen werden konnten. Bei Spuren chirurgischer Eingriffe war es auch möglich, ein wenig über die Behandlungsmethoden zu erfahren. Aber sonst? Wenig.
Ein paar Schädelsägen und medizinische Geräte aus Bronze und Eisen, das ist auch schon alles.
Geheimes Wissen für alle
Seit einigen Jahren findet in Europa eine verstärkte Rückbesinnung auf traditionelle Werte statt. In Mitteleuropa haben wir das Pech, dass wir vor etwa 2000 Jahren unsere spirituellen Wurzeln verloren. Oder, besser gesagt, seit dieser Zeit unsere Wurzeln nicht mehr klar sehen können. Zuerst kamen die Römer und Griechen, dann betrat eine über viele Jahrhunderte dominante neue Religion die Weltbühne, die alles unterdrückte, was nicht den Vorstellungen ihrer Protagonisten entsprach. Für die Druiden blieb kein Platz mehr im Eichenhain.
Doch die Päpste und Bischöfe konnten die »spirituelle Szene« nur von der Oberfläche verdrängen. Im einfachen Volk, weit weg von Rom und den Städten mit Bischofssitz, hat sich bis in die heutige Zeit das Wissen von damals verborgen gehalten. Das Wort »Druide« ist nur ein Begriff für eine bestimmte Sorte von Menschen, die zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Funktion erfüllt haben. Diese Zeit ist lange vorbei.
Jedoch: Schamanen, Medizinmänner, weise Frauen, erleuchtete Meister, Gurus, Geistheiler, Lebenslehrer – sie alle hat es in jeder Kultur zu jeder Zeit gegeben, und es wird sie wohl auch immer geben. Universelles Wissen ist unabhängig von festgeschriebenen Glaubenssätzen. Es basiert auf Erfahrung und Eingebung. Höchstwahrscheinlich gab es, seit sich die Menschen in mehr oder minder organisierten Gruppen zusammengefunden haben, immer auch Mitglieder, die für den Austausch mit der Geistigen Welt zuständig waren. Jedes Naturvolk hat sie noch heute, nur in den christlich geprägten Ländern wurden sie in den Untergrund gedrängt. Dieses einstige Geheimwissen ist heute nicht mehr bedroht. Im Gegenteil, es kann sogar eine wachsende Rolle für die menschliche Zukunft spielen. Ob es dazu eine Chance erhält, muss sich allerdings noch herausstellen.
Lange Jahre haben wir im Westen, was das Spirituelle betrifft, fasziniert nach Osten geschaut. Nun beginnen wir, auf unsere eigenen Wurzeln zu blicken. Wir haben zu Beginn des neuen Jahrtausends die einmalige Chance, im Buchladen oder per Suchmaschine im Internet auf sämtliches verfügbare spirituelle Wissen zurückzugreifen, ohne die Häscher der Inquisition fürchten zu müssen. Wenn wir genau hinschauen und hinhören, treffen wir die Kelten allerorten an. Sie sind das erste greifbare mitteleuropäische Volk mit einer Kultur, die auf sämtliche nachfolgenden Zeitalter eine Faszination ausgeübt hat und dies heute mehr denn je tut.
Kaum ein Buchhändler, der nicht die Bücher von J.R.R. Tolkien oder Marion Zimmer Bradley vorrätig hätte. Merlin und König Artus samt Tafelrunde sind fast genauso aktuell wie die »Harry Potter«-Geschichten, in denen Hexen und Zauberer Kindern längst nicht mehr als bedrohliche Monster präsentiert werden, die kleine Hänsel braten. Und der Welterfolg von Dan Browns »Sakrileg« hat nicht nur die Aufmerksamkeit auf Jesus und Maria Magdalena als Paar mit Nachwuchs gelenkt, sondern auch auf den uralten, mit der keltischen Welt eng verbundenen Mythos vom Heiligen Gral.
Die singenden Nachfahren der antiken Barden treffen mit ihren Liedern vom »Circle of Stone« oder der »Ancient Soul« (willkürlich herausgepickte Songtitel eines neuen »Celtic-Music«-Albums) auf immer mehr offene Ohren. Keltischer Schmuck ist in, die zeitlose Ornamentik fasziniert nicht nur die jungen Generationen. Manch einer entscheidet sich für eine lebenslange Verzierung dieser Art und begibt sich unter die Nadel eines Tätowierers. Keltische Motive gehören inzwischen zu den Standardangeboten der Tattookünstler.
Im südenglischen Steinkreis von Stonehenge, der als Megalithbauwerk viel älter ist als die keltische Kultur, zelebrieren weiß gekleidete Mitglieder diverser Druidenorden ihre alljährlichen Sonnwendfeiern. Der ehemalige Premierminister Winston Churchill gehörte einem Druidenorden an. Queen Elizabeth II. wie auch ihr Sohn Prinz Charles wurden zu Ehrendruiden ernannt. Und in Deutschland sind die Kelten nach dem Krieg allgemein zu attraktiveren Vorfahren avanciert als die Germanen, deren kulturelles Erbe von den Nationalsozialisten für ihre eigene Propaganda missbraucht worden war.
Damals aktuell wie heute: die Sinnsuche
Trotzdem: Warum beschäftigen wir uns im 21. Jahrhundert mit einem Volk, das offiziell als antik gilt? Es ist wohl doch die alte, immer wieder strapazierte Suche nach dem Sinn des Lebens und in diesem Zusammenhang nach mehr Gesundheit.
In der Tat können uns die keltischen Ur-Ur-Urahnen dabei behilflich sein. Denn die Sinnstiftung war auch innerhalb der keltischen Gesellschaften ein wesentliches Thema. Das zeigen uns die alten Sagen, Märchen und Mythen, ganz besonders die Gralslegende mit ihren unermüdlich suchenden Rittern. Die keltische Zeit war eine Epoche des Austausches und des Miteinanders. Ausgehend vom Alpenraum verbreitete sich die Kultur etwa ab dem 8. vorchristlichen Jahrhundert über weite Teile Europas. Damals bauten die einzelnen Völker zu ihren Nachbarn enge Handelsbeziehungen auf. Während die Römer in späterer Zeit unterworfenen Völkern ihre Sitten und Gebräuche, Religion und Verwaltungsformen überstülpten, wurde die keltische Kultur vom jeweiligen Nachbarn in den meisten Fällen gern und freiwillig übernommen. Die Gründe sind plausibel: Die keltische Religion war lehrreich, sie erklärte den Menschen die Welt. Ihre Rituale gaben Halt und Orientierung. Aus philosophischer Sicht erhielten die Menschen Antworten auf Sinnfragen. Man fühlte sich eingebettet in die Natur, als Teil des grünen Reiches, nicht als ihr Eroberer. Die Kunst war eng mit der Natur verbunden und zeitlos schön. Die Medizin war hoch entwickelt und wirksam. Wir können uns heute leicht vorstellen, dass Angehörige von Völkern, die mit der keltischen Kultur in Berührung kamen, schnell fasziniert waren und gern das in ihren Augen Sinnvolle übernahmen. Druiden, Barden und Künstler genossen höchstes Ansehen, weil sie den Menschen diese Werte vermittelten. Sänger und Dichter waren die einflussreichsten Berater der Könige und Stammesfürsten. Man stelle sich dies in der heutigen Politik einmal vor!
Anhand ihrer eigenen Geschichte haben die keltischen Völker gelernt, dass der heute oft zitierte Spruch »Der Weg ist das Ziel« schon den Kern der Sinnfrage berühren kann. Hinschauen, unterscheiden, lernen, das Bewusstsein weiterentwickeln – diese Aufgaben scheinen im Leben unserer Vorfahren eine größere Rolle gespielt zu haben als am Materiellen orientiertes Denken und Handeln. Jede Keltin und jeder Kelte kannte die heiligen Mythen, die die Druiden erzählten. Die Geschichten sind sich in ihrem Kern immer ähnlich: Da ist zunächst der Ruf, der an die Hauptperson der Handlung gerichtet wird, dann bricht jene auf in die Welt, besteht zahlreiche Prüfungen. Später kommt es zur Einkehr und Besinnung mit dem Resultat der Erkenntnis. Letzter Schritt ist die Heilung. Diese Mythen sind ein wesentlicher Teil der Heilkunde. Sie geben Antworten: Mensch, schau hin, erkenne! Zuerst die Welt, dann dich selbst.
Ob bewusst oder unbewusst: Im Keltentum sind unsere kulturellen Wurzeln für uns alle greifbar. Dies gilt übrigens auch für die meisten weißen Nordamerikaner, deren Vorfahren einst vor der Armut von den britischen Inseln, aus Irland und vom europäischen Festland flüchteten, was das große Interesse am Thema erklärt, das auch dort herrscht. Wir brauchen heute nicht mehr neidvoll unseren Blick Richtung Osten zu wenden. Auch wenn die großen Bücher fehlen: Die spirituellen Wurzeln sind vorhanden. Hier, direkt vor unserer Nase. Wir müssen nur noch ein wenig Licht in die mächtigen »Nebel von Avalon« bringen und den Schleier lüften, den Jahrhunderte voller Irritationen, Fehlinterpretationen und Missverständnisse über Europa gebracht haben. Die Zeit ist reif.
Sie werden in den einzelnen Kapiteln dieses Buches immer wieder auf Ratschläge und Tipps stoßen, die ich aus dem keltischen Wissen abgeleitet habe. Es sind kleine Anregungen und Hinweise mit großer Wirkung, die Sie leicht in Ihren Alltag integrieren können. Dabei geht es bewusst nicht um revolutionäre Veränderungen, die Ihr Leben von heute auf morgen auf den Kopf stellen. Vielmehr sind es leichte Schritte nach vorn mit klarem Blick zurück. Das zeitlose, universelle Wissen zeigt sich nicht in wuchtigem Bombast, es sind die kleinen, steten Tropfen des Zaubertranks aus dem großen Druidenkessel, die uns heil machen. Auch habe ich Übungen in den Text eingebaut, die es Ihnen erleichtern, die alten Weisheiten in Ihrem Alltag zu leben.
Lassen Sie uns nun auf der Suche nach den historischen Kelten und ihren geheimnisvollen Druidenärzten im großen Buch der Geschichte blättern.
Druiden – Schamanen aus den Alpen
Es muss um das Jahr 5000 vor unserer Zeitrechnung gewesen sein, als eine schleichende Klimaveränderung auf unserem Planeten das Leben veränderte. Die Sommer wurden wärmer und länger, die Winter verloren an Kälte. Ihren Höhepunkt erreichte diese Erwärmung, so berichtet die Geschichtsschreibung, um das Jahr 1300 v. Chr. Damals setzten weltweite Hitzeperioden und in der Folge zahlreiche Vulkanausbrüche, Erdbeben, Sturmkatastrophen und Überschwemmungen den Menschen und der Natur heftig zu. Etwa um das Jahr 1200 v. Chr. endete diese Wärme- und Dürreperiode.
Während uns die geschichtliche Forschung gute Einblicke in den Alltag von Völkern der klassischen Kulturen geben kann, wie etwa in den der Ägypter, weiß man recht wenig über die Menschen, die vor 4000 oder 5000 Jahren in Europa lebten. Historiker gestehen inzwischen ein, dass man die schöpferische Kraft der vorgeschichtlichen Europäer lange Zeit unterschätzt hat. Das Märchen von den primitiven Steinzeitmenschen, die im Schatten der großen Hochkulturen fellbehangen und mit zerzausten Haaren in Höhlen hausten, steht zwar immer noch in manchen Schulbüchern. Sein Haltbarkeitsdatum ist aber längst überschritten.
Bitte bedenken Sie: Es passt nicht zusammen, dass urzeitliche Menschen, die mehr oder weniger gerade erst von den Urwaldbäumen geklettert sein sollen, riesige Felsbrocken aus den Bergen brechen, nur um diese dann 400 Kilometer entfernt im Kreis aufzustellen – wie beim Bau der Megalithanlage von Stonehenge in Südengland geschehen. Nicht nur, dass allein schon der Transport eine Meisterleistung gewesen sein muss – nein, diese vermeintlichen Primitivlinge haben gleich einen kosmischen Kalender aus dem Hinkelsteinkreis in der Ebene von Salisbury gebastelt, der praktisch heute noch funktioniert.
Die Erbauer des »Steincomputers« von Stonehenge waren in der Lage, Mond- und Sonnenfinsternisse exakt vorauszusagen. Für jeweils 300 Jahre! Wer so etwas konnte, dem waren auch andere Dinge möglich. Als die keltische Kultur sich in Europa auszubreiten begann, hat es bereits eine hochstehende Vorgängerkultur gegeben, so viel gilt heute als sicher. Inzwischen geht man davon aus, dass kulturelle Umwälzungen in der vorkeltischen Zivilisation ab dem 13. Jahrhundert v. Chr. einsetzten; Vorgeschichtler haben für diese Zeit umfangreiche mitteleuropäische Wanderungen nachgewiesen. Allerdings hatte diese Kultur, bedingt durch die damaligen Naturkatastrophen, ihre beste Zeit schon hinter sich. Was durch die Kelten genau von dieser Kultur übernommen wurde, ist nicht überliefert. Wir dürfen jedoch annehmen, dass die Megalithmenschen eine spirituelle Elite besaßen, die als Priester und Hüter des Wissens wahrscheinlich auch für die Heilkunde zuständig war. Jedenfalls weisen die wenigen Darstellungen aus jener Zeit – Höhlenmalereien, Plastiken – darauf hin. Es ist durchaus möglich, dass die Kelten hier auf ein bestehendes »Ur-Druidensystem« trafen, das ihnen brauchbar und sinnvoll erschien. Der Gedanke, dass die Ureinwohner angesichts des Untergangs ihrer Kultur ihr Wissen an befähigte Auserwählte aus Kreisen einer neuen Kultur weitergaben, ist legitim.
Kein Volk tritt plötzlich ins helle Rampenlicht der Weltbühne – mit voll entwickelter Kultur, Religion, Sprache, Sitten und Gebräuchen. Die Kultur der »Steinsetzer« ging mit großer Wahrscheinlichkeit im späteren Keltentum auf. Da man aus Wissenschaftlersicht kaum etwas über die Bewohner weiter Teile Europas in jener Zeit weiß, spricht man vorsichtig von »Proto-Kelten«.
Die Meinungen gehen auseinander, ob man bei den Kelten überhaupt von einem Volk sprechen kann. Einige Autoren tun es, andere nicht. Es besteht allerdings Einigkeit darüber, dass die kulturellen Gemeinsamkeiten ausschlaggebend dafür sind, dass man etwas als »keltisch« bezeichnen darf. Die Wiege des Keltentums stand mitten in Europa. Genauer gesagt, im heutigen Böhmen und im angrenzenden Österreich. Dort hatten sich ungefähr im 13. Jahrhundert v. Chr. zwei sehr unterschiedliche Menschengruppen zusammengetan: sesshafte Bauern, die die Angewohnheit hatten, ihren Küchengefäßen die Form einer Glocke zu geben, und die deshalb heute als Angehörige der »Glockenbecherkultur« bezeichnet werden, und nomadische Reiter, die aus dem Süden des heutigen Russlands nach Westen vorgedrungen waren. Anscheinend förderte die Mischung aus Erdverbundenheit und Reisefreudigkeit, aus Erfahrung und Neugier die Kreativität enorm, denn vor etwa 3000 Jahren begann die vorkeltische Zivilisation, enorme Entwicklungssprünge zu machen. Findige Köpfe revolutionierten mit einem sehr effektiven neuen Eisenpflug die Feldbewirtschaftung, was eine massive Steigerung der Ernteerträge zur Folge hatte. Man erzeugte nun mehr Nahrungsmittel, als man selbst essen konnte. Daher entwickelte sich der Handel mit den Menschen in den Nachbarregionen, was wiederum auch zu kulturellem Austausch führte.
Weil man die Felder effizienter bewirtschaftete, blieb den Menschen mehr Zeit für Kunst, Religion und Musik. Bald breitete sich die neue Zivilisation aus, zunächst in die Alpentäler. Im heutigen Salzkammergut stießen die frühen Kelten auf einen Bodenschatz, der eine sehr wichtige Rolle für ihre zukünftige Entwicklung spielen sollte: Salz. Die wichtigsten Bergwerke, aus denen sie das weiße Gold ans Tageslicht förderten, lagen am Hallstätter See. Salz wurde im großen Stil aus der Erde geholt und entwickelte sich zum wichtigsten Handelsgut. Und mit den Salzlieferungen kamen auch die anderen schönen Dinge, die die Kelten produzierten, in die Welt. Sternförmig strahlte die keltische Kultur von der Bergwerksregion in alle Richtungen. Heute bezeichnet man sie nach ihrem geografischen Ausgangsort als »Hallstattkultur«.
Im Laufe der nächsten 400 Jahre sind mehrere Handelsfürsten sehr reich geworden, und es bildete sich eine Adelskaste heraus, die sich stattliche Burgen leistete, die von gewaltigen Ringwällen umgeben waren. Diese Handelsfürsten müssen ziemlich pompös gelebt haben, denn Verstorbenen wurden riesige Schätze mit in die Gräber gegeben. Auch hielten sich die Fürsten eigene Armeen, mit denen sie bei Bedarf ihren Willen gegenüber dem restlichen Volk und den Nachbarn durchsetzen konnten.
Man weiß nicht genau, wie es dazu kam, dass die Mächtigen ungefähr in der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. der Reihe nach gestürzt wurden, es wird jedoch vermutet, dass die geistige Elite, die Druiden, dahinterstand. Stellen wir es uns einmal so vor: Den Druiden gefiel nicht, dass die Macht dort lag, wo der Reichtum war. Sie stellten fest, dass die Reichen sich abschotteten und ihre Positionen ausnutzten – das Gleichgewicht innerhalb der Gesellschaft war deutlich gestört. Druiden waren Schamanen. Nur die Hochsensiblen beziehungsweise -sensitiven der einzelnen Stämme wurden für das Druidenamt ausgewählt: Menschen, die von anderen Druiden zunächst ausgiebig beobachtet und für fähig befunden worden waren. Und diese geistige Elite wusste sehr genau, dass Harmonie ein wichtiger Faktor war, wenn man das Gesamtwohl einer Gesellschaft im Auge hatte. Es scheint eine Revolution gegeben zu haben, die dafür sorgte, dass die alten Machthaber ihre Positionen verloren. Der Keltenforscher Manfred Böckl ist dieser Spur in seinem interessanten Buch »Schlangenring und Werwolfstein« nachgegangen und vermutet, dass mithilfe der Druiden eine sehr viel vernünftigere Regierungsform geschaffen worden ist. Demnach hätten die Druiden neue Stammesführer und -führerinnen ausgebildet, die vorher aus den Fähigsten ausgewählt worden waren. Sie wurden an die Spitzen der Sippen und Stämme gestellt. Die Eichenpriester übernahmen dabei selbst die moralische und geistige Führung, was der weiteren Entwicklung eine sehr positive Richtung gegeben haben dürfte.1
Dass die neue Führungsschicht von einer spirituellen Elite angeleitet und beeinflusst wurde, hatte für alle große Vorteile. Nicht Macht und Gier waren es, was das Leben von nun an bestimmte, sondern ein sinnvolles Miteinander. Resultat war ein erneuter kultureller Aufschwung. Etwa um das Jahr 450 v. Chr. begann die »La-Tène-Zeit«, die bis ungefähr zum 1. nachchristlichen Jahrhundert andauerte. Wie in einer Kettenreaktion übernahmen die Nachbarvölker die keltische Kultur. Sie keltisierten sich quasi selbst, weil sie erkannten, dass dies etwas Neues war, das ihnen ein besseres Leben versprach. Die neue Kultur, die nebenan gelebt wurde, war praktischer, fröhlicher, plausibler. Das Keltentum verbreitete sich bis auf die Britischen Inseln und auf die Iberische Halbinsel. Es gab Kelten in Anatolien und im heutigen Russland. Handelsbeziehungen reichten bis nach Nordafrika und Asien. »La-Tène-Zeit« heißt die Epoche, weil man im gleichnamigen Ort in der Schweiz wunderbare Kunstschätze aus jener Zeit gefunden hat. Die Kelten von damals lebten uns ein Europa vor, von dem wir heute nur träumen können. Zu jener Zeit geschah es, dass sich eine Sprache gemeinsam mit einer unvergleichlichen Kunst und einer den Lebenssinn erkennbar machenden Spiritualität weit über den Kontinent verbreitete und damit der Beweis angetreten wurde, dass Einheit funktioniert, wenn die einzelnen Bestandteile passen. Die Anführer hatten weise Berater und Beraterinnen, Entscheidungen wurden nicht von Despoten getroffen. Und auch die einfache Bevölkerung hatte Mitspracherechte. Man hätte durchaus ein riesiges Imperium errichten können, aber das wollte keiner. Leider wurde die Ruhe auf Dauer von einem gierigen Feind gestört. Im 3. vorchristlichen Jahrhundert drängten die Römer die Kelten in Norditalien über die Alpen nach Norden. Bis zum Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. wurde das keltische Kontinentaleuropa vom Römischen Reich vereinnahmt und bald darauf auch der Süden der britischen Insel. Lediglich Schottland und Irland blieben römerfrei, in Teilen auch Cornwall und Wales.
Mit den Augen der anderen
Im 5. vorchristlichen Jahrhundert berichtet Hekataios von Milet von keltischen Siedlungen und bezeichnet das Hinterland der ligurischen Küste als »Keltiké«. Nach ihm äußerte sich Platon über die kriegerische Gesinnung dieses Volkes und dessen kollektive Vorliebe für alkoholische Getränke. Auch wenn der Grieche Polybios in seinen Geschichtsschreibungen nur kurz auf die Kelten eingeht, gelten seine Aufzeichnungen neben denen seines Kollegen Poseidonios von Apameia als wichtige Quellen. Leider sind beider Originalschriften nicht erhalten geblieben; man kennt heute nur noch Zitate in den Arbeiten späterer Autoren.
Informationen über das Leben der Kelten finden sich, über den gesamten Text verstreut, in Gaius Julius Cäsars Aufzeichnung »Der Gallische Krieg«. Der spätere Kaiser war in den Jahren 58–51 v. Chr. römischer Prokonsul und eroberte als Feldherr Gallien. Sein großer Vorteil damals: Dank militärischer Geschlossenheit waren die römischen Armeen dem Gegner überlegen. Außerdem versuchten zu dieser Zeit drei gallische Fürsten gleichzeitig, das Land zu einen. Dabei bekämpften sie sich gegenseitig.
An der gegenüberliegenden Grenze des Keltenlandes verbreiteten die benachbarten germanischen Stämme Unruhe und fielen immer wieder verwüstend und nach Sklaven jagend ein. Dieser Bedrohung von zwei Seiten waren die keltischen Völker nicht gewachsen. Cäsar war der erste Autor, der (aus sprachlichen Gründen) zwischen den Kelten und den Germanen, die im Nordosten lebten, unterschied. Die Menschen rechts des Rheins, am Rand des nördlichen Keltenlandes, nannten sich selbst »Sweben«. Man vermutet heute, dass die Kelten sie als »Germani« bezeichneten. Es gab übrigens auch zwei keltische Stämme – einen an der oberen Rhône und einen anderen in Spanien –, die diesen Namen trugen. In Cäsars Aufzeichnungen lesen wir von großen stadtähnlichen Siedlungen, die er als »Oppida« bezeichnete. Titus Livius schuf mit seiner »Römischen Geschichte« ein Werk, das uns ebenfalls als wichtige Informationsquelle dienen kann. Sein Zeitgenosse Strabon von Amaseia befasste sich in seiner »Geografie« mit dem Norden Europas und den dort lebenden Menschen. Von Plinius dem Älteren finden sich in der Literatur viele Zitate seiner Berichte in Sachen Keltenkultur. Aus den Aufzeichnungen von Strabon von Amaseia erfahren wir, wie die Druiden Heilpflanzen, beispielsweise die Eichenmistel, den Bärlapp oder das Eisenkraut, sammelten und welche Rituale sie anwendeten, um die Heilkräfte der Natur freizusetzen.
Bis zum Beginn des 5. Jahrhunderts n. Chr. hielt die römische Vormachtstellung, dann brach das Reich zusammen. Während das Keltentum in den heute deutschsprachigen Ländern keine Kraft mehr hatte, sich neu zu erheben, versuchten die Britannier auf ihrer Insel eine Wiederbelebung. Fast wäre dies auch gelungen, doch dann standen schon die nächsten Invasoren vor der Tür: Angeln, Sachsen und Jüten hatten vom Festland her übergesetzt. Dass die Britannier gewaltigen Widerstand leisteten, erzählen uns die Sagen aus jener Zeit. Damals spielte sich auch das Geschehen ab, aus dem später die Legenden um König Artus, seine Ritter und den Druiden Merlin wurden. Die Eroberer siegten schließlich. Nur an den Rändern, in Wales, Cornwall, auf der Insel Man und in Schottland, konnten sich keltische Stämme halten. Dann fand eine intensive Christianisierung statt und ließ dem alten heidnischen Glauben in seiner ursprünglichen Form keine Chance. In Irland vermischte sich die keltische Spiritualität zunächst mit der römischen Religion, die damals noch nicht so festgeschrieben war. Das alte Wissen überstand im Untergrund die Anfeindungen. Es überlebte in den Häusern der Eingeweihten, die es nur an Auserwählte weitergaben. Oder bei den Mitgliedern fahrender Gruppen, die ihren Lebensunterhalt als Gaukler, Musiker und später auch als Minnesänger und Troubadoure verdienten. In diesem Fall waren es wieder die Hochsensiblen und Sensitiven, die die Überlieferungen hüteten, die nun zu Geheimnissen geworden waren.
Ein schriftlicher Quellenbereich, aus dem wir heute noch schöpfen können, sind die irischen und walisischen Sagen. Irgendwann nach dem 7. Jahrhundert n. Chr. wurde der Ulster-Prosazyklus nach den ältesten mündlichen Überlieferungen aufgeschrieben, die sich seit der Antike in der Volkserzählung erhalten hatten. Aus dem 12. Jahrhundert stammt der sogenannte Mythologische Zyklus. Im Mittelpunkt steht der legendäre Volksstamm der Tuatha De Danann. Druidisches Wissen spielt in dieser Mythologie eine zentrale Rolle. Etwa aus der gleichen Zeit stammt der Fen-(auch Fenier-)Zyklus von Finn (Fionn), dem Führer der Fianna.
Auf dem Kontinent hatte die keltische Kultur um das Jahr 80 v. Chr. in manchen Regionen einen Einbruch erlebt. In Süddeutschland verfielen bislang blühende Städte. Warum? Wissenschaftler wissen keine konkreten Antworten. Bald darauf besetzten die Römer weite Teile Europas. In den folgenden rund 500 Jahren war ihr Anteil an der Bildung einer neuen Kultur, die aus der Vermischung ihrer römischen mit der keltischen entstand, regional unterschiedlich stark ausgeprägt. Der Einfluss Roms nahm von Süd nach Nord ab. Als das Römische Reich zum Ende der Antike zusammenbrach, übernahm in der südlichen Region ab dem 5. Jahrhundert die Kirche immer mehr auch die staatliche Autorität. Die Franken, die bald darauf die Bildfläche betraten, besetzten viele politische Ämter im Süden Galliens mit Gallorömern. Zuvor war die sogenannte norisch-pannonische Kultur im alten keltischen Ursprungsland in die von Norden vorrückenden Germanenstämme aufgegangen. Im 5. Jahrhundert fielen die Hunnen von Osten her ein. Europa erlebte einen gewaltigen Umbruch, im Zuge dessen neue Bevölkerungsgruppen entstanden, die auch alte keltische Sprach- und Kulturelemente übernahmen. Davon zeugen nicht nur heute noch gebräuchliche Orts-, Gelände- und Gewässernamen zwischen Mittelrhein und den Alpen, die auf ursprüngliche keltische Bezeichnungen zurückgehen, sondern auch Bräuche, Märchen und geheimes Wissen. In Irland, Wales, Schottland und in Cornwall hielten sich, wie schon gesagt, Reste des alten Keltentums. Aber nicht nur dort. Denn die Annahme, dass mit Beginn der römischen Zeit die keltische Sprache auf dem Festland ausstarb und das romanisierte Volk fortan offiziell nur noch Latein sprach beziehungsweise die Sprachen der germanischen Völker übernahm, stimmt nur bedingt. Es blieben auch bei uns, wie in den Asterix-Comics, kleine keltische Inseln erhalten. So lebten beispielsweise noch im 4. und 5. Jahrhundert in der Region Mosel-Saar, in der römischen Provinz Belgica, ehemals keltische Stämme, die bis ins Mittelalter hinein durch eine eigene Sprache auffielen. Diese Sprache basierte auf dem Vulgärlatein und enthielt auch keltische Anteile. Der Kirchenvater Hieronymus, der von 347 bis 420 lebte, wunderte sich, dass in Trier Gallisch gesprochen wurde. Etwa zur gleichen Zeit benutzte der römische Dichter Ausonius, der auch einige Jahre in Trier lebte, in seinen Schriften viele gallische Namen und erwähnte die »druidische Herkunft« seiner Mutter.
In Europa gibt es noch eine Kultur, die am Rande existiert und von Historikern kaum beachtet wird. Es ist die der fahrenden Gaukler, Spielleute und Schausteller. Dieses fahrende Volk spielte seit dem frühen Mittelalter eine wichtige Rolle als Musikanten und Unterhalter, aber auch als Informanten und Verbreiter von Liedern, Sagen und Legenden, die auf den öffentlichen Plätzen und an den adeligen Höfen in Form von musikalischen oder schauspielerischen Darbietungen präsentiert wurden. Die Fahrenden bewahrten eine eigene Heilkunde, mit der sie auf den Märkten Geld verdienten. Sie sprachen eine eigene Sprache (und viele tun es heute noch), die »Welsch« genannt wird. Sie enthält Wörter, die auf einen keltischen Ursprung hinweisen könnten, und lässt in ihrem Namen Assoziationen mit Wales oder das Wallis zu. In der Mythologie etwa der Jenischen, eines fahrenden Volkes, das in der Schweiz als nationale Minderheit anerkannt ist, wird davon berichtet, dass es sich um die Nachfahren keltischer Stämme handelt, die von den Römern entwurzelt wurden.
ROM war gierig. Der wahnsinnige Hunger nach Macht und vermeintlichem Ruhm, der die Anführer eines eigentlich kleinen Stammes mitten auf dem italienischen Stiefel dazu trieb, große Teile Europas und Nordafrikas zu unterwerfen, brachte viel Leid mit sich. Andere Staaten wurden nicht nur unterworfen, es fanden sogar regelrechte Völkermorde wie etwa an den keltischen Menapiern im Rheinland statt. Auch wenn das Römische Reich in der Spätantike untergegangen ist, blieb der Menschheit dessen Gier erhalten.
Die Kelten hatten einen völlig anderen Bezug zu materiellen Dingen als die Römer, die nicht verstehen konnten, dass ihre Nachbarn den Toten wertvollen Besitz in Form von Gold, Silber und Edelsteinen mit ins Grab gaben. Oder dass man prächtige Kessel und Schwerter in Gewässern versenkte. Den Römern fehlte das ausgleichende druidische Element – ihre Kultur war krank. Und wir erleben heute noch täglich vor unseren Augen, dass die männlich dominierte Giergesellschaft die größten Bereiche unseres Lebens steuert. Gier treibt Firmen und Regierungen an. Es ist eigentlich heute noch so wie im alten Rom. Das Erlangen von Eigentum, Macht und Prestige gilt für einen großen Teil der Menschheit als Lebensziel, das Streben nach Gewinn und Wachstum ist der Motor der Gesellschaft. Die Römer wollten immer mehr, wollten Völker unterwerfen und ausbeuten. Letztlich scheiterten sie an sich selbst. Das Streben nach Besitz ist der Versuch, das Dasein zu ergreifen und so lange festzuhalten, wie es geht. Auch wenn autoritäre Herrschaftsformen im Verlauf der Geschichte immer wieder überwunden wurden, hat sich die Gierwirtschaft erhalten. Sie ist der Hauptgrund für die globale Umweltzerstörung und die Ursache für das große derzeitige und künftige Leid. Keiner kann die Gier verbieten. Menschen, die glaubten, dass Alternativen zum Kapitalismus – ob man sie jetzt Sozialismus oder Kommunismus nannte – die Gier überwinden können, sehen sich längst eines Besseren belehrt.
WENN wir die Gier überwinden wollen, müssen wir bei uns selbst anfangen. Am Anfang steht immer Achtsamkeit. Sie hilft uns, zu erkennen, wo uns unheilsame Kräfte gierig werden lassen. Sodann sollten wir diese destruktiven Motivationen gegen konstruktive austauschen. Dass dies funktioniert, zeigen uns die Naturvölker, und auch innerhalb der keltischen Kultur lassen sich Beispiele finden. Die Gier ist ein Produkt des menschlichen Geistes und lässt sich verwandeln. Ihr gegenüber stehen Mitgefühl und Liebe. Was die Erde betrifft, sollten wir Menschen erkennen, was wir anrichten, und die Schädigung unserer Umwelt unterlassen. In Mitteleuropa hat man beim Thema Waldsterben bewiesen, dass es Möglichkeiten des Eingreifens gibt. Auch die deutliche Einschränkung von FCKW-Gasen hat gezeigt, dass Gesellschaften durchaus in der Lage sind, vernünftig zu handeln. Allerdings beseitigt ein symptomatisches Vorgehen keine Gier. Wer sich selbst nur als kleines Rädchen im Getriebe empfindet und Entscheidungen Politikern, Konzernchefs oder generell »den Anderen« überlässt, trägt nur wenig zur Besserung bei.
Zauberwort Achtsamkeit
Wir stehen an einem Wendepunkt. Der Autor Manfred Folkers schreibt passend dazu in seinem Buch »Achtsamkeit und Entschleunigung. Für einen heilsamen Umgang mit Mensch und Welt«: Wenn das Giersystem bestehen bleibt, sich auch künftig ungebremst ausdehnen darf und die Menschen sich weiterhin von ihm zu einem verschwenderischen Umgang mit den natürlichen Ressourcen treiben lassen, kann es für den Zustand des Planeten Erde keine heilsamen zukunftsfähigen Prognosen geben. Ungefesselt wird die vom Gierprinzip beherrschte Ökonomie unseren Heimatplaneten so lange malträtieren, bis die Erde selbst diese Entwicklung umdreht und sich die Wirkungen der zurzeit noch geleugneten Ursachen in einer deutlichen, nicht mehr kontrollierbaren Wucht zeigen.«2 Nun, die Anzeichen sehen wir seit einigen Jahren vermehrt. Muss es denn erst so weit kommen, dass die Menschheit dazu gezwungen wird, von der Gier zu lassen? Wenn man sich anschaut, dass vor allem wohlhabende Menschen der Gier verfallen sind, sollte man nicht mehr von Unwissenheit sprechen, sondern schlichtweg von Dummheit.
Kühne Punks
Für die Griechen waren die Kelten die »Keltoi«, »Keltai« oder »Galatai«. Mit Letzterem sind die Galater gemeint, Adressaten des Apostels Paulus in seinem Brief an die Galater. Die Römer nannten die Kelten »Celtae« oder »Galli«. Die germanischen nördlichen Nachbarn kannten sie als »Welsche«. Dieser Begriff begegnet uns heute noch: Bezeichnungen wie »Wales«, »Cornwall«, »Wallis«, »Walsertal« oder »Wallone« gehen auf das germanische Wort zurück. Vermutlich haben sich die Kelten selbst »Keltoi« oder »Keltai« genannt und damit in ihrer Sprache »die Kühnen« gemeint.
Es ist ihnen nie gelungen, ein einheitliches politisches Gebilde zu erschaffen, das man als keltische Nation bezeichnen könnte. Dazu waren die einzelnen Stämme, Clans und Großfamilien zu eigenständig und der von ihnen besiedelte Raum zu groß. In ihrer Hochzeit, also etwa vom 5. vorchristlichen Jahrhundert bis zur römischen Eroberung, lebten keltische Stämme auf den britischen Inseln, im heutigen Belgien und in den Niederlanden (die Nordgrenze verlief etwa dort, wo die Rheinausläufer ins Meer münden), in Frankreich, Luxemburg, halb Deutschland (bis zum nördlichen Niederrhein), in der Schweiz, Österreich, Tschechien, der Slowakei, in Ungarn, Rumänien, in einem Teil der Türkei, in der nordostitalienischen Poebene sowie in Spanien und Portugal. Wenn man heute von den Kelten als Volk spricht, sind vor allem sprachliche, religiöse und kulturelle Gemeinsamkeiten dafür ausschlaggebend, weniger genetische. Aber auch, was das Aussehen betrifft, lassen sich Gemeinsamkeiten erkennen. Die Römer und Griechen verglichen die Haarpracht der Keltenmänner oft mit Pferdemähnen. Manche kneteten ihr Haar mit Kalkwasser und strichen es senkrecht aus der Stirn. Andere schmierten sich Fett auf die Kopfhaut und färbten die Haare mit »Sapo« rot. Unser Wort Seife ist von diesem pflanzlichen Reinigungs- und Färbungsmittel abgeleitet, das unter Zuhilfenahme von Talg und Asche hergestellt wurde. Was die Stimmen betrifft, besteht bei den antiken Autoren ebenfalls Einigkeit: Sie werden als tief und rau bezeichnet. Müsste man heute einen typischen Kelten aus der Zeit der römischen Kriege kennzeichnen, wäre ein Wort passend: Punks!
Unsere antiken Gewährsleute beschreiben die Kelten als den germanischen Nachbarn nicht unähnlich. Ammianus Marcellinus schildert sie als groß, mit heller Haut und von recht wildem Aussehen. Von der hellen Hautfarbe leitet Isidor von Sevilla den Namen der Gallier ab. Das griechische Wort »gala« bedeutet »Milch«. Von den Siluri und Picti in Britannien ist bekannt, dass sie Kriegsbemalungen und Tattoos trugen.
Die Kelten hatten eine klare Einteilung in drei Kasten: Adel, Volk und Knechte. Cäsar berichtet, dass die Männer über Leben und Tod ihrer Frauen und Kinder gebieten durften. Es soll nicht selten vorgekommen sein, dass beim Tod eines vornehmen Mannes seine Ehefrau(en) und Bedienstete ihm (unfreiwillig) ins Jenseits folgten. Adelige Männer hatten das Privileg, mehrere Frauen heiraten zu dürfen. Im Volk war jedoch die Einehe üblich. Laut Cäsar war das Verhältnis Adel zu Volk 1 : 10. Die keltischen Adeligen bezeichneten einen Gefolgsmann als »ambactus«. Wörtlich übersetzt bedeutet dies »jemand, der um einen anderen herum ist«. Unser Begriff »Amt« ist aus diesem Wort hervorgegangen.
Könige und Seher
Durch die Romanisierung der keltischen Welt ist auf dem europäischen Kontinent die keltische Sprache nicht überall, aber größtenteils verschwunden. Die Bevölkerung hatte Sitten, Sprache und Kultur der Römer übernommen. Historiker deuten dies aus Grabsteininschriften, die nach dem ersten Jahrhundert keine keltischen Namen mehr aufführen. Fluss- und Ortsbezeichnungen blieben unter den Römern aber weiterhin erhalten. Auch heute noch begegnen uns Orts-, Gewässer- oder Personennamen, die keltischen Ursprungs sind. So bleibt die Erinnerung an das Volk der Helvetier in der lateinischen Form des Schweizer Staatsnamens (Helvetia) erhalten. Dort spricht eine Minderheit noch Rätoromanisch. Diese Sprache geht auf den Stamm der Räter zurück, die ursprünglich in der heutigen Schweiz lebten, während die Helvetier im Schwarzwald zu Hause waren. Die Stadt Bregenz benannte man nach dem Stamm der Briganti. Aus dem keltischen Ortsnamen Cambodonum wurde Kempten. Im heutigen Paris waren einst die Parisier beheimatet. An die Belgen erinnert der Staatsname Belgien. Die seit dem Mittelalter für das antike Caledonia geläufige Bezeichnung Scotland/Schottland geht auf die Scotti zurück, die aus Irland übergesetzt hatten, um später gemeinsam mit den dort ansässigen Pikten das römische Britannien anzugreifen. In Gallien lebten laut Tacitus in antiker Zeit 64 Stämme. In Galatien (Inneranatolien) waren es sechs, in Irland fünf, in Spanien vier. Die kleinsten Stämme hatten maximal 50 000 Mitglieder, die größeren bis zu 200 000, die sich wiederum auf diverse Unterstämme verteilten. Zunächst hatte jeder Stamm einen eigenen König. Zu Zeiten Cäsars waren an deren Stelle allerdings schon Adelsgeschlechter getreten, die die Regierung übernahmen. Ein Keltenkönig hatte nicht nur den Oberbefehl im Kriegsfall, sondern neben rechtlichen auch sakrale Aufgaben. So galt der Galaterkönig Deiotarus als einer der berühmtesten Seher seiner Zeit.
Für die Könige spielte das Thema Gesundheitsvorsorge eine sehr große Rolle. Es war ihre Pflicht, körperlich unversehrt zu bleiben. Man befürchtete ansonsten den Entzug der göttlichen Gnade. Zunächst lebten die Kelten in dörflichen Siedlungen, später legten sie auch kleinere Städte mit burgartigen Befestigungen oder Fluchtburgen und Fürstensitze in Höhenlagen an. Etwa ab dem 2. Jahrhundert v. Chr. entstanden zentrale Städte als Mittelpunkte der Stammesgebiete. Die meisten Namen dieser Städte trugen die Endung »acum«, z. B. Antunnacum für das heutige Andernach oder Mogontiacum für Mainz. Übrigens lautet der längste heute noch erhaltene keltische Ortsname Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Wörtlich übersetzt bedeutet er »Haseln in der Nähe eines schnellen Wirbels und der St.-Thysilio-Kirche gegenüber der Steininsel Gogo« und gehört einem walisischen Dorf auf der Insel Anglesey. Aus Platzgründen findet man auf Landkarten allerdings nur die Abkürzung Llanfair P. G.
Die Kunst des Überlebens
Das Pech der Kelten war, dass sie nie als geeinigter, militärisch organisierbarer Staat auftraten. Dadurch waren sie den straff gedrillten und nach Plan agierenden Römerheeren unterlegen. Im Zuge der Romanisierung Europas gingen sie in den nachfolgenden Völkern auf. Der keltische Geist war und ist jedoch nicht unterzukriegen. Mittlerweile erleben wir die dritte Renaissance des keltischen Kulturlebens. Jede dieser Wiederbelebungen erschuf eine zentrale (Identifikations-)Figur. Im frühen Mittelalter war dies der Sagenkönig Artus, später war es Ossian, der um 1760 von James Macpherson erfundene schottische Romanheld, und in der Jetztzeit, seit Ende der 1950er-Jahre, der römervertrimmende Schnauzbart Asterix. In den beliebten Büchern der französischen Comic-Autoren René Goscinny und Albert Uderzo, inzwischen von Didier Conrad, haben die Kelten vor nichts Angst – außer davor, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Diese Aussage ist historisch belegt. Eine schriftliche Quelle aus dem Jahr 335 v. Chr. berichtet von einem Treffen Alexanders des Großen mit keltischen Gesandten in der ungarischen Tiefebene, wo den Kelten die Frage nach ihrer größten Angst gestellt wurde und ebenjene berühmte Antwort fiel.
Heute zählt man die Kelten offiziell zu den »verschwundenen Völkern«. In der Weltgeschichte kann man zwei Formen von »Völkerschwund« beobachten: Die erste Variante ist die der Ausrottung eines gesamten Volkes samt Verwüstung des Landes und anschließender Neubevölkerung. Variante zwei, die auf die Kelten zutrifft, ist der Wechsel von Namen, Lebensart und Staatsform. Die Kelten wurden, mit Ausnahme einiger weniger Stämme, von den Römern nicht vernichtet. Ihre Nachfahren leben heute noch, der größte Teil der Mitteleuropäer hat keltische Vorfahren.
Haben die Druiden auf dem europäischen Kontinent ihre Mitmenschen davon überzeugen können, dass es sinnlos war, gegen eine organisierte Übermacht wie das römische Heer bis zum letzten Blutstropfen zu kämpfen? Wir wissen es heute nicht. Der Gedanke ist jedoch legitim. Die keltischen Völker erscheinen uns im Rückblick als eine wandlungs- und aufnahmefähige Sorte Mensch, der eine Anpassung an die Kultur einer Übermacht näher lag als der schrittweise Untergang in aussichtslosen Guerillakämpfen. Der rote Faden, der sich durch die Geschichte des Keltentums zieht, ist die Übernahme von Sinnvollem und die Anpassung an Vorhandenes und Neues. Die Kelten dachten und handelten vermutlich sehr pragmatisch. Ihre Art, zu agieren, war geprägt vom weiblichen Prinzip des Verbindens und Heilens. Die Römer dagegen verkörperten mit der gewaltsamen Unterwerfung ihrer Nachbarvölker und einem grenzenlosen Expansionsdrang den männlichen Aspekt des Bekämpfens und Besiegens. Dieser Umstand führt uns zu einem wichtigen Lernschritt auf dem druidischen Weg: der Fähigkeit, sinnvoll und friedlich zu leben, ohne zu kämpfen.
ÜBUNG: FRIEDLICH LEBEN, OHNE ZU KÄMPFEN
Die römischen Eroberer waren aggressiv. Eitle Kaiser und Heerführer trieben ihre Soldaten von Sieg zu Sieg, nur, um allen anderen und sich selbst zu beweisen, was für tolle Kerle sie waren. Den keltischen Weg zu gehen, bedeutet, seine Probleme selbst zu lösen, ohne dass andere Menschen oder gar Völker darunter leiden müssen. Eine hilfreiche Übung ist dabei die feste Absicht, so gut zu sein, wie man kann. Lernen Sie aus Niederlagen, anstatt nach Ausreden zu suchen. Und schieben Sie die Schuld für Ihre Misserfolge nicht anderen in die Schuhe. Niederlagen haben nur einen Zweck: Sie drängen uns die Frage auf, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Die Römer sind durch ihre Kriege und Eroberungen vielleicht materiell reicher geworden. Glücklicher waren sie trotzdem nicht.
Und diese Erkenntnis führt uns gleich zu einem weiteren Punkt. War die individuelle keltische Seele, als sie sich noch uneingeschränkt entfalten konnte, glücklicher als das kollektive Bewusstsein der römischen Eindringlinge? Die Druiden haben durch ihre spirituelle Praxis erkannt, dass Glück letztlich der Ausdruck eines Lebens in Harmonie ist. Und diese Harmonie – mit der Geistigen Welt, mit der Natur, mit allem, was ist – war ihr zentrales Thema.
ÜBUNG: VON GLÜCKLICHEN MENSCHEN LERNEN
Eine gute Übung auf dem druidischen Weg ist es deshalb, glückliche Menschen zu beobachten und von ihnen zu lernen. Der allererste Schritt ist der in Richtung innerer und äußerer Harmonie. Im Bewusstsein, Teil eines großen Ganzen zu sein, empfindet sich ein glücklicher Mensch nicht als getrennt von seiner Umgebung. Er ruht in sich selbst und nimmt zugleich aktiv am Leben seines direkten Umfeldes teil. Misserfolge sind für den glücklichen Menschen keine Niederlagen, sondern lediglich Rückmeldungen. Er bewertet sie nicht als persönliches Versagen, sondern als Lernschritte. Glückliche Menschen nehmen sich selbst nicht allzu ernst. Übertriebene Ernsthaftigkeit führt leicht zu Verbissenheit. Wer über sich selbst lachen kann, geht mit sich und mit seinen Mitmenschen milder um. Abgesehen davon, werden beim Lachen glücklich machende Stoffe im Organismus freigesetzt. Glückliche Menschen arbeiten zielstrebig, ohne sich selbst zu zermürben. Sie vergeuden keine Energie mit unnützem Grübeln und können langfristige Ziele verfolgen, ohne dabei auf den kurzfristigen Genuss und die Freuden am Rande zu verzichten. Weil sie sich selbst diese Annehmlichkeiten gönnen, vermeiden sie Frustrationsgefühle. Die keltische Kultur ist voller Beispiele dafür.
Als die Römer und später die Germanen der keltischen Kultur ein oberflächliches Ende setzten, taten die Kelten das einzig Vernünftige: Sie arrangierten sich mit den Gegebenheiten und haderten nicht mit ihrem Schicksal. Optimistisch stellten sie eine Verbindung her zwischen den für sie neuen Perspektiven einer anderen Kultur und ihren Erkenntnissen und Überlieferungen. Sie hatten erkannt, dass sich alles in einem steten Wandel befindet. An den westlichen Rändern der alten Welt hat das ursprüngliche Keltentum länger überleben können und immer wieder Renaissancen erlebt – in Irland, Wales, Schottland, Cornwall, auf der Insel Man und in der Bretagne. Dort lebte eine scheinbar ausgestorbene Kultur fort – vor allem in der sakralen Buchmalerei und in der literarischen Mythologie machte sie auf sich aufmerksam. Wie stand es aber um die Religion der Kelten? Um die Heilkunde? Ist das Wissen der Druiden wirklich, wie uns die Geschichtsbücher erklären, mit der Christianisierung untergegangen? Und überhaupt, welche Wirkung hatte die Einführung des christlichen Glaubens in Europa auf das druidische Wissen?
Der Klügere gibt nach
Es hätte auch anders kommen können. Die westliche Geschichte und das immer noch vorherrschende, von einem bibelgläubigen Christentum geprägte Weltbild sind bis in die heutige Zeit mit einem Mann verbunden: Kaiser Konstantin, genannt der Große. Konstantin beherrschte das Römische Reich von 312 bis zu seinem Tod im Jahr 337 n. Chr. Heute wird er als Schlüsselfigur in der Geschichte und Entwicklung des Christentums bezeichnet. Die Überlieferung präsentiert uns diesen Mann als frommen Konvertiten, der dem Christentum zur offiziellen Anerkennung verholfen hat. Die Legende berichtet von einer Vision, die er vor der entscheidenden Schlacht gegen seinen Thronrivalen Maxentius gehabt haben soll. Im Schlaf sah er ein am Himmel schwebendes Kreuz mit der Inschrift »In hoc signo vinces« (»In diesem Zeichen wirst du siegen«). Konstantin soll nun eilig die Schilde seiner Soldaten mit den griechischen Buchstaben chi und rho, den beiden ersten Buchstaben des Wortes »Christus«, versehen und den Gegner bezwungen haben. Von da an galt Konstantins Sieg gleichsam als Triumph des Christentums über die Heiden.
Im Jahr 325 leitete er das Konzil von Nizäa. Damals wurde bestimmt, dass Rom offizielles Zentrum des christlichen Glaubens sein sollte. Und es wurde damit begonnen, festzulegen, was ein Mitglied der christlichen Religionsgemeinschaft in Zukunft zu glauben habe und was nicht. Abweichungen von den festgeschriebenen Dogmen galten bald schon als Häresie. Wir dürfen annehmen, dass das Christentum, wie wir es heute kennen, eigentlich nicht aus der Zeit Jesu stammt, sondern zur konstantinischen Zeit mehr oder weniger amtlich festgelegt wurde. In diesem Sinne verwende ich in den folgenden Kapiteln den Begriff Christentum.
Übrigens blieb Konstantin zeit seines Lebens ein Anhänger des heidnischen Sol-Invictus-Kultes, in dessen Zentrum die Leben spendende Sonne stand. Er selbst wurde erst auf dem Totenbett getauft. Für ihn waren die inzwischen sehr zahlreich gewordenen Christen im Römischen Reich wichtige Verbündete im Kampf um die Macht. Ein Glaube, der der Politik nutzte, wurde toleriert und gefördert. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Christen in erster Linie Anhänger der Lehren Jesu gewesen. Konstantin richtete den Glauben auf einen einzigen Himmelsgott aus und erhob diesen zu seinem offiziellen Schutzherrn. Die Rolle von Jesus als Messias wurde zunächst ignoriert, vielmehr sah sich Konstantin selbst in dessen Nachfolge. Die Christen gingen aus praktischen Gründen diesen Kompromiss ein. Als Gegenleistung wurde ihre Religion offiziell anerkannt. Für unser Thema ist die Tatsache wichtig, dass das Christentum von nun an unaufhaltsam auf dem Weg an die Macht war. Als es schon bald nach Konstantins Regierungszeit römische Staatsreligion wurde, verloren die Kelten mit ihrer alten Religion auch den Berufsstand der Druiden. Denn diese waren als Vertreter einer persönlich erfahrbaren Spiritualität in einen durch Regeln und Gesetze gleichgeschalteten Verordnungsglauben nicht eingliederbar. Sie wurden zu Feinden der Kirche erklärt. Religiöse Funktionäre agieren wie die meisten Menschen in Machtpositionen – Kräfte, die ihren Status zu gefährden drohen, werden von ihnen bekämpft und vernichtet. Die keltischen Heiler und Schamanen, einstmals die Angesehensten ihres Volkes, waren nun Geächtete und Verfolgte. Es war ihnen nicht mehr möglich, wie früher den Druidennachwuchs auszubilden und ihre uralten, ewigen Lehren weiterzugeben. Nur im Untergrund, in den Wäldern, wo das Auge des Gesetzes die verborgenen Treffen weniger Eingeweihter nicht erspähen konnte, lebte das geheime Wissen weiter.
Auf dem Land, bei der bäuerlichen Bevölkerung, blieben viele alte Riten und Vorstellungen erhalten, sie änderten lediglich Äußerlichkeiten und passten sich dem Christentum an, bzw. integrierten die Menschen den christlichen Glauben in ihr heidnisches Weltbild. Dies gilt nicht nur für die römische Zeit, sondern für das komplette Mittelalter und die darauf folgenden Jahrhunderte.
Retter der Kultur
In Irland und Schottland sah die Situation etwas anders aus. Der Einfluss Roms und die Völkerwanderung drangen nicht bis hierhin vor. In Irland entwickelte sich ein eigenständiges Christentum, das das Druidentum in sich aufnahm, anstatt es zu vernichten. Das alte magische Heilwissen war hier leichter einzugliedern, zumindest in den ersten Jahrhunderten. Die irischen Mönche verschwendeten ihre Energie nicht an die aussichtslose Bekämpfung alter heidnischer Elemente. Sie widmeten sich einer Aufgabe, deren Wert wir erst heute richtig abschätzen können: der Rettung der Schriften des klassischen Altertums. Vom europäischen Festland waren Kultur und Wissenschaft in den Jahrhunderten zwischen dem Untergang Roms und dem Mittelalter so gut wie verschwunden. Barbarische Eroberer, zerstörungswütig und ohne Sinn für kulturelle Errungenschaften fremder Völker, hatten im 5. Jahrhundert n. Chr. das Römische Reich überrannt. Die Vandalen plünderten Kunstschätze, verbrannten wertvolle Bücher und zerstörten in einem gewaltigen Rundumschlag die klassische Zivilisation Europas.
Schriften, die gerettet werden konnten, wurden auf dem Seeweg nach Irland in Sicherheit gebracht, weit weg von den Brandstiftern. Und die Iren hatten ja gerade erst richtig lesen und schreiben gelernt! In den neuen Klöstern wurde daraufhin geschrieben, was das Zeug hielt. Die Mönche kopierten alles, was sie in die Finger bekamen – in diesem Fall die gesamte noch vorhandene westliche Literatur. Nur durch die emsige Arbeit der keltischen Neuchristen in den kargen Mönchszellen, aber auch in der freien Natur, konnten die griechisch-lateinische und die römisch-christliche Kultur erhalten werden. Der Abt Columban, der auch als Dichter berühmt war und noch in der Druidentradition stand, gilt heute als Schlüsselfigur bei der Rettung der klassischen abendländischen Literatur. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass ohne die irischen Mönche, so gesehen christliche Druiden oder druidische Christen, die lateinische Literatur verloren gegangen wäre. Für die Bewohner der Grünen Insel ist dies eine selbstverständliche Tatsache, die den meisten Mitteleuropäern allerdings völlig unbekannt ist. Später, als sich auf den Trümmern Roms neue Zivilisationen gebildet hatten, kehrten die Bücher auf den Kontinent zurück.