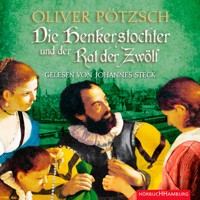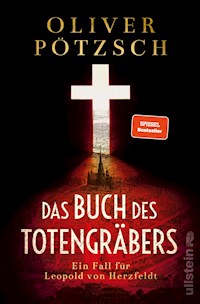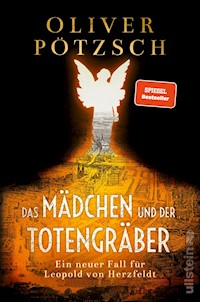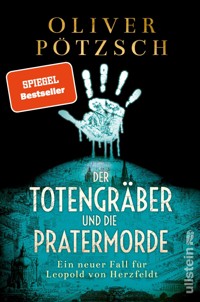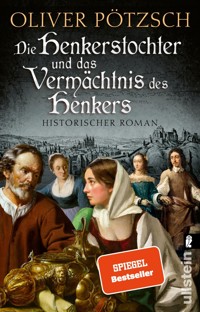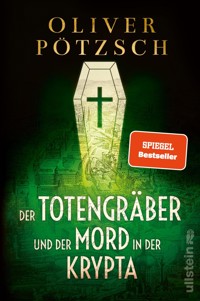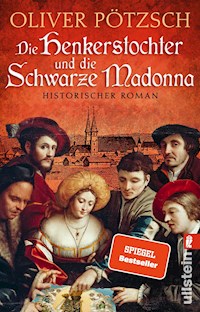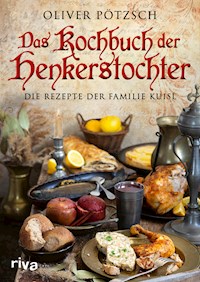9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Damals Kräuter- und Schnabelmasken, heute Mundschutz … Man könnte dem Autor angesichts dieses Romans durchaus seismographische Fähigkeiten bescheinigen.« Süddeutsche Zeitung Der achte Band der erfolgreichen Henkerstochter-Serie von Bestseller-Autor Oliver Pötzsch Sommer 1679. Die Pest, die bereits in Wien wütet, breitet sich in Bayern aus. Der Schongauer Scharfrichter Jakob Kuisl wird von einem Pestkranken aufgesucht, der kurz darauf zusammenbricht. Bevor er stirbt, flüstert er Jakob Kuisl noch ein paar rätselhafte Worte ins Ohr: Kuisl muss Kaufbeuren retten, ein schwarzer Reiter spielt dort mit seiner Pfeife zum Tanz auf, der Mörder hat zwei Gesichter. Gemeinsam mit seiner Tochter Magdalena geht Jakob Kuisl den geheimnisvollen Andeutungen nach. Ein gefährliches Unterfangen, denn inzwischen gibt es immer mehr Tote in Kaufbeuren. Doch was steckt dahinter – die Seuche oder ein raffinierter Mörder?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die Henkerstochter und der Fluch der Pest
OLIVER PÖTZSCH, Jahrgang 1970, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist und Filmautor beim Bayerischen Rundfunk. Heute lebt er als Autor mit seiner Familie in München. Seine historischen Romane haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht: Die Bände der Henkerstochter-Serie sind internationale Bestseller und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.
Von dem Autor sind in unserem Hause außerdem erschienen:Die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der schwarze Mönch · Die Henkerstochter und der König der Bettler · Der Hexer und die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der Teufel von Bamberg · Die Henkerstochter und das Spiel des Todes · Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf · Die Henkerstochter und der Fluch der Pest · Die Henkerstochter und die Schwarze Madonna
Die Ludwig-Verschwörung · Die Burg der Könige · Der Spielmann · Der Lehrmeister · Das Buch des Totengräbers · Das Mädchen und der Totengräber · Der Totengräber und der Mord in der Krypta
Sommer 1679. Die Pest, die bereits in Wien wütet, breitet sich in Bayern aus. Der Schongauer Scharfrichter Jakob Kuisl wird von einem Pestkranken aufgesucht, der kurz darauf zusammenbricht. Bevor er stirbt, flüstert er Jakob Kuisl noch ein paar rätselhafte Worte ins Ohr: Kuisl muss Kaufbeuren retten, ein schwarzer Reiter spielt dort mit seiner Pfeife zum Tanz auf, der Mörder hat zwei Gesichter. Gemeinsam mit seiner Tochter Magdalena geht Jakob Kuisl den geheimnisvollen Andeutungen nach. Ein gefährliches Unterfangen, denn inzwischen gibt es immer mehr Tote in Kaufbeuren. Doch was steckt dahinter – die Seuche oder ein raffinierter Mörder?
Oliver Pötzsch
Die Henkerstochter und der Fluch der Pest
Historischer Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch 1. Auflage Juni 2020 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020 Alle Rechte vorbehalten. Umschlaggestaltung: zero-media. net, München Titelabbildungen: akg-images / Guercino, eigentl. Giovanni Francesco Barbieri. 1591–1666; zugeschrieben. »Der ungläubige Thomas«, um 1620. (Öl auf Leinwand, 120 × 143 cm.) Rom, Pinacoteca Vaticana. (Mann); akg-images / André Held, Feti, Domenico, 1588/89–1623. »Die Melancholie«, um 1618–1623. (Öl auf Leinwand, 172,5 × 128,2 cm.) Paris, Musée du Louvre (Frau); © The Picture Art Collection / Alamy Stock Foto (Stadt); © Lisa Kim / Alamy Stock Foto (Pestmaske) Karte von Kaufbeuren: © Peter Palm,Berlin Autorenfoto: © Frank Bauer | www.frankbauer.comE-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-2236-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Kaufbeuren im Jahre 1679
Dramatis Personae
Der Rattenfänger von Hameln
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Epilog
Nachwort
Kleiner Reiseführer für Kaufbeuren und Umgebung
Leseprobe: Die Henkerstochter und das Vermächtnis des Henkers
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Kaufbeuren im Jahre 1679
Widmung
Für meinen Vater Peter, meine Brüder Florian und Marian, meinen Patensohn Aliahmad und alle anderen Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Pflegerinnen, die jeden Tag dafür sorgen, dass es dem einen oder anderen Menschen ein wenig besser geht. Wir Schriftsteller schreiben nur darüber …
Kaufbeuren im Jahre 1679
Dramatis Personae
Die Familie Kuisl
Jakob Kuisl, Schongauer Scharfrichter
Magdalena Fronwieser (geborene Kuisl), Jakobs ältere Tochter
Simon Fronwieser, Münchner Arzt
Barbara Weisheitinger (geborene Kuisl), Jakobs jüngere Tochter
Valentin Weisheitinger, Münchner Stadtmusikant
Georg Kuisl, Jakobs Sohn
Peter und Paul, Söhne von Magdalena und Simon
Sophia, ihre Tochter
Personen in Schongau und München
Johann Lechner, Schongauer Stadtschreiber
Jakob Schreevogl, Schongauer Patrizier und Freund der Kuisls
Martha Stechlin, Hebamme
Mathias und Josef, Schongauer Stadtwachen
Crescentia Laubinger, Tochter des Peitinger Baders
Der Oberst, unbekannter Auftragsmörder
Kronprinz Max Emanuel, zukünftiger bayerischer Kurfürst
Kaufbeuren
Johann Rehlinger, Kaufbeurer Bürgermeister
Martin Eden, Sohn des verstorbenen Stadtphysikus Hermann Eden
Conrad Näher, Kaufbeurer Scharfrichter
Raffael, Henkersgeselle
Gottlieb Bärwein, Spitalmeister im Kaufbeurer Spital
Hans Kohler, Apotheker
Leonhart Schropp, Chirurgus
Pater Damian, Seelvater des Spitals
Thomas Widmann, Superior der Kaufbeurer Jesuiten
Tobias Hörmann von und zu Gutenberg, Baron und Kaufbeurer Patrizier
Xaver Klingensteiner, Kemnater Scharfrichter
Der Rattenfänger von Hameln
(alte deutsche Sage, erzählt nach den Brüdern Grimm)
Vor vielen Jahren ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von vielfarbigem, buntem Tuch an und gab sich als Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien. Die Bürger wurden mit ihm einig und versprachen ihm einen bestimmten Lohn. Da zog der Rattenfänger ein Pfeifchen heraus und pfiff, und alsbald kamen die Ratten und Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich um ihn herum. Als der Mann nun meinte, sie wären vollzählig, ging er hinaus, und der ganze Haufen folgte ihm, und so führte er sie an die Weser; dort schürzte er seine Kleider und trat in das Wasser, worauf ihm all die Tiere folgten und hineinstürzend ertranken.
Nachdem die Bürger aber von ihrer Plage befreit waren, reute sie der versprochene Lohn, und sie verweigerten ihn dem Manne unter allerlei Ausflüchten, sodass er zornig und erbittert wegging. Im Sommer aber erschien er wieder, jetzt in Gestalt eines Jägers, erschrecklichen Angesichts, mit einem roten, wunderlichen Hut, und ließ seine Pfeife in den Gassen hören. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mägdlein in großer Anzahl gelaufen. Der ganze Schwarm folgte ihm nach, und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand. Die Eltern liefen vor alle Tore und suchten mit betrübtem Herzen ihre Kinder; die Mütter erhoben ein jämmerliches Schreien und Weinen. Von Stund an wurden Boten zu Wasser und Land an alle Orte herumgeschickt, zu erkundigen, ob man die Kinder gesehen, aber alles war vergeblich.
Es waren im Ganzen hundertunddreißig verloren.
Prolog
Im Allgäu, Anno Domini 1679
Der Tod kündigte sich an mit leisem Fiepen.
Cornelius van Leyden dachte zunächst an Kinderstimmen, an entferntes Jammern und Wimmern, doch dann ähnelte es eher einem Kichern. Ja, da kicherte jemand! Erschrocken öffnete van Leyden die Augen, er spürte das Blut im Kopf rauschen. Um ihn herum war nichts als Schwärze. War er etwa erblindet? Er versuchte, sich aufzurichten, doch offenbar war er nicht nur blind, sondern auch gelähmt. Wie sonst ließ es sich erklären, dass er sich überhaupt nicht rühren konnte? Oder war er bereits tot, war das hier die Hölle?
Nachdem er sich eine Weile prüfend hin und her geschoben hatte, kam Cornelius van Leyden zu dem Schluss, dass er weder gelähmt noch in der Hölle war, sondern mit Bändern gefesselt, dicken Lederriemen, die über Brustkorb, Arme, Bauch und Beine liefen. Wie ein Paket verschnürt lag er auf einer Art Bett in einem stockdunklen Raum, vermutlich einem Kerker. Ein Umstand, der ihn eher erleichterte als ängstigte.
Es war nicht das erste Mal, dass Cornelius van Leyden gefesselt in einem Verlies lag. Als lang gedienter Söldner aus den Niederlanden hatte er für so viele Herren gekämpft, dass er sie nicht mehr zählen konnte. Der letzte war der französische König Ludwig XIV. im Holländischen Krieg gewesen, doch davor war van Leyden auch für die andere Seite in die Schlacht gezogen. Er hatte geplündert, gebrandschatzt, vergewaltigt und gemordet, immer mit dem Segen des jeweiligen Herrschers und manchmal auch dem der Kirche. Sein Gewissen war rein, er war ein Hund des Krieges. Schon drei Mal war er dem Teufel gerade noch von der Schippe gesprungen. Zweimal hatte er im letzten Moment aus dem Verlies fliehen können: Kameraden hatten ein Loch in die Mauer gesprengt, während draußen schon das Schafott für ihn aufgebaut wurde. Einmal war beim Hängen das Seil gerissen, und der Feldwebel hatte ihn daraufhin begnadigt. Weder Kerker noch der Teufel konnten einen van Leyden schrecken. Er hatte sieben Leben wie eine Katze, und, verdammt noch mal, er würde auch aus diesem Loch lebend herauskommen!
Wenn nur mein Kopf nicht so dröhnen würde …
Sein Schädel pochte, als würde jemand mit einem Streitkolben darauf herumhauen. Das lag vermutlich an dem vielen Wein, den er gestern in dieser Kaufbeurer Spelunke gesoffen hatte. Mit ein paar anderen Söldnern aus Flandern hatte er auf ihren allerneuesten Herrn angestoßen, diesen jungen bayerischen Kronprinzen, dem noch der Flaum auf den Lippen wuchs. Und doch würde er schon bald Kurfürst sein und damit einer der mächtigsten Herrscher des Reichs. Sie hatten ihren Sold verprasst, dann waren die Huren an den Tisch gekommen und ein paar andere Kerle, an die er sich nicht mehr erinnern konnte. Sie hatten ihm mehr Wein gegeben, und dann noch mehr …
Und so war er hier gelandet.
Cornelius van Leyden ahnte, was geschehen war. Er war einer Bande von Drückern in die Hände gefallen, hundsgemeinen Bastarden, die einen abfüllten und dann mit einer Unterschrift für den Kriegsdienst verdingten. Vermutlich hatte er gestern auf irgendeinem Fetzen Papier sein Kreuz gemacht, sodass er nun einem anderen Fürsten dienen musste. Nun ja, sie würden ihn hier unten ein wenig schmoren und seinen Kater auskurieren lassen. Und dann bekam er eine neue Söldnertracht, pfiff ein neues Lied und marschierte unter einer neuen Flagge.
»Heda!«, schrie er in die Dunkelheit. »Lasst mich raus, ihr Saukerle! Oder bringt mir wenigstens noch was zum Saufen! Hört ihr?«
Erst jetzt fiel van Leyden etwas auf, das er wegen der heftigen Kopfschmerzen bislang nicht bemerkt hatte. Als er die Stirn bewegte, war da etwas …
Etwas um seinen Kopf.
Er schüttelte sich, und es rasselte. Van Leyden erstarrte. Was er für einen Lederriemen um seinen Hals gehalten hatte, war in Wirklichkeit ein Eisenring. Er gehörte zu einem seltsamen Gebilde, das seinen Kopf umschloss.
Einem Käfig wie ein Vogelzwinger.
»Verflucht … Was … was soll das?«
Van Leyden schüttelte und drehte sich, worauf der Eisenring schmerzhaft an seinem Hals schabte. Sein Kopf war tatsächlich in einen Käfig gesperrt! Nun hatten sich seine Augen auch ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt. Er starrte durch das dünne Gitter hinaus in einen Raum, dessen Wände aus grob geschichteten großen Quadern bestanden. Wenn er seinen eingezwängten Kopf ein wenig drehte, sah er am Boden winzige Punkte, die hin- und herhuschten.
Wieder erklang dieses Fiepen, jenes seltsame Kichern, das er zuvor schon gehört hatte.
Und nun wusste er auch, woher es stammte.
Es war das Fiepen von Ratten, Dutzende von ihnen, die über den Boden flitzten und ihn mit ihren Äuglein hungrig anstarrten, als wäre er ein großer appetitlicher Schinken.
Die Biester wurden nun immer frecher. Sie kletterten an den Pfosten seiner Bettstatt empor, liefen ihm über Beine und Brust. Ihre kleinen Füße tappten über den Käfig, der van Leydens Kopf umschloss, ihre langen, glatten Schwänze kitzelten ihn an der Nase. Schmerz durchzuckte ihn, als eine Ratte ihm in den Finger biss. Eine andere knabberte an seinen Stiefeln.
»Holt mich hier raus, ihr Teufel!«, schrie van Leyden in der Hoffnung, dass ihn irgendjemand hörte. »Das ist kein Spaß mehr!«
Plötzlich ertönte unmittelbar hinter ihm ein Geräusch. Etwas knarrte und quietschte, und ein Lichtschein fiel in die Kammer. So schnell, wie sie gekommen waren, huschten die Ratten in ihre Löcher zurück. In dem schwachen Licht sah van Leyden nun über sich in etwa drei Schritt Höhe ein riesiges Gitter, das als eine Art Zwischendecke diente. Wo zur Hölle war er hier nur?
Schritte hallten über den Steinboden.
»Na endlich«, keuchte van Leyden erleichtert. »Macht mich los, bevor mich die Biester noch bei lebendigem Leib auffressen. Und nehmt mir diese komische Maske ab. Was … was soll dieser Unsinn überhaupt? Wenn ihr mich erschrecken wollt, dann lasst euch sagen, dass ein van Leyden weder den Teufel noch die Hölle fürchtet!«
Die Gestalt, die nun direkt hinter ihm stand, gab keine Antwort. Etwas rüttelte an seinem Kopf, und van Leyden hoffte schon, man würde den lästigen Käfig nun endlich entfernen. Aber das war nicht der Fall, im Gegenteil.
Der Mann hinter ihm schien etwas daran festzuschrauben.
»He, was machst du da?«, rief van Leyden. »Zum Teufel, was … was ist das?«
An dem Gewicht, das nun auf seinem Kopf lastete, spürte van Leyden, dass der Mann offenbar eine weitere Apparatur am Scheitelpunkt des Käfigs angebracht hatte. Etwas quietschte, als würden Schrauben und Muttern gedreht, ein hässliches, nervtötendes Schaben. Doch ein anderes Geräusch erschreckte van Leyden viel, viel mehr.
Es war das erneute Quieken von Ratten, das jetzt viel näher klang.
Direkt über seinem Kopf.
Ein letztes Rucken und Rasseln, als würde eine Klappe hochgezogen.
Ein Trippeln und Trappeln wie von Hunderten kleiner Pfoten.
Und dann ergoss sich eine Flut von Ratten in den maskenartigen Zwinger um seinen Kopf, sie huschten durch van Leydens Haare, knabberten an seinen Ohren, verbissen sich in seiner Nase, zerfleischten seine Lippen … Cornelius van Leyden fluchte, kreischte, bat und flehte, während ihm die Ratten bei lebendigem Leib die Haut vom Gesicht rissen.
Jetzt war er sich sicher, dass sie kicherten.
Kapitel 1
München, den 2. August, Anno Domini 1679
Dieser französische Burgunder mundet ganz ausgezeichnet. Es ist mir ein Rätsel, wie wir all die Jahre diesen sauren Fusel aus dem Rheinland trinken konnten. A votre santé!«
Der Münchner Bürgermeister Wilhelm Ligsalz hob sein Glas, dann nahm er einen tiefen Schluck und gab ein schmatzendes Geräusch von sich. »Wirklich köstlich!«
Ligsalz wischte sich über den Spitzbart und machte sich wieder über die Hirschkeule her, die vor ihm auf einem silbernen Teller in brauner Biersoße schwamm. Sein Hemd mit Spitzenkragen und Manschetten wies bereits etliche Flecken auf. Es war der dritte Gang des Abends. Zuvor hatte es schon Karpfen auf fränkische Art gegeben und danach knusprig gebratene Gans mit Klößen, eine Spezialität der dicken Köchin, die eben einen weiteren Krug Wein hereinbrachte. Magdalena war spätestens nach der fetten Gans übel gewesen. Seitdem stocherte sie auf ihrem Teller herum und schob das Fleisch von der einen auf die andere Seite.
Schweigend nippte sie an ihrem Glas, während sie aus dem Augenwinkel die illustre Tischgesellschaft beobachtete. Zu ihrer Linken saß Hans Schobinger, einer der reichsten Brauer der Stadt, neben ihm seine dürre Gattin, deren Mundwinkel stets herabhingen wie bei einer Beerdigung. Rechts, neben Magdalenas Mann Simon Fronwieser, hatte der städtische Kämmerer nebst Gattin Platz genommen, ihnen gegenüber der Münchner Bürgermeister und schließlich ihr Gastgeber, Doktor Malachias Geiger. Im Gegensatz zu seinen aufgetakelten Gästen trug der Doktor lediglich ein schlichtes schwarzes Wams und einen ebenso schwarzen Rock. Freundschaftlich prostete er Magdalena zu.
»Die Kinder sind alle wohlauf, Frau Fronwieser?«
»Danke, ich kann nicht klagen«, entgegnete Magdalena und zwang sich zu einem Lächeln. »Glücklicherweise haben wir ja meine jüngere Schwester Barbara, die sich in unserer Abwesenheit um die kleine Sophia kümmert.«
»Familie ist ein wertvolles Gut, Frau Fronwieser«, erwiderte Malachias Geiger ernst. »Vielleicht das wertvollste, das wir haben. Gerade in diesen unruhigen Zeiten.«
Magdalena nickte und bemühte sich, ihr Unwohlsein zu überspielen. Sie hasste diese Abendessen, zu denen sie und Simon gelegentlich von Doktor Geiger eingeladen wurden. Es wurde über Themen geredet, die sie nicht interessierten, und alles wirkte so steif und aufgesetzt wie ein einstudiertes Schauspiel. Vor allem aber spürte Magdalena die Missgunst ihrer Tischnachbarn. Obwohl sie nun schon etliche Jahre in München lebten, wurden Simon und sie von der sogenannten feinen Gesellschaft noch stets geschnitten. Es war nett gemeint von Doktor Geiger, dass er sie trotz allem immer wieder zu sich lud. Doch auch der Doktor müsste eigentlich merken, wie die anderen Gäste mit dem aus dem fernen Schongau zugezogenen Paar umgingen.
»Habt Ihr schon einmal Fruchteis versucht?«, wandte sich Mathilde Schobinger eben an Magdalena. Sie zog kurz die Lippen hoch, während sie ihre Tischnachbarin spöttisch musterte. »Ich vermute nicht. Es ist sehr teuer. Was man so hört, wird es am französischen Hof täglich serviert, der König liebt es, besonders mit Erdbeeren! Das Eis stammt aus den Alpen, und sie verwenden Rohrzucker aus Westindien. Eine wahre Delikatesse!«
»Ich denke, man muss nicht jede französische Mode mitmachen, auch wenn sie noch so en vogue ist. Wenn ich Eis lutschen möchte, breche ich mir im Winter einen Eiszapfen ab, das ist billiger«, gab Magdalena kalt lächelnd zurück. Sie sprach den französischen Ausdruck besonders gekünstelt aus, und der Brauersgattin entgleisten für einen Moment die Gesichtszüge.
»Äh, haha, meine Frau macht gerne einen Witz, nicht wahr?« Simon Fronwieser drückte unter dem Tisch Magdalenas Knie. »Unser Sohn Peter hat uns erst vor ein paar Wochen ein wenig Eiskonfekt vom Hofe mitgebracht. Köstlich!«
»Das Eis ist wohl beim Kronprinzen vom Tisch gefallen, und das Hündchen hat danach geschnappt.« Bürgermeister Ligsalz lachte derb und nahm einen weiteren Schluck Wein. »Nichts für ungut, Fronwieser. Euer ältester Sohn hat es in der Tat weit gebracht.« Er wischte sich den Wein aus dem Bart. »Was man so hört, gehört er zum Gefolge des zukünftigen Kurfürsten. Meinen Respekt!«
»Nun, Gefolge ist vielleicht zu viel der Ehre«, erwiderte Simon lächelnd. »Aber ja, er war wohl schon bei der einen oder anderen Audienz zugegen. Und man schätzt bei Hofe seine Kenntnisse in Latein und auch in den übrigen akademischen Fächern.«
Magdalena spürte leise Genugtuung. Tatsächlich war Peter ihr ganzer Stolz. Der Sechzehnjährige besuchte als Stipendiat das erlesene Münchner Jesuitenkolleg Sankt Michael, wo man in den höchsten Tönen von ihm sprach. Und von Zeit zu Zeit verkehrte Peter am kurfürstlichen Hof – auch wenn Magdalena nicht wusste, was er dort eigentlich genau trieb. Offenbar hatte Peter unter den Höflingen ein paar Freunde gefunden; Kronprinz Max Emanuel, den er vor Jahren einmal kennenlernen durfte, erkundigte sich ab und an nach ihm. Auch jetzt war Peter wohl gerade in der Münchner Residenz unterwegs. Seinen Eltern hatte er erklärt, er dürfe in der kurfürstlichen Bibliothek ein paar alte Abschriften einsehen. Aber Magdalena hatte auch gesehen, dass sein Blick bei dieser Behauptung leicht geflackert hatte, wie immer, wenn er ihr etwas verheimlichte. Vielleicht hatte er ja auch eine Liebschaft? Nun, sie würde es ihm mehr als gönnen, denn die meiste Zeit verbrachte Peter ohnehin mit Büchern. Anders als sein jüngerer Bruder Paul, den sie schon des Öfteren mit eher zweifelhaften und weitaus älteren Frauen gesehen hatte.
»Reist Euer Sohn denn auch mit dem Thronfolger nach Wien?«, erkundigte sich Hans Schobinger neugierig, und die Blicke aller wandten sich Simon zu. Eine erwartungsvolle Stille entstand. Erst im Mai war Kurfürst Ferdinand Maria gestorben, und sein siebzehnjähriger Sohn Max Emanuel war als zukünftiger bayerischer Herrscher vom deutschen Kaiser nach Wien eingeladen worden. Von der bevorstehenden prunkvollen Reise sprach die ganze Stadt. Wer den Kronprinzen begleiten durfte, gehörte zum wichtigen inneren Zirkel. Wie es hieß, nahm Max Emanuel sogar seinen Leibkoch, seinen Fechtlehrer und seinen persönlichen Perückenmacher mit.
»Äh, nein, Peter hat … andere Verpflichtungen«, erwiderte Simon ausweichend. »Außerdem bin ich, ehrlich gesagt, ganz froh, dass unser Sohn nicht mit dabei ist. Es heißt, dass in Wien eine Seuche …«
»Nun fallt sogar Ihr auf diese hanebüchenen Gerüchte herein, die zurzeit kursieren!« Bürgermeister Ligsalz schüttelte den Kopf. »Manchmal überlege ich, ob es nicht besser wäre, diese neuen ›Zeitungen‹ zu verbieten. Da stehen nur Unsinn und Gräueltaten drin.«
»Nun, wie auch immer, Euer Sohn scheint ein vielversprechender Bursche zu sein«, wandte sich der Brauer Hans Schobinger an Simon. Er hob das Glas. »Wir sollten auf ihn trinken.«
»In der Tat vielversprechend, umso mehr, wenn man seine Herkunft bedenkt«, fügte seine Gattin spitz hinzu.
»Wie meint Ihr das denn?« Magdalenas Stimme war plötzlich so frostig wie das Eis, von dem eben noch die Rede gewesen war.
Die Brauersgattin lief rot an. »Nun, ich meine nur …«
»Äh, hat Doktor Fronwieser eigentlich schon erzählt, dass sein neuestes Traktat von der Leopoldinischen Akademie angenommen wurde?«, meldete sich Doktor Malachias Geiger zu Wort, der das Gespräch ganz offensichtlich in eine andere Richtung lenken wollte. »Es ist erst letzten Monat in der Jahresschrift Miscellanea Curiosa erschienen. Erzählt doch, Doktor Fronwieser, um was geht es denn da genau?«
»Oh, das ist nicht so leicht zu erklären. Im Grunde ist es eine weitere Ausführung meiner Theorie, wie wichtig Sauberkeit in der Heilkunde ist. Meine Untersuchungen dazu zeigen ganz deutlich …«
Während Simon sich in weitschweifenden Erklärungen verlor, nutzte Magdalena die Gelegenheit, um sich ein wenig zu beruhigen. Wie sie diese Natter von Brauersgattin hasste! Wieder einmal zeigte sich: Diejenigen, die selbst nicht aus adligem Geblüt stammten, waren die schlimmsten Neider. Sie traten um sich, als fürchteten sie, andere bürgerliche Aufsteiger könnten sie zurück in die Gosse zerren.
Sieben Jahre war es nun her, dass die Fronwiesers sich entschieden hatten, der kleinen Stadt Schongau für immer den Rücken zu kehren und nach München zu ziehen. Der in ganz Bayern berühmte Arzt Doktor Malachias Geiger hatte Simon eine Assistentenstelle angeboten. Geiger war es auch gewesen, der dafür gesorgt hatte, dass die Familie Fronwieser die Münchner Bürgerschaft erhielt. Gleich darauf waren die Anfeindungen und Sticheleien losgegangen – wobei Simon davon nicht allzu viel zu merken schien. Ganz im Gegensatz zu Magdalena genoss er das neue bürgerliche Münchner Leben, beinahe so, als würde ihm gar nicht auffallen, wie aufgesetzt alles war. Magdalena hingegen vermisste Schongau. Sie hatte eine Weile gebraucht, um sich das einzugestehen, schließlich war ihre Heimatstadt, mehr als fünfzig Meilen entfernt und nahe der Alpen, im Vergleich zur Residenzstadt München ein stinkendes, ödes Provinzkaff. Doch es war eben das Kaff, das sie kannte und in dem sie aufgewachsen war.
Und wo ihr Vater und ihr Bruder noch immer lebten.
Mit Simon und Magdalena war der größere Teil der Familie nach München gezogen, und zwar nicht nur die Söhne Peter und Paul und die kleine Tochter Sophia, sondern auch Magdalenas jüngere Schwester Barbara, die in der Hauptstadt einen städtischen Musikanten geheiratet hatte. Nur Jakob Kuisl, ihr Vater, war mit Georg in Schongau geblieben. Jakob war der Schongauer Scharfrichter, sein Sohn dessen Geselle.
Und ich bin die Tochter eines ehrlosen Scharfrichters, dachte Magdalena.
Im Grunde war es ein Wunder, dass sie so weit gekommen war.
Wehmütig betrachtete Magdalena ihren Mann, der eben die Vorzüge frischen Wassers bei Wundheilungen pries. Auch Doktor Geiger steuerte den einen oder anderen klugen Beitrag bei – zwei Gelehrte, die ganz in ihrem Element waren. Dass die Fronwiesers einer Scharfrichtersippe entstammten, wussten in München allerdings nur sehr wenige. Und Simon achtete peinlich darauf, dass dies auch so blieb. Als Tochter eines Henkers wäre es Magdalena eigentlich unmöglich gewesen, in den bürgerlichen Stand aufzusteigen, aber Doktor Geiger hatte seine Kontakte spielen lassen. Und so waren sie schließlich in ein schmuckes Häuschen im besseren Graggenauer-Viertel gezogen, nicht weit entfernt von Geigers Praxis, in der Simon assistierte. Er verdiente als Arzt gutes Geld, Peter würde wohl schon bald in Ingolstadt Medizin studieren, alle drei Kinder waren wohlauf … Ihr Leben war viel besser, als Magdalena es sich je erträumt hatte.
Und trotzdem war sie nicht glücklich.
Nun, zumindest werden wir uns bald alle mal wiedersehen, ging ihr durch den Kopf. Wenn auch nur für kurze Zeit.
Ja, sie würden nach Schongau reisen, die ganze Familie! Die Sehnsucht nach ihrer Heimat ließ Magdalenas Herz schneller schlagen. Den Grund für diese Reise würde sie den schnöseligen Sesselfurzern hier allerdings sicher nicht verraten.
»Für mich ist Bier immer noch die sauberste Flüssigkeit«, brummte der Brauer Schobinger, der wie die anderen Gäste Simons Erklärungen eher gelangweilt gelauscht hatte. »Wenn ich Münchner Wasser saufe, dann komm ich vom Nachttopf nicht mehr runter. Was soll daran gesund sein?«
»Nun, tatsächlich glaube ich, dass zum Beispiel Branntwein …«
»Ah, da kommt schon die gute Agathe mit dem nächsten Gang«, unterbrach Geiger seinen Kollegen und winkte die Köchin herbei, die mit einer großen Schüssel eben das Speisezimmer betrat. »Wir haben zwar kein Eiskonfekt, aber dafür eine mit Honig gesüßte Eierspeise. Vielleicht mag der Herr Kämmerer ja derweil berichten, wie es um den Bau der neuen Schanzanlagen bestellt ist. Könnte ja sein, dass die Türken auch irgendwann einmal vor München stehen.«
»Ha, möge Gott dies verhüten! Dann müssten wir vermutlich alle diesen grauslig bitteren Kaffee trinken, so wie die Heiden.« Der Bürgermeister leckte sich die Lippen. »Für mich bitte noch ein wenig von dem vorzüglichen hausgemachten Honigwein. Und gerne viel von der Eierspeise.«
Als Magdalena die süßlich riechende gelbe Creme gereicht bekam, spürte sie, wie sich ihr der Magen umdrehte.
Sie mochte gar nicht daran denken, wie viele Gänge noch folgen würden.
Viele Meilen entfernt saß Magdalenas Bruder Georg daheim im Schongauer Henkershaus bei einem weitaus schlichteren Abendessen. Er hatte einen letzten Rest Speck aufgeschnitten, dazu gab es hartes Roggenbrot aus der Vorwoche, einen Kanten schimmligen Käse und einen Rettich aus dem Garten, an dem noch die Erde klebte. Ein Krug schäumendes Bier stand auf dem abgewetzten Tisch.
Und zwei Teller.
»Möchtest du auch einen Schluck?« Nervös langte Georg hinter sich, wo auf einem Wandregal ein paar Tonbecher standen. Zu spät stellte er fest, dass die Becher schmierig waren, vertrocknete tote Fliegen klebten am Boden. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal das Geschirr abgewaschen hatte. In der Henkersstube, die meist nur mit einem Kienspan erhellt wurde, war es ohnehin so dunkel, dass man fast nichts sah. Mit ein paar hastigen Handbewegungen wischte Georg den gröbsten Schmutz fort.
»Danke, ich bin nicht durstig. Ich hab draußen am Brunnen bereits getrunken.«
Die junge, dralle Frau, die ihm gegenübersaß, lächelte ihn an, und Georg wurde noch eine Spur nervöser. Es war erst das dritte Mal, dass er sich mit Crescentia Laubinger traf, und das erste Mal bei ihm zu Hause. Crescentia war die jüngste Tochter des Peitinger Baders, ein hübsches Ding mit großen Brüsten, roten Wangen und einem breiten Lächeln, bei dem Georg dahinschmolz. Sie hatten sich vor ein paar Monaten auf der Kirchweih kennengelernt. Schnell waren sie ins Gespräch gekommen, hatten miteinander getanzt, und Georg hatte dabei gespürt, wie ihm Crescentias Vater argwöhnische Blicke zuwarf. Als Bader war der alte Laubinger zwar selbst ehrlos, aber Georg war eben nur der Schongauer Henkersgeselle und stand deshalb im Stand noch weit unter dem Bader. Jedenfalls so lange, bis Georg nicht selber die Meisterprüfung abgelegt hatte. Und die verweigerte ihm der eigene Vater bislang hartnäckig.
Lange schau ich nicht mehr zu, dachte Georg, der merkte, wie einmal mehr die Wut in ihm aufstieg.
»Was hast du?«, fragte Crescentia neugierig. »Du schaust plötzlich so düster drein.«
»Ach, es ist nichts.« Er nahm den Becher, schenkte sich von dem dunklen Bier ein und trank in kräftigen Zügen. Sein Tag war lang und hart gewesen. Schon frühmorgens hatte er die Schongauer Fragstatt von getrocknetem Blut und Asche reinigen müssen, dann hatte er ein totes Rind mit dem Karren zum Schinder gebracht und die Abortgrube hinter dem Rathaus ausgeschaufelt. Nachmittags war das Gemüsebeet hinter dem Henkershaus dran gewesen, ernten, jäten, graben, dann mussten die Kuh gemolken und die Hühner gefüttert werden … Die Arbeit hörte nie auf. Und es gab keinen, der ihm dabei half, am wenigsten der Vater.
Crescentia nahm sich einen Kanten Brot und knabberte daran, während sie sich in der unaufgeräumten Stube umsah. Ihr Blick blieb an einem großen Schwert hängen, das im Herrgottswinkel neben dem Kruzifix ausgestellt war.
»Ist das …«, begann sie.
»Das Richtschwert, ja«, erwiderte Georg knapp.
»Brr! Wie unheimlich!« Crescentia schüttelte sich. »Ich hab zugesehen, wie dein Vater letztes Jahr dem Schäfer Hartl den Kopf abgeschlagen hat. Ein ziemliches Spektakel ist das gewesen. Drei Schläge hat er gebraucht. Das … das war kein schöner Anblick.«
»Wem sagst du das?«, entgegnete Georg seufzend. »Ich stand direkt daneben. Mein blutbespritztes Hemd musste ich danach zum Waschen geben.«
»Die Leute sagen, dein Vater wird alt.«
Georg schwieg, doch er nickte grimmig. Als er vor sieben Jahren aus Bamberg heimgekehrt war, um als Geselle bei seinem Vater in Schongau zu bleiben, hatte er eigentlich geglaubt, dass er bald der neue Schongauer Scharfrichter sein würde. Schon damals war Jakob Kuisl beinahe sechzig Jahre alt gewesen. Georg hatte geglaubt, der Vater würde sich auf das Altenteil zurückziehen und dem Sohn den Vortritt lassen. Doch er hatte sich getäuscht. Sein Vater war immer noch der gleiche Sturschädel und immer noch so stark wie ein Ochse. Seine Behändigkeit hatte allerdings stark nachgelassen, was sich bei Hinrichtungen immer mehr zeigte.
Vor allem, wenn er betrunken war …
Jakob Kuisl hatte vor einiger Zeit wieder zu saufen begonnen, sein altes Leiden. Noch hielt es sich Gott sei Dank in Grenzen, und doch verbrachte der Vater mittlerweile mehr Abende in den Schongauer Wirtshäusern als zu Hause. Auch jetzt saß er vermutlich in der Glocke, eine der wenigen Herbergen, in denen der Henker noch willkommen war.
Und ich kann zu Hause den Kehricht raustragen, dachte Georg. Als wäre ich seine Magd!
Nun, wenigstens war auf diese Weise in den nächsten Stunden nicht mit dem Vater zu rechnen. Und er, Georg, konnte sich ganz um Crescentia kümmern. Vielleicht war sie ja jetzt endlich so weit, dass …
»Was für ein großes Ding! Magst du es mal für mich in die Hand nehmen?«
»Äh, bitte, was?« Crescentias Stimme riss Georg aus seinen Grübeleien.
»Das Richtschwert. Magst du es mal halten? Ich will sehen, wie du damit aussiehst.«
»Ach so, das …« Georg zuckte die Achseln. »Warum nicht?« Er stand auf und ging hinüber zum Herrgottswinkel. Mit seinen starken Pranken, die ebenso behaart waren wie die seines Vaters, hob er das Schwert aus der Verankerung. Er hatte es erst vor ein paar Tagen geschliffen, es war so scharf wie eine Rasierklinge.
»Hu! Ich bekomm gleich Angst vor dir«, sagte Crescentia und kicherte.
Georg bleckte die Zähne wie ein Tier. Der Griff aus gegerbtem Haifischleder lag gut in der Hand, er machte einen Schritt nach vorne. Das Licht des Kienspans warf seinen Schatten an die Wand, groß und mächtig.
»Du musst genau zwischen zwei Halswirbel treffen«, erklärte er fachmännisch. »Das ist nicht so einfach. Ich hab an toten Ziegen geübt und an aufgehängten Rüben. Wenn ich einmal die Meisterprüfung mache, wird sich schnell herumsprechen, wie gut ich bin.«
»Tja, wenn …«, meinte Crescentia spöttisch.
Georg wollte etwas erwidern, doch ein plötzliches Geräusch ließ ihn innehalten. Es kam von einem verschlossenen Fensterladen her.
Etwas kratzte von draußen dagegen.
»Warte hier, und rühr dich nicht von der Stelle«, befahl er Crescentia.
Das Schwert in der Hand, sämtliche Sinne angespannt, ging Georg hinüber zur Tür. Das Henkershaus befand sich vor den Stadtmauern, unten am Lech im Gerberviertel. Es war eines der letzten Häuser vor dem Auwald und dem alten Burgberg, der den Nachbarort Peiting von Schongau trennte. In letzter Zeit hatte es in der Gegend einige Überfälle gegeben, vermutlich die Taten einer marodierenden Räuberbande, die es auf alleinstehende Gehöfte abgesehen hatte. Der Schongauer Stadtschreiber Johann Lechner hatte bereits ein Dutzend Soldaten ausgeschickt, bislang jedoch ohne Erfolg. Es galt also, vorsichtig zu sein.
Georg atmete noch einmal tief durch. Dann stieß er abrupt die Tür auf und stürzte mit gezücktem Schwert nach draußen. Die Klinge war so schwer, dass er sie trotz seiner Größe und Kraft mit zwei Händen halten musste. Er machte einen Ausfallschritt und sah sich um. Trotz der sommerlichen Wärme wehte ein kühler Luftzug vom Fluss her, sodass sich seine Nackenhaare aufstellten.
»Wer streicht da um mein Haus?«, rief Georg hinaus in die Dunkelheit. »Wer auch immer dort draußen ist, kann sich gerne den Gnadenstoß abholen!«
»Dein Haus?«, ertönte eine knurrende Stimme, nicht weit entfernt. »Das ist ja wohl immer noch mein Haus. Außerdem hältst du das Schwert wie eine Mistgabel. Sei so gut, und nimm es runter, bevor du dir noch wehtust.«
»Mein Gott, Vater!«, stöhnte Georg und ließ das Richtschwert sinken. »Was soll der Schmarren? Beinahe hätte ich dir den Kopf abgeschlagen wie einem Huhn.«
»Ha, da musst du schon früher aufstehen, bevor du mir den Kopf abschlägst! Bis dahin hab ich dich windelweich geprügelt. Windelweich!« Sein Vater lallte leicht, wie Georg jetzt bemerkte. Nun konnte er ihn in der Dunkelheit auch endlich ausmachen. Jakob Kuisl trat hinter dem Misthaufen hervor, der abseits des Hauses lag, und knöpfte sich eben den Hosenlatz zu. Trotz seines Alters war er noch immer eine imposante Erscheinung, bärtig, mit breiten Schultern und einem klobigen Zinken im Gesicht. Ein Turm von einem Mann – allerdings ein Turm, der leicht schwankte.
»Jetzt darf man schon nicht mehr bieseln, ohne vom eigenen Sohn mit dem Schwert bedroht zu werden«, brummte er. »Schöne Zeiten sind das!« Kuisl hatte sichtlich Mühe mit seiner Hose.
»Warum hast du nicht an die Tür geklopft wie jeder vernünftige Mensch? Stattdessen hör ich dich am Fensterladen …« Georg stockte, als ihm ein Verdacht kam. »Hast du etwa gelauscht?«
Der Vater schnaubte. »Spinnst du? Ist mir doch egal, was ihr zwei Turteltäubchen da drinnen so treibt.«
»Ha, also hast du doch gelauscht! Sonst wüsstest du ja wohl kaum, dass ich Besuch hab.«
Mittlerweile war Crescentia hinter Georg an die Tür getreten. Sie hatte sich das Tuch umgeschlungen und sah ängstlich hinüber zu Jakob Kuisl.
»Aha, die Kleine vom Peitinger Bader«, knurrte der Henker im tiefen Bass. »Was wohl dein Vater dazu sagt, dass du dich nachts noch hier herumtreibst?«
»Das Gleiche könnte ich dich auch fragen«, sagte Georg. »Wie viel hast du dem Torwächter diesmal gezahlt, dass er dich nach der Sperrstunde noch rauslässt? Ich dachte, du schläfst deinen Rausch in der Glocke aus und kommst erst morgen früh wieder.«
»Das ist ja wohl ganz alleine meine Sach, wann ich heimkomm«, erwiderte Kuisl. »In mein eigenes Haus«, fügte er drohend hinzu.
»Ich … ich geh dann wohl«, meldete sich Crescentia. Sie machte einen Knicks in Richtung des Schongauer Henkers, wobei sie es vermied, ihn direkt anzusehen. Seit Urzeiten galt der Blick eines Scharfrichters als Unheil bringend, und Kuisls Blick konnte einem wirklich Angst machen, vor allem gerade eben. »Und sagt um Himmels willen nichts meinem Vater. Ich bitt Euch!«
»Den Himmel brauchst du jetzt auch nicht mehr zu Hilfe zu rufen«, brummelte Kuisl in seinen Bart, in dem etliche Speisereste klebten. »Das versuchen die armen Sünder auf dem Schafott auch immer, und es bringt nichts. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Da ist noch nie ein Engel gekommen und hat sie gerettet. Auch nicht bei gefallenen jungen Mädchen.«
Schluchzend lief Crescentia hinüber zur Peitinger Straße, die nicht weit entfernt lag, jenseits des Lechs.
»Crescentia!«, rief ihr Georg hinterher. »Crescentia, so warte doch!« Doch die Baderstochter war bereits zwischen den dunklen Gerberhäusern verschwunden. Nur ihr Weinen war noch längere Zeit zu hören.
Eine Weile lang standen sich Vater und Sohn schweigend gegenüber. Dann fing Georg an zu schimpfen, wobei er noch immer das Richtschwert in der Hand hielt: »Gratuliere, du hast es mal wieder geschafft! Weißt du eigentlich, wie lange ich gebraucht habe, dass mich die Crescentia mal im Henkershaus besuchen kommt?«
»Du hättest mich ja vorher um Erlaubnis fragen können«, erwiderte Jakob Kuisl, der nun ein wenig friedfertiger und auch nüchterner klang. »Ich sag doch nicht, dass du dich nicht mit Mädchen treffen kannst. Aber …«
»Vater, ich bin siebenundzwanzig! Ich kann froh sein, dass sich überhaupt noch eine mit mir treffen will. Bei dem Spektakel, das du jedes Mal veranstaltest! Ich weiß gar nicht, wie viele Mädchen du mir schon vergrault hast. Die Anna vom Schongauer Schinder, die fromme Katharina aus Altenstadt, jetzt die Crescentia …« Georg zählte an den Fingern ab. »Ich bin es wirklich leid! Davon abgesehen, dass ich keine Lust mehr habe, dir hier die Dienstmagd zu spielen. Dieses Haus braucht eine Frau, und zwar bald!«
»Wir haben doch die alte Stechlin, die ab und an mal kommt«, bemerkte Kuisl mürrisch.
Martha Stechlin war die alte Hebamme im Ort, der Henker kannte sie schon seit Jahrzehnten. Im Grunde war sie die einzige Frau, die Jakob Kuisl nach dem Tod seiner geliebten Anna-Maria im Haus duldete.
»Die Stechlin ist eine alte Jungfer, die mehr nörgelt, als dass sie putzt«, entgegnete Georg. »Ich schwöre dir, wenn sich hier nicht bald etwas ändert, bin ich weg! Was ist mit der Meisterprüfung, die du mir schon so lange versprochen hast? Der Schäfer Hartl wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber du wolltest es ja mal wieder selber machen!«
»Ich brauch auch einen Gesellen. Wer soll es denn sonst machen außer dir?« Plötzlich grinste Kuisl. »Aber vielleicht ändert sich ja jetzt bald etwas.«
»Wie meinst du das?«
Kuisls Grinsen wurde breiter. »Nun, du hast mich noch gar nicht gefragt, warum ich schon wieder zurück bin.«
»Weil dich der Wirt rausgeschmissen hat?«, spottete Georg.
»Trottel! Er hat einen Brief für mich gehabt. Erst gestern hat ihn die Postkutsche aus München gebracht.« Jakob Kuisl zog einen schon reichlich zerknitterten, mehrmals gefalteten Bogen Papier hervor. »Deine beiden Schwestern wollen uns schon bald besuchen, zusammen mit der ganzen Familie, auch meinen zwei lausigen Schwiegersöhnen. Es gibt was zu feiern.«
»Und das wäre?«, fragte Georg misstrauisch. Er hatte Magdalena, vor allem aber seine geliebte Zwillingsschwester Barbara schon über ein Jahr nicht mehr gesehen. Früher waren sie beide ein Herz und eine Seele gewesen, und Georg vermisste Barbara mehr, als er sich selbst eingestehen wollte. »Nun spann mich nicht länger auf die Folter!«
»Tja …« Kuisl rieb sich den Bart, er genoss es sichtlich, Georg warten zu lassen. »Die Magdalena lässt fragen, ob der Paul bei mir als Lehrling anfangen kann. Er ist jetzt fünfzehn Jahre alt, stark wie ein Ackergaul, und er liebt die Scharfrichterei, wie du weißt.«
Der Henker grinste jetzt über beide Ohren. »Wenn mein Enkel hier anfängt, ist er schon bald der neue Geselle. Und du kannst meinetwegen der Schongauer Scharfrichter werden, und ich zieh ins Austragshäusl. Du hast mein Wort drauf!« Er ging hinüber zur Tür. »Darauf wollen wir anstoßen. Ich hab einen Durst, dass ich den ganzen Lech austrinken könnte. Oder besser ein Bierfass.« Noch einmal drehte er sich zu seinem verdutzten Sohn um. »Und stell endlich das Richtschwert wieder weg. Oder willst du damit den Stall ausmisten?«
»Quart, Oktave, Septim …«
Die Florettspitze tanzte vor Peters Nase, erst im letzten Augenblick gelang es ihm, seine eigene Klinge hochzuziehen. Stahl klirrte auf Stahl. Der Kronprinz zog sein Florett nach rechts, täuschte eine Finte zur Linken an, ging in die Riposte über, um schließlich rechts zuzustechen.
»Et en garde!«
Die stumpfe Spitze bohrte sich genau auf Brusthöhe in Peters Wams. Max lachte hell auf.
»Tot! Du bist tot! Und du schuldest mir drei Golddukaten!«
Peter wischte sich den Schweiß von der Stirn und warf die Klinge weit von sich. Wie er diesen Sport hasste! Manchmal glaubte er, dass Max dies wusste und ihn deshalb besonders gern damit quälte. Sie standen in einem nahezu quadratischen fensterlosen Raum, an dessen Decke gleich drei Kronleuchter mit Dutzenden brennender Kerzen hingen. Die Wände waren mit Teppichen verhängt; selbst vor der Tür hing eine Art dicker Vorhang, der jedes Geräusch und jedes Licht von außen aussperrte. Es war lange nach Einbruch der Dämmerung, aber draußen hätte es auch heller Tag sein können – Peter hätte es nicht gemerkt.
Die Kammer, die sich gleich neben den kronprinzlichen Gemächern der Münchner Residenz befand, war Max’ liebster Ort, sein Spielzimmer. Sooft es ging, übte er sich dort im Florettfechten, jenem Sport der Adligen und der höheren Bürgerschaft, der als besonders vornehm galt. Für Peter war das Fechten nichts anderes als ein Spiel des Tötens.
»Deine Riposte ist eine einzige Katastrophe!«, spottete Max. »Ich hätte dich durchlöchern können wie ein altes Weinfass. Du musst wirklich mehr üben und deine Nase nicht immer nur in Bücher stecken. Sonst schneide ich sie dir irgendwann einmal ab, mein Freund!«
Auch Max legte sein Florett nun zur Seite. Im Gegensatz zu Peter hatte er kaum geschwitzt, sein eng geschnittenes blaues Wams zeigte keinerlei Flecken. Anders als bei seinen öffentlichen Empfängen trug Max heute keine Perücke, was ihn jünger und auch burschikoser wirken ließ. Trotzdem vergaß Peter keinen Augenblick, dass vor ihm der zukünftige bayerische Kurfürst stand. An seinem achtzehnten Geburtstag, schon im nächsten Jahr, würde Max Emanuel der neue bayerische Herrscher sein. Bis dahin regierte übergangsweise sein Onkel. Danach konnte Max trotz seiner jungen Jahre so schalten und walten, wie er sich dies vorstellte. Als Kurfürst war er dann einer der acht Männer, die den deutschen König ernannten – eine Würde, die seit etlichen Generationen dem Geschlecht der Habsburger vorbehalten war.
Und ich bin mit ihm befreundet, dachte Peter. Oder etwa nicht? Manchmal weiß ich es einfach nicht.
Ihre enge Freundschaft war nach wie vor geheim. Nur ein sehr kleiner Kreis wusste, dass der bayerische Kronprinz mit einem einfachen Münchner Arztsohn verkehrte, dessen Herkunft zudem mehr als zweifelhaft war. Selbst Peters Eltern ahnten nicht, wie eng die Freundschaft der beiden wirklich war. Peter und Max Emanuel kannten sich seit Kindertagen, der Prinz war nur ein Jahr älter als Peter.
Ihre Verbindung, die vor etlichen Jahren mit einem verschwundenen Schoßhündchen begonnen hatte, war überaus kompliziert. Wenn Max und Peter allein waren, gebärdete sich der Kronprinz wie ein Rabauke und Straßenjunge, sie ritten zusammen aus, tobten durch den Münchner Hofgarten, würfelten oder spielten Karten. Peter war für Max jener treue Freund, den der Kronprinz unter all den Höflingen und Speichelleckern niemals finden würde. Waren hingegen andere Gäste anwesend, beispielsweise bei Audienzen, behandelte Max ihn wie Luft. Schon mehrmals hatte Peter daran gedacht, die Freundschaft ausklingen zu lassen. Doch kaum meldete er sich einige Wochen nicht mehr am Hof, stand schon bald ein Diener vor dem elterlichen Haus mit einer Einladung, die eher einem Befehl gleichkam.
Wie auch heute Abend wieder.
Seinen Eltern hatte Peter erzählt, er wolle die Bibliothek der Residenz aufsuchen. Stattdessen leistete er einem einsamen, gelangweilten jungen Adligen beim Fechten Gesellschaft. In den letzten Monaten, nach dem plötzlichen Tod von Max’ Vater, waren ihre Begegnungen zwar seltener geworden. Trotzdem herrschte zwischen ihnen immer noch die Vertrautheit, die sie schon als zehnjährige Buben miteinander verbunden hatte.
»Wenn ich mich recht erinnere, schuldest du mir jetzt schon neun Golddukaten«, sagte Max und grinste. »Drei für das Fechten und sechs für die beiden verlorenen Pferderennen.«
»Verrechne es mit unseren letzten Schachpartien«, erwiderte Peter. Erschöpft setzte er sich auf einen Seidendiwan in der Ecke, eines dieser exotischen neuen Möbelstücke, die er nur vom kurfürstlichen Hof her kannte.
»Touché!« Der Kronprinz schmollte sichtlich. Die Wettkampfschulden waren ein altes Spiel zwischen den Freunden, beide Seiten wussten, dass Peter seine Schulden niemals würde zahlen können. Neun Dukaten waren mehr, als sein Vater in einem halben Jahr verdiente! Zum Ausgleich spielten die Freunde von Zeit zu Zeit eine Partie Schach, die Peter meist gewann. Es ärgerte Max gewaltig, dass Peter ihm zwar in allen körperlichen Wettbewerben unterlegen war, nicht aber im Schach. Dabei war Max kein schlechter Spieler. Zudem war er klug und belesen, er spielte Geige und Cembalo, was ihm seine viel zu früh verstorbene, über alles geliebte Mutter Henriette Adelaide beigebracht hatte, eine Prinzessin aus dem Herzogtum Savoyen-Piemont. Vor allem aber war Max beinahe krankhaft ehrgeizig, ganz anders als sein verstorbener Vater, der als äußerst genügsam bekannt gewesen war. So mancher hatte hinter vorgehaltener Hand sogar von einem gewissen Phlegma gesprochen.
Max nahm das Florett wieder in die Hand und vollführte damit ein paar Übungsschritte. Die Klinge rauschte durch die Luft, während er weiter mit Peter sprach.
»Du weißt doch, dass ich schon bald nach Wien aufbreche«, hob er an, ohne Peter dabei anzusehen. »Hättest du nicht Lust mitzukommen?«
Peter zuckte zusammen. Damit hatte er nun wirklich nicht gerechnet.
Verflucht!, dachte er und suchte eifrig nach einer Ausrede.
»Das … das ist eine große Ehre«, stotterte er. »Aber ich fürchte, ich kann nicht …«
»Und warum nicht?«, fuhr Max dazwischen. Die Klinge zischte leise, fast wie eine Schlange.
Peter wusste, dass eine Einladung des Kronprinzen im Grunde ein Befehl war. Trotzdem wagte er einen Versuch.
»Meine Eltern würden mir das nie erlauben. Wir reisen schon bald nach Schongau. Mein … mein Bruder Paul wird dort seine Lehre beginnen …« Niemals hätte Peter Max erzählt, was für eine Lehre sein Bruder dort genau begann. Bislang wusste Max überhaupt nicht, dass Peter aus einer Scharfrichterdynastie stammte, und manchmal fragte er sich, ob Max überhaupt etwas von ihm wusste. Das Leben anderer Leute schien Max nicht sonderlich zu interessieren. Nach Paul erkundigte er sich fast nie.
»Ach, dein kleiner Bruder«, sagte er nun beiläufig. »Ist das nicht der, der sich so gerne auf der Straße prügelt? Gibt es dafür jetzt neuerdings eine Lehre?«
Peter ging auf den Spott des Freundes nicht ein. Als Kinder waren Paul und er ein Herz und eine Seele gewesen, auch wenn Paul immer ganz anders gewesen war als Peter. Doch sie hatten sich schon vor längerer Zeit auseinandergelebt, jeder ging seiner Wege. Peter hatte Pauls Neid jahrelang in vielen seiner Blicke gelesen. Dennoch schmerzte es ihn, dass sein Bruder nun für immer in Schongau bleiben würde, um dort bei seinem Großvater und seinem Onkel die Scharfrichterei zu lernen.
Allerdings war sein Bruder in letzter Zeit ohnehin kaum noch zu Hause gewesen. Bis vor Kurzem hatte er bei einem Sattler gelernt, die dritte Ausbildung, die er begonnen und nicht zu Ende geführt hatte. Der Meister hatte ihn hinausgeworfen, als Paul sich an seinem Branntwein vergriffen und dann auch noch betrunken und im Zorn die Werkbank zertrümmert hatte. Seitdem trieb Paul sich fast nur noch mit zwielichtigen Burschen in den Münchner Gassen herum. Es war wirklich Zeit, dass sich in seinem Leben etwas änderte.
»Wann wollt ihr abreisen?«
»Was?« Peter schreckte auf. Max ließ das Florett vor seiner Nase hin und her sausen.
»Wann ihr nach Schongau wollt, hab ich gefragt«, sagte der Kronprinz ungeduldig.
»Oh, ich denke so in drei Wochen, wenn der Vater seine Patienten …«
»Nun, dann wüsste ich nicht, wo das Problem ist«, unterbrach ihn Max. »Sicherlich sind wir bis dahin längst wieder zurück. Außerdem wird dir Wien gefallen. Eine echte Weltstadt mit Herz, kein solches Kaff wie München!«
»Aber …«, begehrte Peter auf. Doch Max brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen.
»Diese Reise ist sehr wichtig für mich. Die Audienz beim deutschen Kaiser könnte mit darüber entscheiden, welche Rolle das Haus Wittelsbach zukünftig im Deutschen Reich spielt, verstehst du? Da brauche ich einen Freund an meiner Seite, jemanden, dem ich zwischen all den intriganten Höflingen und Diplomaten blind vertrauen kann.« Die Spitze des Floretts zeigte nun direkt auf Peters Brust. »Und dieser Freund bist du!« Max machte eine kurze Pause, so als würde er seine nächsten Worte genau abwägen. »Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch einen ganz bestimmten Freundschaftsdienst, den du mir dort erweisen kannst. Dafür erlasse ich dir dann auch deine Schulden.« Max ließ das Florett fallen und schlug den Vorhang vor der Tür zur Seite.
»Und jetzt lass uns rüber zum Souper gehen, ich habe einen Bärenhunger.«
Während Peter dem Kronprinzen schweigend folgte, überlegte er, wie seine Eltern wohl auf diese neue Wendung reagieren würden. Denn eines war klar: Den Wunsch eines zukünftigen Kurfürsten abzulehnen war in etwa so unmöglich, wie den Lauf der Sterne anzuhalten.
»Das war das letzte Mal, hörst du? Das allerletzte Mal!«
Nach vier Stunden und etlichen weiteren Gängen standen Magdalena und Simon draußen vor Doktor Geigers Haus. Es war lange nach Sonnenuntergang, trotzdem war es noch schwülwarm, und wie immer im Sommer stank es zum Gotterbarmen. Die wenigen vornehmen Damen und Herren, die um diese Uhrzeit noch an ihnen vorüberflanierten, pressten sich parfümierte Tücher vor Mund und Nase. Wer es sich leisten konnte, verließ die Stadt in den Sommermonaten gleich ganz.
Doktor Geiger hatte ihnen einen mit einer Hellebarde bewaffneten Laternenträger organisiert, der sie sicher nach Hause geleiten sollte. In Paris gab es mittlerweile Straßenbeleuchtung, ja selbst in dem kalten Provinznest Berlin brannten, was man so hörte, Laternen an jeder Ecke. Nicht so in München. Hier war es nach Einbruch der Dämmerung stockfinster, und es trieb sich nur noch zwielichtiges Gesindel in den schmutzigen Gassen herum.
Während sie auf den Diener warteten, setzte Magdalena ihre Strafpredigt fort: »Merkst du denn gar nicht, wie sie hinter unserem Rücken über uns lachen? Wie sie sich das Maul zerreißen über den kleinen dahergelaufenen Provinzdoktor und seine ungebildete Frau Gemahlin?«
»Ich denke, das bildest du dir ein«, erwiderte Simon besänftigend. »Ich finde, der Bürgermeister hat sich sehr für meine Ausführungen interessiert. Und hast du gehört, wie er Peter gelobt hat?«
»Ich habe nur gehört, wie die Frau von diesem Bierpanscher über unsere Herkunft gelästert hat. Ich schwöre dir, wenn dieses dürre Heupferd noch einmal …«
Simon machte eine warnende Handbewegung, und Magdalena sah gerade noch, wie sich der bewaffnete Diener mit der Laterne näherte. Leise flüsternd schlossen sie sich ihm an und machten sich auf den Weg durch die dunklen Münchner Gassen, wobei Simon dem einen oder anderen Kothaufen auswich. Er hatte sich erst vor wenigen Tagen teure Stiefel mit Spitzenrosetten geleistet, die er wie seinen Augapfel hütete. Trotz ihres Ärgers musste Magdalena unwillkürlich lächeln. Ihr Mann hatte die vierzig bereits überschritten, aber er war immer noch so ein Geck wie an dem Tag, als sie in Schongau das erste Mal gemeinsam im Heu verschwunden waren. Wie lange war das nun schon her! Auch sie selbst war mit ihren sechsunddreißig Jahren nicht mehr die Jüngste, obwohl ihre Haare noch genauso voll und schwarz waren wie am Tag ihrer Hochzeit. Auch ihre Figur konnte sich durchaus noch sehen lassen, nur die Falten um ihre Augen gingen nicht mehr als bloße Lachfältchen durch.
»Warum hast du am Tisch nicht erzählt, dass wir mit der Familie nach Schongau reisen?«, fragte Simon. »Man könnte fast meinen, man hätte dir den Mund zugenäht. Sonst redest du doch auch von nichts anderem. Stattdessen legst du dich mit der Gattin von Münchens reichstem Brauer an!«
»Damit dieses Weibsbild noch mehr über uns herzieht?« Magdalena schüttelte den Kopf. »Für die ist unsere Heimatstadt doch nichts weiter als ein schmutziges Dorf mit ein paar Kühen und Schafen.«
»Nun, schmutzig ist München auch. Und Kühe und Schafsschädel finden sich sogar unter den Gästen eines honorigen Doktors.« Simon zwinkerte ihr zu, und Magdalena griff nach seiner Hand und drückte sie. In Momenten wie diesem merkte sie, wie sehr sie ihren Mann noch immer liebte.
Die Vorstellung, mit der ganzen Familie bald zurück in ihre Heimat zu fahren, zumindest für ein paar Wochen, hatte ihr Leben in München in letzter Zeit ein wenig erträglicher gemacht – auch wenn die Reise mit einem Abschied verbunden war. Der Brief, in dem Magdalena ihrem Vater ihren Entschluss ankündigte, musste mittlerweile in Schongau angekommen sein. Sie und Simon hatten lange gerungen, doch am Ende waren sie beide zu dem Schluss gekommen, dass es das Beste war. Für Paul, aber auch für den Rest der Familie. Magdalena war klar, dass sie Paul danach nicht mehr oft sehen würde. Dafür war Schongau einfach zu weit von München entfernt.
»Du musst loslassen, meine Liebe.« Simon schien ihre Gedanken erraten zu haben und erwiderte ihren Händedruck. »Aber das macht wohl eine gute Mutter aus. Dass ihr die Trennung von ihren Kindern immer schwerfällt.«
Die Laterne, die der Diener wie eine Angel vor sich hielt, war das einzige Licht in der Finsternis. Von fern war der Ruf eines Nachtwächters zu hören, der die elfte Stunde ankündigte.
Mittlerweile hatten sie das Graggenauer-Viertel erreicht. Ihr eigenes Haus lag nicht weit entfernt von dem angesehenen Wirtshaus Bürgerbräu in der Burggasse. Es war ein kleines, schmuckes Gebäude, wegen der hohen Grundstückspreise schmal und in die Tiefe gehend gebaut. Hinter dem Haus gab es einen kleinen schattigen Hinterhof, in dem Magdalena Kräuter und Gemüse zog. Früher in Schongau war sie ihrem Mann in der Praxis noch als Hebamme zur Hand gegangen, doch das war in München nicht mehr möglich. Vielleicht war es auch dies, was Magdalena an der Stadt so hasste: Der Schein bestimmte das tägliche Leben. Die Hausarbeit, das Waschen, Putzen, Einkaufen auf dem Markt am Schrannenplatz und vor allem das Ankleiden nahmen sie voll in Anspruch – anders als in Schongau, wo sie als ehrlose, aber nichtsdestotrotz angesehene Hebamme in den Gassen unterwegs gewesen war. Auch deshalb freute sie sich so, ihre Heimatstadt wiederzusehen.
Vor dem Haus verabschiedete sich der Diener mit der Laterne, nicht ohne vorher ein paar Münzen eingestrichen zu haben. Magdalenas jüngere Schwester Barbara schien ihr Kommen bereits gehört zu haben. Sie stand in der geöffneten Tür, und die Ungeduld war ihr anzusehen. Barbara war mittlerweile Mitte zwanzig, eine echte Schönheit mit dem vollen schwarzen Haar, das alle Kuisls hatten. Aber sie konnte auch eine wahre Furie sein. Vor allem der Vater hatte das früher immer wieder zu spüren bekommen.
»Ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr!«
»Glaub mir, ich wäre gerne früher gekommen«, erwiderte Magdalena seufzend. »Aber der Bürgermeister hat gar nicht mehr aufgehört zu reden und zu essen. Nach dem siebten Gang habe ich den Überblick verloren.«
Barbara lächelte schmal. »Klingt nach einem gelungenen Abend.«
»Klingt nach einem furchtbar langweiligen Abend.« Magdalena gähnte und betrat mit Simon das schlichte Vorzimmer. Eine steile Treppe führte in die oberen Gemächer, wo sich die Schlafkammern befanden. Im Gegensatz zu Doktor Geigers Haus gab es hier keine Holzvertäfelung an den Wänden und auch keine Teppiche auf dem Boden. Dafür reichte Simons Lohn dann doch nicht aus. Nicht einmal eine Magd konnten sie sich leisten.
»Wie geht es Sophia?«, erkundigte sich Simon bei seiner Schwägerin. »Schläft sie schon?«
»Wie ein Murmeltier.« Barbara lächelte. »Wir haben aber auch zwei Stunden zusammen gesungen und mit ihren Puppen gespielt. Zum Schluss hat sie kaum noch die Augen aufhalten können.«
Magdalena sah ihrer Schwester an, dass sie den Abend trotz allem genossen hatte. Barbara liebte ihre achtjährige Nichte sehr, vielleicht auch deshalb, weil sie selber keine Kinder hatte – und das, obwohl sie bereits seit einigen Jahren verheiratet war. Ihr Mann Valentin Weisheitinger war ein junger Musikant, der auf Hochzeiten und anderen Feiern spielte. Barbara hatte ihn zufällig kennengelernt, als ihr Vater für sie in München einen Mann gesucht hatte. Dass Barbara einen dahergelaufenen Musikanten geheiratet hatte, würde Jakob Kuisl seiner jüngeren Tochter wohl nie ganz verzeihen, auch wenn er schließlich doch seine Einwilligung gegeben hatte.
»Vielen Dank für alles.« Magdalena umarmte ihre Schwester. »Sophia spricht mehr von dir als von ihrer eigenen Mutter. Du bist die beste Tante, die man sich wünschen kann!«
Barbara grinste. »Wenn du glaubst, dass du mich damit überreden kannst, länger als nötig in Schongau zu bleiben, dann …«
»Aber ein paar Tage werden doch möglich sein!«
»Ein paar Tage, ja.« Barbara nickte. »Aber dann müssen Valentin und ich wieder zurück nach München. Jetzt im Sommer gibt es viele Hochzeiten, auf denen er spielt. Und ich werde ihn auf dem Tambourin begleiten und wohl auch tanzen.«
»Tanzen vor fremden Männern?« Magdalena verdrehte die Augen. »Das lass bloß nicht den Vater wissen.«
Das Verhältnis zwischen ihrer jüngeren Schwester und dem Vater war nie leicht gewesen. Dass Barbara nun nach Schongau mitkam, war ein Gefallen Magdalena zuliebe. Außerdem wollte sie ihren Zwillingsbruder Georg wiedersehen. Aber Barbaras Heimat war mittlerweile München und nicht mehr Schongau.
»Wir sollten dem Vater Tabak mitbringen, das wird ihn freuen, und …« Magdalena zuckte zusammen, als sie an der geöffneten Tür einen Schatten wahrnahm. Als sie erkannte, wer es war, war sie gleichzeitig wütend und erleichtert.
»Paul!«, zischte sie. »Ich dachte, du wärst längst zu Hause.«
»Wen kümmert’s? Wie ihr euch bei den Pfeffersäcken den Bauch vollgeschlagen habt, habt ihr euch ja auch keine Sorgen um mich gemacht, oder?«
Paul stand mit verschränkten Armen in der Tür, seine Augen funkelten. Nicht zum ersten Mal fragte sich Magdalena, woher der Zorn rührte, der stets in Paul zu brodeln schien. Er war ein Jahr jünger als Peter, doch viel kräftiger gebaut, er überragte seinen Bruder um mehr als einen Kopf. Wie so oft trug Paul nur ein einfaches Hemd, das an den Ärmeln eingerissen war, sowie eine kurze Lederhose, die vor Dreck starrte. Er war barfuß, in seinem Gesicht zeigten sich blutige Schmisse.
»Pass auf, wie du mit deiner Mutter redest, junger Mann!« Simon trat mit erhobener Hand auf ihn zu. Sein Sohn war jetzt schon größer als er, Paul kam ganz eindeutig nach seinem Großvater und nicht nach dem schmächtigen Vater. »Wo hast du dich nur wieder herumgetrieben? Hast du dich geprügelt?« Simon deutete auf die Schmisse. »Das muss ausgewaschen werden, bevor es sich entzündet.«
»Ach was, das sind doch nur Kratzer. Wir mussten den Auer Hundsfötten ihre frechen Mäuler stopfen.« Paul grinste und zeigte zwei Zahnreihen, in denen bereits etliche Lücken klafften. Über seiner Oberlippe lag ein dunkler Flaum. »Solltet mal sehen, wie die anderen ausschauen. Die erkennen die eigenen Mütter nicht wieder.«
Magdalena seufzte leise. Sie konnte nur hoffen, dass es ihr Vater und ihr Bruder schafften, Paul in Schongau auf die rechte Bahn zu führen. Eigentlich hatte sie sich geschworen, dass keiner ihrer Söhne ein Scharfrichter werden sollte. Doch es war immer Pauls größter Wunsch gewesen, bei seinem Großvater in die Lehre zu gehen. Seitdem er wusste, dass er nach Schongau reisen würde, war er ein wenig friedlicher geworden.
Zumindest bis heute.
»Weißt du eigentlich, was passiert, wenn dich der Nachtwächter um diese Zeit schnappt?«, schimpfte Simon. »Der steckt dich ins Loch!«
»Ach, aber der Peter darf sich noch draußen herumtreiben, ja? Bei dem machst du kein solches Theater.«
»Dein Bruder ist ein Jahr älter«, gab Simon zurück. »Außerdem weilt er in der Residenz und studiert, während du dich in der Au prügelst. Was glaubst du, was die Leute reden? Hast du auch nur einmal an meinen Ruf gedacht?«
»Ha, dein Ruf! Das ist alles, was dich kümmert!« Paul reckte das Kinn vor. »Der Großvater schert sich einen Scheißdreck um seinen Ruf.«
»Dann ist es ja gut, dass du bald bei deinem Großvater bist und nicht mehr im Haus deines Vaters, du selbstsüchtiger …«
»Aufhören, alle beide!«, fuhr Magdalena dazwischen. »Ich dulde nicht, dass Vater und Sohn so miteinander reden.« Sie wandte sich an Paul. »Beweis deinem Vater, dass du doch zu was nutze bist. Ich möchte, dass du deine Tante heimbegleitest.«
Paul legte den Kopf schief und zwinkerte ihr zu. »Und was ist mit dem Nachtwächter?«
»Nun, ich bin sicher, dass du genügend Schleichwege kennst, um ihm zu entgehen. Sorg dafür, dass deine Tante sicher heimkommt.«
»Worauf ihr euch verlassen könnt«, erwiderte Paul grinsend und zog ein kleines Messer hervor. »Mit mir legt sich da draußen keiner an.«
Kurz darauf war er mit Barbara verschwunden. Simon und Magdalena gingen hinüber in die Stube, wo Simon sich auf die Bank fallen ließ und tief durchatmete.
»Es ist gut, dass er weggeht«, sagte er schließlich.
»Simon, so darfst du nicht reden!«
»Du weißt es doch auch. Er ist …« Simon suchte nach den richtigen Worten. »Anders als wir.«
»Er ist anders als du! Als du und Peter. Und du hast ihn das auch immer wieder spüren lassen.«
»Nun bin ich also schuld?« Simon sah sie zornig an. »Magdalena, du weißt, was er macht. Er ist kein Unschuldslamm. Er prügelt sich, trinkt, vermutlich stiehlt er auch … Erst letzte Woche hat er drei kleine Katzen in einem Bottich ertränkt!«
»Weil ihn die Nachbarin darum gebeten hat.«
»Aber es hat ihm Spaß gemacht, Magdalena! Ich habe es ganz genau gesehen. Er hat keinen Sack genommen. Er hat die kleinen Dinger so reingeworfen, sie zappeln lassen und immer wieder untergetaucht, bis sie jämmerlich ersoffen sind.« Simons Stimme wurde leiser. »Er war schon immer grausam zu Tieren. Ich habe Angst, dass er später auch grausam zu Menschen ist.«