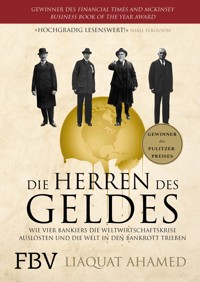
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Strong, Schacht, Norman und Moreau – ihre Namen sind Legende, ihr Vermächtnis die schlimmste Weltwirtschaftskrise des letzten Jahrhunderts. Pulitzerpreisträger Liaquat Ahamed schaut ihnen über die Schulter, im Jahr 1929 an der Klippe des Abstiegs vom rauschenden Boom der Zwanzigerjahre in die Weltwirtschaftskrise. Spannender als durch die Augen der beinahe mächtigsten Männer dieser Zeit lässt sich der komplette Zusammenbruch der Weltwirtschaft kaum erzählen. Auf der einen Seite Benjamin Strong von der Federal Reserve Bank of New York, dessen energisches Auftreten seine totale Überforderung kaschiert. Ihm gegenüber von der Bank of England der neurotische und geheimnisvolle Montagu Norman und Émile Moreau, der misstrauische und ausländerfeindliche Chef der Banque de France. Und dann noch Hjalmar Schacht, gleichsam arrogant wie streng, der brillante Reichsbankpräsident. Zusammen stehen diese vier Männer in der diffizilen Zeit von 1914 bis 1944 auf der Bühne der Welt und ziehen die Strippen in der weltweiten Finanzwelt, zwischen Goldstandard, persönlichen Eitelkeiten und der schlimmsten Weltwirtschaftskrise des letzten Jahrhunderts. Eine wahre Geschichte, die zeigt – gerade in Analogie zu heute –, dass die Großen der Welt mehr von persönlichem Eifer und den eigenen Unzulänglichkeiten getrieben werden als von sachlichem Kalkül zum Wohle aller. Die packende Geschichte einer Ära der Wirtschafts- und Finanzgeschichte, die gleichzeitig Weltgeschichte geschrieben hat und mit der Liaquat Ahamed zu Recht den Pulitzerpreis 2010 gewann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 951
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2010
© 2010 FinanzBuch Verlag GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Original edition copyright © 2009 by Liaquat Ahamed. All rights reserved.
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »LORDS of FINANCE – THE BANKERS WHO BROKE THE WORLD« bei The Penguin Press, a division of Penguin Group (USA) Inc. New York. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with The Penguin Press, a member of Penguin Group (USA) Inc.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Horst Fugger
Lektorat: Ulrike Kroneck
Satz: HJR, Jürgen Echter, Landsberg am Lech
EPUB: Grafikstudio Foerster, Belgern
ISBN 978-3-86248-224-5
Weitere Infos zum Thema
www.finanzbuchverlag.de
Gerne übersenden wir Ihnen unser aktuelles Verlagsprogramm
Inhalt
Einführung
Teil I: Der unerwartete Sturm – August 1914
01. Prolog
02. Ein seltsamer und einsamer Mann Großbritannien: 1914
03. Der junge Magier Deutschland: 1914
04. Zwei sichere Hände Die Vereinigten Staaten: 1914
05. L’Inspecteur des Finances Frankreich: 1914
06. Die Generäle des Geldes Zentralbanken: 1914 bis 1919
Teil II: Nach der Sintflut – 1919 bis 1923
07. Verrückte Ideen Die deutschen Reparationszahlungen
08. Onkel Shylock Kriegsschulden
09. Ein barbarisches Relikt Der Goldstandard
Teil III: Einen neuen Wind säen – 1923 bis 1928
10. Eine Brücke zwischen Chaos und Hoffnung Deutschland: 1923
11. Der Dawes-Plan Deutschland: 1924
12. Der goldene Kanzler Großbritannien: 1925
13. La Bataille – die Schlacht Frankreich: 1926
14. Die ersten Regenschauer 1926 bis 1927
15. Ein kleiner Schluck Whisky 1927 bis 1928
Teil IV: Einen Sturm ernten – 1928 bis 1933
16. Hinein in den Strudel 1928 bis 1929
17. Die Läuterung der Verdorbenheit 1929 bis 1930
18. Probleme mit dem Magnetzünder 1930 bis 1931
19. Eine tickende Zeitbombe auf dem Deck der Welt 1931
20. Goldene Fesseln 1931 bis 1933
Einführung
Am 15. August 1931 wurde die folgende Pressemitteilung herausgegeben: »Der Präsident der Bank of England ist unpässlich infolge der außergewöhnlichen Belastungen, denen er in den vergangenen Monaten ausgesetzt war. Auf ärztlichen Rat hat er jede Arbeit niedergelegt und ist ins Ausland gefahren, um sich zu erholen.« Dieser Präsident war Montagu Collet Norman, D. S. O. Da er mehrmals Adelstitel abgelehnt hatte, hieß er nicht, wie so viele Leute glaubten, Sir Montagu Norman oder Lord Norman. Dennoch war er sehr stolz auf den Namenszusatz D. S. O.: Distinguished Service Order, die zweithöchste Tapferkeitsauszeichnung für Offiziere.
Norman war grundsätzlich argwöhnisch gegenüber der Presse und dafür berüchtigt, was er alles unternahm, um lauernden Reportern zu entkommen. Er reiste unter falschem Namen, hüpfte aus Zügen, und einmal rutschte er sogar auf einer Strickleiter in rauer See von einem Ozeandampfer. Bei dieser Gelegenheit aber, als er sich darauf vorbereitete, das Passagierschiff Duchess of York nach Kanada zu betreten, war er ungewöhnlich mitteilsam. Mit dem Talent für Understatement, das für seine soziale Klasse und sein Land so typisch ist, erklärte er den am Dock versammelten Reportern: »Ich glaube, ich brauche eine Pause, weil ich eine schwere Zeit hinter mir habe. Ich fühle mich nicht so gut, wie ich es mir wünschen würde und denke, dass mir eine Reise auf diesem schönen Schiff guttun wird.«
Die Fragilität seiner psychischen Verfassung war in Finanzkreisen schon seit Langem ein offenes Geheimnis. In der Öffentlichkeit kannte kaum jemand die Wahrheit – dass der Präsident in den letzten beiden Wochen, als sich die weltweite Finanzkrise immer stärker beschleunigte und das europäische Bankensystem am Rand des Kollaps stand, wegen der extremen Belastung einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Daher war die Pressemitteilung der Bank of England, die in Zeitungen von Shanghai bis San Francisco erschien, ein großer Schock für die Anleger auf der ganzen Welt.
So viele Jahre nach diesen Ereignissen ist es schwer, sich die Macht und das Prestige Montagu Normans zu vergegenwärtigen, weil man ihn heute kaum noch kennt. Damals aber galt er als einflussreichster Zentralbankier der Welt. Die New York Times nannte ihn den »Monarchen [eines] unsichtbaren Imperiums«. Für Jean Monnet, den Paten der Europäischen Union, war die Bank of England »die Zitadelle der Zitadellen« und »Montagu Norman war der Mann, der diese Zitadelle regierte. Er flößte jedem Respekt ein.«
Im Jahrzehnt zuvor waren er und die Präsidenten der drei anderen wichtigen Zentralbanken Mitglieder des »exklusivsten Clubs der Welt« gewesen, wie es die Zeitungen ausdrückten. Norman, Benjamin Strong von der New York Federal Reserve Bank, Hjalmar Schacht von der Reichsbank und Émile Moreau von der Banque de France hatten ein Quartett von Zentralbankiers gebildet, das die Aufgabe übernommen hatte, die globale Finanzmaschinerie nach dem ersten Weltkrieg wieder in Gang zu bringen.
Aber Mitte 1931 war Norman das einzig verbliebene Mitglied dieses Quartetts. Strong war 1928 im Alter von 55 Jahren gestorben, Moreau war 1930 in den Ruhestand getreten, Schacht war 1930 im Streit mit seiner eigenen Regierung zurückgetreten und sympathisierte nun mit Adolf Hitler und der Nazipartei. Daher war die Aufgabe, die Finanzwelt zu führen, diesem interessanten, aber rätselhaften Engländer zugefallen, diesem Mann mit dem »spitzbübischen« Lächeln, der theatralisch-geheimnisvollen Aura, dem Van Dyke-Bart und der Verschwörerbekleidung: breitkrempiger Hut, wallender Umhang und funkelnde Smaragd-Krawattennadel.
Für den wichtigsten Zentralbankier der Welt war es wirklich unglücklich, ausgerechnet dann einen Nervenzusammenbruch zu erleiden, als die Weltwirtschaft immer tiefer im zweiten Jahr einer unvorhergesehenen Depression versank. In fast allen Ländern war die Industrieproduktion zusammengebrochen. In den beiden am schwersten betroffenen Ländern – USA und Deutschland – war sie um 40 Prozent gesunken. Fabriken in allen Industrieländern – von den Autofabriken in Detroit über die Stahlwerke an der Ruhr und die Seidenmanufakturen in Lyon bis zu den Werften im Norden Englands – waren betroffen und arbeiteten mit Bruchteilen ihrer Kapazitäten. Wegen schrumpfender Nachfrage hatten die Unternehmen in den beiden Jahren, seit der Niedergang begonnen hatte, die Produktion um 25 Prozent gesenkt.
In den großen und kleinen Städten der Industrieländer gab es ganze Armeen von Arbeitslosen. In den USA, der größten Volkswirtschaft der Welt, waren etwa acht Millionen Männer und Frauen ohne Beschäftigung, was fast 15 Prozent der Erwerbstätigen entsprach. In Großbritannien und in Deutschland, die die weltweit zweit- und drittgrößten Volkswirtschaften waren, gab es weitere 2,5 beziehungsweise fünf Millionen Arbeitslose. Von den vier größten Wirtschaftsmächten schien nur Frankreich ein wenig geschützt vor dem Sturm, der um die ganze Welt fegte, aber auch Frankreich glitt nun langsam nach unten.
Banden arbeitsloser Jugendlicher und Männer, die nichts zu tun hatten, trieben sich ziellos an den Straßenecken, in den Parks, in Bars und Cafés herum. Als immer mehr Menschen ihre Arbeit verloren und sich keine vernünftige Wohnung mehr leisten konnten, entstanden in Städten wie New York und Chicago Slums mit Behausungen aus Kisten, Eisenschrott, Ölfässern, Leinendecken und Autowracks – sogar im Central Park gab es eine solche Siedlung. Ähnliche Slums gab es an den Stadträndern von Berlin, Hamburg und Dresden. In den USA flohen Millionen Obdachlose aus der Armut in den Städten und machten sich auf die Suche nach Arbeit – irgendeiner Arbeit.
Die Arbeitslosigkeit führte zu Gewalt und Unruhen. In den USA brachen in Arkansas, Oklahoma und in den Staaten im Zentrum und im Südwesten des Landes Unruhen aus, weil die Menschen nichts zu essen hatten. In Großbritannien streikten die Bergarbeiter, gefolgt von den Arbeitern in den Baumwollfabriken und den Webern. In Berlin herrschte beinahe Bürgerkrieg. Bei den Wahlen im September 1930 erreichten die Nazis, die mit den Ängsten und Frustrationen der Arbeitslosen spielten und allen anderen die Schuld gaben – den Alliierten, den Kommunisten, den Juden – fast 6,5 Millionen Stimmen und erhöhten die Zahl ihrer Sitze im Reichstag von 12 auf 107. Das machte sie zur zweitstärksten parlamentarischen Kraft nach den Sozialdemokraten. Gleichzeitig gab es jeden Tag Straßenkämpfe zwischen Banden der Nazis und der Kommunisten. In Portugal, Brasilien, Argentinien, Peru und Spanien kam es zu Staatsstreichen.
Die größte ökonomische Bedrohung stellte nun das kollabierende Bankensystem dar. Im Dezember 1930 ging die Bank of United States bankrott, die trotz ihres Namens eine Privatbank ohne offiziellen Status war. Es handelte sich um die größte Bankenpleite in der Geschichte der USA; Spareinlagen im Volumen von 200 Millionen Dollar blieben eingefroren. Im Mai 1931 schloss die Creditanstalt als größte Bank Österreichs mit Vermögenswerten von 250 Millionen Dollar ihre Türen. Da half es auch nichts, dass sie den Rothschilds gehörte. Am 20. Juni verkündete Präsident Herbert Hoover ein einjähriges Zahlungsmoratorium auf alle Verbindlichkeiten und Reparationen aus Kriegszeiten. Im Juli brach die Danatbank zusammen, die drittgrößte Bank Deutschlands, was einen Run auf das gesamte deutsche Bankensystem und eine Kapitalflucht aus Deutschland zur Folge hatte. Reichskanzler Heinrich Brüning verkündete einen Bankfeiertag, beschränkte die Summe, die deutsche Bürger von ihren Bankkonten abheben konnten und unterbrach die Zinszahlungen auf kurzfristige Verbindlichkeiten Deutschlands im Ausland. Im Lauf dieses Monats weitete sich die Krise auf die Londoner City aus, denn sie hatte Deutschland hohe Kredite gewährt, die nun eingefroren waren. Da sie nun plötzlich mit der zuvor undenkbar scheinenden Möglichkeit konfrontiert waren, dass Großbritannien selbst nicht mehr in der Lage sein könnte, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, zogen Anleger aus der ganzen Welt ihr Kapital aus London ab. Die Bank of England war gezwungen, sich von Banken in Frankreich und in den USA 650 Millionen Dollar zu leihen, darunter die Banque de France und die New York Federal Reserve Bank, um zu verhindern, dass ihre Goldreserven vollständig aufgebraucht wurden.
Man sprach schon vom Weltuntergang, weil die Schlangen der Arbeitslosen immer länger wurden, Banken ihre Türen schlossen, die Preise für Agrarprodukte zusammenbrachen und Fabriken ihre Produktion einstellten. Am 22. Juni sagte der bekannte Wirtschaftswissenschaftler John Maynard Keynes bei einem Vortrag in Chicago: »Wir befinden uns heute inmitten der größten Katastrophe – der größten Katastrophe, die fast ausschließlich ökonomische Ursachen hat – in der Geschichte der modernen Welt. Ich habe gehört, dass man in Moskau denkt, dies sei die letzte, die ultimative Krise des Kapitalismus, und dass unsere Gesellschaftsordnung diese Krise nicht überleben wird.« Der Historiker Arnold Toynbee, der viel über den Aufstieg und Niedergang von Zivilisationen wusste, schrieb in seinem jährlichen Rückblick auf die Ereignisse des Jahres für das Royal Institute of International Affairs: »1931 dachten Männer und Frauen auf der ganzen Welt ernsthaft darüber nach und diskutierten diese Möglichkeit auch ganz offen, dass das westliche Gesellschaftssystem zusammenbrechen und nicht mehr funktionieren könnte.«
Während des Sommers erschien in den Zeitungen ein Brief, den Mantagu Norman vor einigen Monaten an Clément Moret, seinen Kollegen bei der Banque de France, geschrieben hatte. »Wenn nicht dramatische Maßnahmen ergriffen werden, um es zu retten, wird das kapitalistische System innerhalb eines Jahres in der gesamten zivilisierten Welt zugrunde gehen«, erklärte Norman und fügte in dem bissigen Ton hinzu, den er mit Vorliebe gegenüber den Franzosen anschlug: »Ich sollte diese Voraussage archivieren, um später darauf verweisen zu können.« Es gab Gerüchte, dass er, bevor er aufbrach, um sich in Kanada zu erholen, darauf bestand, dass Bezugsscheinhefte gedruckt würden, für den Fall dass das Land als Folge eines allgemeinen Währungszusammenbruchs in Europa zum Tauschhandel zurückkehrte.
In Krisenzeiten glauben Zentralbanken allgemein, es sei klug, die Mahnung zu befolgen, die Mütter über die Jahrhunderte an ihre Kinder weitergegeben haben: »Wenn du nichts Nettes sagen kannst, dann sag lieber gar nichts.« So vermeidet man das immer wiederkehrende Dilemma, mit dem Finanziers konfrontiert sind, wenn sie es mit einer Panik zu tun haben: Sie können in ihren öffentlichen Verlautbarungen aufrichtig sein und damit die Angst noch weiter anheizen, oder sie können versuchen, die Menschen zu beruhigen, was in der Regel dazu führt, dass sie Lügen erzählen müssen. Dass ein Mann in Normans Position dazu bereit war, ganz offen über den Zusammenbruch der westlichen Zivilisation zu sprechen, war ein lautes und deutliches Signal, dass den führenden Köpfen der Finanzwelt angesichts des »ökonomischen Schneesturms« die Ideen ausgingen, und dass sie bereit waren, ihre Niederlage einzugestehen.
Norman war nicht nur der wichtigste Bankier der Welt, sondern er wurde auch von Finanziers und Offiziellen aller politischen Schattierungen als Mann von Charakter und Urteilskraft bewundert. Innerhalb dieser Bastion der Plutokratie – zum Beispiel das Bankhaus Morgan – gab es niemanden, dessen Rat mehr geschätzt wurde. Thomas Lamont, Seniorpartner der Firma, sollte Norman später als »den klügsten Mann, den er je getroffen hatte« preisen. Am anderen Ende des politischen Spektrums schrieb der britische Finanzminister Philip Snowden, ein glühender Sozialist, der selbst schon häufig den Zusammenbruch des Kapitalismus vorhergesagt hatte, in überschwänglichen Worten, Norman sei »dem Rahmen des hübschesten Höflings, der jemals den Hof einer Königin zierte, entstiegen«, sein »Mitgefühl mit dem Leiden von Nationen« sei »so zärtlich wie die Gefühle einer Frau für ihr Kind«, und er habe »in überreichem Maß die Qualität inspirierenden Vertrauens.«
Norman hatte seinen Ruf für ökonomischen und finanziellen Scharfsinn erworben, weil er in so vielen Dingen Recht behalten hatte. Seit dem Ende des Krieges war er strikt dagegen gewesen, von Deutschland Reparationen zu verlangen. In den 1920er-Jahren hatte er immer wieder Alarm geschlagen, dass der Welt die Goldreserven ausgingen. Und schon sehr früh hatte er vor den Gefahren einer Aktienmarktblase in den USA gewarnt.
Aber einige wenige Stimmen behaupteten dennoch, dass er und seine Politik, vor allem sein rigider, fast theologischer Glaube an die Vorteile des Goldstandards an der ökonomischen Katastrophe schuld waren, die die Länder der westlichen Welt überrollte. Eine von diesen Stimmen war die von John Maynard Keynes. Eine andere war die von Winston Churchill. Ein paar Tage, bevor Norman zu seinem erzwungenen Urlaub in Kanada aufbrach, schrieb Churchill, der den größten Teil seiner Ersparnisse beim Crash an der Wall Street zwei Jahre zuvor verloren hatte, an seinen Freund und früheren Sekretär Eddie Marsh: »Jeder, den ich treffe, scheint irgendwie beunruhigt, dass auf finanziellem Gebiet etwas Schreckliches geschehen könnte … Ich hoffe, dass wir Montagu Norman aufhängen werden, falls das passiert. Ich werde jedenfalls ganz bestimmt als Kronzeuge gegen ihn auftreten.«
Der Zusammenbruch der Weltwirtschaft von 1929 bis 1933 – heute mit Recht als die große Depression bekannt – war das entscheidende ökonomische Ereignis des 20. Jahrhunderts. Kein Land konnte seinen Folgen entkommen, mehr als ein Jahrzehnt lang wirkte es sich aus, vergiftete jeden Aspekt des sozialen und materiellen Lebens und schädigte die Zukunft einer ganzen Generation. Aus diesem Ereignis erwuchsen die Unruhen in Europa, im »ehrlosen Jahrzehnt« der 1930er-Jahre, der Aufstieg Hitlers und der Nationalsozialisten und schließlich das Abgleiten eines großen Teils der Welt in einen Zweiten Weltkrieg, der noch schrecklicher war als der Erste.
Die Geschichte des Abstiegs vom rauschenden Boom der Zwanzigerjahre in die große Depression kann man auf verschiedene Weise erzählen. In diesem Buch habe ich mich dazu entschlossen, sie zu schildern, indem ich den Männern über die Schulter schaue, die für die vier wichtigsten Zentralbanken der Welt verantwortlich waren: die Bank of England, die Federal Reserve, die Reichsbank und die Banque de France.
Als der Erste Weltkrieg 1918 endete, gehörte zu seinen zahllosen Opfern auch das Weltfinanzsystem. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte eine fortschrittliche internationale Kreditmaschine, die ihr Zentrum in London hatte, die Grundlagen des Goldstandards geschaffen und eine bemerkenswerte Ausweitung des Handels auf der ganzen Welt bewirkt. 1919 lag diese Maschine in Trümmern. Großbritannien, Frankreich und Deutschland waren beinahe bankrott, ihre Volkswirtschaften waren mit Schulden überlastet, die Bevölkerung war durch die steigenden Preise verarmt und ihre Währungen kollabierten. Nur die USA waren wirtschaftlich gestärkt aus dem Krieg hervorgegangen.
Die Regierungen dachten damals, dass man finanzielle Angelegenheiten am besten den Bankiers überlassen sollte. Daher fiel die Aufgabe, die Finanzen der Welt wieder in Ordnung zu bringen, den Zentralbanken der vier wichtigsten überlebenden Mächte zu: Großbritannien, Frankreich, Deutschland und USA.
Wir untersuchen in diesem Buch die Bemühungen dieser Zentralbankiers, das internationale Finanzsystem nach dem Ersten Weltkrieg zu rekonstruieren. Es beschreibt, wie es für einen kurzen Zeitraum Mitte der 1920er-Jahre den Anschein hatte, als sollten sie damit Erfolg haben: Die Währungen auf der ganzen Welt stabilisierten sich, Kapital begann wieder frei rund um den Globus zu fließen, und es gab wieder Wirtschaftswachstum. Aber unter der Oberfläche der Prosperität gab es schon erste Risse, und der Goldstandard, den alle für einen Schutzschirm der Stabilität gehalten hatten, erwies sich als Zwangsjacke. Die finanziellen Kapitel dieses Buches beschreiben die verzweifelten und letztlich vergeblichen Versuche der Zentralbankiers, zu verhindern, dass die gesamte Weltwirtschaft in die Abwärtsspirale der großen Depression geriet.
Die 1920er-Jahre waren eine Zeit, in der die Zentralbankiers, ähnlich wie heute, mit ungewöhnlicher Macht und außerordentlichem Prestige ausgestattet waren. Insbesondere vier Männer dominieren diese Geschichte: Bei der Bank of England war es der neurotische und geheimnisvolle Montagu Norman; bei der Banque de France war es der ausländerfeindliche und misstrauische Émile Moreau; bei der Reichsbank war es der strenge und arrogante, aber auch brillante und intelligente Hjalmar Schacht, und bei der Federal Reserve Bank of New York schließlich war es Benjamin Strong, dessen energisches und kraftvolles Auftreten verdeckte, dass es sich hier um einen tief verletzten und überforderten Mann handelte.
Diese vier Männer standen während des größten Teils des Jahrzehnts im Zentrum des Geschehens. Ihre Lebensläufe und ihre Karrieren gewähren einen tiefen Einblick in diesen Abschnitt der Wirtschaftsgeschichte. Er hilft dabei, die komplexe Geschichte der 1920er-Jahre in einem menschlicheren und leichter zu handhabenden Maßstab darzustellen – die ganze traurige und vergiftete Geschichte des gescheiterten Friedens, der Kriegsschulden, der Reparationszahlungen, der Hyperinflation, der Not in Europa und der Goldgräberstimmung in Amerika, vom Boom und dem folgenden Zusammenbruch.
Jeder von ihnen beleuchtet auf seine eigene Weise die damals vorherrschende Stimmungslage in seinem Land. Montagu Norman, der sich wie Don Quijote auf seine fehlerhafte Intuition verließ, verkörperte ein Großbritannien, das in der Vergangenheit verhaftet war und sich noch nicht mit seiner neuen, weniger bedeutenden Rolle in der Welt anfreunden konnte. Émile Moreau war in seiner Provinzialität und Verbitterung ein nur zu genaues Abbild Frankreichs, das sich nach innen gewandt hatte, um sich die schrecklichen Wunden des Krieges zu lecken. Benjamin Strong, der Mann der Tat, repräsentierte eine neue Generation in Amerika, die sich bemühte, im Weltgeschehen ihre finanziellen Muskeln spielen zu lassen. Nur Hjalmar Schacht in seiner zornigen Arroganz schien nicht im Einklang mit dem schwachen und besiegten Deutschland zu sein, für das er sprach, obwohl er möglicherweise auch nur eine verborgene Wahrheit über die eigentliche Stimmung in seinem Land zum Ausdruck brachte.
Es liegt etwas sehr Bewegendes in dem Kontrast zwischen der Macht, die diese vier Männer einmal ausgeübt haben und ihrem fast völligen Verschwinden aus der Geschichtsschreibung. Diese vier früher vertrauten Namen, von Zeitungen als »der exklusivste Club der Welt« bezeichnet, sind unter dem Schutthaufen der Zeit verschwunden und sagen den meisten Menschen gar nichts mehr.
Die 1920er-Jahre waren eine Zeit des Wandels. Vor dem einen Zeitalter war der Vorhang der Geschichte bereits gefallen, und das andere hatte noch nicht begonnen. Die Zentralbanken befanden sich immer noch in Privatbesitz; ihre wichtigsten Ziele waren die Werterhaltung der Währung und die Verhinderung von Bankpaniken. Sie waren gerade erst dabei, zu bemerken, dass sie für die Stabilisierung der Volkswirtschaft verantwortlich waren.
Im 19. Jahrhundert waren die Präsidenten der Bank of England und der Banque de France rätselhafte Gestalten; wohlbekannt in Finanzkreisen, aber ansonsten nicht im Blickfeld der Öffentlichkeit. In den 1920er-Jahren dagegen interessierte man sich sehr für sie – ganz ähnlich wie heute. Gerüchte über ihre Entscheidungen und geheimen Treffen füllten die Tageszeitungen, und sie hatten es oft mit den gleichen ökonomischen Themen und Problemen zu tun wie ihre Nachfolger von heute: dramatische Bewegungen am Aktienmarkt, volatile Währungen und große Mengen von Kapital, die von einem Finanzzentrum in ein anderes verlagert wurden.
Allerdings mussten sie auf altmodische Weise operieren, hatten nur primitive Werkzeuge und Informationsquellen zur Verfügung. Wirtschaftsstatistiken gab es erst seit sehr kurzer Zeit. Die Bankiers kommunizierten per Post – in einer Zeit, als es noch eine Woche dauerte, bis ein Brief aus New York in London ankam. In wirklich dringlichen Fällen wurde telegraphiert. Erst ganz am Ende des Dramas konnten sie via Telefon miteinander in Kontakt treten – und auch das nur mit Schwierigkeiten.
Auch die Geschwindigkeit des Lebens war anders als heute. Niemand flog von einer Stadt in eine andere. Es war das goldene Zeitalter der Ozeandampfer, als eine Atlantiküberquerung fünf Tage dauerte, als man mit einem persönlichen Diener reiste und man beim Dinner unbedingt ein Abendkleid tragen musste. Es war eine Ära, in der Benjamin Strong, Chef der New York Federal Reserve, monatelang nach Europa verschwinden konnte, ohne dass dies besonders viel Aufsehen erregt hätte. Er fuhr im Mai über den Atlantik, reiste dann zwischen den Hauptstädten Europas umher und besprach sich mit seinen Kollegen, legte von Zeit zu Zeit eine Pause in einem der eleganteren Seebäder und Erholungsorte ein, und im September kam er dann schließlich wieder zurück nach New York.
Die Welt, in der sie operierten, war sowohl kosmopolitisch als auch seltsam provinziell. Es war eine Gesellschaft, in der rassische und nationale Stereotypen eher als Tatsachen denn als Vorurteile galten; eine Welt, in der Jack Morgan, Sohn des mächtigen Pierport Morgan, seine Beteiligung an einem Kredit an Deutschland mit der Begründung ablehnen konnte, die Deutschen seien »Menschen zweiter Klasse«. Der Berufung von Juden und Katholiken ins Stiftungskomitee von Harvard widersprach er mit den Worten: »Der Jude ist immer zuerst ein Jude und erst an zweiter Stelle ein Amerikaner. Und ich fürchte, der Katholik ist nur allzu oft zuerst ein Papist und erst an zweiter Stelle ein Amerikaner«. Im späten 19. Jahrhundert gab es im Finanzwesen eine große Kluft – ob in London, New York, Berlin oder Paris. Auf der einen Seite standen die großen angelsächsischen Banken: J. P. Morgan, Brown Brothers, Barings. Auf der anderen Seite standen die jüdischen Konzerne: die vier Zweige der Rothschilds, die Lazards, die großen deutschen jüdischen Bankhäuser wie Warburg oder Kuhn Loeb und Einzelgänger wie Sir Ernest Cassel. Obwohl sich die weißen Angelsachsen wie so viele Menschen damals gelegentlich antisemitisch verhielten, behandelten beide Gruppen einander mit vorsichtigem Respekt. Allerdings waren sie alle miteinander Snobs, die auf Eindringlinge herabsahen. Es handelte sich um eine Gesellschaft, die eingebildet und selbstzufrieden sein konnte, der die Probleme von Armut und Arbeitslosigkeit gleichgültig waren. Nur in Deutschland – und das ist ein Teil dieser Geschichte – wurden diese unterschwelligen Vorurteile am Ende wirklich bösartig.
Als ich damit begann, über diese vier Zentralbankiers und die Rollen zu schreiben, die jeder einzelne dabei spielte, die Welt in die große Depression zu treiben, tauchte immer wieder eine weitere Figur auf, drängte sich fast in die Szenerie: John Maynard Keynes, der größte Wirtschaftswissenschaftler seiner Generation, obwohl er erst 36 Jahre alt war, als er 1919 erstmals auftauchte. In keinem Akt dieses Dramas, das auf so schmerzvolle Weise aufgeführt wurde, hielt er still und bestand auf mindestens einem Monolog, wenn auch außerhalb der Bühne. Im Gegensatz zu den anderen war er kein Entscheider. Er war in diesen Jahren nur ein unabhängiger Beobachter, ein Kommentator. Aber bei jeder Drehung und Wendung der Handlung hielt er von außen seinen unbestechlichen und spielerischen Verstand dagegen, seinen strahlenden und bohrenden Intellekt und vor allem seine bemerkenswerte Fähigkeit, Recht zu behalten.
In der nun folgenden Geschichte erwies sich Keynes als nützlicher Kontrapunkt zu den vier anderen. Sie alle waren große Herren des Finanzwesens, Bewahrer einer Orthodoxie, die sie gefangen zu halten schien. Im Gegensatz dazu war Keynes eine Nervensäge, Dozent in Cambridge, Selfmade-Millionär, Publizist, Journalist und Bestsellerautor, der aus dem lähmenden Konsens ausbrach, der in eine solche Katastrophe führen sollte. Er war zwar nur etwa zehn Jahre jünger als die vier Würdenträger, aber es sah so aus, als gehöre er einer völlig anderen Generation an.
Um die Rolle der Zentralbankiers während der großen Depression zu verstehen, muss man zunächst einmal wissen, was eine Zentralbank ist und wie sie funktioniert. Zentralbanken sind geheimnisvolle Institutionen; die ganzen Details ihrer inneren Funktionsweise sind so geheimnisumwoben, dass sie kaum ein Außenstehender versteht, nicht einmal Wirtschaftswissenschaftler. Wenn man die Dinge auf das Wesentliche reduziert, dann ist eine Zentralbank eine Bank, der man das Monopol auf die Herausgabe einer Währung eingeräumt hat.1 Diese Macht verleiht ihr die Fähigkeit, die Preise von Krediten zu regulieren – also die Zinsen – und so darüber zu entscheiden, wie viel Geld der Wirtschaft zur Verfügung steht.
Trotz ihrer Rolle als nationale Institutionen, die die Kreditpolitik ganzer Länder bestimmten, waren die meisten Zentralbanken 1914 immer noch in Privatbesitz. Sie besetzten somit eine seltsame Mischzone. In erster Linie waren ihre Direktoren für sie verantwortlich, die meist Bankiers waren. Sie zahlten Dividenden an ihre Aktionäre, hatten aber außerordentliche Macht in Bereichen, die in keiner Weise gewinnorientiert waren. Anders als heute, da die Zentralbanken per Gesetz dazu verpflichtet sind, Preisstabilität und Vollbeschäftigung anzustreben, bestand 1914 der wichtigste und alles andere dominierende Zweck dieser Institutionen darin, den Wert der Währung zu bewahren.
Damals unterlagen alle bedeutenden Währungen dem Goldstandard, der den Wert einer Währung auf eine bestimmte Menge Gold festlegte. Zum Beispiel war ein Pfund Sterling als Äquivalent zu 113 »Grains« Feingold definiert, wobei ein Grain dem Gewicht eines typischen Korns in der Mitte einer Weizenähre entsprach. Der Dollar war als 23,22 Grains Gold von ähnlichem Reinheitsgrad definiert. Da alle Währungen in Gold festgelegt waren, lagen natürlich auch alle Wechselkurse fest. Sie lagen also zum Beispiel bei 113 / 23,22 oder 4,86 Dollar je Pfund Sterling. Alle Arten von Papiergeld mussten legal und frei gegen Gold eintauschbar sein, und jede bedeutende Zentralbank war dazu bereit, Gold gegen jede beliebige Menge ihrer eigenen Währung zu tauschen.
Gold war schon seit Jahrtausenden als Währungsform verwendet worden. 1913 zirkulierten mehr als drei Milliarden Dollar in Form von Gold um die Welt, was ungefähr einem Viertel des gesamten Währungsumlaufs entsprach. Weitere 15 Prozent waren Silbermünzen, der Rest war Papiergeld. Goldmünzen waren allerdings nur ein Teil des Gesamtbildes – und nicht der wichtigste.
Der Großteil des monetären Goldes auf der Welt, fast zwei Drittel, befand sich nicht im Umlauf, sondern war in Barrenform tief unter der Erde in Banktresoren verborgen. Obwohl jede Bank eine gewisse Menge Barrengold hielt, lag in jedem Land der Großteil des nationalen Goldschatzes in den Gewölben der Zentralbank. Dieser verborgene Schatz lieferte die Reserven für das Banksystem, bestimmte die Geld- und Kreditversorgung innerhalb der Volkswirtschaft und diente als Verankerung für den Goldstandard.
Die Zentralbanken hatten zwar das Recht erhalten, Währungen herauszugeben – also im Prinzip Geld zu drucken, aber um sicherzustellen, dass dieses Privileg nicht missbraucht wurde, war jede von ihnen per Gesetz dazu verpflichtet, eine gewisse Menge Gold als Stützung ihres Papiergeldes zu halten. Diese Regeln waren von Land zu Land verschieden. Bei der Bank of England waren zwar die ersten 75 Millionen Pfund Papiergeld davon ausgenommen, aber jeder darüber hinausgehende Betrag erforderte eine vollständige Golddeckung. Die Federal Reserve (die Fed) war dagegen verpflichtet, 40 Prozent aller ausgegebenen Währung in Gold zur Verfügung zu halten – ohne jede Ausnahme. So verschieden diese Regulierungen auch waren, lag ihr Zweck letztlich doch darin, die Menge jeder einzelnen Währung automatisch und fast mechanisch an die Goldreserven der jeweiligen Zentralbank zu koppeln.
Um den Fluss der Währung in die Wirtschaft zu kontrollieren, variierten die Zentralbanken die Leitzinsen. Es war, als drehe man den Knopf an einem gewaltigen monetären Thermostat ein wenig nach oben oder nach unten. Wenn sich Gold in den Tresoren der Bank ansammelte, senkten sie die Kreditkosten, ermutigten Verbraucher und Unternehmen, sich zu verschulden und so mehr Geld in das System zu pumpen. War Gold dagegen rar, dann wurden die Zinsen angehoben, Konsumenten und Firmen nahmen weniger Kredite auf, und die umlaufende Währungsmenge reduzierte sich. Da der Wert einer Währung per Gesetz an ein bestimmte Menge Gold gebunden war, und weil die Währungsmenge, die emittiert werden konnte von der Menge der Goldreserven abhing, mussten die Regierungen innerhalb ihrer Möglichkeiten leben; wenn ihnen das Bargeld ausging, konnten sie den Wert der Währung nicht manipulieren. Daher blieb die Inflation niedrig. Der Beitritt zum Goldstandard wurde zu einem »Ehrenzeichen«; zu einem Signal, dass alle daran teilnehmenden Regierungen sich zu einer stabilen Währung und zu einer orthodoxen Finanzpolitik verpflichtet hatten. 1914 hatten 59 Länder ihre Währungen an das Gold gebunden.
Nur wenige Menschen bemerkten, wie fragil dieses System war, weil es auf einer derart schmalen Grundlage errichtet worden war. Die gesamte je in der ganzen Welt geförderte Goldmenge reichte kaum aus, ein bescheidenes zweistöckiges Stadthaus zu füllen. Neue Lieferungen waren weder stabil noch vorhersagbar, sie hingen von der Förderung ab und kamen nur rein zufällig in genügenden Mengen zustande, um den Bedarf der Weltwirtschaft zu decken. Wenn es kaum neue Goldfunde gab, zum Beispiel zwischen den Goldrausch-Phasen in Kalifornien und Australien während der 1850er-Jahre und den Entdeckungen in Südafrika in den 1890er-Jahren, sanken daher auf der ganzen Welt die Rohstoffpreise.
Natürlich gab es auch Kritiker des Goldstandards. Manche waren einfach Spinner, andere glaubten jedoch, dass vor allem in Phasen sinkender Preise die Interessen von Produzenten und Schuldnern geschädigt wurden. Vor allem galt dies für die Landwirte, die ja beiden Gruppen angehörten.
Der bekannteste Befürworter einer lockereren Geldpolitik und leichterer Kreditvergabe war Williams Jennings Bryan, der populistische Kongressabgeordnete aus dem Farmerstaat Nebraska. Er kämpfte unermüdlich, um den privilegierten Status des Goldes zu durchbrechen und für eine Ausweitung der Kreditbasis durch die Aufnahme von Silber als Reservemetall. 1896 hielt er auf dem Parteitag der Demokraten eine der großen Reden der amerikanischen Geschichte – reich an glänzender Rhetorik und mit tiefer, herrischer Stimme vorgetragen. An die Bankiers aus dem Osten gewandt sagte er: »Sie sind hergekommen, um uns zu sagen, dass die großen Städte für den Goldstandard sind. Wir antworten Ihnen, dass die großen Städte auf unseren weiten und fruchtbaren Ebenen liegen. Brennt eure Städte nieder und verlasst unsere Farmen, dann werden eure Städte wie durch Zauberhand wieder entstehen. Aber wenn ihr unsere Farmen zerstört, wird das Gras in der Stadt wachsen … Ihr werdet den Arbeitern diese Dornenkrone nicht aufdrücken. Ihr werdet die Menschheit nicht an einem Kreuz aus Gold kreuzigen.«
Das war eine Botschaft, deren Zeit gekommen und schon wieder vergangen war. Zehn Jahre vor dieser Rede hatten zwei Goldprospektoren in Südafrika bei einem Sonntagsspaziergang auf einer Farm in Witwatersrand eine Felsformation entdeckt, die sie als Goldader identifizierten. Sie erwies sich als Teil einer der weltweit größten Goldlagerstätten. Zum Zeitpunkt von Bryans Rede war die Goldproduktion um 50 Prozent gestiegen, Südafrika hatte die USA als weltweit größten Goldförderer überholt, und der Mangel an Gold war vorbei. Die Preise aller Güter, auch die der landwirtschaftlichen Rohstoffe, begannen wieder zu steigen. Bryan wurde zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten bestimmt – 1900 und 1908 noch zwei weitere Male –, aber er wurde nie zum Präsidenten der USA gewählt.
Obwohl die Preise während des Goldstandards in großen Zyklen und in Abhängigkeit von der verfügbaren Goldmenge stiegen und fielen, war die Neigung dieser Kurven flach, und letztlich fielen die Preise wieder auf ihren Ausgangspunkt zurück. Der Goldstandard funktionierte zwar bei der Kontrolle der Inflation, war aber nicht in der Lage, die Arten von finanziellem Aufstieg und Niedergang zu verhindern, die die ökonomische Landschaft von nun an so stark kennzeichnen sollten. Diese Blasen und Krisen scheinen tief in der menschlichen Natur verwurzelt zu sein und nicht vom kapitalistischen System getrennt werden zu können. Nach einer bekannten Zählung gab es seit dem frühen 17. Jahrhundert 60 verschiedene Krisen. Die erste dokumentierte Bankpanik kann man allerdings auf das Jahr 33 n. Chr. datieren, als Kaiser Tiberius eine Million Goldstücke aus öffentlichen Mitteln in das römische Finanzsystem pumpen musste, um es vor dem Zusammenbruch zu bewahren.
Alle diese Episoden wiesen Unterschiede im Detail auf. Manche hatten ihren Ursprung am Aktienmarkt, andere am Kreditmarkt, manche an den Devisenmärkten und einige sogar in der Welt der Rohstoffe. Manchmal betrafen sie nur ein einziges Land, schränkten seine Kreditvergabe ein, und verschreckte Bankkunden räumten ihre Konten leer.
Wäre in diesen sogenannten Krisenzeiten nichts anderes passiert, als dass verblendete Anleger und Gläubiger ihr Geld verloren hätten, dann hätte das niemanden sonst interessiert. Aber ein Problem in der einen Bank löste Ängste vor Problemen bei anderen Banken aus. Und weil die Finanzinstitutionen so eng miteinander verflochten waren und einander hohe Summen liehen, konnten sich auch schon im 19. Jahrhundert Probleme auf einem Gebiet auf das gesamte System auswirken. Eben deshalb, weil sich Krisen ausbreiteten und die Integrität des ganzen Systems bedrohten, kamen die Zentralbanken ins Spiel. Sie waren nicht mehr nur die Hüter des Goldstandards, sondern nahmen noch eine zweite Rolle ein: die Verhinderung von Bankpaniken und anderen Finanzkrisen.
Die Zentralbanken besaßen mächtige Instrumente, um mit solchen Ausbrüchen fertig zu werden; vor allem ihre Ermächtigung, Geld zu drucken und ihre Fähigkeit, ihre großen, konzentrierten Goldbestände zu überwachen. Aber trotz dieses Arsenals an Instrumenten war das Ziel einer Zentralbank in einer Finanzkrise sehr einfach und doch nur schwer zu erreichen: die Wiederherstellung des Vertrauens in die Banken.
Solche Zusammenbrüche sind keine historische Kuriosität. Jetzt, da ich dies hier im Oktober 2008 schreibe, befindet sich die Welt mitten in einer solchen Panik – der schwersten seit 75 Jahren, seit dem Ansturm auf die Banken von 1931 bis 1933, die in den letzten Kapiteln dieses Buchs so prominent behandelt werden. Die Kreditmärkte sind eingefroren, die Finanzinstitutionen horten Bargeld, jede Woche gehen Banken unter oder werden übernommen, und die Aktienmärkte brechen ein. Nichts macht die Zerbrechlichkeit des Bankensystems oder die Macht einer Finanzkrise deutlicher, als wenn man quasi aus dem Auge des Sturms heraus über diese Themen schreibt. Wenn man beobachtet, wie die Zentralbanker dieser Welt und Finanzbevollmächtigte mit der aktuellen Situation ringen – indem sie eines nach dem anderen versuchen, um das Vertrauen wiederherzustellen, das Problem mit allen Mitteln bekämpfen, jeden Tag mit dem Unerwarteten und mit erstaunlichen Verschiebungen der Stimmung im Markt zu tun haben –, dann verstärkt dies den Eindruck, dass es beim Umgang mit Finanzpaniken keine magische Kugel und keine einfache Formel gibt. Um ängstliche Anleger zu beruhigen und nervöse Märkte zu beschwichtigen, müssen Zentralbanker mit den elementarsten und am wenigsten vorhersehbaren Elementen der Massenpsychologie kämpfen. Es ist die Geschicklichkeit bei der Navigation durch diese Stürme in unbekannten Gewässern, die ihre Reputation schließlich schafft oder zerbrechen lässt.
Teil I:
Der unerwartete Sturm August 1914
1. Prolog
Was für eine außergewöhnliche Episode im ökonomischen Fortschritt war dieses Zeitalter, das im August 1914 zu Ende ging.
John Maynard Keynes, Krieg und Frieden: Die wirtschaftlichen Folgen des Vertrags von Versailles
1914 lag London im Zentrum eines ausgefeilten internationalen Kreditnetzwerks, das auf dem Goldstandard basierte. Das System hatte zu einer bemerkenswerten Ausweitung des Handels und des Wohlstands auf der ganzen Welt geführt. In den 40 Jahren zuvor hatte es keine großen Kriege oder bedeutenden Revolutionen gegeben. Die technologischen Fortschritte Mitte des 19. Jahrhunderts Eisenbahnen, Dampfschiffe und der Telegraf hatten sich über die Welt verbreitet und weite Territorien der Besiedlung und dem Handel geöffnet. Der internationale Handel boomte, weil europäisches Kapital frei rund um den Globus strömte. Es finanzierte Häfen in Indien, Kautschukplantagen in Malaya, Baumwolle in Ägypten, Fabriken in Russland, Weizenfelder in Kanada, Gold- und Diamantenminen in Südafrika, Rinderfarmen in Argentinien, die Eisenbahnverbindung von Berlin nach Bagdad, den Suez- und den Panamakanal. Obwohl das System so oft von Finanzkrisen und Bankpaniken erschüttert wurde, ging das Handelsvolumen stets nur kurzfristig zurück, und die Weltwirtschaft erholte sich stets wieder.
Mehr als alles andere, mehr sogar als der Glaube an den freien Handel, war der Goldstandard der Totempfahl dieser Ära. Gold war das Lebensblut des Finanzsystems. Es war der Anker der meisten Währungen, es lieferte die Grundlage für die Banken, und in Zeiten von Krieg oder Panik diente es als sicherer Hafen. Für die wachsende Mittelklasse in der Welt, die einen so großen Teil der Ersparnisse beisteuerte, war der Goldstandard mehr als nur ein geniales System zur Regulierung der Währungsemission. Er verstärkte alle viktorianischen Tugenden von Sparsamkeit und Vorsicht bei den öffentlichen Angelegenheiten. Er hatte, um es mit den Worten von H. G. Wells zu sagen, »eine wunderbar dumme Ehrlichkeit« an sich. Unter Bankiers, ob in London, New York, Paris oder Berlin, wurde er mit fast religiöser Inbrunst verehrt, als Geschenk der Vorhersehung, als Verhaltenscode, der über Ort und Zeit hinaus Gültigkeit hatte.
1909 veröffentlichte der britische Journalist Norman Angell, damals als Herausgeber der französischen Ausgabe der Daily Mail in Paris ansässig, eine Broschüre mit dem Titel »Europas optische Illusion«. Die These dieses dünnen Bändchens lautete, die ökonomischen Vorteile eines Krieges seien so illusorisch daher der Titel und die kommerziellen Verbindungen zwischen den Ländern seien nun so ausgeprägt, dass kein vernünftiges Land daran denken würde, einen Krieg zu beginnen. Das wirtschaftliche Chaos, vor allem die Störungen des internationalen Kreditwesens, die die Folgen eines Krieges zwischen den Großmächten wären, würden allen Seiten schaden, und der Sieger würde ebenso viel verlieren wie der Besiegte. Selbst wenn durch Zufall ein Krieg in Europa ausbrechen sollte, würde er bald beendet werden.
Angell saß am richtigen Ort, um über internationale gegenseitige Abhängigkeiten zu schreiben. Sein Leben lang war er so etwas wie ein Nomade. Als Sohn einer Familie aus der Mittelschicht in Lincolnshire war er schon in jungen Jahren an ein französisches Gymnasium in St. Omer geschickt worden. Mit 17 Jahren wurde er Herausgeber einer englischsprachigen Zeitung in Genf, besuchte dort die Universität und wanderte dann aus Verzweiflung über die Zukunft Europas in die USA aus. Obwohl er nur knapp über 1,50 m groß und von zierlichem Körperbau war, stürzte er sich in ein Leben voll körperlicher Arbeit. Sieben Jahre lang arbeitete als Weinpflanzer, Kanalarbeiter, Kuhhirt, Briefträger und Prospektor, ehe er sich schließlich als Reporter für den und den niederließ. 1898 kehrte er nach Europa zurück und zog nach Paris, wo er sich der anschloss.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























