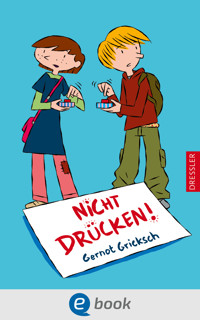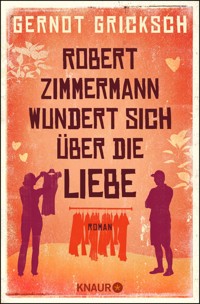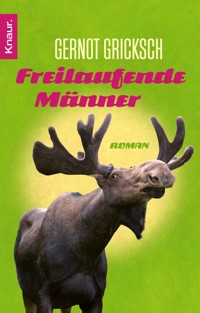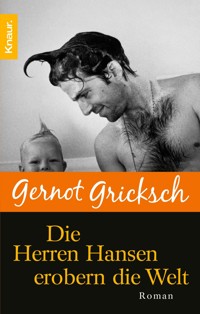
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Herren Hansen erobern nicht nur die Welt, sondern auch die Herzen aller Frauen – denn Sebastian (34) und sein Sohn Paul (gerade mal zwei) sind nicht nur die besten Freunde, sondern auch das tollste Traumteam, seit es Väter und Söhne gibt. Gemeinsam stellen sich die beiden den Abenteuern des täglichen Lebens mit Charme, Verstand und jeder Menge Humor!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Gernot Gricksch
Die Herren Hansen erobern die Welt
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für meine Eltern – zwei großartige Menschen.
»Männer – nur auf der Autobahn weichen sie nicht aus«
Klograffiti in einer Hamburger Kneipe
1.
Als meine Exfrau mir heute am Telefon erzählte, sie habe unseren Sohn Paul beim Klavierunterricht angemeldet, habe ich erst einmal herzhaft gelacht. Nicht, daß ich es an sich komisch finde, wenn man der Frucht seiner Lenden eine musikalische Ausbildung zukommen lassen möchte – aber Paul ist gerade mal zweieinhalb Jahre alt, und die größte Herausforderung, die mein Kind in einem Klavier entdecken könnte, bestünde zweifelsohne darin, mit seinem Spielzeugschraubenzieher eine Taste nach der anderen aus der Verankerung zu hebeln.
Miriam, so heißt meine Ex, konnte allerdings nicht mitlachen. Der Klavierlehrer ihrer Wahl, erklärte sie mir, sei ein Meister seines Fachs und daher entsprechend begehrt. Wer seine kostbare Zeit beanspruchen wolle, müsse den Unterricht daher mindestens drei Jahre im voraus buchen.
»Du hast keine Visionen für unser Kind«, fuhr Miriam mich an. »Dir würde es überhaupt nichts ausmachen, wenn er Buchhalter wird oder sogar Klempner!« Dann legte sie auf – allerdings nicht, ohne mich vorher noch darauf hinzuweisen, daß ich 300 Mark als Reservierungsbestätigung an den Tastenvirtuosen überweisen müsse.
»Du solltest dir das wirklich nicht bieten lassen«, pflegt meine Schwester Anita zu sagen, wenn ich ihr von Vorkommnissen wie diesem erzähle. Und ich weiß, daß sie eigentlich recht hat. Aber was Anita einfach nicht verstehen kann, ist, daß die Frau, die mir mein Kind geschenkt hat, bei mir etwas guthat.
Wenn Anita also sagt, ich solle »dieses Miststück« mitsamt ihren Zicken auf den Mond schießen – was für Miriam eine doppelte Strafe wäre, da sie unter extremer Höhenangst leidet und außerdem auf einem fremden Planeten niemanden hätte, dem sie auf die Nerven gehen könnte – dann denke ich immer nur an die zwölf Stunden im Kreißsaal.
Miriam war eine Erstliga-Gebärende. Soll heißen: Sie hat nicht einfach dagelegen, aufgepumpt wie ein detonationsbereiter Basketball, starr vor Entsetzen ob der Dinge, die da kommen sollten. Nein, Miriam fand zwischen zwei Preßwehen noch Zeit, Juniors Herzwerte am Monitor zu checken und mich darüber zu informieren, daß ich, wenn es denn unbedingt sein müßte, noch schnell pinkeln gehen sollte, da alle Anzeichen darauf hindeuteten, daß der ganz große Zirkus unmittelbar bevorstünde.
Nun sind Männer ja dafür bekannt, daß sie bemerkenswert weitflächige Teile des weiblichen Körpers einzig in »da unten« und »da drin« aufteilen. Aber selbst wenn ich bei den pflichtschuldigst besuchten Geburtsvorbereitungskursen besser aufgepaßt hätte, statt mich in krude Gedankengänge darüber zu verlieren, wie die Kursteilnehmer Mark und Elisabeth wohl je in der Lage sein sollten, ein Kind großzuziehen, wo sie doch selbst nur über die mentalen und sozialen Fähigkeiten eines minderbemittelten Pavianpärchens verfügen, selbst wenn ich also genau gewußt hätte, welche Konsistenz der Muttermund hat und ob ein Baby sich seinen Weg in die wirkliche Welt robbend, flutschend oder zuckend bahnt – nichts hätte mich wirklich auf das Wunder der Geburt vorbereiten können. Das größte Wunder, davon bin ich fest überzeugt, besteht nämlich darin, daß nicht stets zwei Hebammen anwesend sind: eine, die das neue Leben in Empfang nimmt, und eine, die den kollabierten Vater vom Linoleumfußboden kratzt.
Stellen Sie sich einen Mann vor, der hilflos durch ein Krankenhauszimmer zappelt, in der das Geschrei seiner (damals noch geliebten) Frau gerade derartige Phonwerte erreicht, daß Motörhead wie eine Kuschelrock-Combo wirkt. Und stellen Sie sich das Gesicht dieses Mannes vor, wenn die Hebamme ihm mit einem freundlichen Lächeln mitteilt, daß jetzt die Austreibungsphase beginne. Die Austreibungsphase! Mein Gott, wir brauchen einen Exorzisten! Jeden Moment rechnete ich damit, daß Max von Sydow mit Weihwasser und Kruzifix bewaffnet den Kreißsaal betreten würde, während Miriam literweise Erbsensuppe erbricht, Sauereien pöbelt und mit verzerrter Grimasse Gott lästert.
Kein Mann – jedenfalls keiner, mit dem ich in näherem Kontakt stehen möchte – kann eine Frau verfluchen, die so etwas durchmachen mußte und dann, nach getaner Geburtsarbeit, das Baby auf der Brust, ganz milde lächelt und sagt: »Scheiße. Er hat deine Gummelnase geerbt.«
So ist das also mit Miriam und mir: Ich liebe sie nicht mehr und sie mich schon gar nicht. Aber ich zolle ihr jenen Respekt, der allen Menschen zustehen sollte, die mutigen Schrittes durch den Vorhof der Hölle marschiert sind. Zumal sie am Ende dieser Hölle meinen Sohn Paul in Empfang nahm – ein süßes, kleines Kerlchen, das gerade in diesem Moment eine offene Tetrapackung Apfelsaft auf meinen hellen Berberteppich schleudert …
Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.
2.
Ich heiße übrigens Sebastian. Sebastian Hansen, wenn man auf Nachnamen wert legt. Ich bin 34 Jahre alt, selbständiger Werbetexter, gelegentlicher Feinschmecker, Anhänger irischen Folkrocks, Kinofreak, leidenschaftlicher Videogame-Spieler, Kunstbanause, Sportmuffel und Verfechter der Theorie, daß neunzig Prozent aller Menschen an sich gut sind und die restlichen zehn Prozent die Welt regieren. Hauptberuflich aber bin ich alleinerziehender Vater: Ich bin eine echte Koryphäe in Sachen Feuchttücher, Reformhaus-Gummibärchen und Duplo-Plastikbausteine. Aber fragen Sie mich bloß nicht, wie ich das neue Stück von Franz Xaver Kroetz finde. Ich habe zu Hause schon Theater genug.
Miriam, Pauls Mutter, lebt achtzehn U-Bahn-Stationen entfernt. Sie hat wieder geheiratet und heißt jetzt mit Nachnamen Frühstück. Kein Witz! Der Mann, in den sie sich vor gut einem Jahr verliebt hat, heißt Matthias Frühstück, ist Immobilienmakler, sieht blendend aus, hat ein riesiges Haus im Hamburger Nobelviertel Volksdorf, in dessen Keller man problemlos ein halbes Dutzend Nuklearraketen verstecken könnte, und fährt einen BMW. Miriam hat sich also in nahezu jedem Punkt verbessert – außer beim Nachnamen. Und das erfüllt mich zugegebenermaßen mit tiefer Befriedigung. Ich meine, jeder, der Miriam kennenlernt, denkt jetzt: »Wow! Die Klunker an ihrem Hals sind ganz sicher kein Modeschmuck, und schau dir mal ihren scharfen Typ in der Luxuskarosse an – aber Frühstück möchte ich wirklich nicht heißen!« Da war Hansen eindeutig besser.
Paul lebt bei mir. Frau Frühstück und ich teilen uns zwar das Sorgerecht, aber der feste Wohnsitz unserer kleinen Coproduktion befindet sich in meiner Wohnung. Was ziemlich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, daß Miriam für diese Entscheidung zwar keine der angeblich naturgegebenen Mutterinstinkte (die sie, soweit ich das sagen kann, nicht hat), dafür aber ein besonders stark ausgeprägtes und nicht nur im Hinblick auf unser Kind tief verwurzeltes Besitzdenken bekämpfen mußte. Allerdings sollte ich dazu noch anmerken, daß sie das Kind eigentlich auch nie wollte. Paul ist ein GG-Produkt – das Ergebnis eines geplatzten Gummis. Und es war einer der ganz seltenen Fälle in unserer fünfjährigen Beziehung, bei denen ich mich gegen Miriam durchsetzen konnte, als sie einen Abtreibungstermin mit der Klinik vereinbaren wollte und ich mich mit dem Telefon in der Gästetoilette einschließen mußte. Ich habe es da drinnen ziemlich lange ausgehalten.
Am Ende redeten wir uns irgendwie ein, daß ein Kind unsere Ehe womöglich retten könnte. Dämlich, was? Ich meine, wir sind uns damals selbst dann schon auf die Nerven gegangen, wenn wir uns mal wieder nicht einigen konnten, ob man Spaghetti auf tiefen oder flachen Tellern serviert – wie konnten wir da ernsthaft annehmen, unsere Beziehung würde sich entspannen, wenn wir uns zu alledem noch ein kleines, schreiendes, spuckendes Etwas ins Haus holen?
Miriam ist nicht gerade eine überzeugende Mutter, und das sage ich wirklich nicht nur, weil ich ein frustrierter, gehörnter, in seinem Selbstbewußtsein bis ins Mark getroffener Exehemann bin. Ich meine einfach, daß man sich in ein Kind hineinversetzen können muß, wenn man es großziehen will. Aber dazu muß man selbst einmal ein Kind gewesen sein – und Miriam ist schon als ausgewachsene Klugscheißerin und humorloses, berechnendes Biest zur Welt gekommen.
Sagen wir’s so: Ich bilde mir durchaus ein, zu den phantasiebegabten Menschen zu gehören; ich kann mir zum Beispiel problemlos vorstellen, wie der Papst auf Inlineskates in eine Schwulenpinte rollt, und meinetwegen auch, wie ein Meerschweinchen an der Mailänder Scala mit einer Arie aus Don Giovanni Triumphe feiert. Aber Miriam als knuddeliges, kleines Kind? Tut mir leid, das kriege ich beim besten Willen nicht gebacken.
Daß unsere Ehe nicht funktionierte, war also eigentlich logisch. Man sagt zwar, daß sich Gegensätze anziehen, und bis zu einem gewissen Punkt ist das vermutlich sogar richtig. Aber ebensowenig wie man in einem Zoo die geschmeidigen, scharfzähnigen Tiger mit den arglosen Hoppelhäschen in einen Käfig sperrt, sollte man eine Frau, die von sinistrer Raffinesse durchdrungen ist und nur unter Androhung von Waffengewalt lachen würde, mit einem Mann zusammenleben lassen, der mit simuliertem Bauchschmerz Cocktailparties schwänzt und, sobald die Gattin die Wohnung verlassen hat, glückselig sein Super Mario-Spiel anschmeißt.
Sie fragen sich jetzt vermutlich, warum ich Miriam überhaupt geheiratet habe. Die Antwort ist ebenso einfach wie wirklich peinlich: Miriam ist bildschön, gnadenlos gut im Bett und kann sehr lebensecht so etwas wie Charme simulieren. Männer geben sich damit erstaunlich lange zufrieden. Wir können einfach nichts gegen unsere Triebe tun: Wenn wir nicht mögen, was wir hören, konzentrieren wir uns eben auf das, was wir sehen. Stellen Sie sich die humorvollste, intelligenteste, einfühlsamste Frau der Welt in einem unattraktiven Körper vor – wir Vollidioten bemerken sie frühestens, wenn wir bei all den scharfen, dummen Hühnern drumherum abgeblitzt sind.
Ja, mir ist das auch peinlich.
3.
In letzter Zeit fragt mich meine Schwester Anita immer öfter, ob ich denn nicht auch fände, daß Paul eine neue Mutter braucht. Nicht so eine Teilzeit-Xanthippe wie Miriam, die gelegentlich auftaucht wie ein Geier im Sturzflug, sich das kleine Würmchen schnappt, es ein paar Stunden lang ganz furchtbar nervös macht und den verdatterten Knirps dann eiligst wieder abliefert, weil sie noch auf die Vernissage irgendeines Avantgarde-Künstlers aus Usbekistan muß. Nein, Anita meint eine Zweitbesetzung, die den ehemaligen Star locker an die Wand spielt: eine Frau, die bei uns einzieht und Paulchen ein steter Fels in der Brandung des Lebens ist. Das wäre es, was Paul braucht, sagt Anita.
Wenn ich ganz ehrlich bin: Nein, finde ich nicht. Mein Sohn und ich sind ein ziemlich gut eingespieltes Team, und ich habe wirklich nicht den Eindruck, daß Paul irgend etwas fehlt. Anita fragt dagegen nie, ob nicht womöglich mir etwas fehlt. Und wenn ich noch mal ganz ehrlich sein darf: Ja, tut es!
Ich meine, wenn man den ganzen Tag mit ebenso kindischen wie unerotischen Sachen wie Werbetexten, Brio-Eisenbahnen und den lustigen Taschenbuch-Abenteuern von Bobo Siebenschläfer beschäftigt ist, sehnt man sich irgendwann dann doch nach Unterhaltung für Erwachsene, wenn Sie verstehen, was ich meine. Es ist einfach unfair, daß selbst Miriam, die eigentlich nicht mehr Wärme braucht als ein Nogger, regelmäßig Frühstück im Bett hat und ich unter meiner Decke höchstens mal Pauls Stoffteddy vorfinde.
Nun bin ich bedauerlicherweise kein Mann für eine Nacht (womit mein hormonelles Problem ja schnell gelöst wäre), sondern von etwas komplexerer Wesensart. Kompliziert, sagt Anita. Bescheuert, findet Frau Frühstück. Dabei bin ich einfach nur ein furchtbar harmonieduseliges Kerlchen, für den eine ganze wild durchvögelte Nacht völlig umsonst ist, wenn die dazugehörige Frau mich am nächsten Morgen nicht anlächelt. Das ist um so komplizierter, da ja das erste geschlechtliche Zusammentreffen zweier Individuen üblicherweise nicht der ganz große Knaller ist. Schließlich weiß man ja nie, was der andere am liebsten mag; womöglich ginge ich die ganze Sache besonders zart und langsam an, während die Dame meiner Wahl sich nur mühsam ein Gähnen verkneifen und wehmütig an die Handschellen und die Lederpeitsche denken würde, die sie zu Hause im Wandschrank hängen hat.
Als Kinofan würde ich es mal so formulieren: Der erste Sex sollte nach meinem Geschmack kein Kurzfilm sein, sondern ein Vorfilm. Ob der Hauptfilm dann eine nette Freundschaft, eine leidenschaftliche, hingebungsvolle Liebe bis ans Lebensende oder eben nur ein gelegentliches, entspanntes Herumgebumse ohne jedwede Verpflichtung wird, klärt sich dann schon. Und wenn es tatsächlich ein unüberwindbares Kompatibilitätsproblem gibt und am Ende dieser Nacht ein Abschied für immer steht, dann sollte doch bitte schön ich derjenige sein, der das entscheidet. Ehrlich: Ich würde das ganz diplomatisch und freundlich formulieren – schließlich weiß ich, wie es ist, wenn jemand einem auf dem Selbstbewußtsein herumtrampelt.
Eine Frau, die jetzt in mein Leben tritt, hätte einen verdammt schweren Job. Ich schleppe schließlich nicht nur meine Frau-Frühstück-Neurose mit mir herum, sondern habe auch noch dezidierte Vorstellungen über den eventuellen Lauf der Dinge, bin eine ausgesprochene Mimose und außerdem enorm verwöhnt. Von Paul nämlich.
Mit der bedingungslosen Zuneigung, die ein Kind verteilt, können Erwachsene nur schwer konkurrieren. Neulich hat Paul mir zum Beispiel das letzte Stück seiner Kinderschokolade geschenkt. Das letzte! Falls Sie keine Kinder haben, erkläre ich Ihnen, was das bedeutet: Es ist der glühendste, leidenschaftlichste Beweis einer selbstlosen Liebe, den ein Mensch einem anderen überhaupt nur entgegenbringen kann! Da kann eine ganz normale Frau in der Regel leider nicht mithalten, ob mir das nun paßt oder nicht.
4.
Schon seit einer Viertelstunde stehe ich vor dem Spiegel und versuche meine Frisur in den Griff zu kriegen. Meine Haare weisen heute mal wieder eine frappante Ähnlichkeit mit der ehemaligen Sowjetunion auf: Überall spalten sich Teile ab, streben in verschiedene Richtungen und machen dort, was sie wollen.
Normalerweise ist mir das Tohuwabohu auf meinem Kopf egal. Wenn ich tatsächlich mal einen Termin außer Haus habe, konzentriere ich mich nur auf die wesentlichen Aspekte meiner äußeren Erscheinung: Ich rubble die Fruchtzwergflecken von meiner Jeans und rasiere mich. Manchmal. Wenn man als »Kreativer« in der Werbung arbeitet, bekommt man nämlich so eine Art Freibrief in Sachen Unästhetik: Man gilt (aus mir unerklärlichen) Gründen als Beinahekünstler und darf deshalb auch beinahe aussehen wie ein Penner. Mir soll’s recht sein.
Heute habe ich allerdings einen Außentermin in eigener Sache, und einen wichtigen noch dazu: Ich bin verabredet.
Mit einer Frau!
Sie heißt Andrea und arbeitet als Assistant Art Consultant für eine Agentur, die mich gelegentlich beschäftigt. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, was ein Assistant Art Consultant ist; in der Werbebranche hat jeder eine dieser kruden Berufsbezeichnungen und ist irgendein Vice, ein Director oder ein Consultant. Hört sich alles wahnsinnig schick an, muß aber nicht wirklich etwas zu sagen haben: Büroboten heißen, glaube ich, Delivery Executives.
Andrea ist, soweit ich das beurteilen kann, Graphikerin: Sie sitzt vor einem Computer und fummelt an Bildern herum, was an sich ja nicht unbedingt falsch, aber auch nicht wirklich weltbewegend wäre. Aber: Andrea ist auch eine ausgesprochen attraktive Frau, ein kleiner, energiegeladener Feger mit einer leichten, überaus aparten Tendenz zum Pummeligen und wunderschönen großen braunen Augen, die einen hinreißenden Kontrast zu ihrem strohblonden Haar bilden. Andrea lacht viel – aber, was ich besonders liebenswert finde, niemals über ihre eigenen und dabei meistens doch wirklich witzigen Bemerkungen. Anita, die Andrea nicht kennt, würde sagen, sie ist patent. Das heißt, man traut ihr auf den ersten Blick zu, daß sie neben all den Durchschnittsdingen, zu denen Frauen so fähig sind, auch Regale andübeln und eine perfekt abgeschmeckte Teriyaki-Sauce zusammenrühren kann und im Gegensatz zu mir wohl auch weiß, welchen Wasserhahn man im Falle eines Rohrbruchs als erstes zudrehen muß.
Ich habe eine ganze Weile mit mir kämpfen müssen, bis ich Andrea endlich fragte, ob sie mit mir essen geht. Nicht, daß ich schüchtern wäre, aber momentan würde jeder Korb, den ich kassiere, so schwer auf mir lasten wie ein Frachtcontainer. Es gab allerdings schon deutliche Anzeichen dafür, daß ich nicht abblitzen würde – sie hat mich in den letzten Wochen mächtig angeflirtet.
Normalerweise bin ich der letzte, der es bemerkt, wenn eine Frau an mir Interesse hat. Ich nehme alle netten Gesten gemeinhin als rein asexuelle, zwischenmenschliche Aufmerksamkeiten. Deshalb habe ich auch den Witz bei Harry und Sally nie so richtig verstanden. Stellen Sie mich an die Wand, und spucken Sie mich tot: Ich glaube wirklich, daß Männer und Frauen Freunde sein können, ohne jemals Hand an den Intimbereich des anderen zu legen!
Bei Andrea waren die Anzeichen aber nun wirklich ziemlich offensichtlich, selbst für einen Döskopp wie mich. Ich meine, wie viele rein geschäftsmäßige Graphikerinnen tätscheln einem schließlich die Hand, wenn man Dias aussucht, oder massieren einem den Nacken, wenn man übermüdet am Schreibtisch sitzt? Die ganze Agentur dachte scheinbar eh schon, daß wir zusammen sind – und ich Schussel überlegte noch, ob sie mich überhaupt mag …
Ich jedenfalls mag sie. Nein, eigentlich mehr als das: Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, daß Andrea ein potentieller Deckel ist – und Deckel sind selten und müssen mit besonderer Sorgfalt behandelt werden.
»Deckel?« fragen Sie sich jetzt vermutlich und ziehen es ernsthaft in Erwägung, mich ab sofort nicht nur für einen tapsigen Jammerlappen, sondern auch für einen ausgemachten Spinner zu halten. Deshalb erkläre ich es Ihnen: Liselotte Pulver, Deutschlands Antwort auf Doris Day, sang dereinst in Kohlhiesls Töchter das schöne Lied »Jedes Töpfchen findet sein Deckelchen«. Und bis heute bin ich der festen Überzeugung, daß dieser Song eine der tiefgründigsten und wertvollsten Analysen des gemischtgeschlechtlichen Miteinanders darstellt.
Ich bin mir ganz sicher, daß es irgendwo da draußen für jeden jemanden gibt, sogar für Leute, bei denen man denkt, selbst wenn sie tot unter der Erde lägen, würden die Würmer noch einen großen Bogen um sie machen. Selbst Kassenwarte von Kleingartenvereinen, ehrenamtliche FDP-Wahlkampfhelfer und Leute, die jedes Jahr dasselbe Appartement in El Arenal mieten, haben eine reelle Chance, nicht allein durchs Leben gehen zu müssen. Auch Dieter Bohlen hatte, zumindest zeitweise, seine Verona (von Naddel ganz zu schweigen) – selbst für die verbeultesten Kübel gibt es also einen adäquaten Aufsatz.
Bei Miriam hatte ich damals offenkundig versucht, mir einen chromglänzenden Schnellkochtopfdeckel überzustülpen, aus dessen Überdruckventil ständig beträchtliche Mengen an heißer Luft entwichen. Und das, obwohl ich mich selbst doch eher als einen soliden, handelsüblichen Schmortopf betrachte, der mit allerlei Artgenossen auf den Grabbeltischen der Karstadt-Haushaltswochen herumliegt und trotz (oder gerade wegen) seiner eher durchschnittlichen Bauart gut funktioniert und schön warm hält. Andrea könnte gut zu diesem zutiefst unexzentrischen, durchaus aber als Geheimtip zu handelnden Modell passen: Sie lebt und lacht offensichtlich gern, und ganz sicher muß man nicht erst acht Schichten schimmernde Veredelung abkratzen, um herauszufinden, aus welchem Material sie tatsächlich besteht.
An Paul denke ich natürlich auch: Andrea scheint mir im Gegensatz zu Madame Frühstück nicht der Typ Frau zu sein, bei dem Spielzeug pädagogisch wertvoll und zu alledem von einem weltweit anerkannten Designer sein muß. Und ganz sicher würde sie nicht tagelang mit diesen meist arschhäßlichen, dafür aber höchstpreisigen und trotzdem vollkommen witzlosen Gimmicks hinter Paul her rennen, wenn der sich viel lieber mit einem Teelöffel auf den Kopf schlägt und dabei hochvergnügt »Paul ist eine Trommel!« schreit.
Auch wenn die arme Andrea momentan wohl einfach denkt, ich sei bloß auf einen netten Abend und vielleicht auch eine nette Nacht aus, erlaube ich meiner Phantasie durchaus ein paar Ausflüge in die nahe und auch ferne Zukunft. Topf und Deckel und so. Um’s kurz zu machen: Ich schätze, es könnte Spaß machen, langfristig etwas mit Andrea auszukochen.
5.
Ich fühle mich sauwohl«, sagt Andrea, greift über den Tisch, schnappt sich meine Hand und schwingt den Mund zu einem hinreißenden Lächeln.
Ich grinse zurück.
Dieser Abend ist definitiv ein Volltreffer!
»Ich hab’ mich echt gefreut, als du mich gefragt hast, ob wir mal ausgehen wollen. Ehrlich gesagt«, ihre Stimme wird ein bißchen leiser, und ihre braunen Scheinwerferaugen funkeln, »fand ich dich schon süß, als ich dich das erstemal gesehen habe.«
Ich räuspere mich und spitze den Mund. »Dann … äh … dann darfst du mich jetzt auch gerne küssen.« Andrea lacht – und unsere Münder treffen sich über dem Tisch. Zaghaft und verspielt, aber, hey, sehr angenehm.
Als sich unsere Lippen nach ein paar Sekunden, die mir wie eine wunderbare Ewigkeit vorkommen, wieder trennen, lacht Andrea – ein klein bißchen zu laut, weil sie jetzt genau wie ich ein wenig unsicher ist. »Ich will noch ein Bier.«
Erstaunlicherweise ist das der erste Anflug von Nervosität, den ich heute abend erlebe. Bisher war ich einfach nur entspannt. Andrea hat mir all den Streß erspart, den Frauen Männern gerne antun: Ich mußte nichts entscheiden, das Gespräch nirgendwo hinlenken, keine Situationen oder Stimmungen herbeiführen. Andrea hat nicht erwartet, daß sie ein Programm geboten bekommt, das sie entweder abnicken oder zum Kotzen finden kann. Statt dessen haben wir einfach viel geredet und gelacht. Als wären wir Bruder und Schwester – außer natürlich, daß ein Bruder seiner Schwester nicht verstohlen auf den Busen starrt und sich vorstellt, wie nett es wäre, ihn zu knuddeln.
Andrea und ich hatten uns um neun im Daruma verabredet, einem der wenigen japanischen Lokale, das von den besonders lästigen 90er-Jahre-Yuppies noch nicht aufgespürt und annektiert wurde. Und tatsächlich trudelte Andrea auch um Punkt neun ein, womit sie prompt den ersten Pluspunkt sammelte: Ich hasse Unpünktlichkeit! Nicht, daß es mir etwas ausmacht, irgendwo allein herumzusitzen – aber wenn sich jemand mehr als zehn Minuten verspätet, habe ich immer das Gefühl, ich hätte irgend etwas durcheinandergebracht, sitze in der falschen Kneipe oder habe den Tag verwechselt.
Dank Andrea gab es auch kein Eis, das wir zwischen uns hätten brechen müssen: Noch bevor wir saßen, sprudelte sie los, und binnen kürzester Zeit kannte ich die Eckpfeiler ihres Lebens – Bücher aller Art, Wanderurlaube in unwirtlich-romantischen Gegenden wie Irland und Schottland und jede Form von Jazz, außer natürlich Dixieland, der, wie jeder zivilisierte Mensch weiß, einzig bei Kleinstadt-Straßenfesten und als Vorspann-Untermalung bei Woody-Allen-Filmen akzeptabel ist. Schon nach kurzer Zeit hatte Andrea einen Pluspunkt-Kontostand erreicht, bei dem ich ihr, ohne zu zögern, mein Leben verpfändet hätte. Und als sie mir dann, zwischen Seetang-Nudelsuppe und Sashimi, den ersten von vielen plüschigen Blicken zuwarf, bei denen es nicht nur in meinem Nacken kribbelte, war ich kurz davor, mich hemmungslos in diese wunderbare Frau zu verlieben.
So atemlos Andrea plappern mag, so konzentriert kann sie aber auch zuhören. Sie ist nicht bloß neugierig, sondern ehrlich interessiert. Und sie ist einer der wenigen kinderlosen Menschen, der Aufmerksamkeit nicht bloß heuchelt, wenn ich von Paul erzähle.
»Ich liebe Kinder«, sagt sie plötzlich ganz ruhig und ernst. »Mein letzter Freund wollte aber keine. Da hab’ ich ihn verlassen.«
Der plötzliche Stimmungswechsel irritiert mich, und weil ich nicht weiß, was ich dazu sagen soll, stammle ich banal: »Na ja, es sind doch letztlich immer eine Menge Faktoren, die bei einer Trennung eine Rolle spielen.« Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Hilfe!
Andrea lächelt. »Na ja, schon. Mark hatte auch noch andere Fehler – er putzte sich zum Beispiel nur äußerst widerwillig die Zähne, und sein Traumurlaub bestand darin, drei Wochen lang an irgendeinem Strand zu rösten. Zweimal die Woche hatte er außerdem Fußballtraining, komme, was da wolle. Selbst an meinem Geburtstag! Und jeden Samstagabend bei der Sportschau mutierte er für eine Stunde zum Autisten, den man rütteln und schütteln konnte, ohne daß er irgend etwas merkte. Aber das Hauptproblem war, daß er sich, ich zitiere, ›den Spaß am Leben nicht durch irgendwelche Schreihälse ruinieren lassen will‹.«
Ich rolle angesichts dieser Aufzählung grober Verstöße gegen die Grundregeln eines kultivierten Lebens mit den Augen. Andrea schien einen Moment darüber nachzudenken, was sie gerade alles gesagt hatte, und begann zu lachen: »Also, bei näherer Betrachtung war er vielleicht einfach ein Idiot.« Dann wurde sie wieder ernst. »Weißt du, es ist so: Ich will Kinder. Und einen Mann, der das nicht auch will, kann ich nicht gebrauchen.«
»Habe ich schon erwähnt, wie sehr ich Fußball hasse?« griene ich. Andrea lacht noch einmal, greift sich ihr Glas und wirft mir über den Rand hinweg den plüschigsten aller Plüschblicke zu. »Wohnst du weit von hier?« Ich hatte gehofft, daß sie das fragt. »Ober – zahlen!«