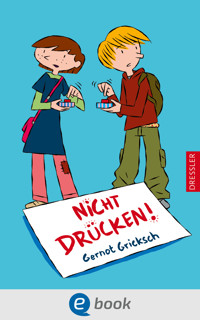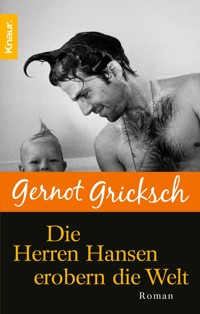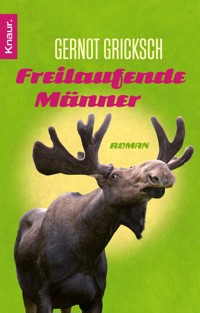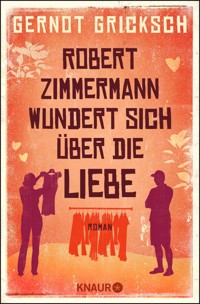
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Da kann der bekannte Schlager noch so oft behaupten, dass es Wunder immer wieder gibt: Robert glaubt nicht daran. Jedenfalls nicht, bis er ausgerechnet in einer Chemischen Reinigung seine große Liebe findet. Monika ist intelligent, hat Humor, sieht klasse aus ‑ dass sie 16 Jahre älter ist, macht ihm überhaupt nichts aus. Auch nicht, dass sie einen pubertierenden Sohn hat. Und dass Monika, die sich immer alleine durchschlagen musste, in einer ganz anderen Welt lebt als er, der verwöhnte Junge aus reichem Hause. Für Robert ist klar, dass sie füreinander bestimmt sind. Allerdings sehen seine Freunde das anders. Und Monika auch. Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe – aber eins tut er ganz sicher nicht: sie aufgeben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Gernot Gricksch
Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 13 1 / 2
Tom Schilling als Robert [...]
Nachspann
Kapitel 1
Ich heiße Robert Zimmermann und ich hasse meinen Namen. Vielleicht gehören Sie zu jenen Leuten, die an Robert Zimmermann nichts Negatives entdecken können. Vielleicht finden Sie, mein Name klänge etwas steif, nicht sehr originell, aber doch wohl keineswegs hassenswert – aber dann gehören Sie eben nicht zu den erschreckend vielen Menschen, die wissen, dass Robert Zimmermann der Geburtsname Bob Dylans ist. Jawohl, Amerikas größte Hippielegende und ich haben denselben Namen im Reisepass! Und Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Leute sich deshalb berufen fühlen, mich mit irgendwelchen blöden Witzen zu traktieren.
Eben gerade ist es wieder passiert. Ich sitze hier an Bord einer British-Airways-Maschine, und die Stewardess, die meinen Namen offenbar bereits in der Passagierliste entdeckt hatte und schon so blöde griente, als ich meinen Platz einnahm, tauchte plötzlich mit einer Thermoskanne neben mir auf und fragte giggelnd und übertrieben laut: »One more cup of coffee?« Und prompt stimmten ihre zwei Kolleginnen, die hinter dem Vorhang der ersten Klasse auf ihren Einsatz gelauert hatten, prustend im Chor ein: »One more cup of coffee for the roooooad, one more cup of coffee before I gooooo … to the valley below!« Es folgte das obligatorische Gegacker der vermeintlich Witzigen.
Okay, es ist zugegebenermaßen eine angenehme Abwechslung, wenn jemand mal einen anderen Song als Blowing in the Wind oder The Times, they are a-changing für seinen Bob-Dylan-Namensvetter-Witz benutzt. Normalerweise hätte ich die erstaunliche Tatsache, dass drei junge, hübsche Frauen, für die doch eigentlich selbst der Sommerhit des letzten Jahres schon ein Oldie sein müsste, einen eher unbekannten und obendrein rund 30 Jahre alten Dylan-Song im Repertoire haben, wohl auch mit einem höflich-neckischen Grinsen quittiert. Aber nicht heute. O nein, heute nicht! Denn heute ist der entsetzlichste Tag meines Lebens. Heute ist der Tag, an dem ich meine große Liebe verloren habe.
Wenn ich tatsächlich Bob Dylan wäre, würde ich jetzt einen Kugelschreiber zücken und auf einer British-Airways-Serviette den tragischsten und herzerweichendsten Song meiner Karriere niederschreiben. Ich würde mir dann meine Klampfe schnappen, die natürlich wie eine Geliebte neben mir auf einem Extraplatz reisen würde, und mit meiner unvergleichlichen Stimme, die klingt, als ob ich einen Tampon in der Nase und seit drei Tagen nicht mehr geschlafen habe, die Ballade meines großen Unglücks anstimmen. Und alle meine Mitreisenden, selbst die Manager mit den Aktenkoffern auf dem Schoß, würden hemmungslos zu schluchzen beginnen und noch Jahre später von diesem denkwürdigen Flug mit dem traurigsten Mann der Welt erzählen.
Aber ich bin ja nicht Bob Dylan. Ich bin nur Robert Zimmermann. Alles, was ich tun kann, ist Ihnen zu erzählen, was mir passiert ist. Die ganze Geschichte.
Was ich Ihnen zu erzählen habe, ist eine Liebesgeschichte. Es ist jedoch keine gewöhnliche Liebesgeschichte. Aber andererseits: Wann war die Liebe je gewöhnlich?
Alles begann vor 14 Monaten. An einem Montag im Mai. Es war ein schöner, sonniger Frühlingstag im sonst nicht gerade sonnenverwöhnten Hamburg. Und ich hatte einen Soßenfleck auf meinem Anzug.
Ich besaß damals zwei Anzüge. Nicht aus Überzeugung oder modischer Erwägung, sondern weil ich sie für meinen Job brauchte. Ich war für die Pressearbeit der Computer- und Videospielfirma CloneByte zuständig, und obgleich sich unsere Branche sonst gern den Anstrich eines Horts von freidenkenden Partyjüngern und hippen Individualisten gibt, bestand mein Boss darauf, dass ich mich bei offiziellen Terminen und Präsentationen dem branchenübergreifenden Schlips-Diktat beugte. An diesem Montagabend sollte ich einer Gruppe geladener Journalisten im schicken Park Hyatt-Hotel unser neues Nintendo-Gamecube-Spiel Metroid Frenzy 2 vorführen.
Ich wollte am Abend direkt von meinem Büro in der Hamburger Jarrestadt zum Hotel in der Innenstadt fahren und hatte mich deshalb bereits morgens in den edlen Zwirn geworfen. Keine gute Idee. Denn als ich mir Mittags mit meinem Kollegen Jens am Imbiss an der Straßenecke eine Currywurst einverleiben wollte, musste ich lernen, dass Wurstwaren erschreckend große Sprünge vollführen können, wenn man mit einer Plastikgabel in sie hineinzustechen versucht und dabei an der ketchupgetränkten Pelle abrutscht. Die Currywurst attackierte mich im Brustbereich, und der Fleck, den die an ihr klebende Currysoße darob auf meinem Hugo-Boss-Designeranzug hinterließ, hatte die Größe (und wegen der untergerührten geschmorten Zwiebeln auch die Konsistenz) eines überfahrenen Igels.
Mein zweiter Anzug lag zu Hause zerknittert im Wäschekorb. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als mit meinem ketchupverschmierten Sakko in die nächste chemische Schnellreinigung zu trotten und zu beten, dass der Wortteil Schnell auf dem Neonschild über der Tür den Tatsachen entsprach.
»Wir sind verpflichtet, eventuelle Gewalttaten polizeilich zu melden«, sagte die Frau hinter dem Tresen mit ernster Stimme und hielt vorwurfsvoll das Sakko hoch, das tatsächlich aussah, als hätte ich mich im Blut eines Mordopfers gesuhlt.
»Das ist Ketchup«, murmelte ich bloß. Normalerweise bin ich schlagfertiger. Ehrlich.
»Das sagen sie alle«, sagte die Reinigungsexpertin und lächelte nun doch ein wenig. Ihre grünen Augen funkelten. Für einen kurzen Augenblick blendeten sie mich richtig, diese erstaunlich grünen Augen.
Sie schnupperte kurz an dem Fleck. »Curry«, stellte sie dann fest. »Da lief wohl einiges an der Frittenbude schief, hm? Sind Sie nicht schon einen Tick zu alt, um noch mit Essen zu kleckern?«
Ich wurde tatsächlich ein wenig rot. »Die Wurst war feindselig«, sagte ich entschuldigend.
Die Frau lachte. »Eine Kampfwurst. Soso.«
»Wie schnell können Sie es reinigen?«, fragte ich ganz geschäftsmäßig, um den für mich arg peinlichen Kleckerdialog zu beenden. »Ich habe heute Abend nämlich einen wichtigen Termin.«
»Eigentlich dauern Sakkos 24 Stunden«, sagte die Frau.
»Und un-eigentlich?«, hakte ich nach und setzte dabei mein verführerischstes Lächeln auf. Ich weiß, wie ich Frauen dazu bewegen kann, mir etwas weiter entgegenzukommen, als sie es ursprünglich geplant haben.
»Drei«, lächelte sie. Es war ein nettes Lächeln, ein attraktives Lächeln, ein einnehmendes Lächeln – aber keines, das mir als Mann galt. Es war ein unverbindliches, universelles Kunden-Lächeln. Die Frau mit den wunderschönen grünen Augen hätte den Gefallen einer beschleunigten Sakko-Säuberung offenbar jedem getan, der sie freundlich genug darum bat. Der spezielle Charme, den ich mir gern zuschreibe, schien an ihr abgeprallt zu sein. Ich war nichts Besonderes für sie.
Das wurmte mich.
»Toll, danke«, sagte ich trotzdem und überlegte kurz, ob ich diese zwei Worte mit einem Zwinkern begleiten sollte. Doch wenn auch dieser Flirtversuch ohne nennenswerte Wirkung verpufft wäre, hätte mein Ego womöglich Schaden genommen. Also lächelte ich einfach nur weiter.
»Auf welchen Namen?«, fragte die schnelle Sauberfrau und zückte einen kleinen Quittungsblock. Ich betrachtete ihre Hände. Sie hatte außergewöhnlich schlanke Finger.
»Robert Zimmermann«, beantwortete ich ihre Frage. Ich sah, dass sie aufhorchte und sehr wohl wusste, was es mit meinem Namen auf sich hatte. Sie überlegte offenkundig, ob sie etwas Pfiffiges sagen sollte. Doch dann entschied sie sich Gott sei Dank dagegen, notierte einfach nur meinen Namen, als hätte er nichts Ungewöhnliches an sich, und reichte mir den nummerierten Abschnitt der Quittung. Für den Bruchteil einer Sekunde berührte ihre Hand dabei die meine, was ich erstaunlich erfreut zur Kenntnis nahm.
»Um fünf können Sie das Sakko abholen.«
»Mach ich«, antwortete ich. »Bis dann.«
»Bis dann«, sagte die Frau und wandte sich dann, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen, dem nächsten Kunden zu. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass nach mir jemand den Laden betreten hatte. Es hatte sich angefühlt, als wären die Frau und ich ganz allein gewesen. Nur sie und ich.
Nachdem ich die Reinigung verlassen und sich die Tür mit einem leisen Bing Bong hinter mir geschlossen hatte und ich jackenlos den Rückweg ins Büro antrat, fühlte ich mich irgendwie seltsam. Mein Herz klopfte. Gedankenverloren rieb ich meine Hand.
Ich bin es gewohnt, dass Frauen mit mir flirten. Das mag eingebildet klingen, ist aber einfach wahr. Ich bin 27 Jahre alt, einen Meter neunundachtzig groß, schlank und durchtrainiert. Ich habe ein kantiges Gesicht mit markantem Kinn, ich habe dunkelblondes, modisch geschnittenes Haar, blaue Augen und einen Mund, mit dem es sich, wie bereits erwähnt, ganz wunderbar lächeln lässt. Ich sehe gut aus. Ist einfach so. Natürlich ist Aussehen Glücksache, größtenteils zumindest, aber es ist eben auch ein nicht zu verachtender Vorteil im Leben.
Ich war bereits auf der Schule ein Mädchenschwarm, ich kenne es gar nicht anders. Natürlich genieße ich es, wenn ich die verstohlenen Blicke gut aussehender Frauen auf mir spüre, und es ist durchaus schon vorgekommen, dass ich mir selbstzufrieden im Spiegel zugezwinkert habe. Aber unterm Strich versuche ich, aus meinem guten Aussehen keine allzu große Sache zu machen.
Lorna hat mal gesagt, es sei typisch für die wirklich schönen Menschen, dass sie ihre körperlichen Vorzüge als etwas Selbstverständliches betrachten. Menschen wie ich könnten uns gar nicht vorstellen, wie es sei, als optisches Mittelmaß durchs Leben zu gehen oder sich für unsere Attraktivität ein Bein ausreißen zu müssen. Ich dachte mir, dass eine Beinamputation der Attraktivität doch eigentlich alles andere als förderlich sei, behielt diesen logischen Einwand aber für mich. Lorna war meine Freundin, und Logik zählte nicht zu ihren herausragenden Eigenschaften. Außerdem wusste ich, dass Lorna es nur gesagt hatte, um ein Kompliment aus mir herauszukitzeln. Sie wollte von mir hören, dass sie selbst doch weiß Gott auch eine Schönheit sei. Und mit ihrer Porzellanhaut, ihren perfekten Körpermaßen, ihren festen, nicht zu großen und nicht zu kleinen Brüsten, ihrem kleinen, strammen Po, ihrem vollen, blonden, leicht gewellten Haar und ihren braunen Schlafzimmeraugen ist sie das vermutlich auch. Also sagte ich brav, was sie hören wollte. Sie freute sich darüber. Und abends hatten wir dann Sex, wir beiden schönen Menschen. Hipp, hipp, hurra.
Wie gesagt: Ich bin es gewohnt, dass Frauen mich attraktiv finden und dass sie mir das oft auch zeigen. Die Frau aus der Reinigung jedoch hatte kein besonderes Interesse an mir signalisiert. Zuerst dachte ich, sie würde mit mir flirten, wegen der frechen Sprüche über mein Kleckern. Aber letztlich sah es doch so aus, als wäre sie einfach ein humorvoller Mensch und würde öfter mal mit Kunden herumscherzen. Wahrscheinlich hatte sie mich schon vergessen.
Mir dagegen blieb sie im Kopf kleben. Den ganzen Weg zum Büro dachte ich über sie nach – obwohl es an diesem Tag weiß Gott anderes gab, womit ich mich gedanklich zu beschäftigen hatte. Die Präsentation am Abend war eine echt große Nummer und erforderte noch einiges an Organisation. Doch sosehr ich mich auch zwang, über die termingenaue Anlieferung des Beamers, über die Details des Büfetts und die Auswahl der Getränke nachzudenken, die wir den Journalisten servieren wollten – immer wieder wanderten meine Gedanken zurück zu der Frau in der Reinigung. Und irgendwann merkte ich, dass sich dabei ein geistesabwesendes Lächeln auf meinem Gesicht breit gemacht hatte.
Ich war verwirrt. Was ging denn hier ab? Wieso vergaß ich die Frau nicht einfach, so wie sie mich wahrscheinlich auch? Es war ja keineswegs so, dass mir noch nie zuvor amüsante, attraktive Frauen begegnet waren. Und auch wenn ich es nicht gern zugebe: Einige von denen haben mich nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Brad Pitt bin ich eben doch nicht. Damit kann ich leben, ehrlich. Bei der Frau aus der Schnellreinigung aber wurmte mich der offenbar mäßige Eindruck, den ich hinterlassen hatte, furchtbar. Ich kam überhaupt nicht darüber hinweg. Diese Frau war irgendwie … anders. Von diesem ersten kurzen Treffen an wusste ich bereits, dass sie etwas Besonderes war. Etwas ganz Besonderes.
Ach ja: Habe ich schon erwähnt, dass sie so etwa fünfzehn bis zwanzig Jahre älter war als ich und dass in ihrem Haar bereits ein paar graue Strähnen schimmerten?
»Ist Steve heute Abend auch da?«, fragte Lorna am Telefon. Sie hatte kurz nach meiner Rückkehr ins Büro angerufen.
»Er hat sich zumindest angemeldet«, antwortete ich, nachdem ich einen Blick auf die Liste der akkreditierten Journalisten für die Präsentation geworfen hatte.
»Ach«, seufzte Lorna, »ich wünschte, ich könnte auch kommen. Steve ist sooo cool!«
Lorna sprach von Steve-P, dem Moderator der MTV-Computerspielsendung Byte my Ass, einem goateebärtigen, blond gefärbten Hippster, der von Spielen ungefähr so viel Ahnung hatte wie ich von der hohen Kunst des Ikebana. Steve-P ließ sich seine gesamten Texte heimlich von pickligen vierzehnjährigen Computersüchtigen schreiben und reicherte sie dann nur noch mit pseudocoolen Gags an. Die breite Masse vor der Glotze hielt ihn jedoch für den Papst des digitalen Entertainments. Irgendwann würde ich seinen Fans gerne erzählen, dass ich mal beobachtet habe, wie Steve-P eine Viertelstunde lang vergeblich versucht hat, Super Mario durch den Lava-Level zu bugsieren. Das können selbst Fünfjährige im Halbschlaf.
»Kann ich?«, fragte Lorna und schreckte mich aus meinen Gedanken auf.
»Was?«, fragte ich zurück.
»Ach, Dummerchen! Kann ich zu der Präsentation kommen? Bitte, bitte«, säuselte Lorna mit ihrer lasziven Sirupstimme, der sich kaum ein Testosteronproduzent erwehren kann. Bei mir funktionierte sie allerdings nicht mehr so recht. Ich war einfach schon zu oft von ihr vollgeschleimt worden.
»Klar«, murmelte ich trotzdem. Wenn Lorna partout den großen Steve treffen wollte, sollte sie den großen Steve eben treffen. Mir doch wurscht.
»Du bist soooo ein Schatz«, säuselte meine zufriedene, promihungrige Freundin.
»Um acht«, sagte ich. »Park Hyatt.«
Als ich auflegte, fragte ich mich einmal mehr, warum ich eigentlich noch mit Lorna zusammen war. Traurig, aber wahr: Sie war einfach langweilig. Klar, sie sah aus wie modelliert und ihre Blowjobs waren Weltklasse, aber ich freute mich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr, wenn ich sie sah. Und es fiel mir nicht einmal schwer, meine Gefühle für sie in vier einfache Worte zu kleiden: Ich hatte sie über. Vielleicht brauchte ich ein Beziehungs-Update.
Natürlich war mir die Gefahr, mich lächerlich zu machen, bewusst gewesen. Trotzdem hatte ich auf dem Weg zur Schnellreinigung doch einen Strauß Frühlingsblumen gekauft. Als kleines Dankeschön für die außergewöhnlich schnelle Reinigung meines Sakkos. So die offizielle Version. Und weil ich Sie die letzten drei Stunden einfach nicht aus meinem Kopf herausbekommen habe. Doch das würde ich wohl besser erst einmal für mich behalten.
Kurz bevor ich die chemische Reinigung erreichte, fragte ich mich dann aber doch noch einmal mit Nachdruck, ob ich eigentlich verrückt geworden war. Was sollte denn das? Warum wollte ich diese mir völlig unbekannte Frau partout beeindrucken? Warum wollte ich ums Verrecken mehr für sie sein als bloß ein ganz normaler Kunde? Das ergab doch alles gar keinen Sinn! Ich war drauf und dran, die Blumen einfach in ein Gebüsch zu schmeißen und mich so vor einer recht wahrscheinlichen Blamage zu bewahren. Aber irgendetwas hielt mich davon ab. Ich fand sie attraktiv, diese Frau. Sehr attraktiv sogar. Und auf vage, mysteriöse Art begriff ich, dass diese Schönheit nicht nur äußerlich war. Ich wollte ihr die Blumen geben. Ich musste ihr die Blumen einfach geben.
Rückblickend weiß ich nicht, ob ich damals wirklich auf den ersten Blick gesehen, erkannt, gespürt habe, dass diese Frau anders als jede andere Frau ist, die ich je getroffen habe und womöglich in meinem Leben treffen werde. Aber ich mag die Vorstellung. Ich mag die Idee, dass es sofort diese unsichtbare, funkensprühende Verbindung zwischen ihr und mir gab. Das ist zwar kitschig, aber irgendwie auch cool.
Vielleicht – und um ehrlich zu sein: wahrscheinlich – war ich aber zuerst bloß angepisst, weil ich bei ihr ins Leere geflirtet hatte. Vermutlich war es vor allem gekränkte Eitelkeit. Vielleicht hätte ich nie etwas unternommen, wenn sie bei unserem ersten Zusammentreffen auf mein magisches Lächeln brav mit gebührendem weiblichem Entzücken reagiert hätte. Vielleicht hätte ich mich einfach nur über die Aufmerksamkeit und Bestätigung gefreut, und damit hätte sich die Sache gehabt.
Ganz egal, warum es so gekommen war – schließlich stand ich mit einem Blumenstrauß in der Hand vor der Reinigung. Als ich die Tür öffnete, sah ich allerdings eine andere Person als meine grünäugige Reinigungsfee hinter dem Tresen stehen. Ein Mädchen. Siebzehn, achtzehn Jahre alt vielleicht. Sie trug eine dieser gelblich eingefärbten Brillen, die der Popstar Anastacia populär gemacht hat, und sie musste kurz zuvor gestolpert und in einen Schminkkoffer gefallen sein: Sie hatte ein quietschbuntes Gesicht.
Ich schob meinen Quittungsabschnitt über den Tresen und räusperte mich. »Vorhin hat mich eine Kollegin von dir bedient, so etwa vierzig Jahre alt. Grüne Augen. Brünett.«
»Ach, Monika«, sagte das Mädchen. »Ich meine: Frau Bleckner.«
Monika. Sie hieß Monika.
»Die hat schon Feierabend«, fuhr das Mädchen achselzuckend fort, während sie mein Sakko von der Garderobenstange angelte.
»Oh«, sagte ich und warf einen ratlosen Blick auf meine Blumen. Ach, was soll’s. »Na ja, ich kann sie ja auch dir geben. Danke, dass es so schnell geklappt hat mit dem Sakko.« Ich schob die Blumen über den Tresen, ohne das Mädchen dabei anzuschauen. Die war mir schließlich egal.
Mein Gegenüber staunte. »Danke, ey«, sagte sie. Ich gönnte ihr nun doch einen kurzen Blick. Ihre rotlackierten Wangen schoben sich beim Lächeln nach oben. Sah so aus, als wäre es das erste Mal in ihrem Leben, dass ihr jemand Blumen schenkte.
Ich bezahlte und verließ das Geschäft.
Monika.
Es war halb zwei Uhr nachts, als ich nach Hause kam. Die Präsentation hatte sich ziemlich hingezogen, und danach waren Lorna, ich und ein paar der Journalisten noch in einer Kneipe auf dem Kiez versackt. Steve-P, dem Lorna während des offiziellen Termins voll entwürdigendem Groupie-Gehabe kaum von der Pelle gerückt war, hatte sich ziemlich schnell verabschiedet, weil er noch den Spätflug zurück nach London nehmen musste. Lorna war enttäuscht. Und noch enttäuschter war sie zu sehen, dass der Rest der Computerjournalisten-Gang vorwiegend aus Menschen bestand, die sich immer noch von ihren Müttern die Klamotten bei Quelle bestellen ließen, Star-Trek-Videos sammelten und sich eine Viertelstunde lang mit Wollust über den neuen Matrox-Grafikbeschleuniger ereifern konnten. Nur wer jemals mit anhören musste, wie ein Computerfreak einen Witz erzählt, darf es wagen zu behaupten, er wüsste, was Schmerz ist.
Ich war an diesem Abend mit den Gedanken aber sowieso woanders. Ich dachte, so sehr ich mich auch zwingen wollte, es nicht zu tun, ständig an eine Frau namens Monika. Eine Frau, von der ich nichts wusste, außer dass sie in meinem Kopf klebte. Einen Moment lang fragte ich mich ernsthaft, ob ich vielleicht langsam verrückt wurde.
Lorna und ich nahmen getrennte Taxen nach Hause. Wir wohnten vom Kiez aus gesehen in entgegengesetzten Richtungen. Unser Abschiedskuss war ohne Leidenschaft.
Als ich zu Hause die Wohnungstür aufschloss und eigentlich nur noch müde ins Bett plumpsen wollte, hörte ich aus Oles Zimmer Jimmy Nail singen. Ole ist mein Mitbewohner. Und Jimmy Nail hört er nur, wenn er deprimiert ist. Show me the difference, if you can, between a woman and a man, schallte es durch den geräumigen Flur unserer topsanierten Luxus-WG in Bestlage. Ich seufzte und klopfte an Oles Tür.
»Yup«, rief er.
Ich betrat das Zimmer. Da saß er, der Ole, auf seiner Matratze. In der Hand eine Dose Maibock, im CD-Player eine Disc von Großbritanniens melancholischstem Staatsbürger und vor sich ausgebreitet ein halbes Dutzend Briefe. Man musste kein Inspektor Columbo sein, um diese Zeichen korrekt zu deuteten: Liebeskummer!
Ole trug eines seiner zahlreichen karierten Baumwollhemden, das seine Neigung zum überdurchschnittlichen Bauchumfang mehr schlecht als recht kaschierte, und eine braune Cordhose. Wann immer man ihn sah, schien sein letzter Friseurbesuch Monate zurückzuliegen, denn Oles Haupthaar glich einem Flokati. Seine fusselige Kinnpartie legte außerdem Zeugnis von seiner Aversion gegen regelmäßige Rasuren ab. Ole war kein sehr attraktiver Mensch. Er war nicht hässlich oder wirklich dick, und sein Gesicht war trotz der Bartstoppeln, die sich wie Tundragestrüpp über die Wangen und das Kinn verteilten, nicht deformiert oder Ähnliches. Ole hatte nur einfach keine wirklichen optischen Qualitäten. Dass er diesem Manko nicht mit ausgewählter Garderobe und einem vorteilhaften Haarschnitt zu trotzen versuchte, sondern lieber herumrannte wie einer von diesen Leuten, die man bei Dokumentarfilmen über Rockfestivals der 60er-Jahre immer zufrieden grinsend auf der Wiese sitzen sieht, konnte niemand so recht verstehen. Ich auch nicht. Aber was machte das schon? Ole war eben Ole.
»Liebesbriefe oder Rechnungen?«, fragte ich und wies auf das Häufchen Papier, das offensichtlich der Auslöser für Oles Frust war.
Ole hob einen der Briefe auf und las ihn mir vor: »Hallo Teddybär. Ich bin 22 Jahre alt und studiere Jura. Genau wie du suche ich nach einer Beziehung, die mehr ist, als bloß ein geregeltes, belangloses Miteinander. Ich bin ein sehr romantischer Typ, und deine Anzeige scheint mir zu verraten, dass auch du ein Mensch mit viel Gefühl bist. Ich würde dich gern treffen. Bitte melde dich doch. Nadine.«
Ich kratzte mich am Kopf. »Ich wusste gar nicht, dass du eine Kontaktanzeige aufgegeben hast.«
Ohne etwas zu sagen, fingerte mein Mitbewohner aus einem der herumliegenden Umschläge ein Passfoto heraus und reichte es mir. Nadine hatte eine Tendenz zum Pfannkuchengesicht. Aber auf Post von einer Kate-Moss-Doppelgängerin durfte Ole wohl auch nicht hoffen.
»Klingt doch gut«, sagte ich. »Du solltest dich mit ihr treffen. Und sie sieht ja auch, ziemlich … äh … süß aus.«
»Sehr süß sogar«, sagte Ole, der offenbar andere ästhetische Standards setzte als ich. »Und ich hatte heute Abend ein Date mit ihr.«
»Und?«, fragte ich. »Wie lief’s?«
»Das ist mein sechstes Maibock«, antwortete Ole und hob die Dose hoch. »Und ich plane, im Laufe der Nacht noch einige mehr zu konsumieren. Reicht das als Antwort?«
»So schlimm?«, fragte ich.
»Yup«, sagte Ole.
»Erzähl«, forderte ich ihn auf und nahm mir ebenfalls ein Maibock aus der Tüte, die neben der Matratze stand.
»Wir hatten uns im Fritz Bauch verabredet«, begann Ole. »Und ich sah Nadine sofort, als ich hereinkam. Sie wirkte irgendwie wie ein Fremdkörper. Sie trug so einen rosa … äh … ich weiß nicht: Flauschpulli?«
»Kaschmir«, sekundierte ich.
»Whatever. Und eine Perlenkette. Jurastudentin halt. Irgendwie sah sie nicht glücklich aus.«
Das glaubte ich Ole sofort. Das Fritz Bauch ist eine urige Pinte im Schanzenviertel, in der man mehr Hausbesetzer und Bauwagenbewohner vorfindet als angehende Staatsanwälte, die ihnen später den Prozess machen würden.
»Ich ging also zu ihr und fragte sicherheitshalber: ›Nadine?‹ Sie sah zu mir hoch und ihr Gesicht entgleiste. Sie war offenbar enttäuscht von mir.«
»No offense«, sagte ich. »Aber biste mal auf die Idee gekommen, dich für dein Date zu rasieren und in ein paar vernünftige Klamotten zu steigen?«
»Nee«, sagte Ole. »Wieso? Ich bin doch kein Blender! Ich suche keine flüchtige sexuelle Erleichterung. Wenn ich meinen Hormonaushalt ausbalancieren will, mache ich einfach ein Date mit Fräulein Faust.« Er wedelt mit seiner linken Hand. »Mensch, Robert, ich suche eine Frau, die ich lieben kann und die mich liebt. Und dafür muss sie mich schon so sehen, wie ich wirklich bin.«
Okay. 1 : 0 für Ole.
»Das ist wie mit Wonderbras«, schweifte er nun ab. »Ich meine, was ist das für ein Beschiss? Da wuppen Frauen ihre Brüste hoch, erwecken den Anschein, sie wären doppelt so groß wie in Wirklichkeit. Und wenn man dann zur Sache kommt und sie aus ihren Klamotten schält und den BH öffnet … Ups! Wo sind dann die Titten geblieben? Wie beknackt ist das? Ich habe null Problem mit Frauen, die kleine Brüste haben. Ich habe aber ein Problem mit Frauen, die das für irgendwie wichtig halten.«
Das musste man Ole lassen: Er war ein konsequenter Mensch. Trotzdem dachte ich, es wäre eine gute Idee, ihn auf den ursprünglichen Gesprächspfad zurückzuführen. Sonst hätten wir um sieben Uhr morgens noch auf seiner Matratze gesessen. »Also, ihr Gesicht entgleiste …«
»Yup«, sagte Ole. »Nur ganz kurz, aber merklich. Als ich mich setzte und ein Bier bestellen wollte, fragte sie gleich, ob wir nicht woanders hingehen könnten. Sie fände den Laden unappetitlich und der eine Typ am Tresen würde sie immer so anstarren. Ich sah zu dem vermeintlichen Glotzer rüber. Der Kerl war so breit, dass er vermutlich direkt durch Nadine hindurchschaute und in der hintersten Ecke der Kneipe kleine Elefanten in Ballettröckchen herumhopsen sah. Aber egal: Wir brachen also auf und Nadine winkte draußen ein Taxi heran. Ein Taxi, das sie übrigens später wie selbstverständlich mich bezahlen ließ.«
»Und wo seid ihr dann hingefahren?«
»Sie wollte in die Klimperkiste. Noch’n Bier?«, fragte Ole und zauberte wie aus dem Nichts eine zweite Tüte voller Maibock-Dosen hervor. Er war offensichtlich wirklich fest entschlossen, seinen Frust bis zum Totalausfall mit Alkohol zu ölen.
»Danke nein«, sagte ich. »Muss morgen arbeiten.«
Ole zuckte mit den Schultern und ließ seine neue Dose zischen. »Kennst du die Klimperkiste?«
Ich nickte. »War mal kurz drin. Mehr so etwas für die Elterngeneration, oder?«
»Aber hallo. Da fühlste dich wie bei einem Betriebsausflug des FDP-Landesverbandes! Schlipse und Schnurrbärte und Frauen in halblangen Kostümen. Und Phil Collins in den Lautsprechern«, seufzte Ole. »Aber jedem sein Ding, oder? Nadine mochte die Klimperkiste. Und mir gefiel Nadine. Der Anfang unseres Dates war zwar etwas holprig verlaufen, aber im Taxi hatte sie schon ganz nett erzählt. Außerdem ist sie in Natur tatsächlich noch hübscher als auf dem Foto.«
»Kaum zu glauben«, sagte ich und warf einen weiteren flüchtigen Blick auf das Pfannkuchenbild.
»Wir hatten einen kuscheligen Eckplatz ganz hinten in der Kneipe, mit Kerzenlicht und so«, fuhr Ole fort. »Und Nadine erzählte gleich los. Von ihren zwei Schwestern, die beide schon Kinder hatten, von ihren Kommilitonen, ihrem Studiengang, ihren Zukunftsplänen. Ich sage nur: Wirtschaftsrecht.« Ole seufzte einmal mehr. »Und von ihren Hobbys. Sie ist in einer Theatergruppe und spielt Lacroix. Oder Lacoste … oder so.«
»Du meinst Lacrosse«, half ich ihm. »Lacroix ist Dosensuppe und Lacoste ist eine Klamottenmarke.«
»Whatever«, murmelte Ole wieder. »Nach etwa einer Stunde fragte ich mich, ob Nadine nicht vielleicht auch etwas über mich erfahren sollte. Wenn es ihr ausschließlich darum ging, ihre eigene Welt zu monologisieren, hätte sie sich ja auch mit einem Kassettenrekorder verabreden können.«
Wissen Sie, was ich an Ole bewundere? Der nimmt selbst nach sieben Maibock noch Worte wie monologisieren in den Mund!
»Und weil Nadine mittlerweile schon beim etwas abseitigen Thema Hamburger Nahverkehr angekommen war und sich über die zunehmende Tendenz zur Verspätung bei der U-Bahn ereiferte und ich langsam das Gefühl bekam, dass die zwischenmenschliche Komponente unseres Dates etwas kurz käme, winkte ich den Rosenverkäufer herüber, der gerade durch das Lokal schlich und seine Blumen feilbot.«
»Guter Move«, lobte ich.
»Guter Move am Arsch«, schnaubte Ole. »Der Blumenmann war, glaube ich, ein Inder. Oder ein Pakistani? Egal. Ich wollte ihm also gerade eine Rose abkaufen, da nölte Nadine plötzlich los, dass sie lieber keine Blume will, weil man diese illegal eingereisten Sozialparasiten nicht unterstützen dürfe.«
»Wie bitte?«
»Das habe ich auch gesagt: Wie bitte? Ich habe gehofft, dass Nadine nur einen missglückten Witz abgesondert hat. Aber da lag ich leider falsch. ›Diese Scheinasylanten ruinieren unser komplettes soziales System‹, hat sie gesagt. Und: ›Ich finde, man sollte sie boykottieren, wenn unsere Regierung es schon nicht schafft, sie auszuweisen. Die werden zu Hause doch nicht wirklich verfolgt, die wollen hier nur abkassieren!‹ Das alles sagte sie wohlgemerkt, während der Rosenverkäufer direkt neben mir stand! Der trat würdevoll den Rückzug an und ging zum Ausgang, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Ich war völlig fassungslos.«
»Und dann?«
»Dann habe ich gesagt, dass ich mal pinkeln muss, und bin aufgestanden. Bin zum Tresen, habe der Bedienung mitgeteilt, dass diese Kuschelpulli-Eva-Braun meine Zeche mitbezahlt und bin abgehauen.«
»Richtig!«, sagte ich. »Radikal, aber richtig.«
»Draußen habe ich dann noch den Blumenverkäufer stehen sehen und mich bei ihm entschuldigt«, fuhr Ole fort.
Ich nickte. Ole war ein guter Mensch.
»Willste ’ne Rose?«, lachte er plötzlich und griff hinter sich. Erst jetzt sah ich, dass eingequetscht zwischen zwei Kissen hinter seinem Rücken ein in Papier eingeschlagenes Bund mit mindestens vierzig Baccara lag. Ein Sühnekauf offensichtlich. Ich lachte auch, nahm ihm das Blumenbündel ab und sagte: »Ich stell die mal ins Wasser.«
»Ich werde mich aber trotzdem noch mit den anderen Frauen treffen«, sagte Ole und wies auf die restlichen Briefe. »Irgendwo da draußen muss doch jemand für mich sein.«
»Irgendwo da draußen ist für jeden von uns die Richtige«, versicherte ich ihm.
»So wie Lorna?«, fragte Ole mit hochgezogener Augenbraue. Ich wusste, dass er von Lorna nicht allzu viel hielt.
»Eher nicht«, gab ich zu. »Lorna nervt langsam. War kein guter Griff.« Ich überlegte kurz, ob ich Ole von Monika erzählen sollte, aber ich hatte Angst, er würde meine aufkeimende Obsession für eine völlig fremde Frau nicht verstehen. Und wer könnte es ihm verdenken?
»Is’n Scheißspiel mit der Liebe«, murmelte Ole, dem nun langsam die Augen zuzufallen drohten.
»Auf jeden Fall isses keins mit leicht durchschaubaren Regeln«, stimmte ich zu, während ich mich erhob und dabei darauf achtete, die Rosen nicht abzuknicken.
»Nacht, Alter«, brummte Ole und schaffte es noch, die halb volle Bierdose zu seinen Büchern auf die Teekiste neben seiner Matratze zu stellen, bevor er sich in seiner Wolldecke einrollte und nahezu unverzüglich zu schnarchen begann.
Um drei Uhr lag ich schließlich im Bett. Ich hatte vorher noch die Rosen angeschnitten und in Ermangelung eines Behältnisses von angebrachter Größe in drei Vasen verteilt. Unsere Küche sah aus wie eine Filiale von Blume 2000.
In dieser Nacht hatte ich einen Traum. Und zwar von Monika! Ich träumte von ihren grünen Augen und ihrem Lachen. Sie saß in einem Korbstuhl, trug ein geblümtes Sommerkleid und schwenkte einen Quittungsblock. Hol mich ab, strahlte sie mich an. Hol mich ab! In drei Stunden bin ich fertig! Dann wachte ich auf. Ich atmete schwer. Sigmund Freud hätte seine Freude an mir gehabt.
»Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?«, fragte ich Ole fünf Stunden später beim Frühstück.
»Du, Robert, ich mag dich auch. Aber ich bevorzuge Frauen«, grinste er. Man muss Respekt haben vor einem Mann, der sich nur 300 Minuten zuvor dreieinhalb Liter Starkbier einverleibt hatte und nun schon wieder gut gelaunt alberne Witze absonderte.
»Ha ha«, sagte ich. »Im Ernst: Du bist doch Mediziner. Gibt es womöglich irgendein Das-ist-die-Richtige-Meldungshormon? Oder irgendwelche elektromagnetische Sympathiestrahlung oder so etwas?«
»Erstens«, lächelte Ole, »bin ich kein Mediziner, sondern Medizinstudent im vierten Semester. Und zweitens hege ich eine fundamentale Verachtung für Leute, die so etwas Wunderbares wie die Liebe auf biochemische Vorgänge zu reduzieren versuchen.«
»Okay, dann frage ich dich nicht als Mediziner, sondern als Romantiker: Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?«
»Als Romantiker: Ja. Unbedingt. Ich glaube, dass zwischen zwei Menschen schon beim ersten Händedruck Funken sprühen können, dass sich zwei Seelen binnen Sekunden verbinden, verknoten, auf ewig zusammenschweißen. Aber ich habe so meine Zweifel, ob es besonders häufig vorkommt, dass sich eben diese zwei Menschen tatsächlich treffen. Meine große Liebe wohnt vermutlich in der Kalahari.«
Ich sagte nichts.
»Wieso fragst du?«, wollte Ole wissen. »Gibt es da etwas, was du mir erzählen willst?«
»Weiß ich noch nicht«, antwortete ich wahrheitsgemäß. »Mir ist gestern etwas seltsames passiert, und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll.«
»Mmh«, brummte Ole und nahm einen weiteren Schluck aus dem Kaffeebecher. »Halt mich auf dem Laufenden, okay?«
»Mach ich«, versprach ich.
Kapitel 2
Das kleine Leuchtsignal, das uns Passagiere zum Anlegen des Sicherheitsgurtes auffordert, ist erloschen, und ich greife nahezu unverzüglich nach dem Gameboy, den ich stets in meiner Hemdtasche trage. Ich mag meinen Gameboy. Normalerweise stecke ich ein Rennspiel oder ein buntes Jump & Run, in dem ich irgendeinen Fantasyzwerg durch gefährliche Parcours steuern muss, in den Ladeschlitz und entspanne mich binnen Minuten. Heute allerdings steht mir mehr der Sinn danach, jemanden zu töten. Ich lade Ex vs. Sewer 3 ins Gerät – ein Ballerspiel der besonders martialischen Machart – und erlege binnen einer Minute zehn digitale Terroristen. Jetzt geht’s mir besser. Zumindest ein bisschen.
Ich habe mal in einer Zeitschrift ein Interview mit einem Psychologen gelesen, der den immensen Erfolg von Computer- und Videospielen darauf zurückführt, dass einem diese Games keinerlei Kreativität oder gar einen autonomen Denkprozess abverlangen, sondern den Spieler vielmehr durch bloßes Befolgen starrer Regeln zum Erfolg führen. Diese Spiele seien also symptomatisch für unsere geistig arme westliche Welt, die auf bloßen Konsum ausgerichtet sei und Individualismus zusehends verabscheue, hatte sich der Mann ereifert. Das ist zwar ziemlicher Blödsinn, und ich kenne mehr als genug Spiele, die sich ausschließlich durch Kreativität und Nachdenken lösen lassen, aber ich gebe gern zu, dass ich es mitunter genieße, keinen eigenen Gedanken fassen zu müssen. Ich bin tatsächlich ein besserer Mensch, wenn ich starre Regeln befolge. Wenn ich zu denken anfange, hat das nämlich mitunter katastrophale Auswirkungen.
Die Stewardess kommt den Gang entlang und verteilt Schokotäfelchen an die Passagiere. Als sie mir mein kleines Zartbitterstückchen reicht, lächelt sie mich nachdrücklich an. Ich lächle aber nicht zurück, sondern bedenke sie nur mit einem kurzen, ins Grimmige tendierenden Blick. Mir ist nicht nach Lächeln zumute. Ich will lieber Terroristen erschießen.
Die Stewardess sieht enttäuscht aus. Wahrscheinlich ist sie echt nett und ich habe gerade ihre Gefühle verletzt. Aber das ist mir jetzt ziemlich wurscht. Im Verletzen von Gefühlen habe ich schließlich eine gewisse Erfahrung …
Lorna kam direkt nach der Arbeit zu mir. Sie absolvierte ein Praktikum bei einem Innenarchitekten. Es war ihr mittlerweile fünfter Jobanlauf, seit ich sie kannte, und auch diesmal fand sie fast alles an dieser Tätigkeit »irgendwie uncool«. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie auch diese Stelle hinschmeißen und sich etwas Neues suchen würde, was sich dann aber zweifelsohne sehr schnell auch wieder als nicht gut und kreativ genug für sie entpuppen würde.
»Hi«, begrüßte ich meine Freundin, nachdem ich ihr die Tür geöffnet hatte.
»Hallo, Großer«, sagte sie, gab mir einen flüchtigen Kuss und zischte dann erst einmal in mein Badezimmer, um sich frisch zu machen. Ich fand es schon immer irritierend, wie oft Lorna während eines Tages ihr Make-up erneuerte und dass sie selbst bei unseren ruhigen Abenden daheim nicht darauf verzichten mochte, ihren Kajalstrich nachzuziehen und die Lippen mit frischem Rot zu tünchen. Es kam mir immer vor, als würde sie eine Tarnung anlegen, als hätte sie etwas zu verbergen. Mit einem gewissen Unwohlsein stellte ich fest, dass es längst mehr Dinge an Lorna gab, die mich störten, als welche, die ich mochte.
Ich hatte auf dem Heimweg beim Inder angehalten und zwei Mal Chicken Biryani mitgenommen, dazu eine Flasche Rotwein. Bei Saturn hatte ich vorher schon zwei DVDs gekauft – einen japanischen Anime-Film, den mir mein Kollege Jens empfohlen hatte, und den neuen James-Bond-Streifen. Der Plan war, dass Lorna und ich auf dem Sofa sitzen, ostasiatisch essen, Wein trinken und einen meiner zwei actionreichen neuen Filme gucken würden.
Lorna hatte zuerst ein wenig gequengelt. Sie wollte lieber clubben. Es gab irgendwo am Hafen eine neue Bar, deren DJ als heißer Geheimtipp galt. Obwohl Lorna nicht wirklich an Musik interessiert war, hätte sich beim Auschecken dieses angesagten Plattenauflegers die Chance für sie geboten, ihrer Lieblingsbeschäftigung zu frönen – dem Guckt-mal-alle-her-und-bewundert-mich-Spiel. Ich aber hatte keinen Bock auf noch eine Nacht voller hipper Menschen, bunter Drinks und exzessiven Namedroppings. Ich brauche hin und wieder einfach meine Ruhelöcher. Ich wollte Sesselpupen, ich wollte einen Abend daheim. Ganz friedlich, ganz nett, ganz unerheblich.
Aber dann kam alles ganz anders.
Die leeren Aluschalen des Inders standen auf dem Tisch, die Rotweinflasche war fast leer und 007 schon seit einer knappen Stunde mit der Rettung der freien Welt beschäftigt, als ich mich plötzlich zu Lorna umdrehte und sie zu ihrer und meiner eigenen Überraschung fragte: »Liebst du mich eigentlich?«
Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass üblicherweise Frauen so etwas die Männer fragen. Und dass Männer es hassen. Aber irgendein unwiderstehlicher Impuls drängte mich in diesem Moment dazu, Lorna mit einer profunden Frage zu konfrontieren. Einen Tag zuvor hatte ich Ole nach seiner Meinung über das Phänomen der Liebe auf den ersten Blick befragt, heute begab ich mich freiwillig auf beziehungsanalytisches Terrain mit meiner Freundin. Was war los mit mir? War da irgendein bescheuertes Warmduscherhormon in mir erwacht?
Ich hatte Lorna die ganze Zeit, während sie in den Fernseher schaute, aus dem Augenwinkel gemustert und dabei festgestellt, dass sie mich wütend machte. Sie nervte mich nicht, sie ärgerte mich nicht, sie rief bei mir tatsächlich Wut hervor. Das war unfair und gemein, denn sie hatte mir nichts, aber auch gar nichts getan. Trotzdem ertappte ich mich plötzlich dabei, dass es mich maßlos störte, wie sie mit den Schneidezähnen über ihre Unterlippe scharrte. Das tat sie immer, wenn sie sich konzentrierte. So ein dezentes Knuspern und Knostern mit ihren kleinen, weißen, perfekten Zähnen. Schnurp, schnurp, schnurp. Ich konnte mich erinnern, dass ich eben dieses Lippenscharren sehr süß gefunden hatte, als ich sie kennen lernte, und dass es etwas bedeuten musste, wenn es mich jetzt plötzlich fuchste. Wie kann etwas Anziehendes binnen so kurzer Zeit zu etwas Abstoßendem mutieren? Was war denn jetzt schon wieder los: Ich hatte eine bildschöne Freundin und mochte sie nicht mehr anschauen? Ich fand, dass ich das nicht einfach ignorieren konnte. Dass ich herausfinden musste, was nicht stimmte mit Lorna und mir. Und weil ich erschreckend oft vor dem Reden das Denken vergesse, fragte ich Lorna eben: »Liebst du mich eigentlich?«
»Natürlich liebe ich dich!«, lachte Lorna. Offenbar finden Frauen es im Gegensatz zu uns Kerlen keineswegs lästig, wenn man sie nach dem aktuellen Stand ihrer Emotionen befragt. Dann schickte sich Lorna an, mich zu küssen. Und es sollte kein Husch-Husch-Kuss werden, sondern – wie ihre ganze Körpersprache signalisierte – ein inniger Knutscher mit eventueller Fortsetzung im Bett. Sex mit Lorna war allerdings so ziemlich das Letzte, wonach mir in diesem Moment der Sinn stand – aber wie sich herausstellte, reichten bereits fünf Buchstaben, um ihre erotische Anwandlung im Keim zu ersticken.
»Wieso?«, fragte ich.
»Wie? Wieso?«, fragte Lorna verwirrt.
»Warum liebst du mich?«, spezifizierte ich meine Frage.
»Weil du cool bist«, antwortet Lorna wie aus der Pistole geschossen. »Und sexy. Und nett. Zumindest meistens.« Sie runzelte die Stirn. »Aber momentan bist du eher seltsam.«
»Oh, okay«, sagte ich. »Sorry.« Ich nahm einen Schluck aus meinem Rotweinglas und wandte mich wieder dem Bond-Film zu.
Thema erledigt?
Natürlich nicht.
»Wie jetzt … sorry?« Lorna nahm die DVD-Fernbedienung und drückte die Stopp-Taste. »Was soll denn das? Ist irgendwas? Willst du mir vielleicht irgendwas sagen?«
»Nee«, druckste ich herum. »Ich weiß auch nicht. Ich hab mich nur gewundert …«
»Worüber?«, fragte Lorna. »Über mich?«
»Über uns«, gab ich zu. »Was das ist mit uns beiden …«
»Was das ist?« Lornas Gesicht entgleiste. »Wir sind ein Paar! Wir lieben uns!«, rief sie. »Oder etwa nicht? Willst du mir den Laufpass geben, oder was?«
Ich schluckte.
Genau das wollte ich. Erst jetzt begriff ich, dass ich die Ouvertüre zu Lornas und meiner Trennung angestimmt hatte. »Nein, Quatsch«, sagte ich – jedoch halbherzig. »Wieso denn? Nee. Echt nicht. Also …«
Feigling!
»Es gibt nur so viel, was wir nicht voneinander wissen«, begann ich mich um Kopf und Kragen zu reden.
»Was denn?«, fragte Lorna und musterte mich skeptisch. Sie hatte keine Ahnung, worauf das alles hinauslief. Genauso wenig wie ich übrigens.
»Na ja, also: Willst du später mal verbrannt oder lieber beerdigt werden? Oder nach einem Unfall: Darf ich dann deine Organe spenden? Und willst du eigentlich Kinder? Wenn ja, wie viele? Und sollen die getauft werden?« Ich hätte mir selbst in den Arsch treten können. Was, um Himmels willen, faselte ich da?
Lornas Kinnlade fiel nach unten. Sie war völlig perplex. »Ob ich verbrannt werden will?«, kreischte sie. »Bist du bescheuert?«
Ich zuckte mit den Schultern. Frauen sollten sich zweimal überlegen, ob sie sich wirklich darüber aufregen wollen, dass wir Männer so selten über unsere Gefühle sprechen. Wenn wir es nämlich tatsächlich mal versuchen, muss man damit rechnen, dass so ein Bockmist dabei herauskommt.
»Liebst du mich denn?«, schrie Lorna. »Oder willst du mich nur verbrennen?«
Ich seufzte.
Lorna sah mich lange an, vergeblich auf eine Reaktion wartend. »Liebst du mich?«, wiederholte sie schließlich ihre Frage, diesmal mit bedrohlich ruhiger Stimme.
»Weiß nicht«, sagte ich leise. Und ohne sie dabei anzusehen. »Ich … ich glaube nicht.«
Jetzt war es raus.
Warum konnte ich nicht irgendeine der Standardfloskeln runterspulen? Es ist nicht deine Schuld, sondern meine. Ich habe gerade eine Krise, wahrscheinlich bin ich beziehungsunfähig. Du hast etwas Besseres als mich verdient. Laber-rhabarber-und-so-weiter. Bisher hatte ich meine Freundinnen wirklich eleganter abserviert.
Lorna starrte mich an. Ich sah, wie ihre Augen feucht wurden. Dann stand sie auf, verließ das Zimmer, zog sich im Flur ihre Jacke an und ging, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Immerhin verzichtete sie nicht darauf, die Wohnungstür mit voller Wucht zuknallen.
Ich saß nur da. Ich hatte plötzlich Kopfschmerzen. Nach einer knappen Minute, in der ich nichts tat, außer verwirrt zu sein, nahm ich die Fernbedienung und drückte die Play-Taste. 007 war cool. Der hätte sich so einen peinlichen Ausfall wie ich eben nicht erlaubt – wahrscheinlich, weil er weiß, dass so ziemlich alle Frauen, mit denen er etwas hat, entweder bald sterben oder sich als feindliche Agentinnen entpuppen, und es deshalb ohnehin keinen Sinn macht, über sie nachzudenken.
Kurz darauf trat Ole ins Zimmer. Er hatte von seinem Zimmer aus zumindest Fragmente unseres Streites mitbekommen.
»Maibock?«, fragte er und hielt mir eine der übrig gebliebenen Dosen der letzten Nacht hin.
Ich überlegte kurz. Starkbier nach Rotwein war wahrscheinlich keine gute Idee. Aber dann dachte ich, dass es bescheuert wäre, ausgerechnet jetzt etwas Vernünftiges zu tun, nahm Ole also wortlos die Dose aus der Hand und ließ sie zischen. Mein bester Freund setzte sich neben mich und schaute in den Fernseher. »Ich finde diese Bond-Filme total öde«, sagte er, machte aber keine Anstalten zu gehen.
Und ich? Ich hatte ein schlechtes Gewissen wegen dem, was ich eben getan hatte.
Aber irgendwie war ich auch erleichtert.
Als ich am nächsten Tag im Büro am Schreibtisch saß und die aktuellen Spielezeitungen durchblätterte, um nachzuschauen, ob unser neues Playstation-2-Spiel Racoon vs. Bandicoot die erhofft guten Wertungen bekommen hatte, fragte ich mich, ob ich Lorna anrufen sollte. Ja, dachte ich, das wäre anständig von mir.
Andererseits: Was sollte ich ihr sagen? Wenn ich ihr sagte, es täte mir Leid, lief ich nur Gefahr, dass sie mir verzieh. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Es ist fies, aber ich gebe zu, dass es mir am liebsten gewesen wäre, wenn Lorna einfach aus meinem Leben herausgerutscht, wenn sie einfach verpufft wäre. Tschüss und das war’s. Sie könnte doch plötzlich die neue Freundin von Tom Cruise sein. Oder George Clooney. Oder meinetwegen auch Steve-P. Sie dürfte gern 10 Millionen Euro im Lotto gewinnen, die Erde in ihrem Privatjet bereisen und sich Hawaii als Urlaubsinsel kaufen. Ich wünschte ihr wirklich alles erdenklich Gute – Hauptsache, ich wäre kein Teil mehr davon. Ich wollte sie happy entschwinden sehen, ohne formelle Trennung, ohne Streit, Vorwürfe und Erklärungen. Aber das ging natürlich nicht so einfach. Ich wusste, dass Lorna eine Erklärung, wenn nicht sogar eine Entschuldigung verdiente. Nicht dafür, dass ich mich von ihr getrennt hatte, aber dafür, wie ich es getan hatte.
Dennoch schob ich den Anruf bei Lorna, der mich als emotional zumindest halbwegs reifen Menschen ausgewiesen hätte, auf die lange Bank. Männer, das ist bekannt, hoffen heimlich stets, dass sich Dinge von selbst lösen. Tun die Dinge aber leider nicht. Sie werden üblicherweise immer nur noch schlimmer. Heute weiß ich, dass es klüger gewesen wäre, das Gespräch mit Lorna so schnell wie möglich zu führen. Aber heute weiß ich sowieso eine Menge Dinge, die ich damals nicht mal ahnte. Zum Beispiel, dass ich mich nicht zuletzt wegen Monika von Lorna trennen wollte. Diese magische, magnetische, mysteriöse Schnellreinigungsfrau hatte bei mir, ohne es zu ahnen, einen raren Anfall von Selbsterkenntnis hervorgerufen. Ich hatte schon länger gespürt, dass Lorna und ich ein schwaches Team waren, aber erst Monikas Auftauchen hatte mich dazu veranlasst, die Konsequenz aus dieser Erkenntnis zu ziehen. Seit zwei Tagen geisterte mir diese grünäugige Frau bereits im Kopf herum. In völlig unerwarteten Momenten presste mein heimtückisches Gehirn ein Bild von Monikas Gesicht in mein Bewusstsein oder ließ mich ihre Stimme hören, diese ziemlich tiefe, leicht rauchige Stimme, die so gar nichts mit dem kieksig-fiepsigen Kleinmädchenduktus zu tun hatte, den meine bisherigen Freundinnen auch nach dem Ende der Pubertät noch nicht ablegen mochten. Monikas Stimme war aufregend. Und diese Augen! Dieses Lächeln! Es war der blanke Wahnsinn, aber diese Frau hatte tatsächlich von mir Besitz ergriffen.
Natürlich sagte ich mir, dass ich eine Klatsche hätte, dass ich mich da in etwas hineinsteigern würde. Himmel, ich hatte Monika drei Minuten lang gesehen. Sie war eine wildfremde Frau – obendrein noch fast so alt wie meine Mutter –, die nichts getan hatte, als mich mit meinem ketchupgetränkten Sakko aufzuziehen. Da musste ich mir doch nicht gleich einreden, dass sie etwas Besonderes sein könnte. Dafür gab es überhaupt keine rationalen Anhaltspunkte. Wahrscheinlich war sie sowieso verheiratet.
Nee, war sie nicht. Sie trug keinen Ring!
Oder sie hatte einen Lebensgefährten.
Oder …
Ich bombardierte mich innerlich mit Dutzenden von logischen Einwänden gegen meine aufkeimende Obsession für diese fremde Frau – während ich gleichzeitig in der Telefonbuch-CD-ROM ihren Nachnamen suchte. Es gab zwölf Bleckners in Hamburg, verriet mir das Programm. Aber nur eine Monika Bleckner. Sie wohnte in Barmbek, in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Denhaide. Das war nicht allzu weit von der Jarrestadt, wo ich arbeitete, entfernt …
Mein Chef war ein netter und flexibler Mensch. Als ich ihm kurz nach Ende meiner Probezeit mitgeteilt hatte, dass ich zumindest einen Teil meiner beträchtlichen Überstunden und Wochenendarbeit dadurch ausgleichen wollte, dass ich dreimal die Woche meine Mittagspause auf zwei Stunden ausdehnen würde, um sie für einen Besuch im Fitnessstudio an der Mundsburg zu nutzen, hatte er damit kein Problem. Und so stiefelte ich auch an diesem Tag Punkt 12 Uhr 30 aus dem Bürogebäude, meine schwarze Nike-Sporttasche in der Hand, die ich am Times Square in New York gekauft hatte und die sich später als billiges Hongkong-Imitat entpuppte, deren Nähte sich auflösten und deren Trageriemen eines Tages ohne Vorwarnung einfach in der Mitte durchriss. Ich wollte wirklich ins Fitnessstudio gehen, auf dem Stepper schwitzen und mich an den Geräten mit zehn Extrakilos auf den Gewichten für mein beknacktes Verhalten kasteien. Aber als ich an der Bushaltestelle ankam, von der aus ein Bus mich die üblichen drei Stationen bis zum Studio transportieren sollte, ging ich einfach weiter. Ich gestattete meinen Beinen, meinem Instinkt und jenem Teil meines Gehirns, der mir nun schon seit zwei Tagen das Leben schwer machte, die Kontrolle zu übernehmen. Und so ging ich … genau … in Richtung Schnellreinigung.
Bis dato hielt ich mich weiß Gott nicht für einen romantischen Menschen. Wirklich nicht. Ich sah mich als Pragmatiker. Ich brauchte Gründe für meine Taten, ich brauchte Strategien, Konzepte, Ziele. Dieser ungeplante Fußmarsch zu Monikas Arbeitsplatz machte jedoch keinerlei Sinn. Ich hatte keine Ahnung, was ich dort wollte. Dreht um, befahl also mein vernünftiges Ich meinen Beinen. Halt die Klappe, blaffte meine verrückte Hälfte, die offenkundig längst die Machtübernahme in die Wege geleitet hatte, zurück. Mein vernünftiges Ich war beleidigt, vielleicht auch eingeschüchtert. Jedenfalls schwieg es fortan. Und so ging ich weiter.
Als ich an einem Lidl-Supermarkt vorbeikam, hatte ich für einen kurzen Moment die groteske Idee, eine Flasche Ketchup zu kaufen, sie über meine Windjacke zu kippen und so einen Vorwand zu haben, Monikas Reinigung betreten zu können. Aber ich war dann doch smart genug zu erkennen, dass das allzu offensichtlich gewesen wäre.
Schon wieder Ketchup? Unmöglich!
Ich griff also in meine Sporttasche und nahm das isotonische Maracujagetränk heraus, Sirupanteil 7 %, und goss den halben Inhalt kurz entschlossen über meine Jacke, ohne sie vorher auszuziehen. Eine alte Dame, die mir just in diesem Moment entgegenkam, schüttelte nur den Kopf. Die Jugend von heute machte einfach keinen Sinn mehr!
Monika lachte. Ein lautes, raues Lachen, tief aus dem Zwerchfell, ungetrübt von eitlen Zweifeln, ob es weiblich und attraktiv genug sei. Ein wahrhaftiges Lachen. Dabei wurden ihre Augen ganz schmal, funkelten aber weiter und hatten plötzlich etwas katzenhaftes.
»Bei Budnikowski haben sie Lätzchen im Angebot«, lachte sie. »Drei Stück für 3,99. Das könnte eine sinnvolle Investition für Sie sein. Das wird ja langsam zur Gewohnheit.« Sie hob meine Jacke hoch und musterte ungläubig den überdimensionalen Maracujafleck.
»Ich bin beim Trinken gestolpert«, erklärte ich.
Monika hob die linke Augenbraue hoch, sah mich grinsend an und versah meine Jacke mit einem nummerierten Quittungsabschnitt. »Morgen zur selben Zeit ist die Jacke sauber, Herr Zimmermann«, lächelte sie, reichte mir meine Quittung und wandte sich dann einem Bettlaken zu, das auf dem Tisch hinter ihr auf eine Heißmangelbearbeitung wartete.
Wenn ich einen weniger markanten Namen gehabt hätte, wäre es leichter gewesen, zu glauben, dass sie ihn sich absichtlich gemerkt hätte.
»Äh …«, hob ich an.
Monika drehte sich wieder um und lächelte mich an. »Ja?«
»Äh …«, versuchte ich es noch einmal, »ich wollte mich noch bedanken. Für das Sakko vorgestern. Dass das so schnell ging.«
»Keine Ursache«, sagte Monika. »Gern geschehen. Lara war übrigens ganz aufgeregt wegen der Blumen.«
»Die wollte ich eigentlich Ihnen geben«, verriet ich.
Monika lächelte nur.
»Also …«, stammelte ich. »Ich geh dann mal.«
»Wir sehen uns morgen«, sagte Monika. Ihr Blick war ein ganz, ganz klein bisschen anders als sonst. Spüren Frauen, wenn sie einem Mann gefallen?
»Bis morgen also.« Ich hob schlaksig meine Hand, als wollte ich ihr zuwinken, nahm sie dann aber schnell wieder herunter, weil das eine dusselige Geste war.
»Bis morgen«, grinste Monika. Es war offenkundig, dass ich sie amüsierte. Nicht ganz der Effekt, den ich mir erhofft hatte. Das war kein Flirt geworden – das war peinlich. Monika machte schon wieder Anstalten, sich von mir abzuwenden.
Sag was, Robert!, befahl mir eine meiner neuerdings inflationär auftretenden inneren Stimmen. Das ist deine letzte Chance!
»Sie …«, stotterte ich, »Sie ha … haben sehr schöne Augen.«
O mein Gott! War ich jetzt völlig durchgedreht?
Monika sah mich verblüfft an. »Danke«, sagte sie irritiert, drehte mir dann endgültig den Rücken zu und beschäftigte sich kopfschüttelnd mit der Bettwäsche.
Okay, jetzt war es richtig peinlich.
Ich verließ den Laden.
Als ich draußen auf der Straße stand, konnte ich es immer noch nicht fassen. Äh, Sie haben sehr schöne Augen! Was war bloß los mit mir? Ich bin normalerweise weder schüchtern noch ein Fettnäpfchentreter. Wenn dem so wäre, könnte ich mich in meinem Job kaum behaupten. Ich habe ständig mit Promis und Models zu tun, die wir für die Werbe- und Marketingkampagnen unserer Spiele einspannen, und noch nie hat mich einer dieser wahlweise schönen oder wichtigen oder berühmten Menschen auch nur ansatzweise eingeschüchtert. Ich kann bei Messen und Conventions mit den makellos gebauten Hostessen am Stand herumschäkern, ich kann auf Partys inmitten von zehn bauchfrei gekleideten, extraleckeren Mädels sitzen und amüsante Storys erzählen und dabei völlig entspannt, lässig und womöglich sogar ein bisschen gelangweilt sein. Aber bei Monika Bleckner, Schnellreinigungsangestellte jenseits der 40, schmolz meine Souveränität wie Butter in der Sauna. Ich hatte mich völlig zum Affen gemacht.
Äh, Sie haben sehr schöne Augen?
Ich schämte mich in Grund und Boden!
Als ich noch überlegte, wie ich diesen erbärmlichen Auftritt je wieder wettmachen könnte, klingelte mein Handy. »Zimmermann«, meldete ich mich förmlich. Es war schließlich das Firmenhandy.
»Hier auch«, sagte eine Frauenstimme am anderen Ende. Meine Mutter. »Bringst du diesen Sonntag Lorna mit?«, fragte sie, ohne sich vorher die Mühe eines höflichen Wortgeplänkels zu machen.
Jeden zweiten Sonntag besuchte ich meine Eltern zum Mittagessen – und jedes Mal betete ich, dass meine Mutter kein neues exotisches Kochbuch in die Finger bekommen hatte und mir karibische Hühnerleber mit Mangosauce oder Fisch in Bananenblättern servierte. Meine Mutter war eine grandiose Köchin konventioneller Gerichte – ihr Schweinebraten war eine Klasse für sich –, aber regelmäßig bekam sie den Rappel, sich an internationalen Spezialitäten versuchen zu wollen. Da meine Mutter aber ein ausgesprochener Sturkopf war, sich niemals von einem Kochbuch vorschreiben lassen würde, wie ein Essen korrekt zubereitet wird, und die fremden Rezepte stets variierte, verfeinerte oder gar verbesserte, haben mein Vater, meine Schwester und ich schon am eigenen Leib erfahren müssen, wie es schmeckt, wenn Teriyakisauce mit Maggi aufgepeppt wird, wenn man das arabische Kichererbsengemüse mit Bechamelsauce anrührt und wenn eine resolute Köchin das Sashimi, weil es roh »irgendwie seltsam« aussieht, kurz entschlossen paniert und in die Pfanne wirft. »Das sind die teuersten Fischstäbchen, die ich je gegessen habe«, hatte mein Vater damals trefflich bemerkt und von meiner Mum einen ihrer legendären Giftblicke kassiert.
»Ich glaube nicht, dass Lorna diesmal mitkommt«, antwortete ich meiner Mutter und hoffte, dass sie keine Erklärung für das Fernbleiben meiner Freundin verlangte. Lorna war meine erste Begleiterin zu einem der traditionellen Sonntagsessen gewesen, die je Gnade in ihren Augen gefunden hatte. Sie hatte sich den Respekt ihrer potenziellen Schwiegermutter dadurch verdient, dass sie bei meinem Einzug in die Zweier-WG mit der Putzhilfe ihrer Mutter auftauchte, die arme russlanddeutsche Seniorin von Wisch-Einsatz-Areal zu Wisch-Einsatz-Areal scheuchte und sich dabei meiner Mutter gegenüber wortreich über das mangelnde Hygienegespür der Gattung Mann ausließ.
»Lorna hat irgendeinen anderen Termin«, log ich. Ich würde die Trennung von Lorna meinen Eltern erst publik machen, wenn ich nicht mehr so verwirrt darüber war und sie mit authentischer Gelassenheit als Lappalie herunterspielen konnte.
»Das ist gut«, sagte meine Mutter überraschenderweise.
»Wie bitte?«, fragte ich nach.
»Es ist ganz gut, dass Lorna diesmal nicht mitkommen kann. Papa und ich müssen nämlich etwas mit dir besprechen«, erklärte meine Mutter und verhinderte eine Rückfrage meinerseits, indem sie gleich darauf sagte: »Bis Sonntag also. Es gibt Schweinebraten. Tschüss, Robbie.«
Klick.
An einem anderen Tag hätte ich ob dieser Ankündigung vermutlich zu grübeln begonnen, was meine Eltern mir mitzuteilen gedachten, aber an diesem Tag war ich viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich stand auf der Straße – peilungslos, blamiert und von mir selbst entsetzt – und fragte mich, was ich nun tun sollte.
Sollte ich doch noch ins Fitnessstudio gehen? Wenn ich das Laufband weglassen würde, konnte ich den Rest des Trainingsplans noch absolvieren. Aber an diesem Tag regierte bei mir die blanke Unlogik. Als hätte ich nicht schon ausreichend dumme und peinliche und unüberlegte Sachen getan, als wäre dies nicht der perfekte Zeitpunkt gewesen, die groteske Fixierung auf eine gewisse Monika Bleckner zu beenden und mich wieder meinem Alltag zuzuwenden, ging ich stattdessen zum nächsten Taxistand. Ich stieg in den ersten wartenden Wagen und nannte dem Fahrer Monikas Adresse, die ich in der Telefon-CD nachgeschlagen und in mein Gedächtnis eingebrannt hatte. Ich wollte sehen, wo und wie die Frau, die mein Gehirn kontrollierte, wohnt.
Als ich ein paar Minuten später aus dem Taxi stieg, betrachtete ich eine monotone Abfolge von Hausfassaden. Barmbek ist einer der eher unschicken Stadtteile Hamburgs, eine reine Wohngegend, ehemals ein »Arbeiterviertel«, in dem drei- bis fünfstöckige Mietshäuser aus rotem Klinkerstein das Straßenbild beherrschen. In einem dieser Blöcke wohnte Monika. Es war weder ein Alt- noch ein Neubau, sondern bloß ein zeitloser, funktionaler Wohnkasten, deren Zwei- oder Dreizimmerwohnungen wahrscheinlich nur mit einem besonders geschickten Händchen für Inneneinrichtung eine persönliche Note entwickelten. Anders als beispielsweise ein stuckverziertes Jugendstilhaus oder ein verwinkeltes, gläsernes Penthouse hatten diese Gebäude keinerlei Eigenschaften, keinen eigenen Charakter, keine Aura.