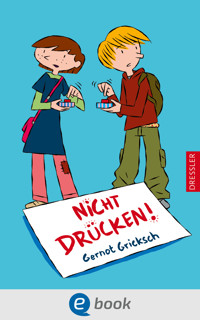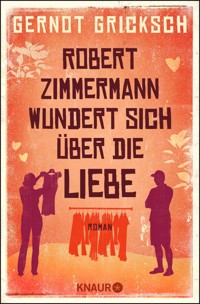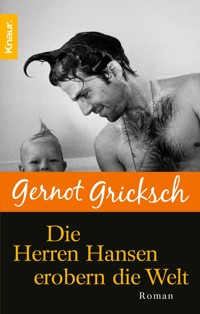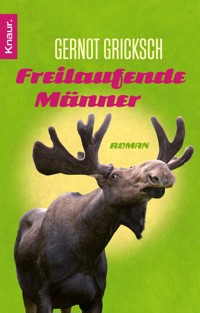
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich bin kein Das-Glas-ist-halb-voll-Typ, auch kein Das-Glas-ist-halb-leer-Mensch. Das wäre zu simpel. Ich bin eher ein Das-Glas-ist-zwar-hübsch-aber-ein-bisschen-dreckig- und-das-Zeug-darin-schmeckt-irgendwie-seltsam-Mann.« Thomas hat keine Ahnung, was er mit seinem Leben anfangen soll – dafür aber als leidenschaftlicher Hypochonder einen eingebildeten Herzinfarkt pro Woche. Seinen besten Freunden Jens und Malte geht es nicht viel besser. Darum wollen die drei Midlife-Crisis-Opfer an einem nordschwedischen See gemeinsam ausspannen, grillen, angeln, die Seele baumeln lassen. Ein Männerurlaub eben, ganz ohne Stress und Komplikationen. Doch dann taucht eine Frau auf. Kurz darauf noch eine. Und schon haben drei freilaufende Männer ein gewaltiges Problem ... Freilaufende Männer von Gernot Gricksch: als eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Gernot Gricksch
Freilaufende Männer
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Motto
Der Tisch wird weich. [...]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Vierzehn Monate später
Selbst der stärkste Mann
kann sich nicht selbst in die Höhe heben.
Konfuzius (551 – 479 v. Chr.)
Der Tisch wird weich. Ich kralle mich mit den Händen in die Tischplatte, doch die sabscht unter meinen Fingern weg, als hätte sie sich von einer Sekunde auf die andere in Schmelzkäse verwandelt. Ich schwitze. Der Schweiß läuft mir über das Gesicht, als würde es Salzwasser regnen. Und während ich so dasitze, starr vor Angst, während meine Finger in dieser elenden Tisch-Scheiblette versinken und meine Knie von einem Augenblick auf den anderen zwar zu zittern aufhören, dafür aber gar nicht mehr zu existieren scheinen, einfach verschwinden, sich in Luft auflösen, während ich also völlig die Kontrolle verliere, höre ich aus weiter Ferne, durch einen trüben Nebel aus verschwommenen Bildern und leisem Summen und Brummen, Maltes Stimme.
»Alles okay, Thomas?« Es gelingt mir, meinen Kopf in Maltes Richtung zu drehen … und sehe, dass seine Sorge nicht gravierend zu sein scheint. Malte trinkt einen großen Schluck aus seinem Bierglas und ist bereits dabei, seinen Blick wieder von mir abzuwenden, um die Blonde am Tresen abzuchecken.
»Ich …«, röchele ich, »ich kriege … keine … Luft.«
»Was?« Jetzt wird mir doch Maltes komplette Aufmerksamkeit zuteil.
»Luft!«, ächze ich. Es gelingt mir, meinen linken, offensichtlich vollkommen muskellosen Arm leicht zu heben und in Richtung meiner Brust zu bewegen. »Mein … Herz!«
»O Scheiße!«, schreit Malte und springt auf. Er läuft um den Käsetisch herum – der seltsamerweise unter seinen Händen starr und fest bleibt – und packt meinen Kopf. »Guck mich an!«
Na super, denke ich. Das Letzte, was ich auf dieser Welt zu sehen bekomme, ist das Gesicht eines pomadigen Weiberhelden.
»Total glasig!«, keucht Malte und brüllt dann zum Tresen hinüber: »Einen Krankenwagen! Schnell! Mein Kumpel hat einen Herzinfarkt!«
Ich sacke auf meinem Stuhl immer tiefer in mich zusammen, während ich in dem verzweifelten Versuch, meiner Lunge zumindest eine Minimalversorgung an Sauerstoff zukommen zu lassen, immer schneller und immer hastiger nach Luft schnappe. Alles dreht sich. Und jetzt verwandelt sich auch noch der Stuhl in eine schwammige Masse. Ich rutsche von ihm hinunter, doch bevor ich auf dem Boden aufschlage, fängt mich Malte auf … nur um mich einen Augenblick später, kaum langsamer und nicht weniger schmerzhaft, auf das speckige Linoleum krachen zu lassen.
Malte beugte sich über mich. Sein Gesicht kommt immer näher.
»Was machst du denn da?«, höre ich eine fassungslose Stimme. Das ist Jens. Kommt der also auch endlich mal von der Toilette zurück.
»Ich fange mit der Mund-zu-Mund-Beatmung an«, klärt ihn Malte auf. »Er kriegt keine Luft!«
Jens zieht Malte zur Seite. »Bisschen früh für Wiederbelebung, oder?« Seine Stimme klingt erstaunlich gelassen.
Jetzt sehe ich Jens’ Gesicht über mir. »Du hast doch gar nichts getrunken«, wundert er sich.
Das wird ja immer schöner! »Keine Luft«, keuche ich, um auch ihm den Ernst der Lage zu verdeutlichen. »Mein Herz!«
»Krankenwagen kommt sofort«, höre ich nun eine andere Stimme. Durch den Nebel erkenne ich, dass sich inzwischen ein halbes Dutzend Gäste um meinen mehr oder weniger reglos daliegenden Körper geschart haben. Ich höre eine Sirene.
Sie kommt näher.
Und dann wird alles hell.
1. Kapitel
Einen Monat bevor mein Körper mich in einer Hamburger Kneipe so schmählich im Stich lassen wird, schien die Welt noch halbwegs in Ordnung. Keiner von uns dreien ahnte, was das Leben für uns in der nahen Zukunft an heimtückischen Überraschungen bereithalten sollte.
Exakt achtundzwanzig Tage vorher, vier Samstage vor meinem Kneipenkollaps, spielten Jens, Malte, mein unzuverlässiger Körper und ich sogar Squash. Wir sind kein eingeschworenes Sportlertrio oder so etwas. Es war eine spontane Idee. Malte hatte den Court in seinem Stamm-Squashclub einfach mal für eineinhalb Stunden gebucht, damit wir drei Männer uns ohne Zeitdruck und im steten Wechsel die Bälle um die Ohren schlagen konnten.
Ich hatte schon seit Jahren nicht mehr gesquasht. Ich erzähle zwar oft, wie gern ich mich mal richtig auspowere, mache es dann aber tatsächlich so gut wie nie. Bereits wenn ich fünfzehn Minuten auf dem Trainingsfahrrad strample, sehe ich so rot aus wie eine Tomate und halte Jan Ullrich für den bewundernswertesten Menschen der Welt. Ich stelle den Schwierigkeitsregler meines Trainingsfahrrads ja nicht mal auf Bergauf. Ich bin eine Flachland-Lusche.
Jens ist schon ein wenig fitter. Er hat bis vor fünf Jahren regelmäßig Racketball gespielt. Doch dann musste er sein Hobby aufgeben: Er hat eine eigene Fahrschule, eine Frau und drei Kinder. Was er deshalb nicht hat, ist Zeit. Jedenfalls nicht für Sport.
»Okay, Mädels!«, lachte der fast schon obszön sportliche Malte und klopfte mit dem Schläger auf die Seitenwand des Courts. »Wer will zuerst von mir abgebügelt werden?« Er trug sündhaft teure Nike-Sportschuhe, eine perfekt sitzende Sporthose, ein enges, seinen im Fitnessstudio gestählten Oberkörper betonendes Marken-T-Shirt und ein Stirnband, das sein schwarzes, gegeltes Haar im Zaum hielt. Sein Schläger sah ebenfalls ziemlich teuer aus. Natürlich tat er das.
Ich dagegen trug eine 19,95-Euro-Jogginghose, meine schon ziemlich abgeschabten Adidas-Laufschuhe und ein T-Shirt der Powerpuff Girls. Die Powerpuff Girls sind eine Zeichentrickserie für Kinder. Es ist keineswegs so, dass ich morgens um 7 Uhr 40 Super-RTL einschalte, um mir die drei Mangamädels anzuschauen. Tatsächlich habe ich die Sendung noch nie in meinem Leben gesehen. Ich fand nur das Wort so lustig, dass ich das T-Shirt einfach kaufen musste. Powerpuff! Wie ein Bordell, in dem man sich anstrengen muss.
Ich drehte den Schläger, den ich am Tag zuvor nach einigem Wühlen im Keller wiedergefunden hatte, in der Hand und sah Jens an: »Mach du mal zuerst. Ich guck euch zu und versuche, mich dabei an die Regeln zu erinnern.«
»Du willst ja bloß, dass ich außer Atem bin, wenn du ins Spiel kommst«, lachte Malte. »Aber das wird dir auch nichts bringen! Dich würde ich auch noch besiegen, wenn ich schon am Tropf hänge!«
Jens seufzte. Manchmal nervte ihn Maltes Großmäuligkeit. Er holte seinen Racketballschläger aus der Hülle.
»Was willst du denn damit?«, fragte Malte erstaunt.
»Damit kann man auch Squash spielen«, entgegnete Jens. »Kein Grund, sich für teures Geld einen Squashschläger zu leihen oder zu kaufen.« Jens ist ein sparsamer Mensch. Muss man wohl auch sein, wenn man eine Fahrschule hat. Und eine Frau. Und drei Kinder.
»Na, wenn du meinst … aber jetzt mal los, los«, trieb Malte ihn an. »Können wir endlich mal loslegen?«
Jens seufzte noch einmal. Als er sein schlichtes blaues T-Shirt in den Hosenbund der Shorts steckte, zeichnete sich sein Bauchansatz ab. Wir wurden eben alle nicht jünger.
Mit Jens war ich befreundet, seit ich denken kann. Wir waren schon zusammen auf der Schule. Malte dagegen kannte ich erst seit gut zwei Jahren. Er war Geschäftsführer der TV-Produktionsfirma Punchline Entertainment, für die ich als freier Autor arbeitete. Ich versorgte ihn mit launigen Sketchen und Blödelmonologen für eine von ihm produzierte Comedyshow. Streng genommen war mein Kumpel also gleichzeitig mein Boss. Jens und Malte hatten sich erst vor vier Monate kennen gelernt. Wegen Schweden.
Schweden!
Jens und ich hatten diesen Urlaub seit fast zwei Jahren geplant. Vier komplette Wochen wollten wir uns aus der Tretmühle ausklinken – faulenzen, angeln, grillen, ein bisschen wandern, reden und schweigen, bis wir wieder genug Energie für den Alltag geladen haben würden. Es war ein Traum, den wir lange geträumt hatten und der nun endlich bald wahr werden sollte.
Eines Tages hatte ich Malte von dem geplanten Trip erzählt – und weil der ein Freund schneller Entscheidungen ist, hatte er sich spontan bei uns eingeklinkt. Jens hatte damit kein Problem. Zum einen senkte ein weiterer Mitreisender die Kosten, zum anderen war er nach ihrem ersten Treffen von Malte noch schwer angetan. Maltes ebenso souveräne wie schillernde Mann-von-Welt-Masche hatte meinen eher ruhigen und unspektakulären Kumpel schwer beeindruckt. Malte fand Jens im Gegenzug zwar sympathisch, allerdings auch ein wenig zu brav. Einmal hatte er ihn sogar als »graue Maus« bezeichnet. Eine keineswegs harmlose Frotzelei, zumindest nicht für Malte. Denn der hat regelrechte Angst vor der Unauffälligkeit. Als ob sie einen verschlingen könnte wie Treibsand. Malte wollte bemerkt werden. Das war der Sinn seines Lebens.
Wir hatten uns über das Internet eine verhältnismäßig luxuriöse Blockhütte – man könnte sie auch Blockvilla nennen – in Jämtland gemietet. Es verging kaum ein Tag, an dem ich nicht die Website des Vermieters besuchte und mir die Fotos des idyllisch gelegenen Domizils anschaute. Ich konnte es kaum abwarten aufzubrechen.
Jämtland liegt ziemlich weit oben im Norden Schwedens, und was der Reiseführer zu dieser Region zu sagen hatte, klang mehr als verführerisch:
Das leicht gebirgige Jämtland grenzt an Norwegen und ist eines der letzten unberührten Naturgebiete Europas. Nicht einmal zwei Prozent der Fläche sind bebaut. Jämtland ist reich an Wald, grünen Wiesen, kristallklaren Gewässern und sogar schneebedeckten Berggipfeln. Hier leben zahlreiche vom Aussterben bedrohte Tiere wie Bär, Vielfraß und seltene Marder. In den rund dreitausend Flüssen und Seen, die Jämtland prägen, gibt es einen reichen Fischbestand verschiedenster Arten, was auf Sportangler starke Anziehungskraft ausübt.
Nicht nur auf Sportangler. Auch auf mich. Auf uns. Jens, Malte und ich gierten dieser Auszeit regelrecht entgegen. Gemeinsame prä-schwedische Unternehmungen wie dieser Squashsamstag sollten vor allem dazu dienen, dass wir unsere Bande enger schnürten und so eventuellen Reibereien im Urlaub vorbeugten. Speziell Jens und Malte hatten ja noch einige Kennenlernarbeit zu leisten. Ich hoffte sehr, dass meine beiden ungleichen Freunde sich im Laufe der Zeit etwas annähern würden, hatte diesbezüglich aber so meine Zweifel. Dass Gegensätze sich anziehen, ist ein Mythos, oder?
Malte war anders als Jens, Jens war anders als Malte und beide waren anders als ich. Was sie gemeinsam hatten – und was sie von mir unterschied: Sie waren im Großen und Ganzen gut drauf. Ich dagegen fand gern mal das Haar in der Suppe. Für mich steckte die ganze Welt voller lästiger Umwege, Fallstricke und tiefer Gruben. Ein einziger langer Hindernislauf.
Zwar war ich durchaus stolz darauf, dass ich meine negativen Gedankengänge zumeist für mich behielt oder bloß in sarkastische Witze verpackte, um den Menschen um mich herum mit meiner Unzufriedenheit und meinen mentalen Macken nicht die Laune zu versauen. Doch manchmal wünschte ich mir, ich könnte nicht nur den anderen, sondern auch mir vorgaukeln, dass mir die Dinge leicht fielen.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Weder weinte ich nachts in mein Kissen, noch hasste ich mein Dasein, und schon gar nicht dachte ich darüber nach, mich aus irgendeinem Fenster zu werfen. Ich lebte gern. Wirklich. Ich hatte nur manchmal das Gefühl, ich hätte die falsche Gebrauchsanweisung fürs Leben mitbekommen. Oder das falsche Leben. Optimismus war einfach nicht mein Ding. Ich war nie ein Das-Glas-ist-halb-voll-Typ. Ein Das-Glas-ist-halb-leer-Mensch war ich allerdings auch nicht. Das wäre zu simpel gewesen. Ich war eher ein Das-Glas-ist-zwar-hübsch-aber-ein-bisschen-dreckig-und-das-Zeug-darin-schmeckt-irgendwie-seltsam-Mann.
Verständlich also, dass ich Malte und Jens beneidete. Ich beneidete sie nicht um ihre Leben an sich, mit denen ich nichts hätte anfangen können – weder mit Maltes hochtouriger, statussymbolgespickter Dauerparty noch mit Jens’ irgendwie piefiger und spießiger Familienidylle. Aber ich beneidete die beiden um ihre Einstellung. Sie hatten die Dinge im Griff. Sie nahmen das Leben, wie es kam, sie richteten sich im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten komfortabel darin ein und fanden so ihre Glücksnischen. Aber ich? Ich konnte das nicht. Ich war irgendwie immer auf der Suche. Blöderweise suchte ich vorwiegend nach der Antwort auf die Frage, was genau ich eigentlich suchte.
Exakt in der neunzigsten Minute unseres Squashmarathons traf mich Maltes Ball mit voller Wucht am Hinterkopf. Für einige Sekunden wurde mir schwarz vor Augen. Ich taumelte, stützte mich an der Plexiglaswand ab und atmete tief durch. Dann war alles wieder okay.
»Scheiße, das hat wehgetan!«, meckerte ich trotzdem los.
»Heul doch«, schlug Malte lässig vor.
»Feierabend«, seufzte Jens. Malte hatte dreimal gegen ihn gewonnen und viermal gegen mich. Jens hatte zweimal gegen Malte gewonnen und dreimal gegen mich. Ich dagegen hatte nur eines gewonnen: die Erkenntnis, dass ich kein besonders sportlicher Mensch war. Immerhin, wir schwitzten alle. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass es bei mir am schlimmsten war.
Jens und ich saßen nach dem Duschen und Umziehen bereits an der Bar des Squashcenters, während Malte noch stolze zwanzig Minuten im Umkleideraum damit verbrachte, sich einzucremen, seine Haare zu föhnen und dann mit Gel in die richtige Form zu bringen.
»Wie geht’s Marion?«, fragte ich Jens, während wir auf das Ende von Maltes Feintuning warteten. Mein Freund nahm einen Schluck von seinem Pils, während ich mich an meiner Apfelschorle festhielt.
»Gut«, antwortete Jens. »Wir renovieren die Küche.«
Seltsame Antwort, oder? Marion war keine Klempnerin, die berufsbedingt tagtäglich Rohre in Küchen verlegt, sie war auch keine Innenarchitektin oder Fliesenlegerin. Marion war Jens’ zierliche, liebenswerte Gattin. Aber so etwas passiert eben, wenn man langjährige Eheleute nach dem Befinden ihrer Partner fragt: Sie reden einfach über ihr Leben und das Zuhause an sich. Anstatt dass Jens mir eine Information über Marion als Person gab – über ihr Wohlbefinden, ihre Gedanken oder Gefühle –, betrachtete er sie offenbar bloß als Bestandteil seines persönlichen Heim-Universums. Wahrscheinlich war es Marion gewesen, die die Küchenrenovierung angeregt hatte, und so verknüpften die Synapsen in Jens’ Hirn automatisch das Wort Marion mit dem Wort Küche. Und aus seinem Mund kam deshalb eine Antwort, die de facto so gut wie nichts mit meiner Frage zu tun hatte.
Marion geht es gut, wir renovieren die Küche.
Gruselig!
Ich stellte mir vor, dass ich womöglich auch einmal mit einer Frau zusammenleben könnte, die für mich kein begehrenswertes Individuum mehr war, sondern bloß der integrale Bestandteil eines alltäglichen Konzepts. Dem Romantiker in mir lief bei dieser Vorstellung ein kalter Schauer über den Rücken. Aber andererseits war ich der letzte Mensch, dem es zustand, sich ein Urteil über diese Dinge anzumaßen: Die längste Beziehung, die ich je zustande gebracht hatte, dauerte nur etwas länger als ein Jahr. Ich hatte also nie herausgefunden, wie es war, vom Stadium des Einanderfindens in das weniger euphorische, aber womöglich selig machende Stadium des Füreinanderdaseins hinüberzugleiten. Ich sollte Jens nichts vorwerfen. Er schien, im Gegensatz zu mir, begriffen zu haben, wie diese Dinge eben funktionieren.
2. Kapitel
Wie geht es Marion?«
Jens zuckte zusammen, als Thomas ihn das fragte. Für einen kurzen Moment hätte er fast dem Impuls nachgegeben, die ganze Wahrheit herauszurücken, sie einfach auszuspucken, loszuwerden, abzuladen: Marion? Marion geht es schlecht! Sie hat letzte Woche herausgefunden, dass ich eine Affäre habe. Eine Affäre? Nein, eine Geliebte! Ich habe eine Geliebte, Thomas. Ich habe mich in eine andere Frau verliebt. Mein Leben bricht auseinander! Ich bin völlig hilflos. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ich auch mache, ich zerstöre etwas. Ich zerstöre Marions Leben – oder das meiner Geliebten. Und im Zweifelsfall, vielleicht in jedem Fall, zerstöre ich auch etwas in mir selbst. Hilf mir, Thomas! Gib mir einen Rat. Sag, was ich tun soll. Ich habe eine Frau zu viel. Und ich bin so allein.
Das alles hätte er gerne herausgebrüllt. Oh, wie liebend gern er es losgeworden wäre. Doch was Jens dann tatsächlich sagte, war bloß: »Marion geht es gut. Wir renovieren die Küche.«
Was für eine dumme Antwort. Was für eine kalte, herzlose Antwort. Thomas würde sich daran vermutlich nicht einmal stören, dachte Jens. Thomas war nicht gut in zwischenmenschlichen Gefühlen. Er fragte wahrscheinlich ohnehin nur aus Höflichkeit nach Marion und würde gar nicht verstehen, was Jens gerade durchmachte, selbst wenn er es ihm haarklein auseinander pflücken würde.
Thomas hatte keine Ahnung, wie weh Liebe tun konnte. Er ging der Liebe aus dem Weg. Immer, wenn die Dinge ernst wurden mit einer Frau, wenn wahre Nähe vonnöten war, setzte sich Thomas ab. Oder er benahm sich so unmöglich, so unnahbar, dass die Frauen es irgendwann aufgaben und ihn widerwillig verließen. Entließen. Zurück in sein emotionales Vakuum. Jens hatte das viele Jahre lang immer wieder beobachtet. Anfangs hatte es ihn irritiert, dann hatte er akzeptiert, dass Thomas wohl einfach so war: ein Nicht-Liebender. So was gab’s wohl.
Trotzdem, Thomas war sein bester Freund. Und ein Freund, der ihm zuhörte und beistand, war das, was Jens in diesem Moment am meisten brauchte. Und doch war alles, was er sagte: Marion geht es gut. Wir renovieren die Küche.
Das ist es, was Männer tun. Sie geben kurze Antworten. Sie halten dicht. Die langen, tragischen, emotional aufgewühlten Reden halten sie nur sich selbst. Als Monolog. Stumm.
Sie hieß Karin. Karin hatte bei Jens Fahrstunden genommen. Schon an dem Tag, an dem sie sich anmeldete und sechs Stunden »Auffrischung« buchte, hatte es geknistert. Jens hatte nie geglaubt, dass es das wirklich gibt: Dass Funken sprühen können zwischen zwei Menschen. Er hatte das für ein Groschenromanklischee gehalten. Bis zu jenem Tag, an dem diese Funken ausgerechnet ihn trafen. Als er Karin gegenüberstand, sah er mehr als bloß irgendeine Frau. Er wusste nicht mal genau, was es war … aber er sah es.
Funken sind kein Flächenbrand. Man kann sie ignorieren. Dann gibt es weder lodernde Leidenschaft noch ein flammendes Inferno. Dann bleibt alles beim Alten. Und zuerst hielt Jens das auch durch. Er ignorierte diese seltsame Spannung, die zwischen Karin und ihm existierte. Er behandelte sie wie eine ganz normale Fahrschülerin. Anfangs jedenfalls.
Karin war frisch geschieden. Ihr Exmann war ein Autonarr und Reihenhausmacho, der lieber darauf verzichtete, bei einer Feier etwas zu trinken, als dass er seine Gattin ans Steuer des geliebten BMW gelassen hätte. Sechs Jahre war Karin verheiratet gewesen, und nur viermal in all dieser Zeit war sie Auto gefahren. Nun, da sie von ihrem fahrersitzfixierten Lebensgefährten getrennt lebte, schickte sie sich an, wieder eine mobile Persönlichkeit zu werden, und kaufte sich einen Fiat Punto. Es beeindruckte Jens, dass sich Karin nicht einfach hinter das Steuer setzte und losfuhr, sondern dass sie sich ihren Mangel an fahrerischer Routine eingestand und erst ein paar Stunden unter Aufsicht das Fahrgefühl zurückgewinnen wollte, bevor sie sich wieder in den regulären Verkehr eingliederte.
Jens schätzte Verantwortungsbewusstsein. Er selbst war ein extrem verantwortungsbewusster Mensch. Und genau das war sein Problem.
»Ich brauche nur Routine, wir müssen nicht bei null anfangen«, hatte Karin bei der ersten Fahrstunde gelächelt. »Ich weiß, wo Gaspedal und Bremse sind.«
»Kennen Sie auch schon die Kupplung?«
»Wir wurden uns bereits vorgestellt.«
Als Karin anfuhr, gab es nichts zu bemängeln. Sie hatte Fahrgefühl, war umsichtig, gliederte sich elegant in den fließenden Strom von Fahrzeugen ein. Sie wusste, was zu tun war.
»Sie machen das sehr gut«, lobte Jens.
»Sie haben aber auch etwas sehr … Beruhigendes«, hatte Karin geantwortet. Drei Fahrstunden später duzten sie sich bereits.
Am Ende der sechsten und letzten Fahrstunde fragte ihn Karin, ob sie nicht mal zusammen essen gehen wollten.
»Ich bin verheiratet.« Jens hatte seinen Ringfinger hochgehalten, als ob das eine Antwort auf ihre Frage wäre.
»Ich weiß«, hatte Karin geantwortet. »Ich habe deine Frau im Büro gesehen. Sie ist sehr hübsch.«
»Ja, das ist sie.« Jens musste schlucken.
»Aber auch verheiratete Männer müssen essen, oder?«
»Schätze, das stimmt.«
Menschen haben Hunger. Und Karin, die einen außergewöhnlichen Sensor für die Gefühle anderer hatte, musste irgendwie erkannt haben, dass Jens fast verhungert war. Sie hatte gesehen, was andere nicht sahen.
Drei Wochen später, nach diversen heimlichen Abendessen und nachdem sie das erste Mal Sex hatten – wunderbaren, spontanen, leidenschaftlichen und unvernünftigen Sex –, lagen sie nebeneinander in Karins Bett. Sie strich mit dem Finger über seine Brust. »Warum bist du so unglücklich?«
»Ich bin nicht unglücklich«, hatte er geantwortet. »Ich … ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe das Gefühl, das ich etwas Schreckliches getan habe. Einen großen Fehler. Aber ich bin auch glücklich. Und … und dafür schäme ich mich.« So hätte er mit Marion nie reden können. Mit seiner eigenen Frau konnte er schon lange nicht mehr reden.
Karin hatte ihn geküsst. »Ich habe mich in dich verliebt.«
Jens hatte nicht geantwortet. Er hatte nur genickt und die Augen geschlossen – weil er fürchtete, weinen zu müssen. Er war so unglücklich, wie ein glücklicher Mensch nur sein konnte.
Er hatte so viel Angst, wie jemand nur haben konnte, der gerade gerettet wurde.
»Nicht einschlafen«, sagte Karin. »Du musst zurück zu deiner Familie.«
Jens hatte drei Kinder. Lukas war fünfzehn, Tom zehn und die kleine Emma fünf. Thomas hatte einmal gelästert, dass Jens seinen Nachwuchs wohl nach dem Vorbild eines realsozialistischen Fünfjahresplans produziert hätte. Er fand, dass das zu seinem Freund passte: Planung in allen Lebenslagen.
Doch wenn Jens sein Leben tatsächlich konsequent geplant hätte, dann wäre er nie in das Dilemma geschliddert, in dem er sich nun befand. Nach siebzehn treuen Jahren hatte er sich in eine andere Frau verliebt. Aufrichtig verliebt.
Es wäre für ihn um so vieles leichter gewesen, wenn die Liebe ein exklusives Phänomen wäre. Wenn die eine Liebe automatisch erlosch, sobald eine neue aktiv wurde. Wenn die Gefühle für Marion in exakt jenem Moment verpufft wären, in dem er begriffen hatte, dass Karin die Frau war, die ihn glücklich machen konnte.
Doch so lief das nicht.
Die Liebe war heimtückisch.
Und hartnäckig.
Marion war ein schwieriger Mensch. Die Ehe mit ihr lag quasi brach. Jens konnte sich nicht einmal mehr erinnern, wann genau sie das letzte Mal Sex gehabt hatten. Es war Monate her, ein halbes Jahr sogar. Weil es nun Karin gab, mit der Sex so aufregend und wahrhaftig war, wie er es mit Marion nie erlebt hatte, litt Jens nicht mehr wirklich darunter. Doch vorher war er fast daran verzweifelt.
Als Jens Marion kennen gelernt hatte, war sie süß wie Zucker, witzig, hellwach und voller Energie. So war sie heute fast nie mehr. Sie war … leer. Immer öfter war sie auch bitter, beleidigend manchmal, abweisend. Sie war unzufrieden, warum auch immer. Jens konnte keinen plausiblen Grund erkennen, warum sie manchmal wegen Kleinigkeiten an die Decke ging oder sich plötzlich in ihr Zimmer verkroch, sich mitten am Tag ins Bett legte. Da verharrte sie dann, stundenlang, die Decke über den Kopf gezogen, das Licht gelöscht, die Vorhänge geschlossen. Marion vernarbte innerlich, doch Jens hatte keine Ahnung, wo die Verletzungen herkamen. Man musste sie behandeln wie ein rohes Ei. Denn wenn sie zerbrach, zerbrach alles. Die ganze Familie.
Und trotzdem: Jens liebte Marion. All die Jahre zusammen, all die geteilten Gefühle und Glücksmomente und Erfahrungen und Erinnerungen und Schmerzen und Träume – das blieb. Die Vorstellung, Marion zu verlassen, machte Jens nicht nur Angst, sie tat ihm weh. Zumal er wusste, dass sie ihn brauchte. Und dann waren da auch noch die Kinder. Jens liebte seine Söhne und seine kleine Tochter. Er liebte sie vielleicht sogar mehr als Marion und Karin zusammen. Sie waren das Zentrum seines Lebens. Emma, Tom und Lukas nicht mehr täglich zu sehen, sondern ihre Leben nur noch an Wochenenden und in Urlauben im Zeitraffer rekapituliert zu bekommen, mit ihnen zu festgelegten Terminen in Freizeitparks zu gehen und sie nur bei Laune zu halten, anstatt sie durchs Leben zu begleiten, bloß ein Besuchstags-Papi zu sein – das war eine Vorstellung, die Jens fast zerriss.
Es war unmöglich.
Über ein Jahr war es Jens gelungen, seine Liebschaft geheim zu halten. Er fühlte sich wie ein Schwein dabei, und vielleicht war er das ja auch, aber er sah keine Möglichkeit, die Geheimnistuerei zu beenden. Dann würde schließlich alles zusammenbrechen.
Doch acht Tage bevor er mit Thomas und Malte zum Squashspielen ging, geschah genau das: Seine Welt explodierte.
Thomas hatte die Legende aufrechterhalten, dass er immer noch zum Racketball ging. Zweimal die Woche, log er Marion vor, spielte er in einem Club in Altona. Danach ging er angeblich mit seinen Kumpeln etwas trinken.
Jens hatte seine Lüge so perfektioniert, dass er in Karins Wohnung tatsächlich seine Sportkleidung anzog und in ihrem Wohnzimmer für zehn Minuten hysterisch schnelles Standjogging machte, damit die Klamotten seinen Schweißgeruch annahmen und keinen Verdacht erweckten, wenn Marion sie später in die Wäsche gab. Anfangs hatte Karin das komisch gefunden, später nervte es sie.
Nach seinem Fitnessbetrug duschte Jens immer. Dann hatten Karin und er meistens Sex. Danach duschte Jens wieder, um den Geruch der Lust zu vernichten.
Es war entwürdigend.
An dem Tag, an dem alles kaputtging – acht Tage bevor er Thomas mitteilte, dass es Marion gut ginge und sie die Küche renovierten –, hatten Jens und seine Geliebte keinen Sex. Ihre Beziehung war schließlich nicht rein physisch. Karin und Jens hatten tatsächlich angefangen, ein Paar zu werden. Er führte ein regelrechtes Parallelleben mit ihr: Sie gingen zusammen aus, in möglichst entlegenen Stadtteilen und in Restaurants und Bars, wo niemand Jens zu kennen drohte, und sie teilten das Alltägliche. Jens hatte sogar Karins Auto zum TÜV gebracht und ihr bei der Steuererklärung geholfen.
An diesem Tag war er am frühen Abend mit ihr zu Ikea gefahren, um ein neues Regal zu kaufen. Nachdem er den Karton in seinen Wagen geladen hatte – ihr Fiat wäre dafür viel zu klein gewesen –, hatte sie ihn lange angeschaut.
»So geht das nicht weiter.«
Jens hatte zu Boden gesehen und geschwiegen.
»Ich liebe dich.« Karins Stimme war ernst.
»Ich liebe dich auch«, hatte Jens geantwortet. Seine Stimme zitterte. »Ich liebe dich wirklich.«
»Dann muss etwas geschehen.«
»Ich weiß«, hatte Jens geantwortet. Es war fast ein Flüstern.
»Wir haben ein Recht auf Glück.«
Jens sah wieder zu Boden. Karin strich mit der rechten Hand über seinen Kopf. Dann fasste sie ihm unters Kinn und hob sanft sein Gesicht an, bis er ihr direkt in die Augen blickte.
»Wir gehören zusammen«, sagte sie.
Jens küsste sie. Weil er wusste, dass sie Recht hatte. Und weil es wunderbar und grauenhaft war, dass sie Recht hatte. Er wollte bei ihr sein, aber er wollte nicht zu ihr gehen. Er liebte sie, er liebte sie von ganzem Herzen. Doch er wusste nicht, wie das gehen sollte, diese Liebe. Diese Doppelliebe.
Er küsste sie heftig, fast schon ein bisschen grob. Karin drückte sich an ihn. Ihre Zungen verschlangen sich ineinander. Jens bekam eine Erektion. Das erschien ihm unpassend, doch was sollte er tun. Alles in seinem Leben war derzeit unpassend. Nichts passte zusammen.
Als die beiden ihren nahezu obszönen Kuss beendeten und sich voneinander lösten, hörte Jens eine Stimme. Eine entsetzlich vertraute Stimme.
»Du Schwein.«
Lukas!
Sein ältester Sohn stand neben ihm. Im Hintergrund sah Jens dessen peinlich berührte Freunde zu ihnen herüberschauen.
»Du verdammtes Schwein!«, schrie Lukas und rannte davon.
»Lukas! Warte!«, rief Jens. Doch sein Ältester sprang ins Auto seiner Kumpel, die nun ebenfalls hastig einstiegen. Noch während Jens zu ihnen hinüberlief, heulte der Motor auf und der Wagen brauste vom Parkplatz.
Karin legte zaghaft eine Hand auf Jens’ Schulter.
Er schüttelte sie ab.
Als Jens zwei Stunden später nach Hause kam, saß Marion im Halbdunkel. Jens brauchte ein paar Sekunden, bis seine Augen sich justierten. Marion saß auf dem Sofa. Kerzengerade. Sie atmete schwer.
Es war kurz nach neun Uhr. Aus Lukas’ Zimmer hörte man leise Musik, Marilyn Manson. Emma und Tom schliefen vermutlich schon.
Es war offensichtlich, dass Lukas seiner Mutter von seiner Entdeckung erzählt hatte. Es herrschte eine brüllende Stille.
»Verlässt du mich?«, fragte Marion schließlich mit tonloser Stimme.
»Ich …«
»Suchst dir einfach eine Neue, wenn dich die Alte nicht mehr glücklich machen kann«, flüsterte Marion.
Jens schluckte. Er wusste nicht, was er sagen sollte.
Marion erhob sich langsam und ging dicht an ihm vorbei, ohne ihn zu berühren. »Bitte verlass mich nicht«, flüsterte sie, bevor sie im Schlafzimmer verschwand. Jens sah, dass Marion das Sofa mit einem Laken bezogen hatte und seine Bettwäsche sorgfältig darauf ausgebreitet war.
Er drehte sich um.
Die Tür zum Schlafzimmer war geschlossen.
3. Kapitel
Als Malte schließlich frisch geföhnt, gegelt und eingecremt aus dem Umkleideraum kam und zu uns an den Tresen trat, umwehte ihn ein etwas zu starker Hauch von Davidoffs Zino-Parfum. Herb. Männlich. Und teuer natürlich.
»Na, wie sieht’s aus, Jungs?«, strahlte er. »Wie wär’s mit indisch essen? Ich lade euch ein!«
Jens aß sicher lieber Pizza als Chicken Punjabi, aber noch lieber aß er umsonst. »Super-Idee«, sagte er also. »Das ist ja echt großzügig von dir.«
»Hey«, grinste Malte und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Kein Problem.«
Jens war ein wenig geizig, Malte war ein wenig großkotzig. Und ich war ziemlich hungrig. Eine Viertelstunde später saßen wir im Delhi und studierten die Speisekarte.
Normalerweise waren wir alle drei durchaus quasselfähig, aber diesmal brachten wir nur ein stockendes Gespräch zusammen. Malte checkte alle fünfzehn Minuten sein Handy, als ob er eine extrem wichtige SMS erwarten würde. Jens wirkte irgendwie geistesabwesend. Und ich versuchte, das Gespräch am Laufen zu halten, indem ich unermüdlich von irgendwelchen Filmen, Büchern und Theaterstücken erzählte, die ich in letzter Zeit konsumiert hatte. Ich war ein sehr guter Secondhand-Erzähler. Ich kolportierte gern die Ideen, Visionen, Geschichten und Erlebnisse anderer Leute. So hat man immer etwas zu erzählen und bleibt trotzdem unangreifbar. Manchmal gab ich sogar eigene Ideen als etwas aus, was ich irgendwo gelesen hatte, nur damit niemand erfuhr, worüber ich so nachdachte.
Gerade als ich meinen Freunden vom neuen Woody-Allen-Film vorschwärmen wollte, ließ Jens die Bombe platzen. »Ich habe ein Geliebte!«, sagte er plötzlich. »Ich bin völlig im Arsch und muss das jetzt jemandem erzählen.«
Ich starrte Jens fassungslos an. Von allen Leuten auf der Welt war er so ziemlich der Letzte, dem ich so etwas zugetraut hätte.
»Ich betrüge Marion seit über einem Jahr«, fuhr Jens fort.
»Wow!«, rief Malte und legte sogar sein Handy zur Seite. »Cool … Ich meine: Nicht, dass ich das toll finde oder so, aber … also, ich meine … das ist ja ein Hammer!«
»Sie heißt Karin«, sagte Jens. »Marion hat es vor einer Woche herausgefunden.«
»O mein Gott! Das ist ja entsetzlich.« Ich legte tröstend meine Hand auf seine. Jens sah mich verblüfft an. Er schien überrascht, dass ich so emotional reagierte. Manchmal habe ich das Gefühl, er hält mich irgendwie für gefühlskalt oder so. »Aber … ich dachte immer, Marion und du, ihr wärt das perfekte Paar.«
»Es ist alles andere als perfekt bei uns«, verriet Jens. »Ich weiß: Marion wirkt total locker. Aber so ist es nicht. Es ist … schwierig.«
Ich war mir nicht sicher, ob ich hören wollte, was Jens mir als Nächstes erzählen würde. Ich rede nicht gerne über mich. Und ich bevorzuge es ebenso, auch von meinen Mitmenschen nur höchstens fünfzig Prozent aller relevanten Dinge zu wissen. Ich brauche dieses kleine Stück Distanz zu anderen Leuten, das nur aufrechtzuerhalten ist, solange man keine intimen Geheimnisse kennt.
Maltes Handy klingelte. Er hatte tatsächlich Girls just want to have fun von Cindy Lauper als Klingelton. Peinlich, oder?
»Entschuldigt mich«, sagte mein geschmacksverwirrter Kumpel und erhob sich. Während er telefonierte, ging er in den Vorraum des Restaurants.
Die Unterbrechung stoppte Jens nicht. Er musste einfach loswerden, was ihn bedrückte. Ich seufzte innerlich. Manchmal konnte man eben nicht entkommen. »Marion hat Probleme«, begann er. »Du hast sicher schon bemerkt, dass es bei uns zu Hause … na ja, etwas sauberer ist als normal …«
Zugegeben, es sah bei Jens und Marion immer extrem gewienert aus. Aber es war nicht so, als würde man ein Sagrotan-Entwicklungslabor betreten, wenn man sie besuchte. Es war eigentlich recht gemütlich bei den beiden. Ein bisschen spießig vielleicht, aber gemütlich.
»Es gibt Nächte, die sie komplett durchschrubbt«, erklärte Jens. »Ungelogen. Die ganze Nacht! Dann werden alle Schränke ausgeräumt, alles wird poliert. Und den Backofen schrubbt sie sowieso einmal die Woche. Stundenlang. Sie ist besessen!«
»Gibt’s keine Therapie dagegen … oder so?«, fragte ich.
»Sie sagt, so etwas braucht sie nicht. Sie will nur nicht in einem Schweinestall leben, sagt sie. Sie ist … sie ist so wütend in letzter Zeit, nichts ist gut genug für sie. Sie sagt, ihr fehlt etwas im Leben. Aber gleichzeitig ist ihr auch alles zu viel.«
»Mmm«, murmelte ich. Was sollte ich auch sagen?
»Sex mit ihr ist nahezu unmöglich. Ich meine, das letzte Mal musste ich regelrecht betteln«, fuhr er vor und betrat jetzt definitiv die Informationsregion, die ich am meisten fürchtete. »Sie hat nichts davon, wenn ich mit ihr schlafe, und das ist ein Scheißgefühl für mich.«
»Für sie wahrscheinlich auch«, konnte ich mir nicht verkneifen. Aber Jens bekam das gar nicht mit.
»Sie weigert sich, irgendetwas auszuprobieren. Oralsex ist ihr angeblich viel zu unhygienisch. Und ich musste Kondome benutzen, obwohl sie die Pille nimmt.«
Ich wünschte, ich wäre woanders. »Aber«, warf ich zaghaft ein, »war das denn immer so?«
»Sie hatte schon immer ihre Macken«, seufzte Jens. »Wer hat die nicht? Aber so richtig schlimm ist es erst in den letzten Jahren geworden. Sie ist so traurig und weiß nicht, wohin damit. Also wird Wut daraus. Und sie steckt uns alle damit an. Dabei ist sie so verdammt zerbrechlich, Thomas.«
»Aber ist das nicht erst recht ein Grund, bei ihr zu bleiben? Ich meine: Ist das nicht das, worum es bei der Liebe geht? Füreinander da zu sein?« Ich wusste, dass ich moralinsauer klang und nicht wirklich wusste, wovon ich sprach – aber es war nun mal das, was ich dachte.
Jens sah mich lange an. »Das ist ja gerade eines der großen Probleme«, antwortete er schließlich. »Ich käme mir vor wie ein Schwein, wenn ich sie verlassen würde. Sie braucht mich, auch wenn sie es mich niemals spüren lässt. Aber ich habe nur dieses eine Leben. Ich habe doch auch ein Recht auf ein bisschen Glück, oder? Und als ich Karin kennen lernte … Karin ist so ganz anders. Sie ist so unglaublich spontan. Und Sex mit ihr – hey, der ist richtig wild. Wir haben Spaß. Richtigen Spaß! Ich fühle mich so lebendig mit ihr. Und ich darf plötzlich Hähnchen mit den Fingern essen.« Er grinste schief und bemerkte dabei meinen skeptischen Blick. »Sie ist eine tolle Frau, Thomas«, betonte er. »Und wenn es Marion nicht gäbe, oder wenn Marion gesund wäre … wenn meine Kinder unter solch einer Trennung nicht so leiden würden … Ich meine: Was soll aus den dreien werden, wenn sich Marion allein um sie kümmert? Sie ist ja jetzt schon hysterisch und macht sie manchmal völlig irre. Wie soll das erst werden, wenn ich das nicht mehr ausgleichen kann?«
»Kannst du nicht das Sorgerecht …«, warf ich ein.
»Das gesteht mir kein Richter zu. Und es wäre auch unfair. Marion liebt die Kinder. Und sie meint es gut mit ihnen. Es würde sie umbringen, wenn ich sie ihr wegnehme.«
Wir sahen uns eine Weile schweigend an. »Scheiße«, sagte ich schließlich, weil mir wirklich nichts Besseres einfiel. »Das ist wirklich Scheiße.«
Jens setzte ein seltsam nachsichtiges Lächeln auf. Irgendwie … milde. Ich ärgerte mich, dass ich nichts Wertvolleres zu seinem Dilemma sagen konnte, dass ich keine reifen Ratschläge oder Weisheiten beisteuern konnte, aber was verstand ich schon von diesen Dingen? Mein persönlicher Beziehungsheld Jens hatte versagt! Er war für mich der Guru der funktionierenden Zweierkiste. Was sollte ausgerechnet ich ihm also raten? Er tat mir aufrichtig Leid, ich fühlte mit ihm. Ehrlich. Doch mehr als ein blasses, leeres »Scheiße« fiel mir trotzdem nicht ein.
Jens nickte mir zu. Er wirkte erleichtert, dass er seine Geschichte losgeworden war. Und machte eigentlich nicht den Eindruck, als ob er von mir eine wertvollere Reaktion erwartet hätte. Hmm …
»Ich muss los!«, sagte Malte, der in diesem Moment eilig an den Tisch trat und mit dem Handy wedelte. »Ich zahle vorn an der Kasse, okay? Tut mir Leid. Ist wichtig. Jens … also … du machst das schon. Red mit Thomas, lass einfach alles raus. Das hilft, glaube ich.« Er schnappte sich seine Lederjacke, die über der Stuhllehne hing, warf sie sich über die Schulter, hob noch einmal die Hand zu einem hastigen Abschiedsgruß und verschwand.
Für ein paar Sekunden sahen Jens und ich uns nur stumm an.
»Ja«, sagte ich dann. »Red mit Thomas, der kennt sich so gut aus. Und lass einfach alles raus, du.«
Wir prusteten beide los, und das Lachen tat uns in diesem Moment beiden gut.
Nachdem wir uns beruhigt hatten, fuhr Jens wieder ernst fort: »Das Schlimmste sind die Kinder. Ich könnte niemals ohne meine Kinder sein. Ich will sie nicht verlassen. Ich kann sie nicht verlassen.«
Ich nickte.
»Aber Lukas hasst mich«, flüsterte Jens.
»Ich glaube nicht, dass Kinder ihre Eltern wirklich hassen können«, sagte ich. »Ihr solltet euch mal richtig aussprechen. Du musst ihm alles erklären.«
»Er will nicht mit mir reden. Und was soll ich ihm auch sagen?«
Ich tätschelte wieder seine Hand. Das war schlechter, als etwas wirklich Einfühlsames zu sagen. Aber besser als nichts.
Am nächsten Nachmittag trafen Malte und ich uns im Konferenzraum seiner Firma. Er verlor kein Wort über Jens und dessen dramatische Enthüllung. Ich war mir nicht sicher, ob das so etwas wie Diskretion sein sollte – schließlich war Jens mein bester Freund und für ihn nur ein flüchtiger Bekannter – oder schlichtes Desinteresse. Ich tippe mal auf Letzteres.
Malte produzierte mit seiner Company Punchline Entertainment vier verschiedene TV-Shows. Für eine davon, die Comedyserie Lach, Mann!, diente ich als einer von drei Autoren. Star der Sendung war Axel Lachmann, ein hyperaktiver, zu Zoten neigender Sechsundzwanzigjähriger, der sich meiner Meinung nach mit seinem infantilen Geblödel bloß an seinen Eltern rächen wollte. Die hatten ihn nämlich dereinst in der Hoffnung auf Hirn-, Kultur- und Charaktererweiterung auf die Rudolf-Steiner-Schule geschickt und dreimal die Woche zum Klavierunterricht genötigt. Vergeblich. Axel war und blieb ein ebenso ungebildeter wie unsensibler Idiot – und ein grottiger Komiker dazu. Der Kerl schaffte es, jede noch so gute Pointe mit falschem Timing und völlig überzogenen Grimassen zu ruinieren. Er war allerdings ein erfolgreicher Idiot, einer der einschaltquotenstärksten Comedians im deutschen Fernsehen, was ich ganz nüchtern und wertfrei damit erklärte, dass die Welt eben voller Idioten ist, die gern anderen Idioten dabei zusehen, wie sie idiotische Sachen machen.
Axel freilich lebte in dem Irrglauben, er wäre ein humoristisches Gottesgeschenk, und führte sich entsprechend auf. Manchmal versuchte er bei den wöchentlichen Meetings selbst ausgedachte Kalauer in die Show zu drücken. Es waren stets Humorergüsse aus den niedersten Regionen der Witzewelt. Da, wo die Pointen-Sonne niemals schien.
Malte, der seinen Star bei Laune halten wollte, und die beiden anderen Autoren, die unerfahrener, dafür aber deutlich ehrgeiziger waren als ich, quittierten Axels verbale Rohrkrepierer stets mit braven Hohohos. Manchmal wurde einer der Gags tatsächlich benutzt; damit hielt Malte seinen indirekten Ernährer in der trügerischen Annahme, er hätte einen wertvollen Beitrag zur Sendung geleistet und überhaupt eine stimmungsaufhellende Wirkung auf die Welt. Die Tatsache, dass ich Axel ob seiner Spaßversuche nur müde anmuffelte und nicht einmal unter Androhung einer sozial unverträglichen Fristloskündigung über sein dummes Gesabbel gekichert hätte, beeindruckte Herrn Lachmann nicht. Ich glaube, er hielt mich einfach für einen depressiven alten Mann, der nur mühsam und unter Schmerzen Gags generieren konnte. Dementsprechend gering war seine Bereitschaft, meinen Ansichten zu den dramaturgischen und inhaltlichen Mängeln seiner Einfälle zuzustimmen. Lachmann und ich standen auf den gegenüberliegenden Seiten der Humorfront – und Malte dazwischen. Kurz: Den allwöchentlichen Konferenzen sah ich ungefähr genauso freudig entgegen wie einer Rektaluntersuchung.
»Hör mal, ich glaub, du verstehst den Witz einfach nicht! Der ist total geil!«, ereiferte sich Axel und malte mir das, was er gern als Sketch in der Sendung hätte, nun schon zum dritten Mal aus: »Also, da sitzt dieser Mann in einem arabischen Restaurant und sagt zu der verschleierten Kellnerin: Ich hätte gern Couscous. Das ist ein Essen, weißte? Reis oder Fleisch oder so was …«
»Hirse«, murmelte ich.
»Hä?«
»Couscous wird aus Hirse gemacht.«
»Ja, egal. Also. Der Typ sagt, er möchte Couscous. Und die verschleierte Kellnerin ist total überrascht und fragt: Du möchten wirklich Couscous? Der Mann sagt: Ja, ich will wirklich Couscous. Und da nimmt die Frau den Schleier ab und gibt dem total geschockten Typen zwei dicke Schmatzer ins Gesicht!«
Axel sah mich erwartungsvoll an. Ich aber behielt meine Mundwinkel, wie es dem Witz gebührte, in nach unten neigender Position.
»Couscous, verstehst du? Kuss! Kuss!« Axel konnte es nicht fassen, dass ich mich nicht vor Lachen auf dem Boden wälzte.
»Okay«, seufzte ich und hob zu einem Vortrag an. Malte versuchte vergeblich, mir mit seinem Blick zu signalisieren, dass ich die Klappe halten sollte. »Also, den rassistischen Unterton dieses Scherzversuches mal ignorierend – und ganz abgesehen davon, dass ich noch nie in einem arabischen Restaurant war, in dem eine verschleierte Kellnerin mit nur rudimentären Deutschkenntnissen bediente –, macht das Ganze auch sonst keinerlei Sinn. Die haben in dem Lokal Couscous auf der Speisekarte stehen. Die Kellnerin hat das Zeug selbst vermutlich schon tausendmal gegessen. Und wahrscheinlich wird dieses Gericht fünfzig Mal pro Tag bei denen bestellt. Die muss doch nun echt wissen, dass Couscous nichts mit küssen zu tun hat.«
»Aber …«, hob der selbst ernannte Humorgott an.
Ich ließ mich nicht unterbrechen. »Der Witz würde höchstens funktionieren – und auch dann nur ansatzweise –, wenn ein Araber in ein bayerisches Bierlokal kommt und sagt: Ich will Couscous. Und die Kellnerin küsst ihn dann zweimal. Aber natürlich ist auch kein Araber so blöd zu glauben, dass es im Brauhausstüble nordafrikanische oder vorderasiatische Gerichte gibt. Und selbst die Zenzi von der Alm dürfte, besonders wenn sie im gastronomischen Gewerbe arbeitet, schon mal von Couscous gehört haben. Womöglich ist sie so blöd zu glauben, Couscous wäre aus Reis oder Fleisch, aber sie weiß sicher, dass es etwas Essbares ist. Ein weiteres Problem mit diesem Witz ist, dass …«
»Ja, okay. Danke, Thomas«, bremste mich Malte und funkelte mich wütend an. »An dem Sketch werden wir also noch ein bisschen feilen. Wir sollten jetzt …«
»Ich hab noch einen!«, rief Axel und servierte uns prompt seine neue humoristische Großtat: »Also, da ist dieser kleine Junge. Den spiele ich natürlich selbst. Ich ziehe mir einen Matrosenanzug an oder so und mache mich ganz klein. Also, der kleine Junge steht im Spielzeugladen und zeigt der Verkäuferin – die ist total sexy, dicke Titten und so – eine Reihe Teddybären, die ganz oben im obersten Regal liegen. Ich will so einen Teddy, sagt der Junge. Also ich. Und die sexy Verkäuferin guckt nach oben ins Regal zu den Teddys und sagt: Soll ich dir einen runterholen? Und der Junge sagt: Nein, danke. Vielleicht später. Jetzt will ich erst mal einen Teddy.« Axel sah uns erwartungsvoll an.
»Entschuldigt mich«, sagte ich und erhob mich. »Ich gehe mal kurz nach draußen und weine bitterlich.«
Ohne ein weiteres Wort verließ ich den Konferenzraum.
»Was, zum Teufel, ist los mit dir?«, pflaumte mich Malte eine Viertelstunde später in seinem Büro an. »Das war total unprofessionell. Du hast dich aufgeführt wie das letzte Arschloch!«
Ich saß mit hängenden Schultern in dem Ledersessel, der vor Maltes Schreibtisch stand. »Aber …«
»Kein aber, Thomas. Was ist los mit dir?«
»Ich weiß auch nicht«, seufzte ich. »Ich stehe momentan irgendwie neben mir. Ich bin total geladen und völlig erschöpft zugleich.«
»Mann, früher hast du an solche Knalltüten wie Axel überhaupt keine Energie verschwendet«, sagte Malte. »Du hast deinen Job gemacht – einen verdammt guten Job! – und es überhaupt nicht nötig gehabt, andere Leute runterzuputzen. Jetzt bist du nur noch grantig. Und, ganz ehrlich: Deine Texte waren auch schon mal besser.«
Ohne nachzudenken machte ich das, was ich mir sonst so sorgfältig verkniff: Ich sagte das Erste, was mir durch den Kopf schoss. »Fragst du dich eigentlich manchmal, warum du das alles hier machst?« Malte sah mich kurz erstaunt an, dann blätterte er mit theatralischer Geste eine Reihe imaginärer Polaroidfotos vor sich auf die Schreibtischplatte: »Mein Haus, mein Sportwagen, meine Yacht, mein Luxusweib für Montag, mein Luxusweib für Dienstag, mein …«