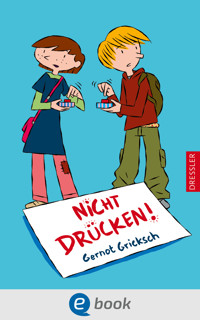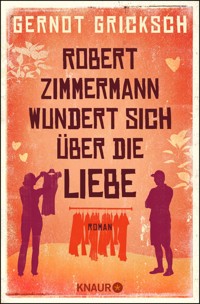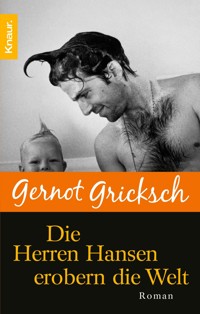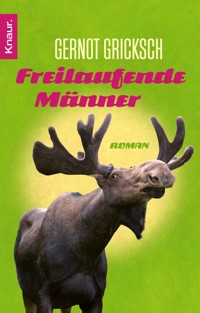6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Als die sinnlose Rede vorbei ist, treten wir ans Grab. Den Kübel mit Sand ignorieren wir. Wir werden unseren Freund nicht mit Dreck bewerfen. Stattdessen legen wir alle gleichzeitig, als hätten wir es wochenlang geübt, den Kopf zurück. Und dann spucken wir in hohem Bogen unsere Kirschkerne in das Grab. Der Pastor funkelt uns wütend an. Doch was weiß der schon.« An seinem 40. Geburtstag steht Piet am Grab eines Freundes. Hier erinnert er sich an Prickel Pit und Schlaghosen, Miami Vice und Startbahn West, den ersten Kuss, die letzte Gehaltsabrechnung. Und Piet denkt an vier Jahrzehnte mit seinen besten Freunden: an die denkwürdige Geschichte der Kirschkernspuckerbande!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Gernot Gricksch
Die denkwürdige Geschichte der Kirschkernspuckerbande
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sofort nach der Geburt ihres Sohnes sprang Piets Mutter auf, um den Vater zu suchen, der sich in einer Abstellkammer eingesperrt hatte. Und Piet? Der blieb im Kreißsaal liegen und dachte erstaunt: »War’s das schon?« Die gleiche Frage stellt er sich vierzig Jahre später am Grab eines seiner besten Freunde; er erinnert sich an Brauner Bär und Schlaghosen, Miami Vice und Startbahn West, den ersten Kuss und die letzte Gehaltsabrechnung. Und Piet denkt an vier Jahrzehnte mit seinen besten Freunden – kurz: an die denkwürdige Geschichte der Kirschkernspuckerbande … Die denkwürdige Geschichte der Kirschkernspuckerbande ist eine bunte Chronik der letzten vierzig Jahre, ein Buch über echte Freundschaft und große Liebe, eine Bestandsaufnahme der Fragen, die uns alle irgendwann im Leben einmal bewegen – und ganz nebenbei ist Gernot Grickschs Roman zum Weinen schön und zum Lachen lustig!
Inhaltsübersicht
Prolog
1960. Kapitel
1965. Kapitel
1966. Kapitel
1968. Kapitel
1969. Kapitel
1970. Kapitel
1972. Kapitel
1973. Kapitel
1975. Kapitel
1977. Kapitel
1978. Kapitel
1980. Kapitel
1981. Kapitel
1985. Kapitel
1990. Kapitel
1994. Kapitel
2000. Kapitel
Epilog
Danksagung
Prolog
13.7.2000
Heute ist mein Geburtstag. Mein Vierzigster. Aber mir ist weiß Gott nicht nach Feiern zu Mute.
Ich stehe hier an einem offenen Grab und wünschte, es würde regnen. Doch die Julisonne brennt, durch kein Wölkchen gemildert, auf uns herab. Der Pastor redet irgendetwas, Phrasen, nichts als Phrasen. Aber was soll er auch sagen – den Menschen, der in diesem Sarg liegt, hat er schließlich gar nicht gekannt. Genauso wenig wie wir. Obwohl wir wirklich dachten, wir täten es.
In wenigen Minuten wird die schlichte Holzkiste in dieses Loch versenkt werden. Und all meine Fragen werde ich auf ewig für mich behalten müssen. Der Trost, den ich hätte spenden können, wird in mir eingesperrt bleiben. Und ich werde damit leben müssen, dass vieles, woran ich geglaubt habe, eine Illusion war. In diesem Sarg liegt ein Mensch, den ich für meinen Freund hielt. Doch ich war nicht Freund genug, um das Wesen seines Geheimnisses zu erkennen. Ich habe nicht einmal geahnt, dass er überhaupt ein Geheimnis mit sich herumtrug. Ein Geheimnis, das ihn schließlich umgebracht hat.
Die anderen stehen neben mir. Keiner von ihnen weint, aber ich weiß, dass sie alle den selben Schmerz empfinden. Es tut weh, einen Teil seiner Träume begraben zu müssen.
Ich hole eine kleine, zerknitterte Tüte aus meiner Jackentasche. Als ich sie öffne, knistert es ziemlich, und ich merke, wie der Pastor, obwohl er immer weiterredet, kurz aufschaut. Ich nehme ein paar Kirschen heraus, die ich heute Morgen extra noch besorgt habe, und gebe jedem meiner Freunde um mich herum eine.
Die anderen sind erst ein wenig überrascht, doch dann begreifen sie. Wir grinsen schief, als wir uns die Kirschen in den Mund stecken. Der Pastor wirft uns einen missbilligenden Blick zu. Jetzt fangen die schon an, bei Beerdigungen kleine Snacks zu verteilen, denkt er vermutlich.
Als die sinnlose Rede endlich zu Ende ist, lassen zwei Männer den Sarg in das Grab hinab. Wir sehen uns an, nicken, und gehen dann alle gleichzeitig an den Rand der Grube. Den kleinen Kübel mit Sand, in dem eine Schaufel steckt, ignorieren wir. Wir werden unseren Freund nicht mit Dreck beschmeißen. Stattdessen legen wir alle gleichzeitig, als hätten wir’s wochenlang geübt, den Kopf zurück. Und dann spucken wir, in hohem Bogen, unsere Kirschkerne in das Grab. Der Pastor funkelt uns mit wütenden Augen an.
Doch was weiß der schon!
1960
Mein Vater verschwand, als meine Mutter in den Wehen lag. Die Hebamme erinnerte sich, dass sie meinen alten Herrn kurz zuvor noch gesehen hatte; er saß im Flur des Krankenhauses, kratzte sich nachdenklich am Kopf und atmete, so erzählte sie, auffallend schwer. Die Hebamme hatte ihm freundlich zugelächelt und war dann in den Kreißsaal zurückgekehrt, wo meine Mutter schrie wie am Spieß. Kein Wunder: Ich wollte unbedingt nachschauen, was da draußen auf mich wartete, und ging bei meinem Aufbruch in die Außenwelt nicht gerade zimperlich vor.
Als ich geboren war, wollte die Hebamme dann meinen Vater holen. Doch der war, wie gesagt, weg. Einfach nicht mehr da. Zuerst dachte sich niemand etwas dabei. »Vielleicht ist er irgendwo draußen, eine rauchen«, mutmaßte die Schwester. Aber meine Mutter wusste, dass etwas nicht stimmte. Mein Vater war Nichtraucher. Und wenn er erst einmal irgendwo saß, dann blieb er da auch sitzen. Mein Vater war noch nie sehr unternehmungslustig.
Nach einer Weile hob meine Mutter mich, der sich gerade gemütlich an ihre Brust gekuschelt hatte und die neue Welt recht nett zu finden begann, hoch und übergab mich kurzerhand der Schwester. »Heinz ist irgendetwas passiert!«, insistierte sie. Dann stand sie auf, so gut es eben ging nach Dammriss und Geburtsstress, und stampfte wankend aus dem Zimmer. Die Schwester legte mich eiligst in eine schnöde Keramikschale, die in Sachen Gemütlichkeit weit, weit hinter einem Busen rangierte, und rannte meiner Mutter hinterher. Die Arme hielt sie ausgestreckt, weil sie fest damit rechnete, dass die Frau mit dem blutigen Nachthemd und den wirr rollenden Augen gleich zusammenklappen würde.
Doch da kannte sie meine Mutter schlecht!
Eine Viertelstunde rumpelte und torkelte Mama durch die Flure und zog mit der Zeit einen immer größeren Tross an Leuten hinter sich her. Ein Arzt, eine Hebamme, zwei Schwestern und ein anderer werdender Vater, dem wohl gerade langweilig war, eilten ihr nach. Meine Mutter grölte immer wieder: »Heinz! Heinz!«, stieß Türen auf, wo sie schreiende Frauen, essende Ärzte und einen verdutzten Elektriker vorfand. Von meinem Vater aber gab es keine Spur.
Schließlich – der Suchtrupp war mittlerweile fest überzeugt, mein Vater hätte sich aus dem Staub gemacht, und angesichts dieser Furie von Frau wäre das weiß Gott auch kein Wunder – fanden sie ihn. Die Putzfrau hatte ihn versehentlich in der Herrentoilette eingeschlossen.
»Warum hast du denn nichts gesagt?«, schnauzte ihn meine wütende Mutter an. »Warum hast du dich nicht irgendwie bemerkbar gemacht?«
»Das habe ich doch versucht«, schwor mein kleinlauter Vater. »Aber keiner hat mich gehört.«
Meine Mutter, die wusste, welch immense Abneigung mein Papa dagegen hat, aufzufallen, sah ihn nur missbilligend den Kopf schüttelnd an.
Ich glaube ihm. Wer jemals auf einer Entbindungsstation war, weiß, dass die Schreie gebärender Frauen sehr, sehr laut und mitunter so exotisch klingen wie kopulierende Nilpferde oder Mudschahedin-Gesänge. Eine Männerstimme, die – wie ich meinen Vater kenne – immer wieder eher zaghaft »Hilfe, Hilfe!« repetiert, würde tatsächlich niemand zur Kenntnis nehmen.
Natürlich kann ich mich selbst an diesen Vorfall nicht erinnern. Aber ich habe ihn oft erzählt bekommen: Die Geschichte von meinem Vater im Herrenklo der Entbindungsklinik Hamburg-Finkenau zählt zu den Anekdoten-Klassikern unserer Familienfeiern. Ich habe die Geschichte so oft gehört, dass es mir mittlerweile vorkommt, als hätte ich sie wirklich bewusst miterlebt. Und immer, wenn ich sie höre, stelle ich mir vor, wie ich in meiner Keramikschale liege, gerade geboren und schon mutterseelenallein im abgedunkelten Kreißsaal, und leise rufe: »Hallo. Hallo. Ist da jemand? Äh … War’s das jetzt etwa schon?«
Diese Frage ist mein Mantra geworden: »War’s das etwa schon?« Man möge es, wenn’s denn einmal so weit ist, in meinen Grabstein meißeln: Piet Lehmann – War’s das etwa schon?
Franz kicherte: »Du hast einfach nur auf dem Klo gesessen?«
Heinz seufzte: »Ich weiß auch nicht. Plötzlich war mir, als bräuchte ich einen Notausgang …«
»Einen Notausgang … auf dem Klo?« Franz prustete jetzt. »Wolltest du dich runterspülen?«
Jetzt grinste auch Heinz: »Ja, ich weiß. Es klingt bescheuert. Aber … weißt du, ich hatte das Gefühl, dass mich jemand wohin zerrt, wo ich nicht hin will …«
Franz wurde ernster. »Aber du wolltest doch auch ein Kind. Hast du jedenfalls gesagt.«
»Will ich auch!«, rief Heinz – und senkte dann, erschrocken über sich selbst, sofort wieder die Stimme. »Ich liebe den kleinen Scheißer schon jetzt. Aber in diesem Moment, als ich da saß und mir die feuchten Hände knetete und Vera so schreien hörte … da dachte ich plötzlich: Halt! Hier stimmt etwas nicht! Ich kann nicht Vater werden – der Schuh ist ein paar Nummern zu groß!«
»Und?«, fragte Franz, »hast du das Gefühl immer noch?«
»Manchmal«, flüsterte Heinz.
Die beiden Männer schwiegen für einen Moment. Dann grinste Franz wieder: »Weißt du, es gibt ein englisches Sprichwort, das heißt Shit or get off the pot.«
Heinz, der kein Englisch konnte, zuckte fragend mit den Achseln.
»Das heißt so viel wie Entweder kackst du jetzt oder du kommst endlich von der Schüssel runter«.
Die beiden Männer sahen sich kurz an. Dann fingen sie an loszuprusten. »Noch nie«, lachte Franz aus ganzem Herzen, »hat ein Sprichwort besser gepasst!«
Sie kicherten noch eine ganze Minute, laut, befreit, und dann nahmen sie sich kurz in die Arme, drückten sich unbeholfen, und Heinz klopfte Franz auf die Schulter.
»Ich will’s ja auch gar nicht anders!«, sagte er. »Nur … manchmal ist man sich einfach nicht sicher, ob man die richtige Abzweigung genommen hat.«
Franz wurde still. Und dann nickte er. Wissend.
Ich habe mir nie recht vorstellen können, dass die Sterne wirklich einen Einfluss auf den Charakter haben. Wie kann man ernsthaft der Umlaufbahn von Pluto die Schuld daran geben, dass jemand ein ausgemachtes Arschloch, ein Jammerlappen oder eine Knalltüte geworden ist? Meine Vermutung ist vielmehr, dass nichts uns mehr prägt als die ersten zehn Minuten unseres Lebens. Die ersten 600 Sekunden nach unserer Geburt.
Ich selbst bin, wie gesagt, ein exzellentes Beispiel. Mich hat man mit viel Gebrülle und Anfeuerungsrufen herausgedrückt, sorgfältig abgecheckt und dann … einfach zur Seite gelegt. Mein Entree ins menschliche Leben begann mit großem Rambazamba – und ehe ich mich versah, lag ich von allen verlassen in einer blöden, kalten Schale und konnte mich des Verdachts nicht erwehren, dass das alles nur ein ganz großer Beschiss war. Bis heute misstraue ich deshalb großen Ankündigungen. Ich bin der Prototyp eines Skeptikers – und das alles nur, weil irgendeine Putzfrau nicht bemerkt hat, dass mein Papa auf dem Klo saß.
Ich würde das als Zufall verbuchen, gäbe es bei meinem Freund Dilbert nicht eine ebenso offenkundige Parallele zwischen den Ereignissen in seinen ersten Minuten auf Erden und der grundlegenden Einstellung zum Leben, die er daraus entwickelte. Dilbert kam nämlich blau zur Welt. Er hatte sich im Mutterleib die Nabelschnur um den Hals gewickelt, kräftig daran gezogen – und dann blieb ihm die Puste weg. Das Erste, was Dilbert also überhaupt erlebte, war eine äußerst erregte Hebamme, die ihm die Schnur ablöste und ihn dann unter kühner Missachtung aller Grundregeln der Antisepsis Mund zu Mund beatmete. »Ich habe meinen ersten Kuss mit zwei Minuten bekommen«, pflegt Dilbert jedem zu erzählen, der ihn gerade kennen lernt. Und das ist nur zur Hälfte eine lustige Bemerkung. Zur anderen Hälfte ist es blanke Selbstüberschätzung. Dilbert, den übrigens jeder nur Dille nennt, kann sich bis heute nicht erklären, warum es tatsächlich Frauen gibt, die nicht sofort, wenn sie ihn sehen, das unbändige Verlangen verspüren, ihre Lippen auf die seinen zu pressen. Dille hält sich für erste Sahne.
Sven, das hat mir seine Mutter einmal erzählt, war eine Steißgeburt. Und auch das passt zu meiner These: Sven macht noch heute nicht unbedingt das, was man von ihm erwartet. Und Petra? Nun, da habe ich zumindest eine sehr gute Vermutung: Die Hebamme, wahrscheinlich noch ziemlich neu in ihrem Beruf und entsprechend aufgeregt, hob das Baby Petra hoch, blickte ihm kurz zwischen die Beine und lächelte dann Petras Mutter an: »Gratuliere, ein Junge!« Dann, als sie genauer hinschaute, merkte sie, dass es ihr eigener Finger war, der zwischen Petras Beinen hervorlugte, und korrigierte sich hastig. Aber irgendwo in Petras Gehirn hatte sich die erste Information schon fest verankert: Ein Junge? Ich bin ein Junge! Junge, Junge …
Über Bernhards Geburt weiß ich nichts. Als ich meine Theorie der ersten Minuten entwickelte, war er bereits verschwunden. Auf seine ganz besondere Reise, die uns alle so faszinieren sollte. Ich konnte ihn also nie nach den Details seines großen Auftritts fragen. Ich nehme allerdings an, Bernhards erste zehn Minuten waren irgendwie traurig. Alles, was mit Bernhard zu tun hat, ist nämlich irgendwie traurig. Ich glaube, deshalb hatten wir alle ihn immer so gern um uns: Er war die arme Sau, die es immer noch ein bisschen schlimmer traf. Das hat uns anderen stets die Perspektive zurechtgerückt und Demut gelehrt: Was auch immer uns gerade quälte – es war immer noch einen guten Schritt von Bernhards Problemen entfernt.
Und was war mit Susanns Geburt? Ach, Susann …
Ich habe keine Ahnung.
Nicht den leisesten Schimmer.
»Wie geht’s denn Karola?«, fragte der Dicke seinen Nebenmann am Tresen und signalisierte gleichzeitig dem Wirt, dass es ihm dringend nach einem neuen Bier verlangt.
»Is’ so weit mit Karola«, brummte der Mann. »Sie is’m Krankenhaus. Seit halb vier schon.«
»Ui!«, tat der Dicke seine Überraschung kund. »Und du bist nich’ da? Als ihr Mann, und so?«
»Was soll ich da rumsitzen?« Karolas Mann zuckte mit den Schultern. »Sie ruft hier an, wenn sie fertig is’.«
Der Dicke nickte. Einleuchtend. Was sollte er da rumsitzen?
Irmhild, die vom Tisch aus zugehört hatte, erhob sich ächzend. Ihre Hüfte machte ihr mal wieder zu schaffen. »Was hör’ ich? Das Kind kommt?« Karolas Mann nickte und grinste unbeholfen. »Hubert als Vater!« Irmhild war entzückt.
»Wird ’n guter Vater, unser Hubert!«, gab sich der Dicke überzeugt und klopfte Karolas Mann auf die Schulter. »Der kann bestimmt gut mit Kindern. Is’ ja selbst noch ’n halbes Kind!«
Hubert, der sich mit seinen fünfundzwanzig Jahren durchaus als ausgewachsenen, ja sogar gestandenen Kerl empfand, verzog ein wenig das Gesicht. Aber seine Gesichtszüge glätteten sich nahezu unverzüglich, als der Mann hinter dem Tresen drei Gläser Korn vor sie stellte und sein jovialstes Lächeln aufsetzte: »Auf den werdenden Vater! Geht aufs Haus!«
Irmhild war Hubert mittlerweile so dicht auf den Pelz gerückt, als wolle sie seinen Schoß besteigen. Sie hatte wieder diesen leicht säuerlichen Atem, da sie es sich nicht nehmen ließ, stets einen Spritzer Zitronensaft in ihren Schnaps zu träufeln. Für Irmhild war dieser Spritzer der ganz persönliche Hauch des Mondänen. Wenn es tatsächlich etwas geben sollte, was noch dichter an einen Cocktail herankam als Korn mit Zitrone, dann übertraf es auf jeden Fall Irmhilds Vorstellungskraft.
»Wie soll’s denn heißen?«, lächelte sie Hubert an.
»Beate, wenn’s ’n Mädchen wird. Und Bernhard beim Jungen!«, sagte Hubert sichtlich stolz, war das doch immerhin das Ergebnis einer fast zweistündigen, ausgesprochen hitzigen Diskussion.
»Bernhard. Guter Name. Kräftiger Name«, brummte der Dicke.
Als das Telefon klingelte, waren sie alle schlagartig still. Der Tresenmann nahm ab, horchte ein paar Sekunden, grinste breit und sagte: »Glückwunsch!«, bevor er Hubert heranwinkte.
Hubert schnappte sich den Hörer: »Karola? Ja? Was isses? Ha!« Hubert strahlte. »Ja, ich komme. Ich fahr’ gleich los.«
Er legte auf und kehrte zu seinen Freunden zurück. »Is’n Junge! Ich hab’n Sohn!«
Der Dicke klopfte ihm einmal mehr auf die Schulter und Irmhild drückte ihm einen ihrer berüchtigten nassen Küsse auf die Wange. »Glückwunsch!«
»Ich fahr’ jetzt mal los«, grinste Hubert und zog sich seine Jacke an. Der Tresenmann wühlte in einem der Regale herum und förderte eine Flasche Sekt hervor. Söhnlein brillant. Wie passend. Er stellte sie vor Hubert auf den Tresen: »Hier. Zum Anstoßen. Musste nur an den Schwestern vorbeischmuggeln!«
Hubert wehrte die angebotene Flache mit erhobener Hand ab. »Karola hat gesagt, wenn das Kind da ist, ist Schluss mit Saufen. Sie sagt, sie trinkt nix mehr. Mütter müssen nüchtern sein, sagt sie!« Hubert sah seine Freunde fast entschuldigend an.
Der Dicke lachte. Irmhild versuchte, ihr Gesicht so neutral wie möglich zu halten. Der Tresenmann stellte die Flasche zurück ins Regal. »Ich heb’se euch auf. Wenn Karola sich das anders überlegt.«
Wir alle wurden im Jahre 1960 geboren. Es war kein schlechtes Jahr. John F. Kennedy wurde Präsident der Vereinigten Staaten, Hitchcock ließ Janet Leigh in Psycho unter der Dusche ermorden und Real Madrid gewann zum fünften Mal hintereinander den Europapokal der Landesmeister. Es war auch das Jahr, in dem die Antibabypille für den deutschen Markt zugelassen wurde. Für unsere Eltern kam sie also zu spät. Schwein gehabt, sage ich jetzt einfach mal.
Unsere Geburtsstadt war Hamburg. Wer jetzt an den Hafen, die Reeperbahn oder andere markante Plätze denkt, liegt allerdings falsch. Unser Kindheitsterritorium hieß Farmsen-Berne – ein Stadtteil im Nordosten, nur eine läppische, zwanzigminütige U-Bahnfahrt von der trubelnden Innenstadt entfernt und doch schon ein Diaspora des Banalen. Hier lebte die gehobene Arbeiter- und die niedere Angestelltenschaft der Stadt. Wir waren nicht mal ansatzweise so edel wie die Pfeffersäcke an der Elbchaussee, aber auch nicht so plakativ proletarisch wie die Malocher von St. Pauli und Altona. Wir waren nicht mal verachtenswerte Vorstädter. Wir waren einfach nur Durchschnitt. Eigentlich hätte bei uns in Farmsen-Berne jeder zweitgeborene Säugling ohne Beine zur Welt kommen müssen, da die hamburgische Durchschnittsfamilie eben nur 1,7 Kinder ihr Eigen nannte.
Damals, 1960, war es uns natürlich schnurz, in welchem Stadtteil wir vor uns hinsabberten. Wenn Babys durch ein Zimmer robben, knallen sie mit dem Kopf am Ende nicht gegen eine Stadtgrenze, sondern gegen einen Türrahmen. Das ist in Famsen-Berne nicht anders als in New York, Jakarta oder Rio de Janeiro.
Von uns sechsen kannten Sven und ich uns als Erstes. Was einfach daran lag, dass Svens Eltern nur drei Reihenhaus-Eingänge von unserem entfernt wohnten. Unsere Eltern mochten sich und spielten abends zusammen Canasta. Sven und ich lagen derweil nebeneinander im Laufstall, hauten uns Holzspielzeug auf den Kopf und drückten turnusmäßig unsere Knödel in die Windel. Niemand konnte damals ahnen, dass wir beide immer Freunde bleiben würden. Und niemand konnte ahnen, dass ich meinen Freund Sven Jahre später beinahe ermorden würde.
Ich versuche oft herauszufinden, was meine früheste Kindheitserinnerung ist. Es gelingt mir nicht. Das Problem ist, dass ich manche Geschichten so oft gehört habe, dass ich sie leibhaftig vor mir sehe und einfach nicht weiß, ob diese Bilder Erinnerungen sind oder nur die mentale Illustration einer alten, oft wiedergekäuten Anekdote. So wie die Sache mit meinem Papa, dem Klo und der Entbindungsklinik eben. Aber natürlich habe ich Erinnerungen, echte Erinnerungen.
Ich erinnere mich zum Beispiel an Frau Mastenfeld. Frau Mastenfeld war meine Kindergärtnerin. Ein Koloss von Frau! Erwachsene wirken auf Vierjährige natürlich immer riesig – aber Frau Mastenfeld war ein wahrer Titan. Hier ist das Bild, das in meinem Gehirn klebt und wahrscheinlich irgendwann, wenn der Alzheimer meine Festplatte nahezu vollständig gelöscht haben wird, noch übrig sein dürfte: Frau Mastenfeld in ihrem Messerschmitt-Kabinenroller! Der Kabinenroller war meines Wissens das einzige Auto aller Zeiten, das nur drei Räder hatte – zwei vorne, eines hinten. Und das Ding war klein! Kleiner als Frau Mastenfeld jedenfalls. Jeden Tag, Punkt ein Uhr, standen wir Kindergartenkinder sorgfältig nach unserem Alter sortiert in Zweierreihen auf dem Hof, sangen irgendein Lied übers Nachhausegehen, und Frau Mastenfeld stieg dabei in dieses radknappe, kleine Gefährt. Nein, sie stieg nicht ein – sie zwängte und presste sich in den Kabinenroller. Wie eine Wurst, die zurück in die Pelle will. Aus dem auch im Winter geöffneten Seitenfenster quollen viele Ächzer und Umphs, später schließlich ihr fleischiger Arm und Teile ihres beträchtlichen Oberkörpers. Nachdem wir Kinder die letzte Strophe hinter uns gebracht haben, hupte Frau Mastenfeld einmal und knatterte von dannen. Direkt zur nächsten Imbissbude, vermute ich.
Das ist es, was von meinen drei Kindergartenjahren noch übrig ist: die fette Frau Mastenfeld in ihrem Kabineroller. Ich erinnere mich nicht daran, mit irgendeinem Kind gespielt zu haben, ich erinnere mich nicht an Bastelstunden, Märchenbücher oder sonst was. Ich erinnere mich nur daran, dass ich zum Begleitchor von Frau Mastenfelds täglichem großem Abgang gehörte. Das lässt den Rückschluss zu, dass ich im Kindergarten nicht allzu viel Spaß hatte.
Ich erinnere mich aber auch an nette Dinge aus meiner Kleinkindzeit: an Ausflüge ans Meer; daran, dass meine Eltern mich als Vierjährigen in der Silvesternacht weckten und ich mir, auf Papas Arm, dichtgepresst an seine Schulter, das Feuerwerk anschauen und meine erste Wunderkerze halten durfte; ich erinnere mich an meinen ersten Kinderteller bei meinem ersten Restaurantbesuch, einem kleinen Dorfgasthof in der Lüneburger Heide – Schnitzel, Kartoffeln und Erbsen. Speziell die Erbsen hatten es mir angetan. Ich bin noch heute verrückt nach Erbsen. Manchmal frage ich mich, ob ich Erbsen so liebe, weil ich damals einen so schönen Tag hatte. Oder ob ich damals einen so schönen Tag hatte, weil ich herausfand, dass ich Erbsen liebe. Ich würde jedenfalls niemanden je als Erbsenzähler beschimpfen – für mich klingt das wie eine sehr hübsche, beruhigende Tätigkeit.
Und ich erinnere mich natürlich an all die kleinen Abenteuer mit Sven. Jeden Tag, wenn ich aus dem Kindergarten kam, ließ ich mich eiligst von meiner Mutter abfüttern, dackelte zu Sven hinüber, klingelte und begab mich dann mit ihm auf eine neue Expedition. Wir waren wie Brüder. Obwohl ich vermute, dass Brüder sich häufiger streiten, als wir es taten. Wir waren immer einer Meinung – das heißt, wir waren immer meiner Meinung. Für Sven, die Sanftmut in Person, gab es nichts, was wichtig genug gewesen wäre, um einen Missklang in unsere perfekte Jungenfreundschaft zu bringen. Ich gab die Anordnungen – Sven führte sie aus. Ich war zufrieden, und deshalb war er es auch: Ich war der große Zauberer auf dem Weg zur Höhle des fiesen Drachen – Sven war mein Gehilfe. Ich war der Cowboy, der vierzig Gangster überwältigte – er war mein Pferd. Ich war Tarzan – er war Cheetah.
Nie, nicht ein einziges Mal, durfte Sven die Heldentaten begehen. Natürlich war das widerlich von mir – aber, hey, ich war ein Kleinkind! Und, keine Angst: Sven wird Jahre später zurückschlagen! Er wird etwas finden, was ihm wirklich wichtig ist. Wichtiger als meine gönnerhafte Zuneigung. Und er wird mich damit an den Rand des Wahnsinns treiben.
Fünf Jahre bestand die ganze Welt nur aus Sven und mir. Alle anderen Kinder konnten uns mal kreuzweise. Bis zu dem Tag, als Petra in unsere Straße zog. Petra war anders. Petra war ein Mensch, an dem man nicht vorbeikam.
1965
Es war ein Samstag, als Petra zum ersten Mal auf unserem Spielplatz auftauchte. Sven und ich waren gerade damit beschäftigt, eine Horde von imaginären Gespenstern in ihre Schranken zu weisen. Das heißt, ich bändigte die Gespenster – und Sven durfte mich dabei anhimmeln. Da stand sie plötzlich vor uns: eine kleine, drahtige Gestalt mit strubbeligem rotem Haar. Damals gab’s den Pumuckl noch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Erfinderin dieses Kobolds irgendwann einmal Petras Weg gekreuzt hat und sich von ihrem Anblick inspirieren ließ.
Petra stand einfach nur da und betrachtete uns, den Kopf leicht schief gelegt und mit hellwachem Blick. So wie ein Ethnologe wohl dem heidnischen Ritual eines bislang unentdeckten afrikanischen Stammes beiwohnen würde. Ich schielte nur hin und wieder verstohlen zu ihr hinüber, war ansonsten aber fest entschlossen, sie zu ignorieren. Die meisten kleinen Kinder sind ein bisschen wie CSU-Wähler: Alles, was neu und fremd ist, finden sie erst einmal bedrohlich. Jedes Novum ist ein potenzieller Angriff auf die eigenen Pfründe. Sven, der gutmütige Sven, lächelte Petra allerdings zu. Ich funkelte ihn giftig an und ließ ihn dann in aller Eile sogar eine eigene Attacke gegen die Gespenster reiten, nur damit er von diesem Fremdkörper abgelenkt wurde. Wenn ich gewusst hätte, dass Petra ein Mädchen ist, hätte ich sie wohl einfach mit einer atavistischen Drohgebärde zu verjagen versucht. Aber ich hielt Petra für einen Jungen. Sie hatte nicht nur diese kurze Zottelfrisur, dreckige Jeans – Nietenhosen hießen die damals – und einen typischen Jungenanorak an, sie hatte auch diese kiebige, rumpelige Aura.
Nach einer ganzen Weile, während der Sven und ich eisern unser Spiel durchzogen und so taten, als wäre sie gar nicht da, öffnete sie plötzlich den Mund und fragte mit erstaunlich kratziger Stimme: »Wenn die Gespenster unsichtbar sind – wie wisst ihr dann, wo ihr hinhauen müsst?«
Eine unerfreulich berechtigte Frage!
Sven sah mich, seinen Guru, erwartungsvoll an. Ich brauchte eine wirklich überzeugende Antwort. »Ich kann die riechen. Die stinken!«, war alles, was mir einfiel. Petra zog skeptisch eine Augenbraue hoch.
Svens Blick wanderte äußerst interessiert zwischen Petra und mir hin und her.
»Außerdem geht dich das nix an. Geh’ weg!«, versuchte ich das bevorstehende Verbalfiasko im Keim zu ersticken.
Petra rührte sich nicht. Ich funkelte sie wütend an. Und Sven, dieser wankelmütige Jünger, fand die ganze Situation offenkundig hochinteressant.
»Ich hab ein Gespenstergewehr«, sagte Petra schließlich. »Das schießt sieben auf einmal tot!« Und dann hob sie einen Stock auf, legte ihn an wie eine Flinte und brüllte: »Ratatatatatata!«
Sven riss die Augen auf. »Toll!«, rief er. »Darf ich auch mal?« Gönnerhaft gab ihm Petra ihr Gewehr, und Sven feuerte begeistert eine Salve auf die Gespenster ab. Ich stand da, völlig abgedrängt, und kapitulierte schließlich: »Ich heiße Piet«, sagte ich.
»Ich heiße Petra«, sagte sie.
»Petra?«, rief ich entsetzt. »Du bist’n Mädchen?«
»Ja.« Petra funkelte mich wütend an. »Aber ich bin stärker als du!«
Ich sagte lieber nichts mehr. Wahre Führer wissen, wann es klüger ist, einen temporären Rückzug anzutreten.
»Hör auf, mich anzulügen!«, schrie Amelie. »Deine dummen Überstundengeschichten glaube ich dir schon lange nicht mehr!«
Franz zischte: »Sei still. Du weckst Sven auf.«
Amelie senkte tatsächlich ein wenig ihre Stimme, aber der Tonfall aus Wut und Traurigkeit blieb derselbe. Franz ahnte, dass es diesmal wirklich ernst war.
»Ich schaue mir das schon viel zu lange an«, sagte Amelie. »Ich will nicht mehr.« Sie sah Franz direkt in die Augen. »Ich will nicht mehr. Und ich kann nicht mehr!«
Franz wollte seine Frau besänftigen und versuchte ihr den Arm um die Schulter zu legen. Doch Amelie stieß ihn weg. Mit verblüffender Kraft. Und dann, als hätte sie ihre letzte Reserve an Energie aufgebraucht, sackte sie zusammen, ließ sich auf den Küchenstuhl fallen und begann zu weinen.
»Wieso?«, fragte sie schließlich, schluchzend.
Franz zuckte mit den Schultern.
»Ist sie hübscher als ich?« Amelie flüsterte jetzt fast.
Franz überlegte. Ein wenig zu lang. Doch dann schüttelte er den Kopf.
»Was?«, fragte Amelie. »Was dann?«
»Es … Es ist …«, begann Franz. Doch dann verstummte er wieder. Tränen stiegen ihm in die Augen. Er ging hinaus in den Flur, langsam, als hoffte er, Amelie würde ihn zurückrufen. Dann zog er sich seine Jacke und seine Schuhe an und ging.
Drei Tage später kam Franz mit einem geliehenen VW-Bus zurück und lud ein paar Kartons mit Sachen ein. Er drückte Sven, der gar nichts verstand, an sich. Franz küsste seinen Sohn, wieder und wieder. Und dann – ahnend, dass dieser Abschied anders war als alle anderen Abschiede, die Sven je erlebt hatte – begann der Junge zu weinen. Auch Franz kämpfte mit den Tränen. Er drückte seinen Sohn noch einmal – so fest, als wolle er Spuren auf ihm hinterlassen, die nie vergehen. Und dann ging Svens Vater. Für immer.
Ich fand’s aufregend. Kein Vater mehr – das war echt ein ganz großes Ding! Heute sind Scheidungen Alltag. Aber damals, 1965, war ein Kind, das nur bei seiner Mutter aufwächst, eine ziemlich spektakuläre Angelegenheit. Ich hatte einen Freund, der in der ganzen Straße Gesprächsthema war! Frauen drehten sich zu Sven um, musterten ihn, tuschelten anderen Frauen etwas zu. Manche tätschelten seinen Kopf und blickten ihn mitleidig an. Ein Mann schenkte Sven eines Tages fünfzig Pfennig. Einfach so! Als ob er sich davon einen neuen Vater kaufen könnte. Wir holten uns Prickel Pit dafür.
Ich gebe es freimütig zu: Ich genoss die ganze Show enorm! Doch Sven konnte meine Euphorie nicht teilen. Er vermisste seinen Vater. Ich konnte das nicht verstehen: Ich hatte Svens Vater immer als ziemlichen Langweiler empfunden. Ein öder Typ, der nie Quatsch machte und irgendwie immer müde aussah. Meistens, wenn ich ihn sah, las er eine Zeitung oder ein Buch. Er schaute immer nur kurz hoch, sagte: »Hallo, Piet«, und verschwand dann wieder hinter seinem Druckerzeugnis. Echt, ein Typ ohne jeden Unterhaltungswert.
Mein Papa dagegen konnte uns mit Geschichten von fliegenden Elefanten und Indianern, die immer nur rückwärts laufen, unterhalten. Er erzählte seine Flunkereien in leisem, distinguiertem Duktus, der den Unfug wunderbar glaubhaft machte. Wirklich, mein Papa war ein prima Geschichtenerzähler! Und er hatte Mitleid mit Sven. Svens Vater war ein guter Freund meines Papas gewesen. Franz fehlte meinem Papa ziemlich – und er konnte sich sicher sehr gut vorstellen, um wie viel mehr sein eigener Sohn ihn vermissen musste. Ich glaube, wenn ich etwas mehr von dem Mitgefühl, der Sanftheit und Nachdenklichkeit meines Vaters geerbt hätte, wäre ich ein besserer Mensch geworden. Aber ich schlage eher nach meiner Mutter – ich bin nicht sehr gut im Anteilnehmen. Hier kommt der Beweis: Eines Sonntagmorgens am Frühstückstisch sagte mein Vater zu mir: »Na, Steppke« – er nannte mich immer Steppke – »wollen wir ins Kino gehen?« Ich flippte völlig aus. Kino! Endlich! Seit einem Jahr war mir bewusst, dass in dem großen, grauen Gebäude am U-Bahnhof Farmsen Filme gezeigt wurden. Und seitdem bettelte ich in regelmäßigen Abständen, dass ich dort hineingehen wollte. An diesem Sonntag – ohne Vorwarnung, ohne dass ich quengeln musste, ohne erkennbaren Grund – sollte es nun tatsächlich so weit sein! Selbst meine Mutter lächelte, als mein Vater das vorschlug. Heute weiß ich natürlich, dass die beiden sich das zusammen ausgetüftelt haben – als kleinen Trost für den niedergeschlagenen Sven, der uns nämlich begleiten sollte.
Und so saßen wir also an diesem Sonntagmittag im Roxy, mein Vater zwischen Sven und mir. Es gab einen Zeichentrickfilm mit Bugs Bunny. Und wir drei amüsierten uns prächtig, bis … bis ich entdeckte, dass Sven sich heimlich, still und leise die Hand meines Vaters geschnappt hatte. Er hielt sie ganz fest. Ich beugte mich sofort wutschnaubend herüber und zerrte an Svens Arm. Er sah mich entsetzt an und ließ meinen Vater natürlich sofort los. »Das ist mein Papa!«, schrie ich Sven an. Und dann knallte ich ihm eine, mit der flachen Hand, mitten ins Gesicht.
Sven heulte laut auf und rannte aus dem Kino. Mein Vater packte mich denkbar unsanft am Kragen und zerrte mich hinter sich her. Wir entdeckten Sven sofort: Er stand heulend im Foyer, unter einem Plakat von Alexis Sorbas. Mein Vater nahm Sven in den Arm, trocknete ihm die Tränen und hielt während des gesamten Rückwegs nach Hause seine Hand. Mich würdigte mein Papa keines Blickes. Erst abends, als ich im Bett lag, sprach er wieder mit mir.
»Ist Sven nicht dein Freund?«, fragte er.
»Doch«, murmelte ich. »Aber er soll nicht deine Hand anfassen!«
»Weißt du, was ein Freund ist?«, fuhr mein Vater fort, als hätte er mich gar nicht gehört. »Ein Freund ist jemand, der einem hilft, wenn es einem schlecht geht. Der alles tun würde, damit es einem besser geht.«
»Aber …«
»… und dein Freund Sven ist im Moment sehr, sehr traurig. Du solltest für ihn da sein. Manchmal sind die anderen ein ganz klein bisschen wichtiger als man selbst.« Er sah mich lange an, mit einem Blick, den ich vorher noch nie von ihm gesehen hatte. Und dann sagte er etwas, was ich niemals vergessen werde: »Heute war das allererste Mal, dass ich mich für dich geschämt habe.«
Leise verließ er mein Zimmer und schloss die Tür.
Am Tag darauf habe ich mich murmelnd bei Sven entschuldigt. Er zuckte nur mit den Schultern, als ob es eine Lappalie gewesen wäre.
1966
Einer meiner Lieblingsfilme ist Die Geschichte einer Nonne mit Audrey Hepburn. Ich werde niemals die Schlussszene vergessen, in der Audrey ihre Nonnentracht ablegt, ein kleines Köfferchen packt und ebenso traurig wie entschlossen aus dem Kloster schreitet. Sie glaubte an Gott, aber die Institution der Kirche funktionierte für sie nicht. Sie war dort falsch.
So ging’s mir mit der Schule. Ich wollte etwas lernen, aber die Methoden fand ich widerlich. Leider konnte ich im Gegensatz zu Schwester Audrey nicht einfach gehen. Staatliche Bildungsstätten sind nun mal bedauerlicherweise keine Glaubensfrage, sondern Pflicht. Ich steckte also fest in dieser Zwingburg sinnloser Rituale, erzwungenen Respekts und des Prinzips des blinden Repetierens. Und noch heute, mit vierzig, wache ich manchmal mitten in der Nacht auf, schweißgebadet und kurzatmig, weil ich von versäumten Hausaufgaben oder geschwänztem Sportunterricht geträumt habe.
An jenem sonnigen Septembermorgen des Jahres 1966, als ich mit der Schultüte in der Hand aus der Haustür trat, wusste ich allerdings noch nicht, dass die Schule und ich nicht kompatibel sein würden. Ich freute mich. Ich war ein großer Junge. Drei Eingänge weiter öffnete gerade Svens Mutter die Tür. Sven kam heraus, ebenfalls ausstaffiert mit einer großen, bunten, zylinderförmigen Schultüte, die – wie ich heute weiß – kein echtes Geschenk, sondern eine Art präventiver Schadensersatz ist. Svens Mutter küsste ihren Sohn und winkte ihm nach, als er mit mir und meinen Eltern losdackelte. Svens Mutter konnte nicht mit zur Einschulung; sie musste arbeiten. Alleinerziehende Mütter müssen immer arbeiten.
Sven und ich kicherten während des gesamten Weges, wir bewegten uns hoppsend fort und drückten die Daumen, dass wir zusammen in eine Klasse kämen. Dann würden wir nebeneinander sitzen.
Petra, die mittlerweile fest zu uns gehörte, begleitete uns nicht. Sie wurde von ihren Eltern in eine reine Mädchenschule verfrachtet. Ich glaube, der Plan von Petras Eltern war, ihr somit ein für alle Mal zu beweisen, dass sie kein Junge sei. Sie sollte dort wohl lernen, wie eine zukünftige Frau zu denken und zu handeln. Sie sollte, wie Psychologen sagen würden, in Kontakt mit ihrer weiblichen Seite kommen. Es sollte allerdings, um schon mal etwas vorauszugreifen, noch sehr, sehr lange dauern, bis Petra diese interessante Erfahrung zuteil wurde.
Als wir den Schulhof betraten, hielt ich den Atem an. Menschen! So viele Menschen! Und mit einigen von ihnen – denen unter ein Meter dreißig – würde ich demnächst viel Zeit verbringen. Ich musterte die Kinder, ob jemand potenziell Spannendes dabei wäre. Was mir ins Auge stach, war allerdings kein Kind, sondern zwei Erwachsene. Ein Mann und eine Frau. Der Mann sah aus, als hätte er in seinen Klamotten geschlafen. Er war ungekämmt, unrasiert und schoss mit seinen Augen wütende Blitze in die Menge. Zuerst wusste ich nicht, warum er so böse schaute, dann sah ich, dass ihn die anderen Eltern mit offener Missbilligung musterten. Sein Blick sagte einfach: Ich hasse euch auch. Die Frau neben ihm hatte dagegen versucht, sich hübsch zu machen. Vergeblich. Sie war sehr dick, und ihr Kopf war so rot, als wäre er bis zur Schmerzgrenze aufgepumpt und würde gleich platzen. Dessen ungeachtet hatte sie sich noch zusätzliche Farbe ins Gesicht geschmiert: zwei rote Balken auf die Wange, hellblaue Balken zwischen Augen und Augenbrauen. Sie trug einen beigefarbenen Hosenanzug, und ihre Haare hatte sie offenbar sehr lange, aber ohne rechtes Konzept mit einem Lockenstab traktiert. Die Frau versuchte so verzweifelt, entspannt auszusehen, dass sie ihre Position fast im Sekundentakt veränderte und vor lauter Geschlackse wie eine falsch konstruierte Aufziehpuppe wirkte.
Neben ihr, ihre Hand haltend, stand ein Junge. Er wirkte furchtbar klein, weil er seinen Kopf und seine Schultern so weit nach unten senkte, als wolle er in die Erde kriechen. Meine Mutter, die bemerkte, wie ich dieses trostlose Trio anstarrte, beugte sich zu mir herunter: »Mit diesem Jungen solltest du nicht spielen«, sagte sie. Ich verstand nicht, wieso. Schummelte der immer, oder was?
Wir gingen zur Turnhalle, wo die Begrüßungszeremonie abgehalten werden sollte. Mama hielt meine Hand, Papa hielt Svens. Ich hatte mich daran gewöhnt, dass Sven die Zuneigung meines Vaters suchte und auch erhielt. Und das war auch ganz okay so: Mein Papa war nett zu Sven, aber mich liebte er. So sah ich das mittlerweile.
Gerade als wir durch die Tür treten wollten, wurde ich zur Seite geschubst. Ein Junge preschte an mir vorbei, stuppste mir dabei in die Rippen und streifte den Kopf meiner Mutter mit seiner Schultüte, die er mit hochgestreckten Armen wie eine Keule schwenkte. »Ich will vorne sitzen! Vorne! Gaaaanz vorne!«, grölte er dabei und schlug sich eine Schneise durch die Leute. Hinter ihm eilte eine Frau her, die immer abwechselnd rief: »Dilbert! Bleib stehen, Dilbert!«, und flüsterte: »Entschuldigung! Entschuldigung! Entschuldigung!«. Meine Mutter grinste. Sie sagte nicht, dass ich mit diesem Jungen nicht spielen dürfte. In meinem sechsjährigen Gehirn keimte eine interessante Frage: Was ist bedrohlicher an einem traurigen, stillen Kind als an einem offenkundigen Rüpel und Schreihals?
»Du kommst mit!«, schrie Karola. »Es ist Bernhards Einschulung, verdammt noch mal!«
Hubert saß in Unterwäsche auf dem Sofa. In der Hand hielt er eine Flasche Bier. »Was soll ich da?«, knurrte er. »Ich hab’ keine Lust. Schule … Scheiße!« Er beugte sich zu Bernhard vor, der bereits fertig angezogen, mit neuer Cordhose und sauberem Pulli, dastand. In der Hand hielt er seine kleine Schultüte. Hubert hatte sie selbst gefüllt: zwei Schokoladentafeln, Brausepulver, sechs Filzstifte in verschiedenen Farben, ein kleines Pixi-Buch. »Hast du etwa Lust auf Schule?«, grinste er seinen Sohn an, zwinkernd, kumpelhaft.
Bernhard sah auf den Boden. Dann, leise, murmelte er: »Ja. Da lerne ich viele wichtige Sachen.«
Hubert ließ sich ins Sofa zurückfallen und nahm noch einen Schluck Bier. Er seufzte. Tatsächlich war er stolz, wie Väter das eben sind. Sein Sohn tat heute seinen nächsten großen Schritt. Aber Hubert schämte sich. Farmsen-Berne, das war wie ein kleines Dorf in der Stadt. Die Leute kannten ihn. Sie hatten ihn oft genug gesehen: besoffen, grölend, labernd. Mit seinen Freunden am Bahnhof. Hubert wusste, dass die anderen Eltern ihn verachteten. Er wusste, dass man ihn als eine Störung im schönen Bild betrachten würde. Die nettesten von ihnen würden ihn bloß mitleidig ansehen. Aber das war das Schlimmste: dieses scheißarrogante Mitleid.
»Zieh dich jetzt an«, schimpfte Karola und schmiss Hubert einen Pullover an den Kopf. »Und putz dir die Zähne!« Dann beugte sie sich zu Bernhard hinunter, drückte ihn fest und fragte: »Bist du aufgeregt?«
Bernhard nickte.
»Musste nicht sein«, lächelte Karola. »Wirst sehen, in der Schule findest du ganz viele Freunde.«
Bernhard lächelte ein wenig bemüht. Hubert, der sich gerade in seine Hose zwängte, begann spöttisch zu singen: »Ein Freund, ein guhuuuter Freuuund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt!« Dann lachte er.
Bernhard sah seinen Vater an. Dann sagte er, leise: »Wenn man Freunde hat, ist man nie mehr allein.«
Karola strich ihm über den Kopf. Hubert schaute seinen Sohn einen Moment erschrocken an, dann nahm er schnell einen letzten Schluck Bier aus der Flasche und nickte geistesabwesend. »Ja, klar!«
Als Hubert sich seine Schuhe anzog und Bernhard bereits die Wohnungstür öffnete und ins Treppenhaus schlüpfte, schlich Karola noch schnell in die Küche. Sie öffnete den Kühlschrank, griff sich eine halb volle Wodkaflasche und nahm einen großen, hastigen Schluck. »Lass mich das durchstehen, lieber Gott!«, sagte sie, als sei der Angesprochene in der Flasche zu finden. »Lass mich das heute durchstehen.«
Sven und ich kamen nicht in dieselbe Klasse. Ich kam in die 1a, er in die 1c. Ich kannte keinen meiner Mitschüler. Zwei der Mädchen hatte ich zwar schon mal gesehen, beim Bäcker oder auf einem Spielplatz – aber, na ja, es waren eben Mädchen. Nichts, worauf sechsjährige Jungen viel Gedanken verschwendeten. Ich brauchte einen Kumpel, einen Verbündeten. Als ich den Klassenraum betrat – von meinen Eltern mit einem Viel Glück und viel Spaß!-Küsschen verabschiedet und nun ganz auf mich allein gestellt –, sondierte ich die Lage, hielt Ausschau nach potenziellen Kontaktpersonen.
Die meisten meiner Mitschüler hatten sich schon einen Platz gesucht und schnatterten fröhlich und aufgeregt mit ihren Sitznachbarn. Drei freie Plätze waren noch da – einer neben einem Mädchen, indiskutabel also, einer neben dem Schreihals Dilbert, der hemmungslos auf dem Tisch herumtrommelte und irgendetwas sang, und einer neben dem stillen, traurigen Jungen, den ich schon auf dem Schulhof beobachtet hatte. Auch jetzt sah er wieder ganz verhuscht aus, starrte auf die Tischplatte, als würde dort eine geheime Botschaft darauf warten, von ihm entziffert zu werden. Ganz automatisch, wie ferngelenkt, bewegte ich mich auf dieses Häufchen Elend zu, ließ mich neben ihm nieder, ließ meine Schultüte auf den Tisch plumpsen und murmelte, freundlich wie ich fand, »Hallo«.
Der Junge schaute entsetzt hoch, sah mir direkt ins Gesicht, zögerte und … senkte seinen Kopf wieder. Ich würde jetzt gern behaupten, ich hätte Mitleid mit ihm gehabt, hätte ihm Unterstützung und Halt geben wollen. Aber so war das nicht. Ich hätte mir in diesem Moment in den Arsch treten können, hatte ich mich doch mit dem offenkundigsten Versager der Klasse gepaart! Ich hatte mich nur zu ihm gesetzt, weil die einzige Alternative im Chaoten Dilbert bestand, der mich zweifelsohne binnen Minuten untergebuttert hätte. Neben Dilbert hätte ich das gesamte Schuljahr hindurch die zweite Geige gespielt. Nee, da wollte ich dann doch lieber so einen stillen, folgsamen Kerl, der tat, was ich ihm sagte. Einen wie Sven eben. Aber verglichen mit diesem schreckhaften, stummen Wesen war Sven ein resolutes Energiebündel. Ich seufzte.
Die Lehrerin betrat die Klasse. Sie hieß Frau Brackner und hatte ein entsetzlich gezwungenes Lächeln. Ich war erst sechs Jahre alt und glaubte noch an den Weihnachtsmann – aber als diese Frau sagte, sie freue sich, uns kennen zu lernen, wusste ich, dass sie log. Solch eine schlechte Schauspielerin war Frau Brackner!