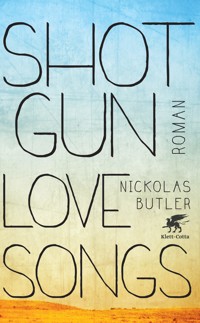10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über eine Zeitspanne von drei Generationen und ebenso vielen Kriegen erkundet dieser Roman die Herzen der Männer: ihre Schwächen und Geheimnisse, ihre Bedürfnisse und Werte. Damit legt Nickolas Butler nach »Shotgun Lovesongs« ein vielschichtiges und sensibles Epos über die Verletzungen, die Männer einander und anderen zufügen, vor. In den Augen seines Vaters ist Nelson eine Enttäuschung. Wer will schon ein Kind, das weder Freunde noch Selbstbewusstsein besitzt? Je intensiver der verunsicherte Junge sich nach Zuwendung sehnt, desto stärker sondert sich der Vater ab, bis er irgendwann ganz aus dem Leben seines Sohnes verschwindet. Doch in einem Punkt hat er sich getäuscht. Nelson ist nicht allein. Jonathan, sein bester Freund aus dem Pfadfinderlager, ist das genaue Gegenteil von Nelson: bei allen beliebt, pragmatisch und mit einer unverwüstlichen Leichtigkeit ausgestattet. Was aber treibt jemanden wie Jonathan dazu, sich mit einem Außenseiter anzufreunden? Und stand Jonathan wirklich immer so rückhaltlos zu ihm? Das Leben im rauhen Wisconsin verlangt Nelson, Jonathan und dessen Familie Prüfungen ab, die Freundschaft und Loyalität auf eine harte Probe stellen. Stimmen zum Buch »Ein zärtliches, einfühlsames Buch – eine wunderbare Lektüre.« People
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Nickolas Butler
Die Herzender Männer
Aus dem Amerikanischen vonDorothee Merkel
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Hearts of Men« im Verlag HarperCollins/Ecco, New York
© 2017 by Nickolas Butler
Für die deutsche Ausgabe
© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Cover: ANZINGER und RASP, München
unter Verwendung eines Fotos von Arcangel
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN978-3-608-98313-5
E-Book: ISBN 978-3-608-11010-4
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Inhalt
I. Teil Sommer, 1962Der Trompeter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
II. Teil Sommer 1996Stardust Supper Club & Lounge
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
III. Teil Sommer 2019Orientierungslauf
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
IV. Teil Herbst 2019Die Drakensberge
48
Danksagung
Für meine Mutter und alle Mütter,
die ihrem Kind ein Buch zu lesen geben.
Für meinen Vater, der sein Bestes getan hat.
Und für Regina, die Königin des Nordens.
Dort, wo erloschene Sterne sich schassten,
verprassten, verblassten –
Dort, wo niemand ein Versprechen hielt.
Oh, und eins noch. Ich sende meine Liebe,
Gleich wie weit es ist und wie lange es dauert – durch das Licht,
Durch die Zeit, durch alle Treulosigkeit der Menschen.
Dear Miss Emily, James Galvin
Hab Vertrauen, du altes Herz. Was ist das Leben schon Anderes als Sterben.
Known To Be Left, Sharon Olds
I. Teil Sommer, 1962
Der Trompeter
1
DER SIGNALTROMPETER BRAUCHT keinen Wecker. In der modrig dumpfen Dunkelheit des Zeltes ertastet er mit seinen zierlichen Händen die Streichholzschachtel und streicht mit einem der blauen, schwefeligen Köpfe an der Schachtel entlang, bis das Streichholz Feuer fängt und das goldene Petroleumlicht der Laterne entfacht. Im nächsten Moment lodert der Docht wie eine Lunge, die in hellen Flammen steht. Der Trompeter gähnt und reibt sich den Schlaf aus den Augen. Im neu geschaffenen Licht sucht und findet er seine Brille und kann nun auch die vertrauten Einzelheiten seines Zeltes erkennen, sieht die Schatten, die in den Ecken lauern, und seine eigenen Habseligkeiten. Als er die Zeltklappe öffnet, schreit eine Eule vom Wipfel eines nahe stehenden Ahornbaumes herab. Der Junge zittert in der frühmorgendlichen Kälte. Ohne Schuhe und Strümpfe huscht er leichtfüßig über die ausgetretenen Pfade des Lagers. Am Waldrand zieht er sich die weiße Unterhose herunter und pinkelt schlotternd und in weitem Bogen in die unsichtbaren, hochgewachsenen, alles erduldenden Farnwedel. Es ist ein schönes Geräusch. Wie Regenwasser, das auf eine Zeltplane prasselt. Dann kehrt er wieder ins Zelt zurück, in dem es nun dank der Flamme der Coleman-Laterne sehr viel wärmer geworden ist. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, denn bis zum Morgengrauen ist es nicht mehr weit.
Nelson, der in der Truppe aus dreißig Jungen der Jüngste ist, schläft allein. Seine Habseligkeiten sind ordentlich in kleine Haufen aufgeteilt: Socken, Unterwäsche, kurze Hosen, Bücher. Hemden und lange Hosen hängen an einer Leine, die er am Zeltpfahl in der Mitte befestigt hat. Morgens ist er dankbar dafür, allein zu sein. Abends jedoch hallen Lagerplatz und Wald vom leisen Gemurmel der anderen Jungen wider, man hört ihr helles Kichern und ihre nächtlichen Gespräche, und das erinnert ihn an seine eigene Einsamkeit. Es ist der fünfte Sommer, den er nun schon ins Camp Chippewa fährt, und der zweite Sommer, in dem er ein Zelt ganz für sich allein hat. Manchmal schleicht er sich um Mitternacht hinaus, um dem Schattentheater zuzuschauen, das die anderen Jungen mit ihren Taschenlampen veranstalten. Er hört zu, wie sie die Seiten ihrer Comichefte umblättern, wie sie mit der Plastikfolie ihrer Schokoladenriegel rascheln, und riecht den Rauch ihrer heimlich ins Lager geschmuggelten Zigaretten. Sein Vater hat ihm halbherzig angeboten, das Zelt mit ihm zu teilen, doch beiden, Vater und Sohn, wurde schnell klar, dass diese Geste letztendlich etwas Peinliches hatte. Nein, es war besser für Nelson, wenn er allein blieb. Vielleicht würde er irgendwann im Laufe der Woche noch einen Zeltnachbarn bekommen, einen anderen jungen Pfadfinder, der schlimmes Heimweh hat oder von den anderen ausgegrenzt wird und der nun eine Zuflucht braucht. Ein Junge, der versehentlich seinen Schlafsack eingenässt hat. Nelson würde bereit sein. Bereit, sein Hab und Gut auf eine Seite des Zeltes zu beschränken, bereit, ein zweites Feldbett aufzustellen, er würde hilfreich, freundlich, höflich, liebenswürdig und stets munter und vergnügt sein.
Nun holt er einen aus Birkenrinde geflochtenen Korb aus seinem Zelt und trägt ihn zu der von rußvernarbten Steinen umgebenen Feuerstelle des Lagers. Es scheint fast so, als würde der Leinwandstoff der Zelte, an denen er vorübergeht, von den in die Nacht hinausbrandenden Schnarch- und Traumlauten leicht hin und her wogen. Am Himmel ergießt sich die Milchstraße über das Kronendach des Waldes – lauter winzige Löcher im Firmament, so funkelnd und violett wie Amethyste oder so blassblau wie das Herz eines Gletschers. An der Feuerstelle bückt er sich und hält seine zierlichen Hände über die Glut der letzten Nacht. Die Restwärme strahlt von seinen Handflächen ab und durchdringt die weichen Polster seiner Fingerspitzen. Er kniet sich hin, beugt sich über die Feuerstelle und bläst mit der Kraft seiner vom Trompetenspiel geübten Lunge in die Glut. Nach ein oder zwei Minuten geduldigen Pustens glimmt das Feuer in einem schläfrigen Rot. Er nimmt ein wenig getrocknetes Gras und ein paar Tannenzapfen aus dem Korb und legt den Zunder in die Kohlen. Dann bläst und bläst er, bis endlich das Feuer auflodert, in kleinen Flammen, wie die Blütenblätter einer urzeitlichen Orchidee, die sich nur des Nachts entfaltet. Der Zunder gerät in Brand, und jetzt greift er mit beiden Händen in den Korb, um mehr Zweige, mehr Tannenzapfen herauszuholen. Das Feuer steigt immer weiter in die Höhe.
Er richtet sich auf, geschmeidig, hellwach, und macht sich daran, das Holz zu einem Tipi aufzuschichten, nimmt jetzt größere Zweige, bis das Feuer laut knistert und die Dunkelheit vor sich hertreibt, zurück in das Kronendach des Waldes, wo die Eule leise davonflattert, fort von den aufgewühlten Funken und den lodernden Tannenzapfen, deren Feuer sich weit in den frühmorgendlichen Himmel hinaufreckt. Nelson geht zu den Picknicktischen, um den verrußten, mit Asche und Teeröl überzogenen Teekessel zu holen. Er schüttelt ihn, hört jedoch kein Plätschern. Also geht er den ganzen weiten Weg bis zu seinem Zelt und kehrt mit einer schweren Feldflasche zu dem nun prasselnden Feuer zurück. Er füllt den Kessel und setzt ihn auf den Feuerrost, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Dann erlaubt er es sich, endlich auszuatmen. Er war schon seit jeher gut darin, ein Feuer in Gang zu bringen.
Nelson hat keine Freunde. Weder hier, im Camp Chippewa, noch zu Hause in Eau Claire, in seiner Nachbarschaft oder in der Schule. Es ist ihm bewusst, dass dies mit den Verdienstabzeichen zu tun hat, mit denen seine Schärpe gespickt ist – bislang sind es genau siebenundzwanzig, was ihm den Rang eines Stern-Pfadfinders verleiht. Es ist nicht unbedingt so, dass das Erringen von Abzeichen uncool ist, aber das Tempo und die Entschiedenheit, mit denen er seine Schärpe mit immer mehr Gewichten behängt hat, erwecken Neid, um nicht zu sagen Mitleid. Seine Unbeliebtheit hat möglicherweise auch mit seiner Brille zu tun, obwohl es genauso gut an seiner Unfähigkeit liegen könnte, einen Basketball zu dribbeln oder im Football einen gut gezielten Pass zu werfen – oder, was noch schlimmer ist, an der geradezu reflexartigen Geste, mit der er seinen Arm im Klassenzimmer in die Höhe schnellen lässt, um eine Frage zu beantworten. Nelson mag die Schule, ja, genießt sie sogar, strebt nach der Anerkennung seiner Lehrer, nach der wohltuenden Überraschung in ihren Gesichtern, wenn er mit irgendwelchen obskuren historischen Details aufwarten kann, die mit Intrigen im Rechtssystem oder selten vorkommenden Elementen des Periodensystems zu tun haben. Es gelingt ihm nicht, den Finger auf den wunden Punkt zu legen, auf diesen einen Bestandteil seiner Persönlichkeit, auf ebendieses Sosein, das er ändern müsste, um mehr Freunde zu gewinnen. Aber er wünscht sich sehnlichst, er könnte es. Wünscht sich, seine Vormittage und Nachmittage wären nicht auf einsame Spaziergänge durch die Flure der Schule beschränkt oder auf endlose Patience-Spiele an den verwaisten Tischen der Cafeteria. Andererseits, vielleicht ist das ja genau der Mensch, der er ist, und niemand sonst. Manchmal, wenn er sich mutig fühlt, geht er ganz in diesem Gedanken auf, stellt sich vor, er sei ein einsamer Wolf ohne Rudel, der durch die Welt wandert, so frei, wie man nur sein kann, ein autonomes Waldwesen.
Bei der Party anlässlich seines dreizehnten Geburtstags saß er im Garten, an einem glühend heißen Sonntagnachmittag im Juni, und wartete auf die Ankunft der übrigen Mitglieder seiner Pfadfindertruppe, wartete darauf, dass sie mit ihren Luftgewehren und Mützen aus Waschbärenfell kommen würden und mit ihren Geschenken, deren Papier vom sommerlichen Schweiß ganz feucht geworden und an einigen Stellen vielleicht schon gerissen wäre. Am Abend zuvor hatte er es sich wider alles bessere Wissen erlaubt, die Stapel von Geschenken vor seinem geistigen Auge vorbeiziehen zu lassen: Bücher und Modellflugzeuge, Baseball-Sammelkarten und Süßigkeiten.
Auf einem der Beistelltische stand ein riesiger Glaskrug mit Limonade, der so heftig in Schweiß ausgebrochen war, als würde er gerade einem brutalen Verhör unterzogen. Der Teller voller Törtchen mit Zuckerguss war bereits wieder im Kühlschrank verschwunden, nachdem er lange genug draußen gestanden hatte, um die unwillkommene Aufmerksamkeit zahlreicher Hornissen und Fliegen auf sich zu ziehen. Seine Mutter hatte ihm dabei geholfen, jedem einzelnen Jungen einen ganzen Monat im Voraus eine Einladung zu schicken. Doch der Nachmittag zog sich immer weiter in die Länge, und kein einziger Junge kam. Also nahm er sich seinen Bogen und verbrachte Stunden damit, einen Pfeil nach dem anderen in die grellen Primärfarben einer Zielscheibe zu schießen, die am Baumstamm der prächtigsten Ulme des Gartens prangte.
Während des Abendessens fiel es ihm schwer, seine Tränen zurückzuhalten, und als sie dann kamen, flossen sie ihm heiß und ungestüm an den sonnenverbrannten Wangen herab. Seine Mutter und sein Vater saßen ihm am Gartentisch gegenüber und sahen zu. In der feuchten Luft des Juniabends klebte die rotweiß karierte Baumwolltischdecke an den aus Mammutbäumen gezimmerten Tischplanken. Zwei Luftballons rahmten die Tafel zu beiden Seiten ein. Sie hingen an ihren Plastikschnüren und machten in der drückenden Sommerluft nicht die geringste Bewegung, vollführten nicht einmal die winzigste Drehung. Seine Mutter kam um den Tisch herum, setzte sich neben ihn und legte ihm den Arm um die Schulter.
»Ich verstehe das nicht«, schluchzte er. »Wir haben ihnen doch Einladungen geschickt! Vor Wochen schon! Wo sind sie denn alle? Wo bleiben sie nur?« Es lag bestimmt nicht in seiner Absicht, dass seine Stimme in einem solchen Heulton aus ihm herausbrach, aber sie tat es, höher und schriller als die des achtjährigen Nachbarsmädchens, das just in diesem Moment am Haus vorbeihüpfte, ohne Schuhe und Strümpfe, sein geliebtes Springseil hinter sich herziehend. Genauso gut hätte er das gesamte Helium einatmen können, das die alles andere als festlich wirkenden Ballons enthielten, die zu beiden Seiten seines Kopfes schwebten.
»Oje«, sagte seine Mutter und versuchte, ihn zu beruhigen. »Es ist Sommer. Bestimmt sind sie alle zu ihren Wochenendhäusern oder in die Ferien gefahren. Und du hattest doch einen wunderbaren Tag, nicht wahr? Hier, im Garten, mit deinem Vater und mir? War es nicht ein herrlicher Tag? Und da gibt es ein paar Geschenke, die du noch gar nicht ausgepackt hast, nicht wahr, Clete?«
Sein Vater sah zu ihnen hinüber, durch seine unendlich dicke Brille hindurch, deren Gläser so trüb waren wie Quarzgestein. Er schlug mit der Hand nach einer Hornisse, die im Zickzackkurs seinen Kopf umkreiste.
»Also, Nelson«, sagte er ausdruckslos, »dieses Geplärre – also dieses Geplärre hier … Jetzt sag ich dir mal was, und das mag hart klingen, aber das ist es nicht. Diese Jungen, diese sogenannten Freunde von dir? Die werden schon ganz bald wieder aus deinem Leben verschwinden. Das kann ich dir versichern. Das tun sie immer. Schau mich zum Beispiel an. Ziehe ich fröhlich mit irgendwelchen Kumpels durch die Gegend? Nein. Es kommt immer eine Zeit, da musst du es ganz alleine schaffen, verstehst du, und vielleicht ist diese Zeit ja jetzt da, so leid es mir tut, das zu sagen.« Er räusperte sich ungehalten.
Doch der Junge weinte nur noch mehr, trotz all seiner Bemühungen, die heißen Tränen und den Schluckauf zu unterdrücken, der ihm vor lauter Kränkung, Einsamkeit und Scham in die Kehle stieg.
»Jetzt ist Schluss mit dem Geheule!«, fuhr Clete ihn an. »Du bist dreizehn Jahre alt, Nelson! Männer tun so etwas nicht – du hörst sofort auf zu heulen! Ist das klar?«
»Lass ihn doch«, sagte Nelsons Mutter, in einem strengeren Ton, als Nelson ihn jemals zuvor von ihr gehört hatte. Dorothy Doughty wagte es nur selten, das Urteil ihres Mannes anzufechten. »Der arme Junge. Lass ihn in Frieden.«
Während des vergangenen Jahres war Nelson aufgefallen, dass eine gewisse Spannung in der Luft lag, eine gewisse Beklemmung, deren Ursache er nur auf sich selbst zurückführen konnte. Irgendetwas stimmte nicht. Türen wurden zugeschlagen, mit zunehmender Häufigkeit und Lautstärke. Vater kam abends spät zum Essen nach Hause und marschierte dann direkt ins Schlafzimmer oder ließ sich in seinen Sessel im Wohnzimmer fallen. Mutter weinte still, während sie das Geschirr spülte, und wenn er sie fragte, was los sei, eilte sie sofort ins Bad, verriegelte die Türe, und die einzige Antwort, die er bekam, bestand aus dem Rauschen des Wassers, das ins Waschbecken floss. Im Garten verlor der früher so makellos gepflegte Teppich aus Rispengräsern seinen stetigen Kampf gegen Löwenzahn und Gundelrebe.
»Aber es stimmt doch, Dorothy. Und das weißt du genau! Nenn mir eine einzige Freundin von dir aus der Schule, die du auch heute noch triffst. Eine einzige.«
»Clete, hier geht es nicht um mich – und um dich auch nicht, im Übrigen. Das ist Nelsons Tag, und der arme Junge –«
»Ich sage dir jetzt mal, wo du Freundschaften schließt. Freundschaften schließt man in der Armee, im Schützengraben und an der Front. Mit Männern, die sich für dich vor eine Kugel werfen, die mit dir ihre letzte Zigarette und den letzten Tropfen Wasser aus ihrer Feldflasche teilen. Es geht hier nicht um Geburtstagskuchen und Kerzen, Nelson. Mit jemandem befreundet zu sein, das bedeutet Loyalität. Lebenslange Treue. Du kommst jetzt bald in ein Alter, in dem dir das immer klarer werden wird. Nicht mehr lange, und es wird keine Spielsachen und keinen Kuchen mehr geben, keine Partys und auch keine Freunde. Dann gibt es nur noch einen Tag nach dem anderen. Die Tage werden sich so gleichförmig aufeinanderstapeln, dass du dich am Nachmittag nicht mehr daran erinnern kannst, was du am selben Morgen noch zum Frühstück gegessen hast. Es tut mir leid, dir das an deinem Geburtstag sagen zu müssen, aber so ist es eben. So sieht die Realität aus.«
Nelson wurde einen Moment lang ganz still. »Ich dachte, sie mögen mich«, heulte er dann wieder los. »Wenigstens ein bisschen. Genug, um zu meiner Geburtstagsparty zu kommen. Und keiner bringt es fertig, wenigstens kurz hier aufzutauchen? Keiner!« Es erschien ihm unmöglich, die Lautstärke seiner Stimme zu kontrollieren. Sie war wie ein grellgelber Luftballon, der sich losgerissen hatte und in den Himmel hinauftrudelte.
»Ach, mein Schatz«, sagte seine Mutter und zog ihn enger an sich. Ihre beiden Körper glühten vor Hitze, und er spürte, wie ihre Kleider zusammenklebten, spürte, dass sein eigener Körper nicht mehr klein genug war, um von ihr in dieser Weise umarmt zu werden, und doch schien ihm sein Herz nicht groß genug, als dass es dieses Zerbrechen hätte verkraften können, diese Zurückweisung. »Ich liebe dich so sehr«, flüsterte sie ihm ins Ohr. »Ich liebe dich so, so sehr.«
»Ich will doch nur, dass man mich mag. Bin ich denn kein netter Mensch? Bin ich das etwa nicht?«
»Aber natürlich bist du das, Nelson. Natürlich bist du das.«
»Bin ich das nicht? Bin ich kein netter Mensch, Mama?«
»Jetzt lass sofort dieses Gejammer sein!«, befahl Clete. »Jetzt sofort!«
»Hör nicht auf den alten Meckerfritzen, Nelson«, gurrte sie. »Wir können hier zusammen sitzen bleiben, solange du willst. Alles Liebe zum Geburtstag, mein süßer kleiner Junge.«
»Es tut mir leid, dass ich weine«, brachte er heraus. »Ich will ja eigentlich gar nicht weinen. Ich will das überhaupt nicht.«
»Ist schon okay, mein Schatz.«
»Hör auf!«, schrie sein Vater. »Hör mit dem Geheule auf!« Seine Stimme war so schneidend wie der Finger, den er seinem Sohn ins Gesicht hielt, als zielte er mit einer Pistole auf ihn. Vor lauter Schweiß glitt ihm seine Brille am Hang des Nasenrückens herab. Und dann sprang er plötzlich auf die Füße, schnallte seinen Gürtel auf und versuchte, das klebrige Leder aus den in der Hitze ganz feucht gewordenen Gürtelschlaufen seiner Baumwollhose zu ziehen. Er riss so heftig daran, als wollte er den Motor eines Rasenmähers anwerfen, aber der Gürtel blieb an seiner Taille haften und seine vor Schweiß glitschige Brille fiel ihm aus dem Gesicht auf den grünen Plastikrasen, mit dem die Veranda ausgelegt war.
»Clete, nein!«, rief seine Mutter. »Clete, nicht heute, okay? Nicht doch, Clete!«
Die Lektionen, die Clete Doughty seinem Sohn erteilte, hatten in letzter Zeit eine neue Intensität gewonnen, was dazu führte, dass Dorothy einen Teil der Gewalt, die für Nelson gedacht war, abfing. Diese Entwicklung erschreckte sie alle drei, sogar Clete, der einmal mit zitternden Händen und bebender Unterlippe über ihrem Körper gestanden hatte, der neben der Küchenspüle auf die Erde gestürzt dalag.
Doch jetzt peitschte der Gürtel hervor wie eine Giftschlange. Seine Schnalle leuchtete bedrohlich im schwindenden Nachmittagslicht, der Dorn stach in die Höhe wie ein einzelner Reißzahn, und Clete Doughty ließ ihn durch die Luft knallen wie eine Bullenpeitsche. »Hör mit dem Geheule auf, junger Mann, hörst du? Ich werde das nicht länger dulden!«
Nelson schrumpfte im Schoß seiner Mutter immer mehr in sich zusammen, so schmerzlich seiner Größe bewusst, des Abgrunds, an dem er stand – so dicht vorm Heranwachsen, so kurz davor, ein Mann zu werden, und doch nur ein Junge, immer noch nur ein Junge, der sich duckte und jammerte, an der Brust seiner Mutter, der auf den Hieb wartete … Aber er wird mich doch sicher nicht hier schlagen, hier in ihren Armen, nicht hier …
In letzter Zeit waren diese Prügel immer häufiger vorgekommen. Wenn es nicht der Gürtel war, dann musste ein hölzerner Löffel herhalten oder ein sorgfältig ausgewählter Zweig der Trauerweide, die im Garten der Nachbarn wuchs. Nelson hatte noch nie zuvor einen Baum gehasst, geschweige denn eine ganze Baumart, bis auf diesen Weidenbaum; bis sein Vater ihn dort hingeschickt hatte, um just die Waffe auszusuchen, mit deren Hilfe er seinen Hintern so wund schlagen würde, dass er die folgenden beiden Nächte nur noch auf dem Bauch liegend schlafen konnte. Dabei war es auch nicht hilfreich, eine brüchige Rute zu wählen, denn sein Vater nutzte diese so lange, bis sie zersplitterte, und verlangte dann eine andere.
»Hallo? Entschuldigung?«, ließ sich in diesem Moment eine zögerliche Stimme hören. Der Klang kam aus Richtung der Garage, von der Einfahrt her, und war so unerwartet wie das Klingeln eines Telefons oder als würden alle Glocken der Stadt gleichzeitig läuten.
Die Sonne, die bisher so unendlich heiß im westlichen Himmel gehangen hatte, schien nun ihren Schmelzofen ein wenig herabzukühlen. Auf dem Vogelfutterplatz im Garten landete ein Kardinalspaar und begann zu singen, als hätte es dem Gast, der in der Auffahrt stand, als Eskorte gedient. Clete strich sich das Haar aus der Stirn und bückte sich, um seine Brille aufzuheben, während Dorothy ihre Umarmung löste und aufschaute. Nach und nach beruhigte sich das hektische Heben ihres Brustkorbs.
Auch Nelsons Weinen ließ nach, doch wie? Wie, wie war dies möglich?
»Oh, es tut mir leid«, sagte Jonathan Quick und kam jetzt hinter der Hausecke hervor. »Es tut mir … schrecklich leid, dass ich so spät komme.«
»Ach, das ist doch überhaupt nicht schlimm, Jonathan!«, sagte Dorothy. »Du kommst gerade rechtzeitig für ein Stück Kuchen und Eiscreme!«
Nelson putzte sich hastig die Nase und wischte sich die Augen. Wunder über Wunder! Jonathan Quick, Pfadfinderstammesführer, fünfzehn Jahre alt und schon einen Meter achtzig groß. Mitglied der Schulschwimmauswahl, feste Größe im Footballteam, Shortstop in der Baseballauswahl, Mitglied des Gesangsvereins und der Modelleisenbahner. Jonathan Quick, der nun in Nelsons Einfahrt stand und eine Schachtel in der Hand hielt. Sie war in Zeitungspapier eingepackt, das mit lauter Cartoons bedruckt war, und obendrauf prangte eine rote Schleife. Jonathan warf einen verstohlenen Blick in Nelsons Richtung und hielt das Geschenk, als wäre es eine heiße Kartoffel, die er nur zu gern an jemand anderen weiterreichen würde.
»Na so was«, sagte Clete. »Jonathan. Was für eine nette Überraschung.« Der Gürtel kroch heimlich wieder um seine Taille, während Clete um den Gartentisch lief und Jonathan seine Hand entgegenstreckte. »Wie schön, dass du dich zu uns gesellst.«
»Ich möchte mich wirklich entschuldigen«, sagte Jonathan und schien nun fast schon wieder unmerklich den Rückzug anzutreten, die Einfahrt hinunter, in der er eben erst erschienen war. »Ich kann nicht lange bleiben, wissen Sie. Im Garten meiner Oma ist letzte Nacht ein riesiger Ast abgebrochen und ich habe ihr versprochen, dass ich noch vorbeischaue, um das ganze Chaos wegzuräumen. Ich wollte ja auch eigentlich viel eher hier sein, aber mein jüngerer Bruder Frank ist heute von ein paar Bienen gestochen worden und wir mussten ihn ganz schnell ins Krankenhaus fahren. Ich hatte ja keine Ahnung, dass man gegen Bienen allergisch sein kann. Wusstest du das, Nelson?«
Nelson war so glücklich, in dieser Weise von Jonathan Quick zur Kenntnis genommen zu werden, dass ihm die vielen Tränen, die er eben noch vergossen hatte, plötzlich vollkommen gegenstandslos erschienen. »Hast du Lust, ein paar Pfeile zu schießen?«, platzte es aus ihm heraus.
»Äh … na klar«, sagte Jonathan. »Aber – wie gesagt, ich kann nicht besonders lang bleiben. Wegen meiner Oma und so.«
Nelson hätte Jonathan am liebsten an die Hand genommen, während er ihm in den Garten vorausging. Clete sackte, immer noch vor Wut kochend, auf einem der Stühle in sich zusammen und stopfte sich ein gefülltes Ei nach dem anderen in den Mund, mit wild mahlendem Unterkiefer. Dorothy strich derweil mit zitternden Händen das Tischtuch glatt. Strich immer und immer wieder darüber, als wären ihre Handflächen zwei heiß dampfende Bügeleisen.
Nelsons Geburtstagsgast blieb etwa fünfundzwanzig Minuten. Genug Zeit, um ein paar einigermaßen gut gezielte Pfeile abzuschießen und zusammen mit Nelsons Eltern – wenn auch recht verkrampft – Happy Birthday zu singen. Genug Zeit für ein Stück Kuchen und eine Kugel geschmolzenes Vanilleeis. Genug Zeit, damit Nelson das Geschenk öffnen konnte und einen Korb aus Birkenrinde darin vorfand.
»Das habe ich selbst gemacht«, sagte Jonathan. »Für dich.«
Nelson umfasste den Korb andächtig mit seinen Händen. »Das hast du für mich gemacht?«, stotterte er.
»Ja, tut mir leid, dass er nicht ganz so dicht geflochten ist, aber … Ich habe nur zwei davon gemacht. Deiner war der erste.« Er wurde rot, weil ihm so unversehens die Wahrheit herausgerutscht war. »Den anderen habe ich meiner Oma geschenkt«, fügte er feierlich hinzu, obwohl er seinen zweiten Versuch in Wahrheit Peggy Bartlett geschenkt hatte, einem Mädchen, von dem er hoffte, es im Oktober zum Schulball einladen zu können.
»Oh, das ist ja wunderschön!«, rief Dorothy und klatschte ein-, zwei-, dreimal leicht in die Hände. »So ein begabter junger Mann!«
»Tja, dann«, sagte Jonathan und schüttelte Nelson die Hand. »Alles Gute zum Geburtstag, alter Kumpel.«
»Danke«, sagte Nelson, der immer noch den Korb bestaunte. »Vielen, vielen Dank!«
Und dann flüchtete der ältere Junge die Einfahrt hinunter, während Nelson reglos stehen blieb und den Korb in Händen hielt. Wie leicht er doch war und wie unregelmäßig geflochten. Nelson fragte sich, womit er ihn wohl füllen könnte, fragte sich, was wohl bedeutsam genug war, um der beispiellosen Großzügigkeit seines älteren Freundes gerecht zu werden.
Er stellte den Korb auf den Gartentisch, neben die Geschenke, die seine Eltern für ihn gekauft hatten: eine neue Hose, ein Bausatz, aus dem man eine tatsächlich funktionierende Uhr bauen konnte, und ein Kinderbuch über den amerikanischen Bürgerkrieg. Aber es war der Korb, zu dem sein Blick immer wieder zurückkehrte. Eine unvollkommene, bezaubernde kleine Krone.
2
DER KESSEL ZISCHT. Nelson nimmt ihn vom Feuer, trägt ihn rasch zu seinem Zelt und schüttelt ihn in Richtung seiner Uniform, sodass das heiß sprudelnde Wasser und der fauchende Dampf in den olivgrünen Stoff einziehen. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Methoden, mit denen man Kleider bügeln kann, wenn man kein Bügeleisen zur Hand hat, und in einigen von ihnen ist Nelson schon sehr geübt. Eine andere Methode, die er vorzugsweise benutzt, besteht darin, das zerknitterte Kleidungsstück mit Essig zu bespritzen. Dies hat jedoch zur Folge, dass sowohl Uniform als auch Pfadfinder eine recht penetrante Geruchsnote verbreiten, und er hat ohnehin schon Mühe genug, Freunde zu finden.
Zwei Mal rennt er mit dem Kessel zwischen Lagerfeuer und Zelt hin und her und hüllt das Hemd und die kurze Hose, die an der Leine hängen, in eine Dampfwolke ein. Endlich stellt er befriedigt fest, dass sich seine Uniform nun in einem makellosen Zustand befindet. Und weil sich im Osten der Horizont bereits leicht aufzuhellen beginnt, macht er sich auf den anderthalb Kilometer langen Weg zum Paradeplatz, der sich in der Mitte des Camp Chippewa befindet. Währenddessen hat er genug Zeit, seine Lippen aufzuwärmen und auf der Trompete zu üben, ohne dabei befürchten zu müssen, seine Truppe oder die Truppenführer oder auch seinen Vater aufzuwecken. Letzterer hat sich bereit erklärt, für den einwöchigen Aufenthalt im Camp Chippewa als Aufsichtsperson zu fungieren, obwohl Nelson ihn kaum jemals in dieser Funktion hat tätig werden sehen. Sein Vater zieht es vielmehr vor, nach jeder Mahlzeit zum Zeltplatz zurückzukehren, sich dort an einen der alten Picknicktische zu setzen und eine Biografie des Baseballspielers Gabby Hartnett zu lesen, der für die Chicago Cubs gespielt und Eingang in die Hall of Fame gefunden hat. Oder er beschäftigt sich damit, die verknotete Angelschnur zu entwirren, die sich beständig um ihre Spule zu wickeln scheint. Er solidarisiert sich auch kaum jemals mit den anderen Vätern, die ihren Söhnen überallhin folgen, während diese von einer Lageraktivität zur nächsten rennen, etwa um ihre Kochkünste zu vervollkommnen, sich durch einen Orientierungslauf zu navigieren oder aus ein paar Lederfetzen eine Geldbörse zu basteln. Es kommt Nelson so vor, als sei das Camp für viele dieser Väter eine Art Urlaub von ihren Jobs, ihren Frauen und dem Rest ihres Lebens. Sie alle, auch diejenigen, die überall dabei sind, erwecken den Anschein, als nähmen sie an den Aktivitäten der Woche kaum Anteil. Nur sehr selten geben sie einen Ratschlag oder eine kluge Empfehlung von sich. Allenfalls sagen sie ab und zu so etwas wie: »Wir könnten noch ein wenig mehr Holz für das Feuer gebrauchen« oder: »Gebt acht, ich habe letzte Nacht einen Kojoten gehört.« Und solche Äußerungen sind jedes Mal unweigerlich von einem scherzhaften Stoß in die Rippen oder einem verschwörerischen Zwinkern begleitet.
Nelson hat es sich diese Woche zum Ziel gesetzt, nicht weniger als fünf Verdienstabzeichen zu erringen. Er möchte noch vor seinem sechzehnten Geburtstag in den Rang eines Adlers aufsteigen. Cletes Pfadfinderkarriere war dagegen recht glanzlos verlaufen. Nelson hat die mottenzerfressene Uniform seines Vaters gesehen – die niedrigen Rang- und wenigen Verdienstabzeichen. Doch sobald sein Vater das eine oder andere Glas über den Durst getrunken hat, erinnert er Nelson an das, was wirklich zählt: nämlich, dass er mit Auszeichnung im Zweiten Weltkrieg gedient hat, dass er von Afrika nach Norden Richtung Italien und von dort nach Frankreich marschiert ist, bevor man ihn im Alter von zweiundzwanzig Jahren und im Rang eines Stabsunteroffiziers ehrenvoll aus der Armee entlassen hat. Doch Nelson ist davon überzeugt, dass es für die ihm vorherbestimmte Zukunft in der Armee der Vereinigten Staaten von Amerika keine bessere Vorbereitung gibt als das, was er hier im Camp Chippewa und bei den wöchentlichen Treffen seiner Truppe in der Vorhalle der evangelischen Kirche Saint Luke’s lernt. Jetzt muss sein Körper nur noch mit seinem Gehirn aufschließen. Vielleicht wäre sein Vater ja dann stolz auf ihn, wenn er sein Leben der Armee widmete, auch wenn Nelson keine Ahnung hat, wie ein solcher Stolz aussehen – geschweige denn sich anfühlen – würde. Eine Umarmung vielleicht? Viel wahrscheinlicher war jedoch, dass sich das Ganze auf einen festen Händedruck und ein damit einhergehendes grimmiges Lächeln beschränken würde. Dennoch, das war doch etwas, auf das man hinarbeiten konnte.
Die Signaltrompete in Nelsons zierlichen Händen stammt von seinem Großvater, der vor einem halben Jahrhundert im Ersten Weltkrieg gedient hat. Als Nelson noch klein war, lag die Trompete auf dem staubigen Sims des offenen Kamins, direkt neben der in Glas und Eichenholz eingerahmten, zusammengefalteten amerikanischen Flagge. Nelson hatte seinen Vater monatelang anbetteln müssen, bis Clete es ihm endlich erlaubte, auf der Trompete zu spielen, aber nur in seinem Zimmer und bei geschlossener Tür. Seitdem lässt er sie kaum jemals aus den Augen und sorgt dafür, dass ihr Messing immer glänzt. Ein Kleinod.
Während der meisten Nächte im Camp nimmt Nelson sein Instrument mit ins Bett, aus Angst davor, die anderen Jungen könnten versuchen, ihm seine Trompete zu stehlen. Nicht etwa, weil sie neidisch darauf wären, sondern weil sie wissen, wie kostbar sie für ihn ist. Er kann sehen, wie sie während der Mahlzeiten von ihren Plätzen an den Esstischen auf ihn zeigen. Und auch, dass sein eigener Vater so gut wie nichts dagegen unternimmt, genauso wenig wie die Väter der anderen oder die Truppenführer, die manchmal mit den Jungen zusammen essen, sich jedoch meistens um einen gesonderten Tisch versammeln. Nelson kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, worüber sie dann so reden, diese erwachsenen Männer in ihren Kleine-Jungs-Uniformen, die dasselbe Essen essen, dieselben Gebete murmeln, dieselben Lagerfeuerlieder singen und dieselben Schwüre ablegen. Die einzige Stimme, von der Nelson jemals hört, dass sie sich zu seiner Verteidigung erhebt, zumindest dann und wann, ist die von Jonathan Quick, und selbst er scheint mehr aus Gereiztheit und Langeweile, wenn nicht gar Abscheu zu reagieren oder auch aus dem Wunsch heraus, sich gegen die anderen zu stellen – und nicht aufgrund eines Gefühls irgendeiner besonderen Verbundenheit oder aus Mitleid.
»Haltet den Mund, Leute«, sagt er dann bei solchen Gelegenheiten. »Wir sind eine Truppe, okay? Lasst uns auch so handeln wie eine.« Oder: »Der Nächste, der sich über Trompeter lustig machen will, kann das mal mit mir versuchen. Dann wird er ja sehen, was er davon hat.«
So nennen ihn die anderen Jungen, das weiß er jetzt, Trompeter. Nicht, um der Aufgabe, für die er bekannt ist, Ehre zu erweisen, sondern vielmehr als Spitzname, der voller Hohn ausgesprochen wird. Eine weitere Methode, ihn auszustoßen.
Der Pfad windet sich zwischen kleinen, urzeitlichen Seen hindurch, die noch aus der Zeit stammen, als sich gewaltige Gletscher wie Dampfwalzen durch diese Landschaft schoben. Aus dem sicheren Schutz der Bäume schauen die Rehe Nelson zu, tänzeln kurz auf der Stelle und springen dann in großen Sätzen tiefer in den Wald hinein. Einmal huscht auch ein Stinktier an ihm vorüber, doch glücklicherweise hält es seinen Schwanz gesenkt. Schließlich öffnet sich der Pfad zum Paradeplatz, in dessen unmittelbarer Nähe die Betreuer und Mitarbeiter des Lagers untergebracht sind, und jetzt hört er auch schon geschäftige Geräusche aus dieser Richtung – undeutliches Stimmengemurmel, Türen, die zugeschlagen werden, das Plätschern von Wasser. Die Betreuer und Mitarbeiter wohnen in kleinen Blockhütten und es heißt, dass irgendwann auch die Zeltlagergäste in solche Unterkünfte umziehen werden.
Der Nebel ist so dicht, dass Nelson den Fahnenmast nicht sehen kann, der etwa zweihundert Meter entfernt steht, und die Luft ist derart schwer, dass er sich fragt, ob er sein Hemd nicht ganz umsonst gebügelt hat. Während er weiterläuft, werden seine Stiefel vom Tau immer nasser. Am Fahnenmast angekommen, schaut er auf seine Taschenuhr, übt noch ein paar Tonleitern und dann, punkt sieben Uhr, stellt er die Füße akkurat nebeneinander, richtet sich kerzengerade auf, hebt die Trompete an die Lippen und bläst die Reveille.
Die Signaltrompete sendet ihren Schall über den Paradeplatz, der aus einer grasbewachsenen Ebene zu Füßen einer kleinen Anhöhe besteht, auf deren Spitze sich der Fahnenmast erhebt. Die Anhöhe ist mit Feldsteinen eingefasst und hinter ihr wachsen hufeneisenförmig eine Reihe majestätischer Ahornbäume in die Höhe. Ganz gleich, was die anderen denken mögen – Nelson liebt diese ihm auferlegte Verantwortung. Liebt die feierliche, von höchster Stelle abgesegnete Macht des Instruments aus Messing, das er in Händen hält, wie er es tief aus dem Bauch und dem Zwerchfell heraus zum Leben erweckt, wie die Töne hervorbrechen und den Nebel durchschneiden, die Zeltleinwände durchbohren und die Kreaturen des Waldes bei ihrer Nahrungssuche aufschrecken. Ihr Schall lässt sogar die dichte weiße Ohrbehaarung des über achtzig Jahre alten Pfadfinderlagerführers Wilbur Whiteside erzittern. Kaum dass dieser den freudigen Klang von Nelsons Signal vernimmt, springt er aus seinem schmalen Bett, wirft sich munter ein Handtuch um den Hals und die mageren Hüften, setzt sich eine riesige Schwimmbrille auf, hinter der seine Augen so aussehen wie die eines überdimensionalen Frosches, und huscht leichtfüßig zum Bass Lake hinunter. Unten am See angekommen, schiebt er die Rohrkolben auseinander, stürzt sich splitternackt in das stille, klare Wasser, durchschneidet mit seinen dürren alten Armen die Oberfläche des Sees und schwimmt einmal hin und zurück. Nelson hat Wilburs morgendliche Runde natürlich noch nie mit eigenen Augen gesehen, aber er hat davon gehört. Vielleicht hat ihm ja ein älterer Junge davon erzählt, der am frühen Morgen dort nach Barschen geangelt hat und vom Anblick des bleichen alten Wilburs, der sich durch den See pflügt, aufgeschreckt wurde.
Mittlerweile kann Nelson ein paar der Lagerbetreuer sehen, wie sie sich in Richtung Fahnenmast aufmachen, während sie noch die Hemdzipfel in die kurzen Hosen stopfen, Gürtel zuschnallen und olivgrüne Socken an Beinen mit mageren Knien hochziehen. Sie kommen ihm entgegen, unterhalten sich mit heiseren Stimmen, lachen leise. Er kann hören, wie das taubenetzte Gras ihre Wanderstiefel bei jedem Schritt quietschen lässt, wie sie sich ab und zu räuspern und auf die Erde spucken, und er hört die Musik der losen Münzen in ihren Hosentaschen. Hätte man ihn gefragt, mit welchem Wort sich seine Bewunderung für diese jungen Männer zusammenfassen ließe, hätte er sie als Helden bezeichnet. Aber natürlich fragt ihn niemand, und so bleibt die Hochachtung, die er für sie hegt, ein Geheimnis. Einige von ihnen halten ihn für einen streberischen Schleimer, aber die meisten behandeln ihn leutselig und sind nett zu ihm.
Sie verkörpern selbstverständlich genau das, was zu werden sein sehnlichster Wunsch ist: groß, stark, sonnengebräunt, geschickt, immer einen Scherz parat, mutig, rechtschaffen, freundlich. Manche von ihnen sind Messgehilfen, andere Ministranten. Einige sind Senatoren oder UN-Botschafter im Schülerparlament, andere sind Mannschaftskapitäne, Klassensprecher oder Herausgeber der Schulzeitung. Diese jungen Männer schließen ihn nicht aus der Herde aus, weil er zu schwach ist, und sie machen sich nicht über seine Andersartigkeit lustig. Sie setzen oder stellen sich einfach nur neben ihn, an den Picknicktischen oder in der Bogenschießanlage, geben ihm Anleitungen, erklären ihm, wie man die verschiedensten nützlichen und komplexen Knoten knüpft, bringen ihm bei, wie man ein Amateurfunkradio benutzt und wo man selbst dann Wasser aufspüren kann, wenn es eigentlich keines gibt. Sie zeigen auf Sternbilder am Firmament, nennen ihm die Namen einzelner Sterne, bestimmen die Wolkenarten, die von West nach Ost und wieder zurück ziehen, und erklären ihm, was solche himmlischen Wanderschaften für das Wetter des nächsten Tages zu bedeuten haben. Sie kennen die Spuren der Tiere, die Gesänge der Vögel, wissen über die Zucht von Tauben und Kaninchen Bescheid. Und an den meisten Tagen, wenn sie sich frühmorgens dem Fahnenmast nähern, nehmen sie ihn mit der freundschaftlichen Gleichgültigkeit eines älteren Bruders zur Kenntnis. Sie nicken ihm zu oder sagen vielleicht »He, Trompeter« oder begrüßen ihn mit einem freundlichen »Nelson«. Er hat sich immer schon nach einem Bruder gesehnt.
Jetzt spielt er die Reveille zum zweiten Mal und kurz darauf tauchen immer mehr und mehr Jungen aus dem Nebel auf, lachen durcheinander, trampeln mit ihren Füßen, boxen sich spielerisch in die Seite. Sie versammeln sich in ihren jeweiligen Truppen, in zwei lang gezogenen Reihen, die Gesichter zur Fahnenstange gewandt. Manche spielen an einem Seil herum oder üben das Knüpfen eines Knotens. Von Nelsons Warte sieht es so aus, als könnte genauso gut eine Armee vor ihm stehen, die sich am Ende eines langen, verzweifelten Krieges befindet, zu einem Zeitpunkt, an dem nur noch kleine Jungen und alte Männer übrig sind, um in den Kriegsdienst eingezogen zu werden. Die Betreuer, Köche und Verwaltungsangestellten bilden ihre eigene Reihe auf dem Grat des Fahnenstangenhügels, die Gesichter den unter ihnen stehenden Pfadfindern zugewandt. Ihre Haltung ist merklich steifer, die Haare auf ihren Kniescheiben dunkler und der Geruch ihres Aftershaves hängt schwer in der Luft. Nelson sieht, wie sich seine eigene Truppe in Position stellt, am östlichen Rand des Paradeplatzes, in der Nähe des sumpfigen Seeufers. Unter ihnen ist auch sein Vater, die morgendlichen Bartstoppeln noch nicht wegrasiert, mit schief sitzendem Pfadfinderhalstuch. Er streckt die steifen Arme in die Luft und gähnt in aller Öffentlichkeit so hemmungslos wie ein gelangweilter Silberrückengorilla, der im Begriff steht, sich ganz gemütlich auf Futtersuche zu begeben.
Pfadfinderführer Wilbur schreitet jetzt der Reihe der Betreuer entgegen, mit im Rücken verschränkten Händen. Nelson bläst die letzte Reveille. Ein paar Nachzügler brechen aus dem sich allmählich hebenden Nebel hervor, als wären sie vor irgendeinem gefährlichen Waldtier auf der Flucht. Auch sie stehen nun stramm, mit roten Gesichtern und außer Atem. Ein Fahnenträger nähert sich dem Fahnenmast mit größtmöglichem Respekt; das ist etwas, worauf Wilbur besteht. Und jetzt faltet man – mit der Sorgfalt und Zartheit, mit der das Personal des teuersten Hotels des Landes ein Bett herrichten würde – die Fahne auseinander, befestigt sie an einem Karabinerhaken und zieht sie gewandt und in gleichmäßigen Tempo in den Himmel hinauf. Wilbur duldet keinerlei ruckartige Bewegungen, während das Sternenbanner in die Höhe steigt. Es ist ein ganz besonderer Anblick, wie sich die Fahne so geschmeidig und zielgenau emporhebt, und es scheint kaum vorstellbar, dass der Mechanismus, der sich hinter diesem Höhenflug verbirgt, aus nichts anderem besteht als lauter Jungen im Teenageralter.
Der Fahnenträger tritt zurück, und alle Lagerteilnehmer heben die Hand ans Herz, um den amerikanischen Treueeid zu sprechen. Dann hält Wilbur seine allmorgendliche Ansprache. Für viele Jungen, deren Mägen mittlerweile recht laut knurren, stellt diese nicht enden wollende Ansprache den stumpfsinnigsten und am schwersten zu ertragenden Moment des Tages dar. Er kann ihnen einfach nicht schnell genug zu Ende gehen, denn dann folgt der wilde Wettlauf zum Speisesaal, der gewaltige Ansturm hungriger Massen.
»Pfadfinder«, hebt Wilbur an, »wir sind diese Woche mit dem herrlichsten Wetter gesegnet, und ich hoffe, ihr nutzt eure Zeit sinnvoll.« Er schreitet auf dem Gras in der Nähe des Fahnenmastes entlang und als er näher kommt, wird Nelson ganz starr. »Schon Benjamin Franklin hat uns einmal gesagt: ›Liebst du das Leben? Dann verschwende die Zeit nicht, denn daraus ist das Leben gemacht.‹ Pfadfinder, ich weiß, dass euch die Abenddämmerung eures Leben wie etwas vorkommt, das unendlich weit entfernt ist, aber ich stehe hier vor euch, um euch zu sagen: Unser Leben währt nur einen Augenblick, und ich würde äußerst ungern erfahren, dass auch nur ein einziger Pfadfinder unter euch seine kostbare Zeit hier im Camp Chippewa mit Faulenzen verschwendet.«
Jetzt breitet sich ein Ausdruck des Ekels auf Wilburs altem, schrumpeligen Gesicht aus.
»Und doch sind mir solch beunruhigende Berichte zu Ohren gekommen, Pfadfinder. Es sind dies Berichte, die, um der Wahrheit die Ehre zu geben, bereits aus der Zeit vor eurer Ankunft diese Woche im Camp Chippewa stammen. Doch erst letzte Nacht kam mir erneut eine solche Meldung zu. Ich habe mir noch kein vollständiges Bild machen können, doch habe ich hier und da aus den Mündern aufgebrachter und verwirrter Jungen von heimlichen Zusammenkünften gehört, von obszönen Vorkommnissen … Es hat den Anschein«, und hier unterbricht er sich und drückt sich einen Finger mit säuberlich gestutztem und gefeiltem Nagel an die trockenen Lippen, wobei die äußerste Fingerspitze seinen weißen Zwirbelbart berührt, »als hätten sich einige unter euch eines sehr unangemessenen, anstößigen Verhaltens schuldig gemacht, eines Verhaltens, das in keiner Weise zu unserem Pfadfindergesetz passt. Ein Verhalten, das ich als äußerst beunruhigend, ja, offen gesagt, als abartig empfinde. Darüber hinaus fürchte ich, dass dieses Verhalten nicht von jungen Männern in das Lager getragen wurde, nicht von jungen Pfadfindern, sondern möglicherweise gar von den mir selbst unterstellten Betreuern, ja, ich wage es kaum zu sagen – von meinen eigenen Mitarbeitern!«
Auf dem Paradeplatz ist es plötzlich vollkommen still. Die Geräusche des Seils und des Karabinerhakens, die gegen die Fahnenstange schlagen – sogar das Knattern der Fahne, die in der leichten Brise weht –, wirken ohrenbetäubend laut. Wilburs Stimme gewinnt an Schärfe, lässt eine steigende Wut erahnen, während sein Vortrag gleichzeitig von Niedergeschlagenheit und großem Kummer zeugt. Seine schmalen Schultern sacken unter seiner Uniform sichtlich zusammen.
»Es mag sein«, fährt er fort, »dass ich das Verhalten jener, von denen ich fürchte, dass sie für diese unglückseligen Vorkommnisse verantwortlich sind, nicht werde korrigieren können. Es mag sein, dass es da etwas in ihnen gibt, das so verdreht und verquer ist, dass es nicht wieder geradegebogen werden kann. Aber als Leiter dieses Lagers ist es meine Pflicht, mich an jene unter euch zu wenden, deren Herzen noch fromm sind und deren innerer Kompass noch in die richtige Richtung weist.
Wisst ihr, es ist nicht leicht, danach zu streben, ein guter Mensch zu sein. Die ganze Welt wird ihr Möglichstes tun, um euch vom rechten Weg abzubringen und eure Prinzipientreue zu untergraben. Ich muss euch da gar keine Einzelheiten nennen. Wenn ihr eure Handbücher gelesen habt, dann wisst ihr, wovon ich spreche.
Das Wichtige ist: Ihr seid die Ritterschaft dieses Landes. Ihr seid es, die einen Ehrenkodex habt, ein Pflichtgefühl, ein Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist. Man wird euch in Versuchung führen, man wird euch auffordern, zu betrügen, euch dem Laster anheimzugeben. Und denjenigen unter euch, die ihr dort draußen vor mir steht, denjenigen, die im Herzen treu geblieben sind, euch möchte ich sagen, dass es eine Belohnung dafür gibt, ein guter Mensch zu sein, anständig und freundlich. Und das ist die folgende: Ihr müsst keine Lügen über euer Tun und Lassen erzählen, ihr müsst nichts verbergen und euch wegen nichts schämen. Ihr müsst euch niemals entschuldigen. Ihr werdet Anführer und Verteidiger sein. Diejenigen in unserer Gesellschaft, die schwach sind, die unterdrückt werden oder schwere Zeiten durchleben, die werden sich an euch wenden und euch um Hilfe oder Rat ersuchen. Und deshalb dürft ihr nicht wanken, deshalb müsst ihr im Geiste beständig bleiben.«
Jetzt wendet er sein Gesicht den Pfadfindern des Camp Chippewa und seinen eigenen Betreuern zu, den Sekretären seines Büros und den Köchen des Lagers, von denen manche stellvertretend für ihre Kollegen die morgendliche Fahnenzeremonie besuchen, während die anderen in genau diesem Moment in der Küche stehen und hektisch unzählige Eier für das Rührei zerschlagen und unzählige Mengen an Speck und Würstchen in die Pfannen werfen.
»Ich bin zu alt, um überhaupt noch über die Art von Verhalten sprechen zu können, von der man mir berichtet hat. Und viele von euch jungen Männern dort draußen sind, wie ich fürchte, zu jung, zu unschuldig, zu reinen Herzens, um in diesem Augenblick in eurem noch so leicht zu beeinflussenden Leben damit konfrontiert zu werden. Um ehrlich zu sein, schäme ich mich, hier oben vor euch zu stehen, während diese schmutzige Wolke über unserer aller Köpfe hängt. Das ist nicht pfadfindergemäß. Meine Hoffnung ist also, dass meine Worte heute Morgen genügen, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten – um dieses verabscheuungswürde Verhalten zu beenden. Um diejenigen unter euch, die mitschuldig sind an diesem Verbrechen, so beschämt, so elend zu machen, dass dies ein für alle Mal und unwiderruflich endet.«
Er berührt die gewachsten Enden seines Schnurrbarts.
»Und jetzt möchte ich all den wunderbaren Freiwilligen, die jeden Abend nach dem Essen dafür sorgen, dass unsere Wege gepflegt und sauber gehalten werden und auch unser Speisesaal, sowie die sanitären Einrichtungen am See und das alte Amphitheater, deren Bühne und Sitzplätze sie ausbessern, meinen Dank aussprechen«, sagt Wilbur zusammenfassend. »Es gibt keinen größeren Ruhm als den eines Freiwilligen, dem der Rücken von all der ehrlichen Arbeit schmerzt, die er ohne jede Aussicht auf Belohnung geleistet hat.
Und nun noch ein Letztes. Bitte haltet eure Seile bereit.«
Hierauf hält jeder der anwesenden Jungen sein ein Meter langes Hanfseil vor sich, mit einer Hand an jedem Ende, wobei die Mitte des Seils nach unten hängt.
»Und jetzt«, sagt Wilbur, »macht einen Kreuzknoten.«
Hunderte von Jungenhänden fangen an zu knoten. Nelson wünscht sich aus tiefster Seele, er könnte an diesem Ritual teilnehmen – denn wer außer ihm könnte einen solchen Knoten schneller und fester binden? –, doch weil er während dieser Zeremonie jeden Tag seine Signaltrompete in Händen halten muss, ist er von dieser Aufgabe befreit. Aber im Stillen sagt er für sich auf, wie es geht, mit jeder Faser seines Wesens: Links über rechts und durch, rechts über links und durch: Voilà!
Nach und nach sieht man, wie die Jungen ihre Knoten hochhalten, bis schließlich jeder einzelne Pfadfinder diese grundlegendste aller Aufgaben erfüllt hat.
Wilbur lässt seinen Blick flüchtig über die Reihen streifen und nickt dann befriedigt. »Das wäre dann alles, meine Herren.«
Die Prozession in Richtung Speisesaal verläuft an diesem Morgen in düsterer Stimmung als sonst. Keiner der Jungen rennt vor, um sich draußen anzustellen und den fettigen Dampf des brutzelnden Specks und der in der Pfanne zischenden Würstchen einzuatmen. Keines der jüngeren Kinder springt durch die Pfützen oder durchkämmt das hohe Gras auf der Suche nach Ringelnattern oder Fröschen.
Nelson fädelt sich neben Jonathan Quick ein. »Was ist denn passiert, Jon? Hast du eine Ahnung, worüber Wilbur da geredet hat?«
»Ist doch egal!« Jonathan zuckt mit den Schultern. »Hast du denn etwas mit der Sache zu tun?«
»Was? Nein, ich hab nur gefragt, ich würde nicht im Traum daran denken –«
»Dann vergiss die Sache, Trompeter. Okay? Außerdem weiß ja sowieso jeder, dass du viel zu sehr damit beschäftigt bist, die nächsten Verdienstabzeichen einzuheimsen, um dir auch nur das Allergeringste zuschulden kommen zu lassen. Du bist wahrscheinlich in deinem ganzen Leben noch kein einziges Mal in Schwierigkeiten geraten, stimmt’s?« Jonathan schaut Nelson bei dieser Frage nicht einmal an und verlangsamt auch seinen Schritt nicht.
Nelson spürt, wie seine Wangen rot werden. Nie zuvor ist ihm seine eigene Ernsthaftigkeit so peinlich gewesen. Wie konnte er nur so blöd sein zu denken, dass Jonathan die Zielstrebigkeit beeindruckend finden könnte, mit der er versucht, zum Adler aufzusteigen.
»Es tut mir leid«, sagt Jonathan und verlangsamt fast unmerklich seinen Schritt. »Das war gemein von mir. Du bist ein guter Kerl. Nein, ich weiß nicht, worüber Wilbur da gesprochen hat. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich meine, manche Jungs schmuggeln gezinkte Spielkarten ins Lager, und ich habe gehört, dass einer der Betreuer einen Stapel Playboy-Hefte besitzt, aber … Ich weiß es nicht. Vielleicht raucht ja jemand Gras oder so.«
Nelson starrt Jonathan verständnislos an.
»Marihuana, du Dummkopf.«
»Es tut mir leid, Jon … Was ist Marihuana?«
»Vergiss es.«
Die Türen des Speisesaals öffnen sich, die Pfadfinder marschieren ins Innere und setzen sich an die ihrer jeweiligen Truppe zugewiesenen Tische. Wie nicht anders zu erwarten, sitzt Nelson allein am äußersten Ende des Tisches seiner eigenen Truppe, bis sich sein Vater zu ihm gesellt, seine dicken weißen Beine über die Bank schiebt und sich neben ihn setzt.
»Und, hast du letzte Nacht gut geschlafen?«, fragt ihn sein Vater und kratzt sich über die Mückenstiche an seinen haarigen Armen.
»Ja.«
»Ich wünschte, ich könnte dasselbe von mir behaupten. Habe bis fast drei Uhr morgens einer verdammten Eule zugehört. Wenn ich ein Gewehr gehabt hätte, dann hätte ich sie abgeknallt.«
»Ich glaube nicht, dass es erlaubt ist, Eulen zu erschießen«, nuschelt der Junge.
»Was?«
»Nichts.«
Nelson starrt die Tischplatte an und murmelt: »Lagerleiter Wilbur war ziemlich wütend heute Morgen.«
»Du darfst nicht vergessen, Nelson, dass Mister Whiteside aus einer Generation stammt, die nichts vom Zigarettenrauchen hält oder von ähnlichen Sachen – wie zum Beispiel ein bisschen Brandy zu trinken. Und seine Liste sogenannter Sünden ist noch sehr viel länger. Ich würde mir an deiner Stelle nicht den Kopf darüber zerbrechen. Wahrscheinlich hat irgendeiner der Betreuer sein Gehalt am Spieltisch verzockt oder so.« Nelsons Vater starrt ihn auf eine merkwürdige Art an, mit leicht zusammengekniffenen Augen. »Es gehört eben zu seinen Aufgaben, dir in Hinsicht auf solche Sachen eine Höllenangst einzujagen.«
Bis die Platten mit dem Essen das Ende des Tisches erreichen, wo Nelson sitzt, sind sie so gut wie leer.
»Macht es dir was aus, wenn ich mich zu den anderen Vätern setze?«, fragt Clete nach einer Weile.
Nelson, der gerade in ein verkohltes Stück Speck beißt, hält inne. Es macht ihm sehr wohl etwas aus. Er möchte nicht im Stich gelassen werden. »Nein, schon gut«, bringt er heraus.
»Okay – ich hole mir dann noch einen Kaffee, Nelson«, sagt Clete und steht auf. »Soll ich dir ein Glas Orangensaft mitbringen?«
»Ja, bitte«, antwortet Nelson leise. Und jetzt ist er wieder allein und die Lücke zwischen ihm und dem nächsten Jungen ist groß genug, dass sich drei Pfadfinder hätten hineinsetzen können.
Überall im Speisesaal beugen sich die Jungen an ihren Tischen vor, lehnen sich über ihre Teller und unterhalten sich über Wilburs Rede. Ein verschwörerisches Summen erfüllt den großen Saal, an dessen Gebälk zahllose Wimpel und an dessen Wänden ausgestopfte Hirsch-, Elch- und Bärenköpfe hängen, die von ihrer luftigen Höhe auf die Pfadfinder herabstarren. Mit seiner rustikalen und leicht gewölbten Decke hat das Gebäude etwas von der düsteren Atmosphäre eines Wikinger-Langhauses. Die Zeit zieht sich qualvoll in die Länge, während Nelson, wieder einmal, still und einsam sein kalt gewordenes Rührei isst. Er spürt, wie ihm Hals und Gesicht vor Scham rot werden. Dann, gerade in dem Augenblick, als er droht, vom Gewicht seiner Ausgrenzung erdrückt zu werden, legt sich eine warme und feste Hand auf seine Schulter. Er zuckt zusammen.
»Wir haben schon seit Jahren keinen Trompeter mehr gehabt, der solche Klänge hervorbringt wie du, mein Sohn. Weiter so!«
Nelson schaut auf und sieht sich Wilburs blassblauen Augen gegenüber, die traurig auf ihn herabschauen. Der Mund darunter hat sich zu einem kummervollen Lächeln verzogen.
»Danke, Sir.«
»Darf ich mich setzen?«
»Äh, natürlich.« Nelson macht eine winzige Geste, mit der er auf den von seinem Vater freigegebenen Platz weist. Die Jungen seiner Truppe, die dahinter sitzen, scheinen einmütig noch enger zusammengerückt zu sein und haben sich noch weiter von ihm entfernt.
»Nelson, stimmt’s?«
Der Junge nickt.
»Wo hast du denn die Signaltrompete her?«, fragt Wilbur. »Du hast sie wohl kaum in einem Musikladen in der Stadt gekauft, nicht wahr?«
»Ähm, von meinem Großvater.«
»Gewöhn dir diese ›Ähs‹ und ›Ähms‹ ab, mein Junge. Das steht dir nicht gut zu Gesicht. Nun, also, ich weiß, dass du noch ein junger Mann bist – so zwölf oder dreizehn, aber die Sache ist die: Du musst einem Mann, der Autorität ausübt, immer mit Überzeugung und Selbstvertrauen antworten. Wenn du einmal gezwungen bist, eine kleine Pause einzulegen, um deine Gedanken zu sammeln, dann ist das nur verständlich. Aber dann verbirg dein Zögern hinter einem festen Blick und sprich erst, wenn du bereit und in der Lage dazu bist. Diese ›Ähs‹ und ›Ähms‹ sind meiner Ansicht nach das Gleiche wie ein Gewehr, das eine Fehlzündung hat. Und wofür taugt ein Gewehr, das nicht schießen kann, frage ich dich?« Der alte Mann grinst in seinen Schnurrbart.
»Ja, Sir.«
»War er im Ersten Weltkrieg, dein Großvater?«
»Ja.«
»Lebt er noch?«
»Nein, Sir.« Nelson starrt auf seinen Teller mit Rührei.
Wilbur holt tief Luft. »Die Welt ist schon ein seltsamer Ort. Man sollte meinen, dass ein Mann unbesiegbar, ja, unsterblich sein müsste, um einen Weltkrieg zu überleben. Aber das ist natürlich unsinnig. Wir sterben alle, jeder zu seiner Zeit. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, Nelson, wie ist dein Großvater gestorben?«
Nelson zögert und schaut Wilbur dann mit traurigen Augen an. »Ich weiß es nicht, Sir. Er ist einfach krank geworden. Ich bin ihn besuchen gegangen, bevor er starb, aber – da hat er schon nicht mehr gesprochen. Er konnte sich nur noch dadurch verständlich machen, dass er einem die Hand gedrückt hat. Ich war noch sehr klein. Erst fünf, glaube ich.« Nelson erinnert sich an diese Hand, an ihre Kälte, an die Adern darauf, an die zu lang gewachsenen Fingernägel, an die Baumwolldecke, die bis zum Kinn des Großvaters hochgezogen war und, später dann, über sein Gesicht.
Sein eigener Vater hat niemals auch nur ein einziges freundliches Wort über seinen Großvater gesagt, der, wie Nelson sich über die Jahre hinweg zusammenreimte, ein schlimmer Trunkenbold und als Farmer eine Niete gewesen sein musste. Nelsons Vater, der die Erniedrigungen hatte erdulden müssen, die die Pleiten und Reinfälle seines eigenen Vaters mit sich brachten, war anscheinend gezwungen gewesen, einen Großteil der schwierigen und beschwerlichen Arbeiten auf der Farm selbst zu übernehmen. Letztendlich geriet die Farm dann unter den Hammer und wurde für einen Spottpreis an die Nachbarn verkauft. Es musste sich um ein wunderschönes Stück Land gehandelt haben, soweit Nelson das hatte feststellen können: einhundertsechzig Hektar weites Land, Felder und Hügel, glasklare Bäche voller Forellen und malerische Sandsteinfelsen. Es hieß, dass es auch einen indianischen Grabhügel gegeben haben soll und sogar einen Bären, und wenn im Frühjahr die Furchen gezogen wurden, fand man jedes Mal Pfeilspitzen in der Lehmerde, die Nelsons Vater dann sammelte und für einen Nickel das Stück an einen Universitätsprofessor verkaufte. Statt sich in den Feldern hinter einem Pferdegespann abzumühen oder wenigstens einen Traktor zu besteigen, hatte es Nelsons Großvater vorgezogen, das Familienerbe in den Bars von Eleva und Strum zu vertrinken.
»Nun«, sagt Wilbur in diesem Moment in einem etwas weicheren Tonfall, vielleicht, weil ihm Nelsons gesenkter Blick und die hängenden Schultern aufgefallen sind. »Ich bin mir sicher, wenn er dich jetzt sehen könnte, wäre er sehr stolz darauf, wie wunderbar du auf dieser Trompete spielen kannst. Die Leute vergessen das leicht, aber der Signaltrompeter war für eine Kavallerieeinheit fast so wichtig wie der General. Ohne ihn gab es ein Durcheinander, ein heilloses Chaos. Auf dem Schlachtfeld ist eine gute Verständigung unverzichtbar.«
Nelson sitzt da und versucht, nicht herumzuzappeln, traut sich kaum, sein Essen anzurühren, und ist sich geradezu schmerzlich der Blicke seiner Truppenkameraden bewusst und auch der Abwesenheit seines Vaters, den er immer noch sehen kann, wie er dort an der Kaffeemaschine steht und gleichgültig Zucker und Milch in eine weiße Tasse rührt. Mein Großvater war ein Trinker, hätte er gern gesagt. Er ist mit nur fünfundfünzig Jahren an seiner Alkoholsucht gestorben. Diese Signaltrompete hat er einem toten Deutschen geklaut. Er war ein Dieb und ein Feigling und ein sehr, sehr schlechter Mensch.
»Die anderen Jungen mögen dich nicht besonders, nicht wahr, Nelson?«
Dieses Mal steigt etwas in dem Jungen hoch, und ohne das leiseste Zögern wendet er den Kopf, schaut Wilbur direkt in die Augen und sagt: »Nein, das tun sie nicht.«
»Und verstehst du auch, warum nicht, Nelson?«
»Nein, Sir.«
»Das liegt daran, dass sie dich als Herausforderung empfinden. Du gehörst nicht zu diesem Haufen, diesem Pöbel. Und das ist auch der Grund dafür, warum du später mal ein Anführer sein wirst. Genau das hat dein Truppenführer zu mir gesagt, ob du’s glaubst oder nicht. Und auch einige der Betreuer hier haben das gesagt, die von deiner Klugheit beeindruckt sind.« Whiteside lässt seinen Blick durch den Speisesaal gleiten und atmet tief aus. »Aber um die Wahrheit zu sagen, Nelson, nicht alle diese Jungen werden später einmal zu guten Männern heranwachsen, zu guten menschlichen Wesen. Wir tun unser Bestes, versuchen unser Möglichstes, um sie zu leiten und zu unterrichten. Aber am Ende … Einer der Jungen, die sich in diesem Raum befinden, wird zum Mörder werden, ein anderer zum Bankräuber. Manche der Jungen in diesem Raum werden die Steuerbehörde betrügen, andere ihre Ehefrauen. Ich wünschte, es wäre nicht so. Aber wenn ich höre, wie du diese Trompete spielst, dann höre ich mehr als nur einen Jungen, der Luft in ein Instrument bläst. Ich höre ein Echo durch die Zeiten hallen. Etwas, das gut und rein ist. Lass dich von ihnen nicht entmutigen, Nelson.«
Nelson versucht, all dies zu verarbeiten, und weiß nicht recht, was er antworten soll. »Danke, Sir«, sagt er schließlich.
»Wenn sie gemein zu dir sind, dann ist es ihr größter Wunsch, dir diese Schönheit wegzunehmen, die Schönheit, die von deiner Trompete ausgeht. Sie möchten sie stehlen, sie vernichten. Lass nicht zu, dass sie das tun. Sei stärker als sie.«
Wilbur umfasst Nelsons Schulter erneut mit seiner Hand, und dieses Mal spürt der Junge, wie klein diese Hand ist, eigentlich kaum größer als die seiner Mutter. Und in diesem Moment sehnt er sich nach ihr. Sehnt sich nach der einzigen Person, die immer freundlich zu ihm gewesen ist, die ihm immer etwas zu essen angeboten oder ein Buch zu lesen gegeben hat, die leichtfüßig durchs Haus schwirrte, »Que sera, sera« sang, oder auf der Treppe vor dem Haus saß, die Zeitung wie eine Decke auf dem Schoß ausgebreitet, und währenddessen ihre tägliche Pall Mall rauchte, wobei sie kaum richtig daran zog, sondern sie einfach nur elegant in der Hand hielt, während ihr der Rauch gleich einem Schleier übers Gesicht zog und sie sich mit ihren wunderschönen Fingern einen winzigen Fetzen Zigarettenpapier von den Lippen pflückte.
Er schließt einen flüchtigen Moment lang die Augen und spürt Wilburs Hand auf seiner Schulter, ihm steigt der Geruch der nachmittäglichen Zigarette seiner Mutter in die Nase und der Geruch der Zeitung, nach Papier und Tinte, und er würde alles darum geben, jetzt bei ihr zu Hause zu sein, selbst wenn er dann das Geschirr abtrocknen oder den Wohnzimmerteppich saugen müsste. Dann ist die Hand verschwunden und Nelson öffnet die Augen.
»Was wollte Mr. Wilbur denn?«, fragt sein Vater, der sich über ihn beugt und ihm das Glas Orangensaft entgegenhält, das er ihm versprochen hatte.
Nelson nimmt den Saft und trinkt ihn aus. Normalerweise besteht seine erste Reaktion auf die Stimme seines Vaters darin, dass er auf seine Füße herabstarrt, oder auf seine Hände, aber dieses Mal entschließt er sich, Wilburs Ratschlag zu befolgen. Er schaut seinem Vater direkt ins Gesicht. Doch sein Vater starrt in seine Kaffeetasse und dann zum Fenster hinaus, schaut sich im Speisesaal um, schaut überallhin außer auf seinen Sohn. Nelson sagt nichts, fast, als wollte er ein Experiment durchführen, um zu sehen, ob sein Vater tatsächlich eine Antwort auf seine Frage haben wollte. Er starrt zu seinem Vater hinauf, bis sich endlich der Blick des älteren Mannes zu ihm herabsenkt und den seinen trifft. »Was?«, fragt Clete.
Mama fehlt mir, würde Nelson gern sagen. »Er hat mir Gesellschaft geleistet.«
»Wer denn?«
»Lagerführer Wilbur.«
»Oh, ja, klar.«
»Papa?«
»Was denn, Nelson?«
Hast du mich lieb?, möchte der Junge fragen. »Danke für den Orangensaft.«
»Ich glaube, ich hole mir noch einen Teller mit Rührei«, sagt sein Vater. Dann geht er wieder davon, in Richtung der Küche, und hält sich den Teller vor den Leib wie ein Mann, der um Almosen bettelt.
3
IN DIESER NACHT liegt Nelson im Bett und liest im Licht seiner Laterne das Handbuch für junge Pfadfinder. Eine Motte stößt gegen die leuchtende Glaskugel. Nelson legt das Buch einen Moment auf die blassweiße Haut seiner Brust. Von draußen schallt Gelächter herein, das Zischen und Knacken des Lagerfeuers, das Surren von Reißverschlüssen und das Knallen zugeschlagener Latrinentüren, bis die Geräusche allmählich nachlassen und die Stille nur noch selten unterbrochen wird, etwa von einem einsamen Husten oder dem tiefen, lang gezogenen Ton eines neu gekauften Furzkissens. Die Motte fliegt immer wieder und wieder gegen die Glaskugel, bis Nelson schließlich seine Hand ausstreckt und das Tier einfängt, sehr vorsichtig, um es nicht zu verletzen. Er spürt die winzige Kreatur, die Behaarung an ihren Beinchen, das Kitzeln der verzweifelt schlagenden Flügel, die Neugier der ausgestreckten Fühler. Er öffnet seine Finger und betrachtet die Motte, wie sie auf seiner Handfläche sitzt.