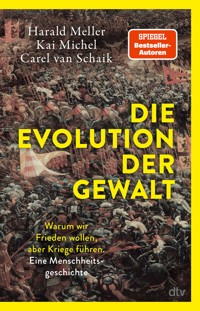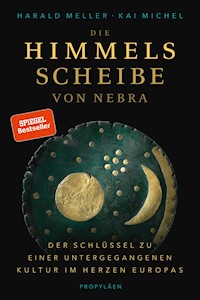
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie ist die älteste Darstellung des Himmels, ihre Entdeckung war eine archäologische Sensation: Die Himmelsscheibe von Nebra stammt aus keiner Hochkultur des Altertums, sie wurde im Herzen Europas gefunden. Welches verlorene Wissen birgt die rätselhafte Scheibe aus Bronze und Gold? Wer waren die Menschen, die sie vor 3.600 Jahren erschaffen haben? Raubgräber entdeckten die Himmelsscheibe von Nebra auf der Spitze des Mittelbergs in Sachsen-Anhalt, der Archäologe Harald Meller rettete sie für die Öffentlichkeit. Seither koordiniert er die Erforschung ihrer Geheimnisse. Gemeinsam mit dem Historiker und Wissenschaftsjournalisten Kai Michel entwirft er das Panorama des sagenhaften Reichs von Nebra. Dessen Kontakte reichten von Stonehenge bis in den Orient, seine Fürsten ließen sich unter gewaltigen Grabhügeln beisetzen. Es war eine Zeit, in der die Vorstellungen von Göttern, Macht und Kosmos revolutioniert wurden. Die Himmelsscheibe liefert uns den Schlüssel zu einer verschollenen Welt, der wir die Grundlagen unserer modernen Gesellschaft verdanken. »Ein Schatz aus Bronze und Gold, vor Tausenden von Jahren vergraben, enthüllt die Existenz einer bisher unbekannten Kultur im Herzen Europas. Kein Romanautor könnte eine so spannende Handlung erfinden, wie sie dieses Buch über die Entdeckung der Himmelsscheibe von Nebra zu bieten hat.« JARED DIAMOND, Pulitzer-Preisträger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Sie ist die älteste Darstellung des Himmels, ihre Entdeckung war eine archäologische Sensation:
Die Himmelsscheibe von Nebra stammt aus keiner Hochkultur des Altertums, sie wurde im Herzen Euopas gefunden.
Welches verlorene Wissen birgt die rätselhafte Scheibe aus Bronze und Gold? Wer waren die Menschen, die sie vor 3600 Jahren erschaffen haben?
Raubgräber entdeckten die Himmelsscheibe von Nebra auf der Spitze des Mittelbergs in Sachsen-Anhalt, der Archäologe Harald Meller rettete sie für die Öffentlichkeit. Seither koordiniert er die Erforschung ihrer Geheimnisse.
Gemeinsam mit dem Historiker und Wissenschaftsjournalisten Kai Michel entwirft er das Panorama des sagenhaften Reichs von Nebra. Dessen Kontakte reichten von Stonehenge bis in den Orient, seine Fürsten ließen sich unter gewaltigen Grabhügeln beisetzen. Es war eine Zeit, in der die Vorstellungen von Göttern, Macht und Kosmos revolutioniert wurden. Die Himmelsscheibe liefert uns den Schlüssel zu einer verschollenen Welt, der wir die Grundlagen unserer modernen Gesellschaft verdanken.
Die Autoren
Prof. Dr. Harald Meller, geboren 1960 in Olching, ist Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle an der Saale und des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Der Landesarchäologe ist ein international anerkannter Wissenschaftler und Ausstellungsmacher.
Kai Michel, geboren 1967 in Hamburg, ist Historiker und Literaturwissenschaftler. Er war Wissenschaftsredakteur bei Zeitungen wie »Die Zeit« oder »Die Weltwoche« und schreibt heute für »GEO«. Er ist Co-Autor des Bestsellers »Das Tagebuch der Menschheit« und lebt in Zürich und im Schwarzwald.
Harald MellerKai Michel
DieHimmelsscheibe von Nebra
Der Schlüssel zu einer untergegangenen Kultur im Herzen Europas
Propyläen
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1819-6
© der deutschen AusgabeUllstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018Umschlaggestaltung: Klaus Pockrandt | pockrandt.netUmschlagmotiv: © Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj LiptákKarten für Vor- und Nachsatz: Peter Palm, Berlin
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Über das Buch und die Autoren
Titelseite
Impressum
Sternstunde
Sie ist ein Rätsel
Sie ist eine Provokation
Sie ist eine Sternstunde der Menschheit
Sie ist eine Flaschenpost
Sie ist der Schlüssel zu einer unbekannten Kultur
Sie ist der Anfang unserer Welt
Teil 1 Der geschmiedete Himmel
1 Archäologie undercover
2 Unter Raubgräbern
3 Die Spur der Sterne
4 Vor Gericht
5 Im Labor
6 »Fälschung!«
7 Goldrausch
8 Der Sternencode
9 Kalenderkünste
10 »Ihr Atem ist der Tod«
11 Metamorphosen
Teil 2 Das Reich der Himmelsscheibe
12 Jenseits von Eden
13 Krieg ums Land
14 Steppenkrieger
15 Glänzende Zeiten
16 Die zwei Hügel
17 Das Geheimnis der Macht
18 Es war Mord
19 Pyramide des Nordens
20 König der Himmelsscheibe?
21 Armeen der Bronzezeit
22 Erste Alchemisten
23 Kräfte des Kosmos
24 Die Rache der Götter
Die sieben Lehren der Himmelsscheibe und kein Ende
Lehre Nummer eins: Das Forschen liegt in der menschlichen Natur
Lehre Nummer zwei: Wir sind Wanderer
Lehre Nummer drei: Das Wilde in uns existiert noch immer
Lehre Nummer vier: Wissen ist Macht
Lehre Nummer fünf: Auch Mentalitäten wachsen
Lehre Nummer sechs: Despotie ist nicht unser Schicksal
Lehre Nummer sieben: Schrift ist nicht alles
Bildteil 1
Bildteil 2
Karte Reich von Nebra in Europa
Detailkarte Reich von Nebra
Dank
Erkundungen im Reich von Nebra
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Feedback an den Verlag
Empfehlungen
Sternstunde
Es geschah am helllichten Tag und nicht, wie immer kolportiert, bei Nacht und Nebel. An einem heißen Julimittag stießen zwei Sondengänger auf dem Mittelberg bei Nebra auf einen Schatz aus Bronze und Gold. Schwerter, Beile, Armringe waren darunter und auch eine sonderbare Scheibe, die sie zunächst für einen Eimerdeckel hielten. Schon am nächsten Tag verkauften die Raubgräber ihre Beute an einen Hehler. Es sollten fast drei Jahre vergehen, bis der Jahrhundertfund bei einer abenteuerlichen Polizeiaktion in der Schweiz sichergestellt werden konnte. Einer von uns beiden war hautnah dabei.
Seither funkelt die Himmelsscheibe von Nebra im dunklen Allerheiligsten des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle an der Saale und verzaubert die Besucher. Über 3600 Jahre alt, präsentiert sie den Nachthimmel in einem Bild von archetypischer Schönheit, das an eine menschliche Urerfahrung zu rühren scheint. Wer kennt nicht das sanfte Taumeln, das uns beim nächtlichen Blick in den unendlichen Sternenhimmel über unseren Köpfen erfasst? Die Himmelsscheibe vereint die Geheimnisse der Vergangenheit mit denen des Universums. Eine mehr als inspirierende Mischung.
Erstmals werden in diesem Buch die Geschichten ihrer Rettung und die ihrer Erforschung aus erster Hand erzählt. Vor allem unternehmen wir das Abenteuer, ein Panorama jener untergegangenen Kultur im Herzen Europas zu entwerfen, aus der sie stammt. Dabei geht es um bedeutend mehr als nur um unsere Vergangenheit, ist doch auch die Himmelsscheibe mehr als nur ein fantastisches archäologisches Objekt. Sie werden staunen, was sie alles ist:
Sie ist ein Rätsel
Wer die Himmelsscheibe betrachtet, kommt unweigerlich ins Grübeln. Sonne, Mond und Sterne glaubt jedes Kind auf ihr zu erkennen. Doch leuchten die nie gemeinsam am Firmament. Stellt der große goldene Kreis also nicht die Sonne, sondern den Vollmond dar? Wozu dann die Mondsichel? Und was fährt da für ein Schiff am Scheibenrand? Und diese Bögen und die sieben Sterne da?
Woche für Woche gehen im Museum Vorschläge ein, was hinter dem Geheimnis der gut zwei Kilogramm schweren Himmelsscheibe stecken könnte. Nicht, weil das Museum einen Wettbewerb ausgeschrieben oder um Mithilfe gebeten hätte. Die Zuschriften kommen unaufgefordert. Von aufwendigen astronomischen Berechnungen über mondgestützte Menstruationskalender bis hin zur Warnung vor dem nahen Weltuntergang ist alles dabei. Selbst komplexe Apparaturen werden konstruiert, als deren Herzstück die Himmelsscheibe die wunderbarsten Dinge vollbringen soll. Sie ist wie die Sphinx: Sie lässt dem Betrachter keine Ruhe, bis er eine Lösung für ihr Rätsel weiß.
Sie ist eine Provokation
Auch die Wissenschaft zwingt sie zu Antworten. Um das Jahr 1600 vor Christus im Boden vergraben, handelt es sich bei der Scheibe aus Bronze und Gold um die älteste bisher gefundene konkrete Darstellung des Himmels. Das heißt: Sie stellt die Gestirne nicht als Götter, Jungfrauen oder mythisches Getier dar, wie das sonst in den Kulturen des Altertums der Fall war. Sie zeigt uns die Himmelskörper so naturalistisch, wie diese sich dem menschlichen Auge am Himmel präsentieren: als leuchtende Objekte unterschiedlicher Größe und Form. Woher rührt der frühe Rationalismus? Was für uraltes Wissen verbirgt sie vor uns?
Wäre die älteste Himmelsdarstellung der Weltgeschichte in Ägypten, Mesopotamien oder im alten Griechenland entdeckt worden, würde das niemanden sonderlich erstaunen. Die Experten hätten anerkennend mit der Zunge geschnalzt, doch das wäre es schon gewesen. Aber dass sie aus einer Zeit stammt, über die unsere Schulbücher kein Wort verlieren, einer Zeit lange vor den Kelten und Germanen– das macht sie zum Rätsel, mehr noch, zur Provokation. Damit stellt sie die bisherigen Kenntnisse über unsere eigene Vergangenheit infrage.
Sie ist eine Sternstunde der Menschheit
Ist das nicht kurios? Da liefert uns die Himmelsscheibe von Nebra den Beleg für eine Sternstunde der Menschheit– und wir haben so gut wie keine Ahnung von der Kultur, der wir sie zu verdanken haben. Dass es sich um einen Geniestreich handelt, ist mittlerweile offiziell anerkannt. Die Weltkulturbehörde UNESCO hat die Himmelsscheibe ins »Weltdokumentenerbe« aufgenommen. Zugegeben, das klingt, als habe man ihr einen Ehrenplatz in der Ruhmeshalle der Bürokratie eingeräumt. Die englische Bezeichnung »Memory of the World« trifft es besser: Die UNESCO weist der Himmelsscheibe einen Platz im Gedächtnis der Welt zu– neben der Magna Charta, der Gutenberg-Bibel, der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte und Ludwig van Beethovens Neunter Sinfonie.
Und das zu Recht. War es nicht der griechische Philosoph Aristoteles, der das Staunen, das die Menschen beim Blick in den Nachthimmel erfasste, zum »Anfang des Philosophierens« erklärte? Seither interessierten sich unsere Vorfahren nicht mehr nur fürs blanke Überleben; sie überschritten die Bedingungen ihrer Existenz und versuchten, die Gesetze der Welt und des Kosmos zu verstehen. Noch heute lässt uns nichts deutlicher die eigene Unwissenheit spüren als die Unendlichkeit des Weltalls; noch heute fasziniert uns nichts mehr als das Universum. Es ist das größte Mysterium aller Zeiten.
Die Himmelsscheibe dokumentiert den ältesten bisher bekannten systematischen Versuch, dieses Mysterium zu ergründen– das sichert ihr den Ehrenplatz im kulturellen Gedächtnis der Menschheit. Dass wir es mit einem menschlichen Urtrieb, etwas wie einer anthropologischen Konstante zu tun haben könnten, darauf deutet ihre überraschende Ähnlichkeit mit einem außergewöhnlichen Objekt unserer eigenen Zeit. Einem Gegenstand, der den vorläufigen Endpunkt jener Entwicklung markiert, die mit der Himmelsscheibe ihren Anfang nahm.
Die Rede ist von der »Voyager Golden Record«, die von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA an den 1977 gestarteten Voyager-Raumsonden montiert wurde. Sie soll außerirdischen Wesen Auskunft über das Leben auf der Erde geben. Dazu enthält die Golden Record Grußbotschaften in 55 Sprachen, Fotos, aber auch mathematische und physikalische Definitionen. Der damalige US-Präsident Jimmy Carter gab ihr eine Botschaft mit: »Dies ist ein Geschenk einer kleinen, weit entfernten Welt, eine Probe unserer Klänge, unserer Wissenschaft, unserer Bilder, unserer Musik, unserer Gedanken und unserer Gefühle. Wir versuchen, unser Zeitalter zu überleben, um so bis in eure Zeit hinein leben zu dürfen.« Mittlerweile hat die Golden Record als erstes menschengemachtes Objekt unser Sonnensystem verlassen.
Obwohl über 3600 Jahre zwischen den beiden Objekten liegen, verbindet sie vieles. Erstens ist da die verblüffende Ähnlichkeit: Hätte die Himmelsscheibe in den 1970er-Jahren nicht noch mehr als zwei Jahrzehnte unentdeckt im Boden gelegen, wären wir sicher, sie diente dem vom berühmten Astronomen Carl Sagan geleiteten Forscherteam als Inspiration. Ob Himmelsscheibe oder Golden Record, in beiden Fällen handelt es sich um kreisrunde Scheiben von der ungefähren Größe einer Langspielplatte. Beide bestehen in der Hauptsache aus Kupfer; bei der einen ist es mit Zinn zu Bronze veredelt, bei der anderen ist es vergoldet. Und bei beiden dient Gold dazu, die Botschaften zu übermitteln.
Zweitens sind beides Botschaften an nicht menschliche Intelligenzen. Die Golden Record will Aliens über das Leben auf dem Planeten Erde informieren. Die Himmelsscheibe von Nebra wurde als Gabe an übernatürliche Mächte im Boden versenkt. Warum? Das ist eine der großen Fragen dieses Buchs.
Drittens verdanken sich beide derselben Motivation, dem urmenschlichen Antrieb, nicht vor den Grenzen unserer Welt haltzumachen. »Das Forschen liegt in unserer Natur«, lautet ein berühmtes Zitat Carl Sagans. »Als Wanderer haben wir begonnen, und Wanderer sind wir noch immer. Wir haben lange genug an den Ufern des kosmischen Ozeans verweilt. Es ist an der Zeit, die Segel zu setzen und zu den Sternen aufzubrechen.« Beide Scheiben verdanken sich dieser Sehnsucht. Die Himmelsscheibe dokumentiert das erste Aufflackern des Wunsches, das Rätsel des Universums zu verstehen; mit ihr haben die Menschen den Aussichtsplatz am Rande des kosmischen Ozeans bezogen. Die Golden Record dagegen lässt den Wunsch 3600 Jahre später Wirklichkeit werden; mit der Voyager-Sonde setzte die Menschheit Segel, um die Grenzen des Sonnensystems zu verlassen. Die Himmelsscheibe und die Golden Record sind das Alpha und das Omega menschlicher Himmelsstürmerei.
Sie ist eine Flaschenpost
Carl Sagan nannte die Golden Record eine »in den kosmischen Ozean geworfene Flaschenpost«. Und diese Metapher taugt auch für die Himmelsscheibe von Nebra. Sie ist zwar nicht durch den Ozean des Raums, wohl aber durch den der Jahrtausende gereist. Auch sie birgt die Botschaft einer längst versunkenen Kultur. Deshalb verspüren wir eine gewisse Solidarität mit jenen armen Außerirdischen, die sich eines Tages daranmachen müssen herauszufinden, was für eine seltsame Zeitkapsel ihnen da ein galaktischer Zufall mit der Golden Record in die Hände gespielt hat (wenn sie denn überhaupt Hände haben). Sie werden sich dieselben Fragen stellen, wie wir das bei der Himmelsscheibe taten: Was um Himmels willen ist das? Spielt uns da jemand einen Streich? Und wenn das Ding echt sein sollte: Wer hat es gemacht? Warum? Wozu? Was ist seine Botschaft? Und wie sieht die Welt aus, aus der es kommt?
Auch nach der Himmelsscheibe hat keiner gesucht. Wie es sich für eine Flaschenpost gehört, ist einer von uns beiden– Harald Meller– eher zufällig auf sie gestoßen. Nicht bei einem Strandspaziergang, aber doch völlig unvorbereitet auf einem Biedermeiersofa sitzend im Berliner Schloss Charlottenburg– und das auch nur in Gestalt schlechter Fotos. Gemeinsam mit Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei heftete er sich an die Fersen der Raubgräber und Hehler, immer fürchtend, nur einem Phantom nachzujagen. Schließlich stellte sich Meller der Schweizer Polizei als Lockvogel zur Verfügung, um die Scheibe in einer– zumindest für ihn– durchaus dramatischen Polizeiaktion sicherzustellen. Als Archäologe ist man ja in solchen Belangen eher selten undercover im Einsatz.
Die Himmelsscheibe war ebenso unerwartet wie unvorstellbar: Niemand hätte für möglich gehalten, dass etwas Derartiges vor Jahrtausenden in Mitteleuropa existierte. Die Scheibe war ein einziges Fragezeichen. Die Welt, aus der sie stammte, musste erst einmal gefunden werden. Deshalb stieß sie am Anfang auf Widerstände. Zweifel regten sich: War das Ding wirklich echt? Kam es tatsächlich aus Sachsen-Anhalt? Stimmte das Alter von über 3600 Jahren? Der zweite Autor dieses Buchs– Kai Michel– recherchierte damals bereits an einer Geschichte für die Wochenzeitung Die Zeit, in der er den Vorwürfen nachging, die Scheibe sei eine Fälschung. Als er zum Ergebnis kam, dass die Vorwürfe haltlos waren, wanderte der Artikel von der Titelseite nach hinten in den Wissenschaftsteil. Seither begleitet Michel die Forschungen rund um die Himmelsscheibe als Wissenschaftsjournalist und Historiker und war bei der Suche nach dem Gold der Himmelsscheibe genauso dabei wie bei der Entdeckung des wohl ersten belegbaren Fürstenmords der Weltgeschichte.
Natürlich haben wir es einfacher als die hypothetischen außerirdischen Scheibendeuter, wenn wir versuchen, unsere Flaschenpost zu entschlüsseln. Immerhin gehören wir derselben Spezies an wie die Schöpfer der Himmelsscheibe. Und die mitteleuropäische Bronzezeit ist keine absolute Unbekannte. Archäologen haben da große Arbeit geleistet, auch wenn davon bisher viel zu wenig ins Bewusstsein der Allgemeinheit gedrungen ist. Trotzdem mochten diese Erkenntnisse nicht recht zu unserem Fund passen; der schien Botschaften aus einer viel komplexeren Kultur zu übermitteln, als man sie bisher für die frühe europäische Bronzezeit für möglich hielt. Also machten wir uns ans Werk. Die Verlockung war riesig, die Ersten zu sein, die diese fast vier Jahrtausende alte Flaschenpost lasen.
Sie ist der Schlüssel zu einer unbekannten Kultur
Deshalb rückten Archäologen, Astronomen und Archäometallurgen, Physiker, Chemiker und Geologen der Himmelsscheibe und ihren Beifunden mit aller Raffinesse zu Leibe. Es wurde alles darangesetzt, dem Fundensemble noch das letzte Geheimnis zu entlocken. Die Himmelsscheibe gehört seitdem zu jenen archäologischen Objekten weltweit, welche die größte Forschungsleistung pro Quadratzentimeter Fläche auf sich vereinen.
Wir wissen mittlerweile bis ins Detail, wie sie hergestellt wurde, welcher Stern als Erstes befestigt wurde, wie viele verschiedene Bronzezeitkünstler an ihr arbeiteten, wie lange sie im Gebrauch war, woher das Kupfer und das Gold stammen und dass sie außerordentliches astronomisches Wissen auf elegante Weise codiert. Die Himmelsscheibe, so viel sei verraten, ist das Produkt einer globalisierten Welt, deren Verbindungen von Stonehenge bis in den Orient reichten.
Kann das denn sein? Um das herauszufinden, startete eine Forschungsoffensive. Archäologen spürten beeindruckende Heiligtümer und den größten Grabhügel Mitteleuropas auf, Anthropologen rekonstruierten aus Skeletten den Gesundheitszustand der Bevölkerung, genetische Analysen enthüllten die Herkunft frühbronzezeitlicher Menschen. Die Himmelsscheibe erwies sich als passender Schlüssel, um das Tor zu einer bisher unbekannten Welt aufzuschließen. Es war, als leuchteten wir mit einer Taschenlampe in die Dunkelheit. Erst erspähten wir nur Schemen, die, als sich die Augen ans Zwielicht gewöhnt hatten, immer deutlicher Gestalt gewannen.
Was wir dort erblickten, werden wir in diesem Buch erstmals zum Panorama einer untergegangenen Kultur zusammenfügen, einem vergessenen Reich mit Fürsten, ja sogar Königen, dem ersten goldenen Zeitalter Europas.
Sie ist der Anfang unserer Welt
Nicht zuletzt ist die Himmelsscheibe auch ein Schlüssel zu unserer eigenen Geschichte. Wir betreiben hier die Archäologie der modernen Gesellschaft. Es ist faszinierend zu beobachten, wie exklusives Wissen eine Gesellschaft entstehen ließ, der wir den Rang des ersten Staates in Mitteleuropa zubilligen werden. Diese Wissensgesellschaft erfand nicht nur die serielle Produktion; sie führte dazu, dass Macht und Reichtum in bisher unbekannten Dimensionen entstanden. Die Folge war ein Auseinanderklaffen von oben und unten, arm und reich– mit auf Dauer fatalen Folgen. Zugleich revolutionierte sie die Glaubenswelt: Ausgegrabene Heiligtümer belegen die Entstehung eines Religionstypus, der fortan die Zeiten dominierte. Und die neuesten Analysen zeigen, dass sich damals sowohl das genetische wie das sprachliche Profil unseres Kontinents formten. Wir alle sind Erben der Welt der Himmelsscheibe.
Wir haben es mit Entwicklungen zu tun, die letzten Endes anders verliefen, als wir das aus den frühen Hochkulturen des Orients kennen. Entwicklungen, welche die Frage aufwerfen, was wir heute als »Wiege der Zivilisation« verstehen sollten. Kein Zweifel, wir haben in der europäischen Bronzezeit nicht die prachtvollen Ruinen und Relikte wie in Ägypten oder Mesopotamien. Eine Nofretete werden wir hier wohl keine finden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Experiment Staat auf europäischem Boden scheiterte und man für lange Zeit andere Wege einschlug. Aber nicht, weil man, wie allgemein angenommen wird, noch so »primitiv« und »barbarisch« war– die Himmelsscheibe ist der beste Beweis dagegen. Nein, hier waren die Bedingungen andere; hier scheiterte der Versuch, dauerhaft eine Gesellschaft mit gottgleichen Herrschern wie im Orient zu etablieren. Das gesellschaftliche Experiment maßloser sozialer Ungleichheit führte nach einer kurzen, prächtigen Blüte zum Kollaps– und disqualifizierte die Despotie in Europa für sehr lange Zeit.
***
Rätsel, Provokation, Sternstunde, Flaschenpost, Schlüssel zu einer untergegangenen Kultur, Anfang unserer Welt: Das sind mehr als Gründe genug, nicht nur der Himmelsscheibe einen Platz im Gedächtnis der Welt einzuräumen, sondern auch jener Kultur, der wir sie verdanken: dem bisher nur Experten bekannten Aunjetitz.
Was wissen wir nicht alles über Ägypten, die Reiche an Euphrat und Tigris, über Inkas, Mayas und Azteken– eine der verblüffendsten Kulturen unserer eigenen Vergangenheit dagegen ist uns gänzlich unbekannt! Und das, obwohl der Archäologie in der Öffentlichkeit ein größeres Interesse denn je entgegenschlägt. Das zeigt allein der Blick ins tägliche TV-Programm. Erstaunlicherweise aber erfahren wir dort kaum etwas über die tiefe Vergangenheit unseres eigenen Kontinents. Allenfalls von Kelten und Germanen wird berichtet, über Stonehenge natürlich und Ötzi. Aber wer weiß denn schon, wie die Welt nördlich der Alpen vor gut 4000 Jahren aussah?
Auch die Schulbücher kümmern sich vor allem um die Hochkulturen des Vorderen Orients und im Mittelmeerraum. Die Botschaft scheint klar: Hier im Herzen Europas wird es kaum mehr gegeben haben als primitive Stämme, die, wenn sie sich nicht gerade die Köpfe einschlugen, mühselig ihre Äcker bestellten und das Vieh hüteten. Nicht der Rede wert.
Man muss das verstehen: Die Vorgeschichte Europas führte die längste Zeit ein Aschenputteldasein. Die Forschung hatte mit dem Manko zu kämpfen, ohne schriftliche Quellen auskommen zu müssen. Wo man aber allein auf Knochen, Keramikscherben oder Pfostenlöcher von Häusern angewiesen war, fiel es schwer, packende Geschichten zu erzählen. Auch resultierte das Desinteresse an der eigenen Vergangenheit aus der aus dem 19. Jahrhundert ererbten Geringschätzung schriftloser Kulturen: Geschichtswürdig sei die Zeit vor den Römern ja nicht, hieß es, denn Geschichte sei nur etwas, was allein jenen »Zivilisationen« zugestanden werden dürfe, welche die hohe Kunst des Schreibens entwickelt hatten. Alles andere sei lediglich Vorgeschichte, auf die erst die wahren Meisterleistungen der Menschheit folgten.
Der Umstand, dass die Karte des prähistorischen Europa die längste Zeit aus vielen weißen Flecken bestand, wurde ausgenutzt. Nichts setzte der Fantasie Grenzen. Deshalb waberten in einschlägigen Darstellungen auffallend oft die Nebel, führten Druiden bei Fackelschein Prozessionen an und glitzerte im Mondlicht das Gold auf den Haaren der Jungfrauen, die der Großen Göttin zu Diensten waren. Auch der Missbrauch der Vorgeschichte für die »Blut und Boden«-Ideologie der Nazis gehört in diesen Kontext. Fehlende Fakten sind die beste Basis für krude Theorien.
Aus all diesen Gründen kümmerte man sich wenig um die europäische Vorgeschichte, mitunter verschwieg man sie gleich ganz. Prominentes Beispiel ist eines der erfolgreichsten Archäologiebücher aller Zeiten, C. W. Cerams bis heute immer wieder aufgelegtes Götter, Gräber und Gelehrte. Es behandelt die Pyramiden, die Tempeltürme Babylons und assyrische Paläste im Wüstensand. Die Vorgeschichte Europas aber ist, abgesehen vom alten Griechenland, kein Thema in diesem tatsachenbasierten »Roman der Archäologie«. Selbst Stonehenge gönnt Ceram nur einen halben Satz, und das allein, weil ein Ägyptenforscher sich dort die Sporen als Ausgräber verdient hat.
Das alles hat sich in den letzten Jahren radikal geändert. Der Einsatz naturwissenschaftlicher Methoden revolutionierte die Archäologie. Selbst unscheinbarste Dinge können heute zum Sprechen gebracht werden: Pollen verraten das Klima, Baumringe das Alter, Zahnschmelz gibt Auskunft über die Herkunft der Menschen, Knochen über ihre Ernährung. Genetiker rekonstruieren Verwandtschaftsverhältnisse und spüren uralte Seuchen auf; Isotopenanalysen und Spurenelementmuster erzählen, woher Metalle stammen; und Anthropologen enthüllen an Skelettmaterial prähistorische Gewaltexzesse. Wir sind gar nicht mehr auf die Schrift angewiesen, um unsere Geschichte zu rekonstruieren.
Gerade die molekulargenetischen Forschungen der letzten Jahre veränderten unsere Sicht auf Europa. Fast im Wochenrhythmus erscheinen Untersuchungen jahrtausendealten Erbguts, der sogenannten alten DNA. Sie zeigen, welche Migrationsbewegungen Europa schufen, wann welche Krankheiten wo zum ersten Mal auftauchten, und sie legen unser eigenes genetisches Erbe frei. Wenn man so will, bringen sie wieder Fleisch an die von den Archäologen ausgegrabenen Knochen.
Zugleich wird immer deutlicher, wie verkehrt es ist, beim Blick auf die Menschheitsgeschichte nur jenen relativ kurzen Zeitabschnitt zu begutachten, der von Schriftquellen beleuchtet wird. Mindestens ebenso wichtig sind die restlichen, mehr als 99 Prozent der Menschheitsgeschichte davor. Denn in dieser Zeit, als die Menschen in egalitären Gruppen als Jäger und Sammler herumzogen, entwickelten sich die Verhaltensmuster, psychologischen Prädispositionen und moralischen Intuitionen, die das menschliche Leben bis heute beeinflussen. Wollen wir uns selbst verstehen, müssen wir wissen, woher wir kommen. Dann verstehen wir auch, warum wir uns in der modernen Welt immer wieder mit denselben Problemen herumschlagen. Das macht die Vorgeschichte zur eigentlichen Menschheitsgeschichte. Sie hat uns stärker geprägt als die Ausnahmeerscheinungen in Ägypten oder an Euphrat und Tigris, mögen diese Reiche noch so spektakuläre Zeugnisse ihrer einstigen Pracht hinterlassen haben.
Autoren wie Jared Diamond oder Yuval Noah Harari feiern dank dieser Perspektive auf die Geschichte des Homo sapiens große Erfolge. Was sie mit Blick auf die globale Geschichte der Menschheit abhandeln, werden wir am Beispiel unserer europäischen Vergangenheit demonstrieren. Wir erzählen die Vorgeschichte, Pardon, die Geschichte unserer eigenen Welt– zumindest soweit sie in die Welt der Himmelsscheibe führt. Auf diese Weise wird zugleich klar, was für eine entscheidende Wegscheide dieses vermutlich zwischen 1800 und 1750 vor Christus geschaffene und um 1600 im Boden deponierte Wunderwerk markiert; und es zeigt auch, welche Probleme mit dem Beginn der Bronzezeit in die Welt traten, die uns bis heute begleiten.
Dass wir das können, hängt damit zusammen, dass die Himmelsscheibe von Nebra auf beeindruckende Weise von den Möglichkeiten profitierte, die sich durch die naturwissenschaftliche Revolution der Archäologie eröffneten. Außerdem war sie selbst ein Anstoß für eine Forschungsoffensive, an deren Ende wir nun das Bild einer bisher grandios unterschätzten Kultur zeichnen können. Davon handelt dieses Buch.
***
Einer von uns beiden rettete, wie bereits erwähnt, im Jahr 2002 die Himmelsscheibe für die Öffentlichkeit. Seither obliegt ihm, Harald Meller, als Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle und Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt die Restaurierung und Präsentation, vor allem aber auch die Koordination der Erforschung des Jahrhundertfunds und der bronzezeitlichen Welt, der wir ihn zu verdanken haben. Ein internationales Netzwerk von Experten unterschiedlichster Wissenschaftsdisziplinen, das allein zwei Forschungsprojekte der Deutschen Forschungsgemeinschaft involvierte, arbeitete daran– und tut es immer noch. Niemand kann also besser über die Himmelsscheibe von Nebra und ihre außergewöhnliche Kultur Auskunft geben als er.
Dank der immensen Erkenntnisgewinne der letzten Jahre sind wir erstmals in der Lage, allen fehlenden schriftlichen Quellen zum Trotz einen neuen faktenbasierten »Roman der Archäologie« zu schreiben, ohne dass wir dabei auf fantastische Ausschmückungen oder dunkles Geraune angewiesen wären. Wir fühlen uns durchaus ein Stück weit Götter, Gräber und Gelehrte verbunden, dessen Erfolg nicht zuletzt in Cerams Überzeugung gründete, dass nichts spannender sei, als die Leser »genau denselben Weg« zu führen, den auch die Wissenschaftler beschritten. Sie werden also bei der Rettung der Scheibe ebenso dabei sein wie bei ihrer Erforschung; sie erleben den Gerichtsprozess mit, in dem es um die Echtheit der Funde ging, gehen auf Goldsuche und nehmen an den Ausgrabungen teil, die das Reich der Himmelsscheibe zutage förderten. Sie werden über dessen Mythen grübeln und zugegen sein, als dramatische Ereignisse, die ganz Europa erschütterten, dazu führten, dass die Himmelsscheibe jene Reise in die Unterwelt antrat, die sie Jahrtausende später in unsere Hände führte.
Keine Frage, der Versuch, das Panorama einer schriftlosen Kultur zu entwerfen, ist ambitioniert. Noch fehlen uns mehr Puzzleteile, als uns lieb ist. Trotzdem lassen sich die bereits entdeckten Stücke zu einem erstaunlich stimmigen Gesamtbild zusammenfügen. Manches ist nur begründete Spekulation, aber das gilt auch für unser Bild von Stonehenge, Ötzi oder Troja. Das Rätseln gehört nun mal zur Archäologie. Wir lassen die Leser jedoch nie im Ungewissen darüber, wo wir spekulieren, und werden alternative Deutungsoptionen aufzeigen. Dafür haben wir Cutting-Edge-Archäologie zu bieten: Vieles erfahren die Leser dieses Buchs als Allererste.
Natürlich wäre es schön, Sagen und Legenden, Epen und Zaubersprüche aus dem Reich der Himmelsscheibe zu besitzen. Was würden wir nicht für einen Homer des Nordens geben, der uns Dinge überlieferte, wie sie in J. R. R. Tolkiens Der Herr der Ringe zu lesen sind: »Auf! Auf! Ihr Reiter Théodens! Zu grimmigen Taten: Feuer und Schlachten! Speer wird zerschellen, Schild zersplittern, Schwert-Tag, Blut-Tag, ehe die Sonne steigt! Nun reitet! Reitet! Reitet nach Gondor!« Aber auch so haben wir einiges à la Tolkien zu bieten: Ringe der Macht, weiß leuchtende Hügelgräber, Reiter aus der Steppe, sagenhafte Schwerter. Von Menschenopfern und einem Stonehenge auf deutschem Boden ganz zu schweigen. Willkommen also in Aunjetitz, der Welt der Himmelsscheibe von Nebra, dem mächtigsten Reich, von dem Sie noch nie gehört haben!
Teil 1
Der geschmiedete Himmel
Eines unterscheidet die Himmelsscheibe von Nebra von den meisten anderen Berühmtheiten der Archäologie: Sie ist etwas völlig Unerwartetes. So spektakulär viele Funde auch sein mögen, streng genommen sind die meisten von ihnen keine Überraschung. Als der Ägyptologe Howard Carter 1922 auf den goldfunkelnden Sarkophag des Tutanchamun stieß, war es genau das, wonach er und viele Archäologen vor ihm gesucht hatten: ein ungeplündertes Pharaonengrab. Heinrich Schliemann war fest davon überzeugt, in den Werken Homers genügend Hinweise entdeckt zu haben, um am Hellespont die Ruinen Trojas zu finden. Als er tatsächlich auf sie stieß, war das eine Sensation– für ihn selbst jedoch nur die Bestätigung seiner Erwartungen. Und der Anthropologe Donald Johanson war auf der Suche nach fossilen Überresten unserer menschlichen Vorfahren, als er in einem äthiopischen Wadi das Fragment eines homininen Unterarms fand. Überraschend war da nur, zu welch komplettem Skelett der Knochen gehörte. Abends, während das Ausgrabungsteam den Fund feierte, erklang der Beatles-Song »Lucy in the Sky with Diamonds« und bescherte der Urmenschen-Dame ihren legendären Namen.
Nach der Himmelsscheibe aber hat keiner gesucht. Man hatte nicht einmal die geringste Ahnung, dass etwas in ihrer Art überhaupt existieren konnte. Die Kultur, aus der sie stammte –Aunjetitz–, war nur Experten ein Begriff, und selbst die hätten nicht damit gerechnet, im heutigen Mitteldeutschland auf die bisher früheste Himmelsdarstellung der Welt zu stoßen.
Wäre die Himmelsscheibe in Ägypten ausgegraben worden, hätte man einen kulturellen Kontext gehabt, der ihr Verständnis erleichterte. Dann würden Ägyptologen sie mit der Sternendecke der Unas-Pyramide aus dem Alten Reich vergleichen, wo Sterne rein dekorativ wie auf einer Tapete in Reih und Glied angeordnet sind. Und wären auf die historisch späteren astronomischen Decken eingegangen, wie die berühmte aus der Sarkophaghalle des Pharao Sethos I. Die ist einige Jahrhunderte jünger als die Himmelsscheibe. Auf ihr wimmelt es von mythologischen Wesen jeglicher Couleur. Angesichts der rationalen Darstellung der Himmelsscheibe wären die Ägyptologen dann zu dem Schluss gekommen, dass die Sternenkunde am Nil doch schon viel wissenschaftlicher war, als man das bisher angenommen hatte. Das wäre eine Überraschung gewesen, eine Sensation vielleicht– aber keine Revolution unseres Wissens.
Doch im Fall der Himmelsscheibe von Nebra ist das anders. Immerhin haben wir es mit einer Region zu tun, die noch 2000 Jahre später von den Römern für barbarisch gehalten wurde. Niemand hätte dort, wo nicht einmal die Schrift existierte, nach einer solch astronomischen Meisterleistung gesucht. Während also die meisten Funde in der Archäologie bisheriges Wissen bestätigen, stellte die Himmelsscheibe es auf den Kopf. Wir mussten erst die Kultur aufspüren, die solch ein Wunderwerk erschaffen konnte.
Noch etwas anderes unterscheidet die Himmelsscheibe von normalen archäologischen Funden. Sie war anfangs nur ein dunkles Gerücht, das in der Schatzgräberszene kursierte; es war völlig unklar, wer sie besaß und was mit ihr geschah. Deshalb stand am Anfang auch keine Grabungskampagne, sondern eine Fahndung. Und aus diesem Grund können wir unser Buch nicht mit einer wissenschaftlichen Bestandsaufnahme der Kultur beginnen, aus der sie kommt, sondern müssen mit einem Krimi starten: mit der abenteuerlichen Rettung der Himmelsscheibe aus den Händen der Hehler.
Daran schließt sich eine weitere Besonderheit an. Kaum war sie sichergestellt, musste nach dem gesucht werden, was sonst in der Archäologie immer schon da ist: der Fundort. Nur er konnte die Geschichte der Himmelsscheibe liefern. Deshalb war es unumgänglich, die Raubgräber zu stellen und ihnen das Geständnis abzuringen, wo ihr Metalldetektor angeschlagen hatte. Erst danach war es möglich, die Himmelsscheibe zu erforschen und in jene verborgene Welt vorzudringen, an deren einstigen Glanz noch das Funkeln ihrer Sterne erinnert. Wir betrieben also Archäologie rückwärts.
Jetzt erst konnten sich Wissenschaftler der verschiedensten Disziplinen an die Arbeit machen. Es ist phänomenal, was sie alles an Informationen aus diesem eigentlich doch recht kleinen Objekt herausholten. Auch der Gerichtsprozess um die Himmelsscheibe trug seinen Teil zu ihrer Erforschung bei, wurde doch dort nicht zuletzt um die Frage gerungen, ob sie nicht eine Fälschung sei. Deshalb wurde noch viel mehr investiert, um ihre Echtheit zu prüfen, als das in der Archäologie ohnehin schon der Fall gewesen wäre.
Von alldem handelt der erste Teil unseres Buchs. Wir erkunden prähistorische Sternenwelten, vertiefen uns in die Geheimnisse bronzezeitlicher Metallurgie, entschlüsseln den Sternencode des geschmiedeten Himmels, gehen auf Goldsuche und schrecken bei der Fahndung nach der Herkunft des astronomischen Wissens nicht einmal vor den Dämonenwelten des alten Mesopotamiens zurück. Starten aber werden wir mit jener Geschichte, die einer von uns beiden immer und immer wieder erzählen muss und die ihm seitens der Boulevardpresse den völlig unpassenden Titel des »Indiana Jones von Halle« eintrug. Doch Harald Meller trägt weder Schlapphut noch Peitsche, und seine Suche nach der Himmelsscheibe brachte ihn an einen Ort, den Indiana-Jones-Darsteller Harrison Ford sicherlich als viel zu kurios abgelehnt hätte. Aber auch das kann Archäologie bieten.
1Archäologie undercover
Wenn Archäologen eines können, dann ist es träumen. Besonders abends am Feuer, nachdem der Tag wieder nur eine Handvoll Scherben eingebracht hat. Je stärker die Knochen schmerzen, umso leidenschaftlicher das Fabulieren. Was man nicht alles endlich einmal finden müsste! Einen Keltenfürsten in einem Grab voller Schätze! Einen Neandertaler mit Faustkeil in der Hand! Warum nicht ein zweites Pompeji? Ötzis Frau wäre auch nicht schlecht, eisgekühlt und taufrisch wie am ersten Tag! Als Archäologe hat man also durchaus ein Faible für Überraschungen. Dass aber die Jagd nach der wichtigsten Entdeckung seines Lebens ausgerechnet auf der Herrentoilette einer Hotelbar enden könnte, hätte Harald Meller sich nicht einmal in seinen wildesten Träumen ausmalen können.
Wenigstens war es die Toilette des Hilton-Hotels in Basel, was die Sache jedoch auch nicht wirklich besser machte. Es war der 23. Februar 2002. Meller war seit knapp einem Jahr Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt und Museumsdirektor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle an der Saale. Fast genauso lange war er einem Fund auf der Spur, der ihm ebenso seltsam wie sensationell anmutete: eine Bronzescheibe, die mit Sonne, Mond und Sternen aus Gold die älteste Himmelsdarstellung der Welt zu sein schien; dazu goldverzierte Schwerter, Beile, Armspiralen und ein Meißel, alles gut 3600 Jahre alt. Heute endlich hatte er die Hehler getroffen, die Scheibe in Händen gehalten– und sich dann in eine ausweglose Situation manövriert.
Meller stand am Waschbecken und wusch sich die Hände. Er hatte sein Handy schon in den letzten Winkel des Raums bugsiert. Kein Empfang, nirgends. Die Hotelbar lag im Kellergeschoss. Wieso hatte ihn die Polizei aus den Augen verloren? Heute früh, in der Staatsanwaltschaft Basel, war bis ins Detail besprochen worden, wie das Treffen mit den Hehlern ablaufen sollte. Verschiedene Szenarien waren durchgespielt worden. Auch Mellers Auftrag als Lockvogel war klar formuliert: »Unternehmen Sie nichts auf eigene Faust! Wir haben Sie stets im Auge!«, hatte ihm der leitende Kriminalkommissär Mario Plachesi eingeschärft, ein ebenso freundlicher wie bestimmter Mann. »Steigen Sie in kein Auto! Die sind mit Ihnen ganz schnell in Frankreich. Dann können wir Ihnen nicht mehr helfen. Sie wären nicht der Erste, den wir aus dem Rhein gefischt hätten!«
Alles war besprochen worden, aber niemand hatte ihm geraten: »Gehen Sie in keine Hotelbar!« Woher hätte er denn wissen sollen, dass sich die Polizei mit einer so einfachen Finte aus dem Konzept bringen lässt? Und jetzt? Endstation Herrenklo?
Die Situation war kurios. Fast am Ziel, und dann ging alles fürchterlich schief. Jeder Versuch, einen Hilferuf abzusetzen, scheiterte am Beton des Basler Untergrunds. Draußen, wenige Meter von der Toilettentür entfernt, saßen die beiden Hehler. Vollkommen unverdächtig sahen sie aus: eine blonde Dame um die 40 und ein grauhaariger Herr, Typ Oberstudienrat, gut 20 Jahre älter als sie. Niemand hätte sich irgendetwas dabei gedacht, wenn er die beiden gesehen hätte, wie sie eben noch mit ihm in der Bar zusammensaßen.
Offiziell hatte man sich getroffen, damit Meller überprüfen sollte, es mit keiner Fälschung zu tun zu haben. Man tat das in Basel, weil die beiden Angst hatten, die deutsche Polizei könnte sie wegen Hehlerei festnehmen. Inoffiziell aber war die ganze Angelegenheit eine Falle. Meller diente der Schweizer Polizei als Lockvogel, damit diese die Hehler verhaften und das archäologische Mysterium in Scheibengestalt sicherstellen konnte.
Doch nun war Meller selbst in die Falle getappt, die Polizei hatte ihn aus den Augen verloren. Wie konnte das passieren? Als er die Frau, ihr Name war Hildegard B., vorhin im Foyer des Hilton getroffen hatte, ging es entgegen der Abmachung weder in eine Bank noch in ein Hotelzimmer, sondern in die holzvertäfelte Kellerbar hinab, die so gut wie leer war. Bloß eine junge Frau war da und ein Herr, der nur ein Bein besaß. Keine Spur von der Polizei. In einer Sitzgruppe saß der angebliche Besitzer des Bronzefunds. Seinen Namen verriet er nicht. Man bestellte Kaffee.
»Sie wissen gar nicht, wie sehr ich mich freue, endlich die Scheibe zu sehen«, war der Museumsdirektor in die Offensive gegangen, als das Gespräch drohte, sich zu lange bei der wegen Schnees recht beschwerlichen Anreise aufzuhalten. »Ich habe alles für die Prüfung dabei.« Er zeigte seinen gelben Werkzeugkoffer. Der Leiter der Restaurierungsabteilung des Museums, Christian-Heinrich Wunderlich, hatte ihn mit hochwissenschaftlich aussehenden Utensilien bestückt, damit sein Direktor auf eindrucksvolle Weise nachweisen konnte, dass es sich um Bronzestücke handelte, ohne dass dabei allzu viel schiefgehen konnte. Echtheit ließ sich mit dem Test keine beweisen; das Prozedere diente in erster Linie dazu, die Hehler in Sicherheit zu wiegen, bis die Polizei einträfe.
Der Mann holte aus einer Tasche ein Paket und wickelte ein grün patiniertes Beil aus der Noppenfolie. »Fangen wir mit diesem hier an.« Meller kramte eine Magnesia-Rinne hervor. Sie fungierte als Feile, mit der er einen hauchzarten Abstrich von der Bronze machte. Darauf tropfte er aus einem Fläschchen 90-prozentige Salpetersäure. »Vorsichtig!«, hatte ihm der Restaurator eingeschärft. Dann wartete er einen Moment und gab aus einem zweiten Fläschchen etwas Natriumsulfit-Lösung hinzu, schließlich noch aus einem dritten Fläschchen das unaussprechliche Toluoldithiol. Sollte Zinn vorhanden sein, würde es sich rot verfärben. »Ein Schwangerschaftstest für Bronze«, hatte Wunderlich gescherzt. Es klappte.
Der namenlose Herr nahm ein Schwert aus der Tasche. Eine hervorragende Arbeit, der Griff war mit einer Goldmanschette verziert. Doch Meller stutzte, er hatte einen Blick in die Tasche geworfen. Da war nichts Großes mehr drin! Sollten die beiden die Bronzescheibe gar nicht mitgebracht haben? War das alles hier umsonst?
Er war verstört; schaute, ob Frau B. eine Tasche dabeihatte, und musste deshalb etwas mit den Chemikalien verkehrt gemacht haben. Jedenfalls scheiterte die Echtheitsprüfung des Schwerts. »Nicht schwanger«, dachte er noch, aber seine Gegenüber hätten das kaum lustig gefunden. Die Stimmung am Tisch trübte sich. Meller war das egal, ihn interessierte nur eins: Wo war die Scheibe? Ein Jahr hatte er darauf gewartet, sie in Händen zu halten. Seine Geduld war zu Ende.
»Entschuldigen Sie«, sagte er, »es kann sein, dass ich die Flüssigkeiten vertauscht habe. Lassen Sie uns die Bronzescheibe testen.«
Der Mann blickte fragend zu seiner Begleiterin– sie nickte. Der grauhaarige Herr sah sich einmal um und schob dann seinen karierten Lehrerpullover hoch. Darunter kamen Handtücher zum Vorschein, die er sich um den Bauch gebunden hatte. Ebenso umständlich wie vorsichtig befreite er sich von ihnen. Ein großes, rundes Stück Bronze kam zum Vorschein. Meller konnte es nicht fassen: Der Mann hatte sich die Himmelsscheibe um den Bauch gebunden!
Meller musste sich einen Moment lang beherrschen, um nicht loszulachen. Doch schon zog die Scheibe seine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Bisher kannte er sie ja nur von Fotos; wusste, dass sie groß wie eine Langspielplatte war, von grünem Malachit überwuchert, unter dem golden die Himmelskörper funkelten. Zögerlich reichte der Mann dem Museumsdirektor die Scheibe. Überrascht vom Gewicht musste Meller nachfassen. Auf den Fotos hatte sie leichter, filigraner ausgesehen, als sei sie aus Bronzeblech. Die Scheibe hier war massiv, richtig schwer.
Harald Meller ist später oft gefragt worden, was das für ein Gefühl war, als er die Himmelsscheibe von Nebra zum ersten Mal in den Händen hielt. »Ehrlich gesagt«, antwortet er dann, »war da für große Gefühle keine Zeit. Die Situation schien mir zu ernst, zu viele Dinge stürzten auf mich ein.« Natürlich war er stolz und glücklich, sie endlich gefunden zu haben. Dass es sich um ein einzigartiges archäologisches Stück handelte, konnte er selbst im schummrigen Licht der Hilton-Bar erkennen. »Das war ein ehrfürchtiger Moment, ja. Doch in diesem Augenblick ging es mir vor allem um eins: zu verhindern, dass die Hehler misstrauisch wurden.«
Meller machte sich an den verabredeten Echtheitstest. Nicht dass er Zweifel an der Authentizität gehabt hätte. Die war offensichtlich. An vielen Stellen war die Malachitpatina mit Erde und Sand fest verbacken. Auch die Hacke der Raubgräber hatte sie überdeutlich demoliert, sogar ein Stück Gold war herausgerissen. Doch all das registrierte er nebenbei. Die Situation war zu ernst. Wo blieb die Polizei?
Unter skeptischen Blicken machte sich Meller an die Prüfung der Scheibe. Wieder rieb er mit der Magnesia-Rinne Bronze ab, achtete aber nun penibel auf die korrekte Reihenfolge der Flüssigkeiten. Und siehe da: Die Probe verfärbte sich rot. Selbst der stoische Mann zeigte so etwas wie ein Lächeln. Meller war erleichtert.
Zumindest einen Moment lang, dann machte sich Nervosität breit. Warum kam die Polizei nicht? Er hatte die Scheibe in die Höhe gehalten, um zu signalisieren: »Hier ist sie! Ich habe sie!« Nichts geschah. Meller sah sich vorsichtig um. Nicht einmal ein Kellner war da. Nur der Einbeinige und die junge Frau rührten in ihren Tassen. Dann geschah etwas Unerwartetes. Hildegard B. kramte einen Vertrag aus der Handtasche und reichte ihn Meller. Man wolle gerne die Modalitäten für den Verkauf regeln.
Der Museumsdirektor schaute erstaunt, schüttelte den Kopf. »Das haben wir nicht verabredet. Sie werden verstehen, dass ich hier nichts unterschreiben kann.«
Er hatte keine Ahnung, welche Konsequenzen das hätte, wenn er als Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt nun mit den Hehlern einen Kaufvertrag abschloß. Doch verdammt, was sollte er tun, wenn die Polizei nicht käme? Wenn er den Vertrag nicht unterschriebe– würden die beiden die Scheibe wieder um den Bauch binden und verschwinden?
Meller überlegte, ob er sich die Himmelsscheibe nicht einfach schnappen sollte. Er war jünger, sicher auch stärker als der Mann. Frau B. würde ihn ebenso wenig aufhalten können, wenn er mit der Scheibe die Treppe hochrennen würde. Seine Augen fielen auf die Hand des Mannes. Sie ruhte in der Tasche. Und wenn er da drin eine Pistole hatte?
»Gehen Sie nicht das geringste Risiko ein«, hatte die Polizei dem Museumsdirektor eingeschärft, »die mögen noch so harmlos aussehen. Sie wissen nie, wer da seine Finger im Spiel hat.« Die Polizei hatte ihm gehörig Angst eingejagt. »Spielen Sie auf keinen Fall den Helden! Und täuschen Sie sich nicht! Illegaler Kunst- und Antikenhandel sind eine Domäne organisierter Kriminalität. Das geht mit Waffenschmuggel, Drogen- und Menschenhandel einher. Wenn Sie wüssten, was wir hier alles erleben.«
Meller stand der Schweiß auf der Stirn. Wie ging es jetzt weiter? Frau B. suchte nach einem Kugelschreiber. Da wusste Meller, was er zu tun hatte: Wenn die Polizei nicht erschien, holte er sie eben selbst!
»Entschuldigen Sie mich bitte, ich muss mir die Hände waschen. Irgendwie haben mir die Chemikalien die Haut verätzt.«
Und damit war er in die Falle getappt. Er tigerte durch die Herrentoilette, den Blick abwechselnd aufs Handy und auf die Eingangstür gerichtet. Der Mann käme sicher gleich nachsehen, wo der Museumsdirektor Meller so lange bliebe. In was war er da nur hineingeraten?
***
Dabei hätte er ja vorgewarnt sein können. Es hatte schon alles kurios begonnen, als Harald Meller das erste Mal von diesem merkwürdigen Fund erfahren hatte. Vergangenes Jahr war das. Es war der 10. Mai 2001, sein 41. Geburtstag. Er war damals als neuer Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt und Direktor des Museums für Vorgeschichte nach Berlin gefahren, um einen Antrittsbesuch bei seinem Berliner Kollegen Wilfried Menghin zu machen. Man kannte sich, die offiziellen Dinge waren schnell erledigt. Menghin, Direktor des Berliner Museums für Vor- und Frühgeschichte, stopfte seine Pfeife und öffnete ein Fenster. Das Büro lag im Seitenflügel des Charlottenburger Schlosses, die Fenster gingen zum Park hinaus. Menghin ging zu seinem Schreibtisch und kehrte mit einem Stapel Fotos zurück. Langsam blätterte er ein Bild nach dem anderen auf den Glastisch. Er schmunzelte dabei so genüsslich, als wäre er ein Pokerspieler, der einen Straight Flush aufdeckte.
Die überbelichteten Fotos zeigten je zwei Schwerter, Beile, Armringe und einen Meißel. Die Stücke waren aus Bronze, erdverdreckt, wie vor Kurzem aus dem Boden geholt. Sie lagen auf grünen und blauen Frotteehandtüchern. Offenbar nicht von Profis geborgen. Dann kamen Fotos, die eine Scheibe aus grün patinierter Bronze zeigten, daneben ein Zollstock. Das Ding maß mehr als 30 Zentimeter im Durchmesser. Meller, auf dem Biedermeiersofa sitzend, nahm seine Brille ab, um die Bilder genauer zu studieren. Unter dem Dreck blitzte es golden. Er erkannte eine Sonne, eine Mondsichel, und die kleinen, über die Scheibe verteilten Punkte schienen Sterne zu sein. Er hatte so etwas noch nie gesehen. Am Rand der Scheibe waren Bögen aus Gold befestigt. Was um Himmels willen war das?
Dann griff sich Meller die Fotos mit den Schwertern. Wunderbar gearbeitete Stücke! In die Klingen waren Verzierungen eingelegt. Züngelte da eine dreiköpfige Schlange? Am Griff prangten Klammern aus Gold. Sie erinnerten an die berühmten Schwerter aus dem Hortfund von Apa in Ungarn. Das waren Prestigeobjekte ihrer Zeit, von Waffenschmieden bis nach Skandinavien kopiert. Bemerkenswert war, dass von Scheibe und Meißel abgesehen die Objekte doppelt vorhanden waren. Solche sogenannten Überausstattungen kannte man aus den prächtigen Fürstengräbern von Leubingen und Helmsdorf. Die stammten aus der frühen Bronzezeit und ihre Grabbeigaben zeichneten sich durch die gleiche Kombination von Gold und Bronze aus.
Wenn also die Stücke zusammengehörten, sollten sie vom Ende der frühen Bronzezeit stammen. Dann datierten sie in die Zeit um 1600 vor Christus. Damals tauchten die ersten Schwerter in Europa auf. Das wäre eine Sensation! Meller kannte keine Darstellung des Himmels, die älter wäre. Vor allem keine, die den Himmel so konkret zeigte.
Menghin begann zu erzählen. Im Herbst 1999 habe ihn ein Mann angerufen, der erklärte, er hätte da etwas äußerst Interessantes. Man traf sich im Café Castello am Spandauer Damm. Ein zweiter, breites Kölsch sprechender Mann war dabei. Die beiden zeigten Menghin Fotos und wollten eine Million Mark für die Stücke.
»Ich war wie elektrisiert! Obwohl der Preis horrend war, hätte ich sofort gekauft. Aber ich durfte nicht.«
»Warum nicht?«
Menghin prüfte seine Pfeife. »Die Männer waren so dumm, mir zu erzählen, wo sie die Scheibe herhatten. Aus einem Bundesland mit Schatzregal!«
Meller lachte. Dass es sich um Raubgräberware handelte, hatte er schon wegen der Frotteehandtücher vermutet. Aber dass die Männer so dreist waren, einem Museumsdirektor freiheraus illegale Ware anzubieten! Denn in Bundesländern mit Schatzregal gehört ein archäologisch bedeutsamer Fund nicht den Findern oder dem Besitzer des Grundstücks, auf dem er gemacht wurde, sondern ist Eigentum des Bundeslandes. Der Scheiben-Fund war also Raubgut. Der Berliner Museumsdirektor hätte sich zum Hehler gemacht, wenn er ihn gekauft hätte.
»Übrigens«, Menghin setzte ein breites Grinsen auf, »was Sie auf den Fotos sehen– das stammt aus Sachsen-Anhalt! Sie sind der zuständige Landesarchäologe. Herr Kollege, diese Scheibe ist Ihre Sache!«
1 Millionenfund: Mit diesem Foto bot ein Hehler die von Raubgräbern geborgene Himmelsscheibe Museen zum Kauf an. Deutlich sind die Beschädigungen zu erkennen.
***
So also hatte das mit der Himmelsscheibe begonnen. Und jetzt sollte das hier in Basel enden? Was für eine Geschichte! Vom Biedermeiersofa in Berlins Schloss Charlottenburg in die Herrentoilette der Basler Hilton-Bar. Das nennt man einen tiefen Fall. Meller fluchte. Was sollte er nur tun? Er konnte ja nicht ewig hierbleiben. Die hatten längst Verdacht geschöpft. Und wenn die Polizei recht hatte und die beiden mit der Kunstmafia zu tun hatten? Dann kämen sie jetzt nachschauen! Aber vielleicht war ihnen die Angelegenheit selbst nicht mehr ganz geheuer; vielleicht überlegten sie gerade, zu verschwinden. Dann wäre die ganze Jagd umsonst gewesen. Das durfte nicht passieren! Meller musste zurück in die Bar.
***
Im vergangenen Mai hatte Menghin seinem Kollegen noch berichtet, dass die beiden Männer erzählten, der Fund sei von ehrenamtlichen Ausgräbern in der Nähe des Kyffhäusers gemacht worden, im Wall einer bronzezeitlichen Höhensiedlung bei Sangerhausen. Zunächst hätten sie die Stücke der Archäologischen Staatssammlung in München zum Kauf angeboten– ohne Erfolg. Menghin habe ihnen dann geraten, sich ans zuständige Museum in Halle zu wenden. »Das war noch vor Ihrer Zeit, Herr Meller.« Doch in Halle sei man nicht sonderlich kooperativ gewesen. »Bringen Sie den Fund nur vorbei«, soll ihnen dort angeblich am Telefon gesagt worden sein. »Aber Sie müssen tapfer sein! Wir lassen Sie verhaften!«
Das lag im Mai 2001 über ein Jahr zurück. In der Zwischenzeit hatte sich ein Kunsthändler bei Menghin gemeldet, der Fund mit der Scheibe sei wieder auf dem Markt. Der Händler habe versprochen, sich umzuhören, auch wenn das eine heikle Angelegenheit sei. Der Fund war Raubgräbergut und damit unrechtmäßig in die Hände der jetzigen Besitzer geraten. Ja, sagte der Kunsthändler, er trete auch gar nicht als Händler auf, er sei ja kein Hehler. Er wolle lediglich helfen, den Fund an den rechten Ort zu bringen. Vielleicht fände sich eine Möglichkeit.
Zurück in Halle, sprach Meller mit dem Kultusministerium und dem Landeskriminalamt in Magdeburg. Auch wenn die Echtheit dessen, was jetzt der »Bronzefund von Sangerhausen« genannt wurde, noch nicht definitiv feststand, sprach doch vieles dafür, dass man es mit einem Schlüsselfund für die europäische Vorzeit zu tun haben könnte. Ließ sich die Botschaft der Scheibe entschlüsseln, würde das vielleicht helfen, prähistorische Monumente wie Stonehenge besser zu verstehen, an deren astronomischen Bezügen die Archäologen seit Generationen herumrätselten.
Die Behörden waren rasch überzeugt, dass der Bronzefund für das Land Sachsen-Anhalt gerettet werden musste. Vordergründig sollte geprüft werden, ob nicht eine Institution wie die Kulturstiftung der Länder den Fund erwerben könnte. Im Hintergrund aber würde das Dezernat für verdeckte Ermittlung des Landeskriminalamts die Ermittlungen aufnehmen und in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft den Museumsdirektor bei allen Schritten unterstützen. Das Ziel war klar: den Fund beschlagnahmen und die Besitzerkette von den Hehlern zurück bis zu den Raubgräbern lückenlos aufklären.
Eine Alternative gab es nicht: Einem Ankauf haftete immer der Makel an, illegal erworbenes Gut gekauft zu haben. Schlimmer noch: Der Fund bekam dabei nicht selten eine Alibi-Geschichte verpasst. Das beraubte ihn seines historischen Kontextes und machte ihn für die Forschung wertlos. Der ebenfalls aus der Bronzezeit stammende Berliner Goldhut, den Menghin im Hinterzimmer eines Zürcher Hotels angekauft hatte, war ein Beispiel dafür. Über die Fundumstände ist nichts bekannt. »Aus einer Schweizer Sammlung«, heißt es bloß. Wahrscheinlich aber war er bei Nacht und Nebel in Süddeutschland ausgegraben worden. Seither ist der Goldhut kaum mehr als eine geheimnisvolle Schönheit, die sich in Schweigen hüllt.
Die Suche geriet jedoch bald zum Stochern im Nebel. Die heiße Spur erkaltete, der Kunsthändler ließ nichts mehr von sich hören. Damit war die einzige Verbindung zum Fund abgebrochen. Hatte der Kunsthändler nur geblufft, und sein Kontakt zu den Besitzern war nicht halb so gut, wie behauptet? Oder hatte er kalte Füße bekommen? Schließlich bewegte er sich auf dünnem Eis– immer in Gefahr, als Hehler ins Visier der Polizei zu geraten.
Man tappte im Dunkeln. Es gab keine Hinweise, mit wem man es zu tun hatte. Die Überprüfung der üblichen Verdächtigen– auffällig gewordene Raubgräber etwa– erbrachte nichts. Die einschlägige Szene war schwer zu überschauen. Im ganzen Osten Deutschlands galt das Schatzregal. Sondengänger schreckte das nicht ab. Militariasammler suchten die Orte der großen Kesselschlachten des Zweiten Weltkriegs ab, stets erpicht auf NS-Ehrenzeichen, Helme oder Waffen. Nach der Wende war der Osten zum Eldorado der Schatzjäger geworden. Metalldetektoren waren in der DDR verboten gewesen. Mit dem Fall der Mauer herrschte Goldgräberstimmung. Viele kamen aus dem Westen, besorgten sich Karten, auf denen Bodendenkmäler verzeichnet waren, und zogen los. Auch statteten sie Arbeitslose mit Detektoren aus und drückten ihnen Telefonnummern in die Hand für den Fall, dass sie etwas fanden. Manches Waldstück sah bald wie eine Mondlandschaft aus, Raubgräberkrater an Raubgräberkrater. Während der Polizei vor Ort der eine oder andere Sondengänger ins Netz ging und eine Geldbuße erhielt, agierten die Hintermänner im Westen im Verborgenen und machten mit den Funden den großen Reibach.
Insofern waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt, als man sich in Halle ausmalte, wer die Besitzer der Bronzescheibe sein könnten und was sie wohl im Schilde führten. Womöglich war die Scheibe schon längst ins Ausland verkauft und diente einem reichen Sammler als Obstschale auf der Louis-Seize-Kommode. Das war eine Vorstellung, die Meller schlaflose Nächte bereitete.
Es gab noch einen zweiten Gedanken, der ihn quälte: Was, wenn alles nur eine Fälschung war? Wenn er wie Don Quijote Riesen nachjagte, die in Wirklichkeit bloß Windmühlen waren? Träumte er sich vielleicht einen Sensationsfund herbei, der gar keiner war? Andererseits: So dilettantisch und in einem traurig restaurierungsbedürftigen Zustand wurde doch keine aufwendige Fälschung präsentiert, das schreckte jeden Käufer ab. Und überhaupt: Wer würde sich eine so abstruse Fundlegende ausdenken? Aus einem Schatzregal-Land! Damit waren die Stücke praktisch unverkäuflich! Nein, die ganze Geschichte war viel zu idiotisch, um erfunden zu sein. Wenn man etwas fälscht, dann etwas Glaubhaftes. Ein Gemälde von Picasso vielleicht oder eine Dalí-Zeichnung, aber nichts völlig Überraschendes. Oder man macht etwas Hübsches aus Gold, schmiert ein bisschen Lehm dran und stattet es mit einem akzeptablen Fundort wie Bayern aus, da gibt es kein Schatzregal.
Bei Menghin in Berlin meldete sich ein Rechtsanwalt, der behauptete, den Besitzer des Bronzefunds zu vertreten, und nun wissen wollte, ob Menghin die Objekte nicht der Öffentlichkeit in einer wissenschaftlichen Publikation vorstellen wollte. Als Menghin Meller davon erzählte, schmiedeten die beiden Pläne, wie sie dieser Spur nachgehen konnten. Leider war der Polizei die Ermittlungslust der Museumsdirektoren nicht geheuer. Man verfolge die Angelegenheit auf bewährte Weise, ließ das LKA verlautbaren. Die Direktoren waren zum Nichtstun verdammt.
Erst im Januar 2002 tat sich wieder eine heiße Spur auf. Ein Redakteur des Münchener Nachrichtenmagazins Focus meldete sich, man habe Fotos vom Schatzfund von Sangerhausen und bäte nun diverse Archäologen um ihre Einschätzung. Ja, der Fund sei noch beisammen, sagte der Redakteur, aber er dürfe seine Quelle nicht nennen. Man habe unter konspirativen Bedingungen Fotos gemacht. Doch die Zeit dränge, es gäbe Interessenten aus den USA. Nein, über die Besitzer könne er wirklich nichts sagen.
Meller war elektrisiert, rief das Kultusministerium an, rief Menghin an. Käme die Bronzescheibe in die Zeitung, adelte die Expertise der befragten Archäologen sie zu einem Jahrhundertfund– und für sensationelle Stücke gibt es immer einen Markt. Der Artikel würde sich nicht verhindern lassen; aber vielleicht könnte man ihn hinauszögern, bis man an die Hintermänner herangekommen war. Wenigstens erteilte die Polizei Menghin nun die Erlaubnis, den Rechtsanwalt, der sich bei ihm gemeldet hatte, zu kontaktieren.
Und das erzielte Wirkung. Zwar behauptete der Anwalt, mit dem ominösen Bronzefund nichts zu tun zu haben, doch eine halbe Stunde später klingelte bei Menghin das Telefon. Eine Frau Hildegard B. war am Apparat. Sie sei Museumspädagogin und im Besitz von Fotos des Schatzes mit der »Sternenscheibe«. Die Stücke befänden sich derzeit in der Schweiz. Ein Privatmann habe sie gekauft, weil er sie für Deutschland retten wollte. Und sie selbst habe einen Roman über die Sternenscheibe geschrieben. Menghin staunte. Sie versprach, sich bei Harald Meller in Halle zu melden.
Das tat Hildegard B. am 12. Februar 2002. Sie erzählte am Telefon, sie sei seit je geschichtsbegeistert und betreibe das Restaurant Historia am Niederrhein. Das sei eine Art Privatmuseum, in dem sich Sammler und Hobbyarchäologen treffen. Schon seit einer ganzen Zeit wisse sie von dem Sternenscheiben-Fund, der sei ja das große Thema in der Szene. Jetzt endlich sei es ihr gelungen, einen Bekannten zu überzeugen, ihn zu kaufen. Dafür habe der Mann 700 000DM aus seiner Altersvorsorge genommen– ohne dass dessen Frau davon wisse. Ansonsten wäre der Schatz sicher in die USA oder Schweiz verkauft worden. Ihr sei es aber eine Herzensangelegenheit, dass die Scheibe dorthin komme, wo sie hingehöre: ins Museum nach Halle. Nur müsse der Mann sein Geld zurückerhalten, damit seine Familie nicht ruiniert werde. Das müsse Meller unbedingt verstehen.
Sie selbst habe die Scheibe einmal in Händen gehalten– und eine magische Kraft gespürt. Er dürfe sie nicht für verrückt halten, aber sie habe eine Vision erlebt. Für einen Augenblick glaubte sie, sie sei mit der Sternenscheibe schnurstracks in die Bronzezeit zurückgeflogen, auf eine Lichtung mitten im dunklen Wald. Vielleicht komme er einmal zum Essen ins Historia? Dann könne man alles gemeinsam bereden.
Tatsächlich fuhr Meller einige Tage nach dem Anruf ins Historia an den Niederrhein. Nach dem Telefonat hatte er das LKA informiert. Die Polizei stimmte dem Besuch zu, instruierte den Archäologen in Sachen Verhandlungstaktik und stellte ihm einen verdeckten Ermittler an die Seite, den er als Herrn Kaiser, den neuen Verwaltungsleiter des Museums, vorstellen sollte.
Als die beiden in der Nähe von Düsseldorf eintrafen, hatten sie mit vielem gerechnet, nicht aber mit Schröder. Das war der nach dem damals amtierenden Bundeskanzler benannte Yorkshireterrier des anwesenden Rechtsanwalts. Während des Abends sprang der kleine Hund immer wieder auf einen Stuhl, streckte sich, um über den Tisch zu schauen, und legte sein Köpfchen mit den Knopfaugen so schief, als bedenke er jeden geäußerten Satz auf das Genaueste.
Das Gespräch kam schnell auf den Bronzefund von Sangerhausen. Die ursprünglichen Finder hatten 32 000DM dafür erhalten, erfuhr Meller. Ein erster Zwischenhändler soll dann stolze 270 000DM Profit gemacht haben. Um den einzigartigen Fund zu retten, habe Frau B. dann einen Bekannten überzeugt, die Stücke zu kaufen. Ihr ginge es gar nicht darum, etwas zu verdienen; sie wolle nur den Fund für die Öffentlichkeit retten und dafür sorgen, dass ihr Bekannter seine 700 000DM zurückerhalte. Meller müsse verstehen, dass ihr Bekannter besorgt und sehr vorsichtig sei. Er habe eine Heidenangst, alles zu verlieren. Deshalb sei an der Summe auch nicht zu rütteln. Die Sternenscheibe werde nicht billiger, aber auch nicht teurer.
Meller erklärte, dass ein Erwerb der Stücke durch das Land unmöglich sei, dass aber ein Ankauf durch die Kulturstiftung der Länder eine Option sein könnte. Die hatte in den Neunzigern auch den Quedlinburger Domschatz angekauft, obwohl er nach dem Zweiten Weltkrieg illegal in die USA gelangt war. Ein Prozess erschien damals als eine zu unsichere Angelegenheit, weshalb man sich für den unbürokratischen Weg des Ankaufs über die Kulturstiftung entschied.
Hildegard B. nickte, das wäre doch eine Möglichkeit.
»Dazu ist es aber zwingend notwendig, ihre Echtheit zu prüfen«, entgegnete der Museumsdirektor.
Der Anwalt, der zwar betonte, nur als Freund und nicht als Rechtsberater am Tisch zu sitzen, warf ein, das Land Sachsen-Anhalt könne auf sein Eigentumsrecht verzichten, dann wäre der Fund frei handelbar. Meller winkte ab; Herr Kaiser, der neue Verwaltungsleiter des Museums, schüttelte ebenfalls den Kopf. Hildegard B. brachte daraufhin die Schweiz ins Spiel, wo sich die Scheibe ja ohnehin derzeit befände. Meller könne die Sternenscheibe zum Beispiel in Basel begutachten. Auch wenn der Rechtsanwalt davon abriet, war das der Plan, auf den man sich schließlich einigte. Sollte der Besitzer zustimmen, würde die Echtheitsprüfung in einem Hotelzimmer oder Tresorraum einer Bank in Basel durchgeführt. Schröder bellte zweimal– ob vor Glück oder als Warnung, ließ sich nicht abschließend feststellen.
***
Eine Woche später, am 22. Februar 2002, stieg Meller ins Auto und machte sich auf den Weg in die Schweiz. Am nächsten Morgen fand in aller Herrgottsfrüh die Lagebesprechung in der Staatsanwaltschaft statt. Es handelte sich um eine große Runde der Basler Kantonspolizei, auch drei Kommissare vom LKA aus Magdeburg waren dabei. Die Schweiz hatte das deutsche Rechtshilfegesuch rasch positiv beschieden. Alles lief routiniert ab: Der Kampf gegen illegalen Handel mit Raubgut gehörte zum Alltagsgeschäft in Basel. Fotos von Harald Meller wurden verteilt. »Das ist der Gute«, scherzte der leitende Kriminalkommissär Mario Plachesi, »wir wollen ja nachher nicht den Falschen erschießen!«
Dann, noch in der Staatsanwaltschaft, klingelte Mellers Handy. Hildegard B. war dran. Man wolle sich um elf Uhr im Hilton am Aeschengraben treffen. »Auch wenn Sie uns nicht sehen: Wir sind immer in Ihrer Nähe«, sagte Plachesi zum Abschied, »unternehmen Sie nichts Unbedachtes!« Der Museumsdirektor machte sich mit dem gelben Köfferchen in der Hand auf den Weg. Kaum war er in der Hotellobby angekommen, zupfte ihn Hildegard B. von hinten am Ärmel. Sie zog ihn zu einer Wendeltreppe, die ins Untergeschoss führte.
»Haben Sie denn kein Zimmer hier?«
Hildegard B. schüttelte den Kopf. Meller war überrascht. Wusste die Polizei davon? Sah sie, dass es die Treppe hinunterging? Schweren Herzens stieg er hinab, wie Orpheus auf dem Weg zu Eurydike in die Unterwelt. Das war sein Fehler gewesen, das wusste er nun. Aber was hätte er anderes tun sollen?
***
»Egal«, dachte Meller in der Toilette der Hilton-Bar und wusch sich zum dritten Mal die Hände, »die Frage ist doch: Was mache ich jetzt? Ich kann mich ja hier nicht ewig verstecken.« Er ging noch einmal die Optionen durch. Den Vertrag unterzeichnen? Nein. Den beiden die Scheibe entreißen…
Was war das?
Das Handy hatte vibriert.
Sollte … ja!
Tatsächlich, die SMS war raus!
Das Handy signalisierte Empfang. Doch schon war der Balken wieder weg. Egal! Jetzt wusste die Polizei, wo er steckte. Meller trocknete sich die Hände und ging hinaus.
In der Hotelbar war noch alles wie gehabt: der einbeinige Mann, die junge Frau. Immerhin stand nun ein Kellner hinterm Tresen. Auf dem Tisch lag der Vertrag. »Da sind Sie ja endlich«, sagte Frau B., »wir haben uns schon Sorgen gemacht!« Meller solle doch bitte unterschreiben, es müsse doch alles seine Ordnung haben.
Jetzt musste auf Zeit gespielt werden. Wer konnte wissen, wie lange die Polizei brauchen würde, bis sie hier war. Meller nahm das Papier, begann den Vertrag zu studieren. Plötzlich war da Getümmel, die Bar voller Menschen. So schnell, dass er gar nicht registriert hatte, wo die hergekommen waren. Alle trugen Zivil.
»Polizei, kommen Sie bitte mit!«
Hinter jedem der drei hatten sich kräftige Männer postiert. Auch Meller wurde festgenommen. Immerhin blieben ihm die Handschellen erspart, die man dem grauhaarigen Herrn anlegte. Der wirkte geradezu apathisch, er konnte nicht fassen, wie ihm geschah. Auch Hildegard B. stand der Schock ins Gesicht geschrieben. Sie protestierte, sah den Museumsdirektor bestürzt an. Dann wurden sie abgeführt.
In der Staatsanwaltschaft ließ die Polizei Harald Meller wieder frei. Die Festnahme hatte nur verhindern sollen, dass in der Hektik des Zugriffs der Falsche entkam. Als Meller von seiner Verzweiflung erzählte und fragte, wieso man ihn aus den Augen verloren hatte, blickte er in amüsierte Gesichter.
»Sie hätten sich nicht die geringsten Sorgen machen müssen. Wir haben Sie die ganze Zeit observiert.«
»Wie denn das?«
»Haben Sie denn niemanden gesehen?«
»Doch, einen Einbeinigen und eine junge Frau.«
Kriminalkommissär Plachesi nickte grinsend. »Wir betreiben verdeckte Ermittlungen und keine offenen. Sie befanden sich stets in besten Händen.«