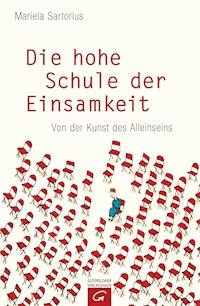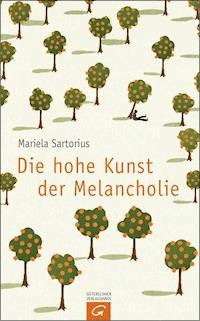
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Auf dem Weg zu mehr Lebenskunst
Die Melancholie ist ein oft verkannter, bittersüßer Hochgenuss für die Feinschmecker der Emotionen. In den oberflächlichen Alltag zwischen aufzehren-dem Stress und dem immerwährenden Zwang zum Spaß bringt sie ein unvergleichliches Gefühl der Tiefe, angereichert durch eine reizvolle Mischung aus Nachdenklichkeit und Sehnsucht. Ein bisschen Wehmut, ein wenig Erinnerung, Offenheit gegenüber neuen Eindrücken gehören auch dazu.
Dieses Loblied auf die Melancholie ist außergewöhnlich und besticht durch eine gelungene Mischung aus Lebenserfahrung und Humor. Wer Melancholie zulässt, wird reich belohnt.
- Was ist Melancholie? Wie zeigt sie sich und wie entsteht sie?
- Die guten Seiten einer vorgeblich negativen Eigenschaft
- Mit einer Galerie der großen Melancholiker dieser Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
I. Melancholie Das verkannte Gefühl
1. Behutsam bitte! Eine vorsichtige Annäherung
Ein hüpfender Mann
Auf einem Waldweg kam mir im letzten Herbst ein Mann entgegen, der sich sonderbar benahm. Er sprang hierhin und dorthin, griff sinnlos in die Luft und stieß hin und wieder seltsame Laute des Bedauerns aus.
Auf gleicher Höhe mit mir hielt er an und sagte: »Ich bin nicht verrückt. Aber meine Großmutter hat immer behauptet, ein Laubblatt in der Luft zu fangen, bringe Glück.« Dann hüpfte er munter weiter seines Weges.
Ich schaute ihm nach, und eine bittersüße Stimmung unvergleichlicher Art legte sich über den Waldweg, die Buchenblätter, den Oktober und mich.
Die Mischung war aber auch allzu reizvoll: Großmutter, Kinderglaube, der Herbst, das Erinnern, Rilkes Zeilen »unruhig wandern, wenn die Blätter treiben«. Es wollte ja gar nicht mehr aufhören!
Melodien mischten sich ein, ein bisschen Chopin, dann das jazzige »Autumn Leaves« und auch »Bunt sind schon die Wälder«, das wir einst im Musikunterricht eher lieblos geplärrt hatten.
Plötzlich roch es zudem noch stark nach Moos und feuchtem Holz, wie es damals roch, als ich mit einer großen Liebe Hand in Hand durch raschelndes Laub schlenderte.
Ich ging weiter. Ein wohliges Schaudern durchrieselte mich. Der Herbstwind fegte jetzt Blätter in Massen herab. Ich brauchte keines zu fangen. Ich war glücklich genug. Willkommen liebe Melancholie!
Wieso »liebe« Melancholie?
Die Melancholie ist ein oft verkannter und verleumdeter Hochgenuss für die Feinschmecker der Emotionen.
In den oberflächlichen Alltag zwischen ätzendem Stress und dem unerbittlichen Zwang zum Spaß bringt diese Abart der Schwermut ein wärmendes Gefühl von Tiefe. Die Mischung aus Nachdenklichkeit und Sehnsucht, Wehmut und Romantik kann ruhig als »lieb« bezeichnet werden. Denn wer sie in ihrer freundlichen Eigenart einmal kennen gelernt hat und sich mit ihrem Wohlwollen verbündete, hat sie nicht selten tatsächlich lieb gewonnen.
Melancholie – und das kann nicht oft genug betont werden! – steht in scharfem Gegensatz zur schweren Krankheit Depression. Deshalb braucht sie keineswegs gemieden, verheimlicht oder unterdrückt zu werden. Sie muss nicht behandelt werden. Sie ist gesund. Man kann sie zulassen und sich ihr hingeben ohne Reue, Scheu und Scham. Und vor allem ohne die Schmerzen der Depression.
Wie eine in beiden Zuständen erfahrene Freundin zusammenfasste: »Melancholie und Freude schließen sich nicht aus. Depression und Freude schon. Das ist der Unterschied.«
Vor dem Abgleiten in die schlimme Krankheit Depression einerseits und in die Sentimentalität, die Larmoyanz und den Kitsch andererseits werden wir in einem späteren Kapitel gewarnt.
Nicht jeder Mensch hat Begabung zur Melancholie. Aber jeder kann sich um sie bemühen: mit Achtsamkeit, Nachdenklichkeit, Geist und einem Minimum an Bildung.
Melancholie darf man sich leisten, stolz und selbstbewusst. Sie ist ein noch zu hebender Schatz, auf den man stößt auf dem Weg zu mehr Lebenskunst.
Aber nicht nur zu dieser Art von Kunst.
Seit Jahrhunderten kommt schließlich kein großer Künstler ohne einen Hang zur Melancholie aus. Zu überwältigender Musik, ergreifenden Gedichten und Geschichten, aber auch zu den atemraubenden Landschaften und romantischen Stimmungen gefeierter Maler gehört offenbar ein Quantum Wehmut.
Der Künstler bedient sich ihrer. Der Denker sowieso. »Warum Denken traurig macht« nennt der Philosoph George Steiner, Professor für Literaturgeschichte an den wichtigsten internationalen Universitäten, sein Buch mit »zehn (möglichen) Gründen«. Er zitiert in seinem Vorwort aus Schellings »Über das Wesen der menschlichen Freiheit« von 1809: »Dies ist die allem endlichen Leben anklebende Traurigkeit, die aber nie zur Wirklichkeit kommt, sondern nur zur ewigen Freude der Überwindung dient. Daher der Schleier der Schwermut, der über die ganze Natur ausgebreitet ist, die tiefe unzerstörliche Melancholie alles Lebens. «
»Wer zu Ende denkt, muss melancholisch werden«, lautet kurz und treffend auch ein bekanntes Bonmot – gerne zitiert von den Denkfaulen, die um ihre gute Laune fürchten. Tiefgründige Gestimmtheit gehört nun mal zu jeder Art von schöpferischer Kraft. Derart angereichert benutzen wir unsere Energie und Kreativität für eventuell anstehende große Probleme; aber genau so wichtig: Wir profitieren von der Melancholie auch bei all den Träumen, Wünschen und Plänen des täglichen Lebens.
Zurück zur »lieben« Melancholie:
Ich habe auf dem Waldweg, als ich dem hüpfenden Mann nachsah, gar nicht anders gekonnt, als diese plötzlich auftretende geballte Stimmung überrascht zu begrüßen, freundschaftlich anzunehmen und mich von ihr schließlich genussreich überwältigen zu lassen.
Und da es keine ungewollte Vergewaltigung war, bot es sich an, die Melancholie »lieb« zu nennen.
Ach!
Es gibt ein kleines Wort, das ich auffallend oft hörte, wenn ich vom Thema dieses Buches berichtete. Und das ging so:
»Worüber schreiben Sie denn?«
»Über die Melancholie.«
– Pause –
»Ach.«
Tja. Ach!
Und das ist dann auch schon die eigentlich beste Art, auf den Begriff Melancholie zu reagieren.
Denn einerseits wird das kleine Wort »ach« ziemlich mutwillig und widersprüchlich bei allen möglichen Gelegenheiten eingesetzt: »Ach wirklich?« »Ach was!« »Ach wie schade!« »Ach wie schön!«
Andererseits taucht es selten im Zusammenhang mit extremen Gefühlen auf. Der Überglückliche sagt nicht »ach«. Der Unglückliche auch nicht. Nicht einmal der Tieftraurige.
Das gedehnte Ach jedoch, im Raum stehend, von Sprechpausen eingerahmt, entfährt am ehesten dem Nachdenklichen, der innehält und reflektiert, dem Sehnsüchtigen, dem Sensiblen. Das Ach als so genannter »gesprächseinleitender Partikel« – wie die Sprachwissenschaftler sagen – ist kein Klagelaut.
Aber es ist gespenstisch oft mit einem Seufzen verbunden.
Und? Was gibt es bei der Melancholie da lang zu seufzen? Ach – es ist ihre alles durchdringende Kraft, die uns im Innersten nicht ohne einen gewissen Schmerz treffen kann. Und es ist zugleich ihre bittersüße Verlockung. Sie ist die große Verführerin zur kleinen Traurigkeit. Schmerz hin oder her.
Und außerdem macht sie einem das Leben schwer bei der Entscheidung, ob man sich ihr nun lustvoll hingeben oder sie vertreiben soll, wenn sie sich nähert – übrigens oft von einer Sekunde auf die andere.
Da wird man ja wohl noch ein wenig seufzen dürfen.
2. »Stimmt mit unserem Kind etwas nicht?«
Ein paar frühe Erfahrungen
»Kühles Treppenhausdas Licht durch blumige Scheibenriecht ganz nach Blau und Grünmit den Fingernan den Lilien entlangeine wie die andereKachel und Klaviervom zweiten Stocküber gebohnertes Holzdraußen die Sonnevoll auf die andere Straßenseitekein Mensch unterwegs.Was wird das Lebendenn nochalles bringen?«
(Mariela Sartorius)
Soweit der Tagebuch-Eintrag eines noch recht jungen Menschen; genauer: eines wohl etwas frühreifen Kindes. Offenbar handelt es sich um einen einsamen Aufenthalt im Treppenhaus eines eleganten Altbaus, vielleicht an einem heißen Sonntagnachmittag, als alle anderen beim Baden sind. Dieses elegische Kind, das sich wenig aus plantschenden und kreischenden Horden macht, lungert stattdessen im elterlichen Haus herum. Nicht unglücklich, aber auch nicht überschäumend glücklich. Und was macht es? Es macht sich Gedanken, es formuliert, es führt Tagebuch.
Melancholiker schreiben für ihr Leben gern.
Früh schon übte auch ich mich in Poesie: Diese Werke, trist bis triefend, wurden vorwiegend anlässlich der Geburtstage nächster Verwandter fabriziert. Über Jahre hinweg boten sich lyrische Ergüsse als preisgünstige Weihnachtsgeschenke für die Familie an. Die geistige Investition fiel leichter als das Opfern des Taschengelds. Da mischte sich früh-merkantiles Denken mit früh-melancholischem Fühlen.
Zudem schienen die Verwandten stets begeistert, ja gerührt (manchmal zu Tränen wegen unterdrückten Lachens). Sie brauchten meine Gedichte (oft in so genannten freien Rhythmen, die sich nicht reimen und umso schneller erstellt sind) weder umzutauschen noch zur Änderungsschneiderin zu bringen. Die Poeme nahmen keinen Platz weg, schmutzten nicht und mussten weder aufgehängt noch aufgestellt werden. Allen Seiten war gedient.
Die Lust am Dichten blieb. Und es ist erstaunlich, dass sich inzwischen ein Skilehrer, eine Fußpflegerin, ein Mechaniker, ein Neurochirurg und eine Immobilienmaklerin, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, als Poeten-Kollegen outeten. Verschämt zuerst, dann zunehmend begeistert. Schließlich gaben sie sogar ihre Süchtigkeit nach dem Dichten zu. Inzwischen tauschen wir ohne Skrupel unsere Ergüsse aus.
Gemeinsamer Nenner: Alle Zeilen zeugen von einem gehörigen Schuss Melancholie. Da schämt sich kein Skilehrer seiner Sehnsucht und keine Managerin ihrer Schwermut. Und weil die Melancholie die Freude nicht ausschließt, sind alle glücklich mit ihrem Tun.
Sich über ein Fotoalbum beugen
Melancholische Momente gab es zur Genüge in meiner Kindheit. Es waren scheinbar alltägliche Situationen. Sie mit starken Empfindungen aufzunehmen oder als banal abzuhaken, sich ihrer später voller Wehmut zu erinnern oder sie alsbald vergessen zu haben – das macht den Unterschied aus zwischen dem Sensibelchen und dem groben Klotz.
Ein empfängliches Kind wird für den Rest seines Lebens ein (auch) nachdenklicher Mensch bleiben. Und der unaufmerksame Rohling? Wenn es gut geht, wird er vielleicht noch lernen, ein wenig süße Tristesse in sein Leben zu lassen.
Zauberische Augenblicke der Kindheit: Ich sitze neben der Großmutter und schaue alte Fotoalben an: Unmögliche Klamotten! Gesichter wie vom fremden Stern! Andere Welten!
»Wer ist denn das? Und wer soll das sein? Ach, und der süße Hund! Lebt er noch?«
»Nein, du Dummerchen, kannst du nicht rechnen? Der ist schon seit vierzig Jahren im Hundehimmel.«
Die alte Frau deutet stattdessen auf eine Art wildlockiges Zigeunerkind mit dünnen braunen Beinen und sagt:
»Das ist deine Mutter in dem Sommer, als meine Mutter starb.«
Sie wird ganz still und klopft noch ein paar Mal mit einem gichtigen Zeigefinger auf das schwarz-weiße Foto mit dem gezackten Rand, blickt vor sich hin und nickt ein wenig. Ich schaue auf ihren Finger und auf die feurigen Augen der kleinen Hexe im geblümten Spielhöschen. Hat sie mit ihrer Großmutter auch alte Fotos angeschaut?
Und wer ist wohl der lustige Junge, der da über eine offenbar selbst gebaute kleine Skischanze springt und dabei fürchterlich grinsen muss? Mit dem wäre man gern befreundet.
»Kindchen, das ist dein Vater.«
Da muss man natürlich sofort aus dem Zimmer laufen und den verdutzten Vater an seinem Schreibtisch heftig umarmen und sich vergewissern, dass dieser Mann mit seinen ersten grauen Haaren hier und jetzt der geliebte Vater ist. Man spürt eine klitzekleine Traurigkeit und weiß nicht warum.
Was sind das für Verbindungen? Was spielt die Zeit für Streiche? Wie hängt alles zusammen? Ich bin froh, dass die Großmutter das Buch zuklappt und mir dringend rät, mich endlich an die Hausaufgaben zu machen.
Das verwirrende Geflecht aus Vergangenheit und Gegenwart, aus Zukunft und Lebenslauf schüchtert ein und begeistert zugleich.
Es ist kein übles Gefühl. Es nagt ein wenig, irgendwas zieht im Brustkorb. Wenn man dem nachgibt, beginnt ein brennendes Gefühl im Rachen, das fatalerweise hochsteigen kann und über die Nase in Richtung Augen drängt. Zu dumm. Wer wird denn weinen? Ohne Anlass. Ohne dass man als Kind den Auslöser, nämlich die Begabung zur Emotionalität, erkennen kann: frühe Melancholie.
Blättern in alten Alben. Das Knistern des Seidenpapiers zwischen den kartonierten Seiten. Staubiger Geruch wie in den Truhen auf dem Dachboden. Stöbern in der Vergangenheit. Heimliche Schatzsuche. Befremdende Rätsel und rätselhafte Entdeckungen. Ist man vielleicht sogar Familiengeheimnissen auf der Spur? Meistens leider nicht. Aber andere Geheimnisse werden nach und nach gelüftet, je älter man wird.
Ist es grausam, alte Fotos anzuschauen? Der Anteil an Melancholie, der dabei am ehesten schmerzt, ist der Blick auf die Vergänglichkeit; das Bedauern aller Alternden oder auch die Reue der unversöhnt Zurückblickenden. Der traurig murmelnde Grundton des Lebens wird eben manchmal übertönt vom lauten Rauschen vorbeiströmender Zeit. Für ein Kind, das sich über ein altes Album beugt, ist es vorerst nur ein ganz sacht melancholisches Staunen.
Peinliches bei Tisch
»Ich hatte Eltern,und die waren gut zu mir.Obwohl ich,dieses neugeborene kleine Tier,sie sicher schreckte.Später leckteich meine Wunden, die der Schuld,gewöhnlich nur an Todestagen.Doch es jagenvoll Ungeduldsich seitdem diese Wiederkehren,und sie lehren,mich endlich einsehen hier:Ich hatte Eltern,und die waren gut zu mir.«
(Mariela Sartorius)
Es war nur eine kleine Episode. Und sie ist mehr als ein halbes Jahrhundert her. Aber sie hat nichts von ihrer Intensität verloren, nichts von ihrer betörenden Kraft:
Obwohl die Mahlzeiten mit den Eltern stets lebhaft, lustig und nicht gerade leise verliefen, obwohl zwischen Streitgesprächen, Nachfragen und Erzählen auch immer wieder die Tischsitten korrigiert wurden, obwohl der Vater nicht umhin konnte, dem genervten Kind die Historie von Rifkabylen zu erläutern oder bundesdeutsche Minister abzufragen, obwohl es also immer laut, angeregt und fröhlich zuging bei Tisch – kam eines Mittags plötzlich ein kleines Schweigen auf.
Mir war nicht aufgefallen, was dem vorangegangen war, weil ich Straßen in meinen Milchreis zog, um die Himbeersauce in die richtigen Bahnen zu leiten – auf jeden Fall war es plötzlich still.
Ich schaute auf. Vater und Mutter hatten zu essen aufgehört und blickten sich an. Die Mutter hatte, wie so oft, ein kleines spöttisches Lächeln um die Mundwinkel, der Vater hatte sich vorgebeugt und Samt in die Augen bekommen. Dann fing er auch noch an, mit geschlossenem Mund zu summen. Eine kleine Melodie, recht nebenbei. Aber offensichtlich mit einiger Inhaltsschwere. Denn sie fiel ein und summte mit. Dann näherten sich auch noch über den Tisch hinweg kurzfristig ihre Hände, obwohl sie noch Besteck darin hielten. Zumindest die kleinen Finger berührten sich. Und ein Lächeln war zwischen ihnen – nicht auszuhalten! Zumindest für mich!
Es war nicht die Ausgeschlossenheit, die ich empfand, es war auch nicht die Frage, was denn da los sei und auf die ich keine Antwort wusste. Aber es war ein Augenblick größter, wenn auch unverstandener Übereinstimmung zwischen uns allen. Eine zugleich vibrierende und wohlige Wärme hatte sich ausgebreitet; ein großes Glücklich-Sein. Und dann (obwohl oder weil?) bekam ich plötzlich ein wenig Nässe in die Augen, die ich mit der Serviette wegwischte.
Der Zauber war sofort verflogen. Die beiden, irritiert und schuldbewusst, kurzfristig in die Romantik junger Liebender abgedriftet, schalteten sofort den pragmatischen Rückwärtsgang ins reale Leben ein, hießen mich, gefälligst weiter zu essen und kehrten, wenn auch mit amüsiertem Unterton, zum Nachtisch zurück.
Wann immer ich heute diese Melodie höre, die einst ein recht populärer Schlager war, stimmt sie mich melancholisch. Die Eltern sind schon lange tot, das Lied eigentlich auch. Aber ich habe mir eine alte Aufnahme davon besorgt. In ihr höre ich Erinnerung und frühes Unverständnis heraus, eines der vielen sowohl wunderbaren als auch wehmütigen Rätsel der Kindheit. Sie vermengen sich heute mit späteren Erkenntnissen, mit Nachdenken und Analysieren. Es ist eine grandiose Mischung. Ich kann das Lied übrigens auf dem Klavier spielen. Ohne Not. Und auch ohne Noten. Wenn niemand zuhört, leiste ich mir diesen melancholischen Kick.
Staunen und Verwirrung früher Jahre. Steckte hinter allem stets noch etwas anderes? Wann war Verwunderung angesagt, wann Bestürzung? Vage und ein bisschen unheimlich waberte am Rand des kindlichen Bewusstseins eine Ahnung von Wirklichkeit und Wehmut und von mangelnden Unterscheidungsmöglichkeiten.
Kleine stolze Außenseiter
»Warum sind alle hervorragenden Männer, ob Philosophen, Staatsmänner, Dichter oder Künstler, offenbar Melancholiker gewesen?«
(Aristoteles zugeschrieben, vermutlich aber von seinem Schüler Theophrast verfasst)
Eine erfahrene Lehrerin berichtet: Da gibt es zum Beispiel die Schülerin, die nicht gemobbt wird und dennoch eine Außenseiterin bleibt. Sie hat alle Voraussetzungen, als Klassensprecherin, als Anführerin, als Vorbild in Fragen der Klamotten, der Jungensanmache, des Sports und der Coolness aufzutreten. Aber sie steht abseits.
Und warum? Weil sie sich absondert. Weil sie den Run auf Fun und den Zwang zum Spaß nicht mitmacht. Sie will keiner Clique angehören. Sie hat eine Freundin, die nicht in dieselbe Klasse geht, und zwei Freunde, die andere Schulen besuchen. Sie hält sich lieber am Rande auf als mittendrin. Wenn sie nicht gerade beobachtet und zuhört, neigt sie dazu, ein wenig verträumt oder gar abwesend zu schauen: entweder durch die anderen hindurch oder am liebsten gleich in die Weite, zu fernen Horizonten und in imaginäre Welten. Ihre Noten sind übrigens gut.
Mit so einer ist gerade noch gut Kirschen essen, aber nicht immer gut Spaß haben und kaum je gut Party machen.
Dann gibt es den Schüler, der lieber mit den Freunden seiner Eltern zusammen ist als mit Gleichaltrigen. Er liest viel und musiziert gern, vor allem allein. Er macht lange Spaziergänge mit dem Hund. Er ist keineswegs altklug, kein Nerd und kein beflissener Streber. Er schaut nicht arrogant auf seine Mitschüler herab – aber sie langweilen ihn mit ihren immer gleichen Themen zwischen Lehrerschelte und Elektronik, Fußball und Mädchen. Bald wird er allerdings erkennen, dass die Gespräche der Erwachsenen auch nicht gänzlich anders sind.
Aber bis dahin gilt er bei Eltern, Pädagogen, im schlimmsten Fall beim Psychotherapeuten als schwieriges Kind. Die wenigsten erkennen, dass dieser Junge keineswegs auf dem Weg in eine gefährliche Depression ist – sondern nur frühzeitig eine Begabung zur Melancholie entwickelt hat. Solche Kinder werden nicht in Ruhe gelassen. Sie werden von den Eltern zum Fußball angestachelt oder zum Golfen mitgenommen, zum Ballett angemeldet oder zum tobenden Kindergeburtstag geschickt.
Vielleicht wird der stille Junge einmal ein herausragender Künstler oder Kurator, ein Abenteurer oder Artdirector. Und aus dem Mädchen eine Modeschöpferin, Pädagogin oder Gorillaforscherin. Popmusiker könnten beide ganz gut werden. Nur Berufe wie Banker oder Baulöwe, Spekulant oder Spitzenpolitiker dürften sie weniger interessieren.
Auffallend viele Geistesgrößen und künstlerische Genies schildern exakt eine Jugend, wie sie hier beschrieben ist. Und sie erinnern sich ihrer damaligen Außenseiterrolle nicht mit Bedauern, sondern mit Stolz und auch Vergnügen.
Im Erziehungssystem von heute ist Melancholie bei Kindern nicht angesagt. Die kleinen Persönlichkeiten, die dem Zeitgeist nicht entsprechen (wollen), werden sorgenvoll beobachtet und schnell ausgegrenzt.
Es ist aber auch allzu verzwickt: Hyperaktiv sollen sie nicht sein, zu verträumt auch nicht. Zappelphilipp und Transuse werden zum Arzt gezerrt oder gleich mit Medikamenten auf ein erträgliches, spießiges Mittelmaß eingestellt.
Derweil haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die jungen Sensiblen, die für die guten wie die schlechten Außenreize besonders empfänglich sind, höchst dankbar und vielversprechend reagieren – solange die Reize positiv sind. Sie entwickeln sich dann tatsächlich sozial umgänglicher und geistig leistungsfähiger als der ausgelassene Wildfang und der robuste Haudrauf.
Frühe Jugend, Pubertät, Gymnasialzeit und Ausbildungsjahre können bekanntlich Hoch-Zeiten mürrischer Melancholie sein. Sie vergehen ansonsten mit den üblichen Extremen zwischen Tobsuchtsanfällen, Lethargie, Aufsässigkeit und Überschwang, schrillen Lachkrämpfen und weinerlichem Schweigen.
Auch der Melancholie muss man Zeit lassen, erwachsen zu werden.
Und dann eines Tages nach dem zugegeben ziemlich langsamen Eintreten einer gewissen Reife ändert sich das, was bisher als Melancholie nicht erkannt und deshalb unüberlegt oder trotzig hingenommen worden ist.
Der Mensch beginnt nachzudenken. Nicht nur über die Fragen, was anziehen?, was wählen?, warum Akne?, sondern auch über die Auswüchse der eigenen Gefühlswelt; eine Welt, die dermaßen verwirrend zu sein scheint, dass es an der Zeit ist, Ordnung hineinzubringen. Der Mensch fängt also an, seine Melancholie zu analysieren. Und sein Vergnügen beginnt.
Wer nunmehr nachdenklich bis tiefsinnig wird, beim Wein oder beim Spargelschälen, neben dem nörgelnden Freund im Auto auf einer ermüdenden Fahrt oder neben der jungen Ehefrau im frühmorgens reservierten Liegestuhl, beim Reifenwechsel, in der Schlange vor der Kasse des Großmarkts, spätabends an einem Tresen, beim Wässern des Gartens oder vor dem Badspiegel – wer innehält und sich für Momente darüber klar wird, wie das Leben abläuft und warum ihn das überhaupt etwas angeht und wieso ihn das dummerweise auch irgendwie traurig macht – dem bleiben zwei Möglichkeiten: Entweder man wird umgehend und ohne Zögern oder Abwehr melancholisch. Oder man flüchtet zur Fernbedienung, zum Shoppen oder zum Sudoku. Hauptsache Ablenkung.
Hiermit schließen wir das Kapitel über den Werdegang des Melancholikers ab: Aus dem traurigen Anfänger in Sachen Melancholie ist der sehnsüchtige Schüler geworden. Und vielleicht, mit ein bisschen gutem Willen, kann er eines Tages ein genießender Meister-Melancholiker sein.
3. Mit der Wehmut kokettieren
Schlendern, räkeln, lila Klamotten
»Driften und dümpeln und wabern und wehn federleicht vogelfrei flüchtig doch sehn süchtig in Sturm oder Sog zu vergehn.«
(Mariela Sartorius)
Ja, was denn nun?
Heranwachsende Melancholiker wollen eigentlich leicht und frei sein, schämen sich aber dennoch nicht ihrer Sehnsüchte. Die kindlichen Empfindungsreichen, die nicht wussten, wie ihnen geschieht, werden sich nunmehr ihrer Schwermut bewusst.
Nicht ohne Koketterie werden die gefühligen Kaprizen zumindest körpersprachlich hinausposaunt. Oder, bei den geübteren Selbstdarstellern, mit verschleiertem Blick und leiser, doch tapferer Stimme scheinbar verheimlicht und gerade deshalb besonders betont. Der alte Trick funktioniert auch der gepeinigten und im Ungewissen gelassenen Mitwelt gegenüber: verbal leugnen, mit Gestik und Mimik aber bestätigen. Schuldbewusste Mütter oder ratlose Partner bleiben am Wegrand zurück.
»Ist was? Sag doch! Hast du was?«
»Nein, nein«, murmelt der Trübsinnige und wendet sich ab.
Besonderheit? Außenseiterrolle? Emotionale Elite? Noch hat man sich nicht entschieden.
Gerne würde man jetzt Schuldige für die kippende Laune finden (ungerechte Mathematiklehrer, eiskalte Kernkraftwerkbetreiber, erfolgreiche Zehn-Kilo-Abnehmerinnen, Theologiestudenten, die fabelhaft aussehen, sich aber verweigern), ist aber unsicher, ob es alle zusammen sind oder niemand davon.
Jedenfalls beginnen sensible Desperados nachzudenken über Gründe und Anlässe ihrer Tristesse. Und nicht zuletzt über die Wirkung auf die Umwelt. Die Pose wird wichtig. Junge Melancholiker tragen ihr unbestimmtes Weh und den umflorten Blick wie das Markenzeichen auf dem Polohemd. Bei manchen alten Stümpern, die ihre Melancholie jahrelang ohne jegliches Vergnügen mit sich schleppen, kippen Outfit und Haltung indessen oft ins Mürrische, was wenig attraktiv ist und meist in nikotinangereichertem Körpergeruch und ausgetretetem Schuhwerk endet.
Auf die Farbwahl von Kleidung, Auto oder Tapete ist nur bedingt Verlass, wenn es darum geht, einen Melancholiker dahinter zu vermuten. Leider sprechen da Mode und Zeitgeist mit. Dennoch hält Schwarz die Spitzenposition: Rappen ziehen den Katafalk. Dunkles ist nach wie vor bei Beerdigungen angesagt, und die Chansonnieren der Tristesse wie Juliette Gréco wären niemals in Pink dahergekommen. Die eigentlichen Tönungen der Betrübten aber scheinen Violett und Grau zu sein; das eine steht für laszive Anmut oder morbiden Unmut, das andere für Trübsinn und Entsagung. Es soll sogar Leute geben, die beides mischen.
Was verbinden Sie mit dem Wort Melancholie?, fragte ich im Bekanntenkreis:
Marcel Proust und sein Buch »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«,Dürer und seine Kupferstich-Abbildungen der Melancholie,die Medizin und ihre bis ins Mittelalter hinein übliche Erklärung von Schwarzer Galle,das kannten sie alle. Aber manche wurden persönlicher: Vom knappen »Alkohol, was sonst?« über verächtliches »lila Klamotten« oder »das ist was für blasierte Snobs« arbeiteten sich die Antworten langsam in intellektuellere Höhen hinauf, um schließlich bei nicht wenigen der Befragten beim Begriff »Nachdenken« vorerst zu enden.
Tatsächlich bricht die Melancholie ja selten ohne Grund oder Anlass in das sonst oft oberflächliche, fröhliche und geschäftige Leben ein.