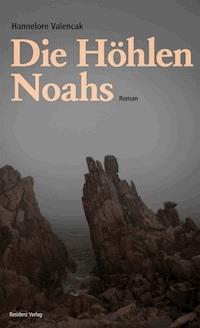
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der nächste Weltuntergang kommt bestimmt. Seien Sie vorbereitet: Lesen Sie dieses Buch! Das Ende der Welt stellt einen vor keine Fragen. Aber was tun, wenn man es überlebt? So wie Martina und ihr kleiner Bruder, die von einem jungen Unbekannten aus dem Feuerinferno gerettet werden. Sie treffen auf andere Überlebende, einen Alten und seine Enkelin, und flüchten gemeinsam in einen Talkessel. Endet das Leben hier oder beginnt es neu? Die Welt jenseits der Berge ist tot, verbrannt, unter giftigem Staub begraben. Was nach der Katastrophe übrig geblieben ist, reicht gerade einmal für ein Leben auf kleinster Flamme, für eine Höhlenexistenz. Sie richten sich ein, sie warten - aber worauf? Eine rettende Arche ist nicht in Sicht. Zumindest der Alte glaubt nicht an die Zukunft. Ein Kampf beginnt - ums Überleben, um die Hoffnung, darum, Mensch zu sein. In düster leuchtenden Szenen stürzt uns Hannelore Valencak in eine Welt nach dem Ende der Welt: radikaler noch als Marlen Haushofers "Die Wand" und schonungsloser als Cormac McCarthys "Die Straße".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Valencak Die Höhlen Noahs
Hannelore Valencak
Die Höhlen Noahs
Roman
Residenz Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2012 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4281-3
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1582-4
WENN Martina hungrig war, mußte sie etwas zu essen haben, und sie wählte zumeist den Weg, der ohne Umstände zum Ziel führte: Sie stahl, was sie brauchte. Dies wurde immer schwieriger, denn die anderen hatten herausgefunden, daß mehr Fleisch verschwand, als sie gemeinsam verbrauchten, und daß Martina wohlgenährt aussah. Die Verstecke wurden immer besser und immer unzugänglicher angelegt. Martina mußte manchmal tagelang suchen, bis sie mit der sicheren Witterung eines Tieres darauf stieß.
Dieser Zustand war zwar anstrengend, doch brachte er auch Vorteile mit sich. Da es zwischen ihr und den anderen allmählich zu einem regelrechten Kleinkrieg gekommen war, brauchte sie auf niemand mehr Rücksicht zu nehmen. Auch Gewissensbisse hatte sie nicht mehr. Aus Diebstahl war offener Raub geworden.
Das Stück Räucherfleisch, auf das sie es abgesehen hatte, entdeckte sie in einem Seitengang der Höhle, dicht unterhalb der Deckenwölbung. Es war in eine Ausbuchtung hineingeschoben wie in eine offene Lade und mit Lattichblättern gegen die Nässe geschützt. Martina wußte, daß es für das Nachtmahl bestimmt war, doch bis zum Abend war es noch lang. Und durch fünf geteilt, ergab es für den einzelnen wenig genug. Besser war, es jetzt und allein zu haben.
Sie reckte sich und preßte sich gegen den Felsen, der von schleimiger Nässe überzogen war und sich mit nadelscharfen Auswüchsen in die Haut bohrte. Ihre Finger fanden Halt in einer Mulde, und ihre Knie ertasteten winzige Vorsprünge. Sie zog sich empor und riß das Fleisch mit einem Ruck zur Erde. Ihre Handflächen waren aufgeschunden, und ihre Knie bluteten, aber die Beute gehörte ihr. Sie bückte sich danach und schob sie unter ihren Arm. Einen Augenblick hatte sie gemeint, Stimmen zu hören. Rasch löschte sie den Span aus, der ihr Licht gegeben hatte, und bemühte sich, flach und leise zu atmen. Nach einer Weile kroch sie auf Händen und Füßen der Helligkeit zu und spähte in die schwach erleuchtete Wohnhöhle. Dort war niemand zu sehen.
Da tat sie zwei, drei große Schritte und war draußen im Freien, wo ihr keiner mehr die Beute abjagen konnte. Ein paar verstreute Lattichblätter würden verraten, was sie getan hatte, doch kümmerte sie sich nicht darum. Auch dies war ein Vorteil des offenen Krieges: Er enthob sie der Mühe, die Spuren verübter Untaten zu tilgen.
Sie floh über die Grashänge zum See hinunter, bis sie sich außer Gefahr wußte. Als sie in den Gürtel der Krüppelkiefern eintauchte, sah sie noch einmal um sich und ging langsamer weiter. Ihre Hände befingerten das Stück Fleisch, das schon körperwarm war und sich wunderbar straff anfühlte. Jetzt, da ihr die Sättigung sicher war, machte es ihr Vergnügen, sie noch eine Weile zu verzögern.
Es war Frühsommer und der Almgrund von tiefgelben Aurikeln übersät. Ein paar Wochen noch, dann welkten sie wieder, dann hörte das Leben wieder auf, ein klein wenig schön zu sein.
Vom Seeufer zogen sich Matten weit hinauf an die Felsgrenze und wurden dort wie Brandung zurückgeworfen. Das Gebirge war ein starrer Ring, der seit Jahrtausenden hielt und sich an keiner Stelle hatte sprengen lassen.
Über dem Felsen, den sie den Letzten Krieger nannten, ging groß und glühend die Sonne unter. Dabei übergoss sich der Himmel mit einem schrecklichen Rot. Es schien stofflich zu sein, dicht und stickig wie Brandrauch, und erweckte unwillkürlich Angst, es atmen zu müssen. Martina wußte gut, seit welchen Tagen es diese Sonnenuntergänge gab, und immer kam mit diesem Rot die Erinnerung zurück, wie sehr sie sich auch mühte, davon frei zu werden.
Mit dem Westwind jagten Wolken über die Grate und bäumten sich steil auf wie eine Herde, die vor dem Abgrund scheut. Am Kesselgrund war kein Wind zu spüren, darum wirkten die Wolken wie etwas Lebendiges, das sich aus eigener Kraft bewegt, das Angst hat und sich anstemmt und weitergewälzt wird, über den Rand der Felsen hinaus. In solchen Augenblicken war es gut, etwas in den Händen zu haben. Wenn es auch nur das Fleisch eines toten Tieres war, das Martina umklammerte, so bannte es doch die Geister dieser roten Stunde und hielt sie von der Erde ab.
Sie erreichte das Seeufer, überquerte mit einem langen Schritt einen versumpften Zufluß und schritt über die schmatzenden Moospolster zu einer sandigen Bucht hinüber, an die fester und grasiger Boden grenzte. Sie raffte den Rock und setzte den Fuß in das Wasser. Die Kälte biß heftig zu, doch Martina ließ sich trotzdem tiefer gleiten und watete zu einem Felsbrocken hinüber, der ein Stück vom Ufer entfernt im Flachwasser lag.
Sie erkletterte den Felsen und zog sich den Kittel über die Beine. Ein wohliges Gefühl durchströmte sie, und sie schlug mit einem kehligen Auflachen die Zähne in das Fleisch. Es war hart wie Holz und hing in zähen Sehnen am Knochen fest, aber Martinas Kiefer waren stark. Sie waren darin geübt, das harte Rauchfleisch von Schafen und Ziegen zu zerbeißen.
Nun gab sie sich ganz der einfachen Freude des Essens hin. Indessen verblaßte das Rot am Himmel mehr und mehr, bis die Wände wieder kreidig in der Dämmerung standen. Martinas Hunger hatte längst nachgelassen, doch sie aß aus Freude am Überfluß weiter, bis sie zu müde zum Kauen war und ihre Wangenmuskeln schmerzten. Dann warf sie die halb abgenagte Keule weit hinaus in das tiefe Wasser, von wo keiner sie zurückholen konnte. Das Verschwenden war eine Lust, trotz der Not, die sie litt. Sie hatte gestern gehungert und würde es morgen wieder tun. Was kümmerte sie das! Jetzt war sie satt und unangreifbar. Was sie sich geraubt hatte, gehörte endgültig ihr, war in ihr. Niemand konnte es ihr mehr entreißen. Sie zog sich an das Ufer zurück und legte sich ins Gras. Hier, in dieser windstillen Mulde, die noch warm von der Sonne war, fühlte sie sich wohl. Alles war gut, außer daß sie allein war, sie, eine junge, durch und durch lebendige Frau. Sie hatte keinen Gefährten, der ihre Zufriedenheit teilte, der an ihrer Seite lag und ihr den Arm unter den Nacken schob. Er hätte nichts reden und nichts tun müssen. Seine Nähe wäre genug gewesen. Sie hätte die Wange an seine Brust geschmiegt und wäre eingeschlafen.
Es hatte eine Zeit gegeben, in der sie nicht allein gewesen war. Seither waren Jahre vergangen. Der Mann, den sie mit ihrer ganzen Kraft geliebt hatte, lebte nicht mehr. Er war erschlagen worden. Seit damals fehlte etwas in der Welt, das durch nichts mehr zu ersetzen war. Es gab die Lust des Raubes, es gab die Stillung von Hunger. Der Körper war in zartes Gras gebettet, und dem Auge bot sich Schönheit dar. Aber alles blieb ohne Wärme und Glanz.
Mit einem Laut wie ein Aufweinen schmiegte sie ihren Körper an den harten, von Baumwurzeln und Steinen durchsetzten Boden.
Lange blieb sie so liegen, die Arme ausgebreitet, das Gesicht im Gras. Die Bergkräuter rochen würzig und stark. Ihr Duft betäubte ein wenig die Sinne und half einzuschlafen.
Martina war schon zwischen Wachen und Traum, als sie oben bei den Bäumen ein Lachen hörte. Sie fuhr empor und packte einen Stein. Hinter einer Kiefer trat ein Mädchen hervor und kam mit aufreizender Furchtlosigkeit näher. Es war in dem Alter, da es die ersten Zeichen der Reife zu zeigen begann, und es trug die Häßlichkeit dieser Jahre linkisch, doch unbekümmert zur Schau.
Sie starrte Martina neugierig in das verweinte Gesicht. Ihr kleiner, dünner Mund zuckte vor Heiterkeit, und in ihren Augen saß ein schadenfrohes Licht.
»Luise! Was suchst du hier?« rief Martina.
»Ein Stück vom Fleisch, das du uns gestohlen hast.«
Martina deutete mit dem Kinn zum Wasser. »Wenn die Fische es dir zurückgeben, kannst du es dir von dort holen.«
Luise stürzte sich auf Martina und schrie: »Ersticken sollst du daran! Es war unser letztes Fleisch, und du fütterst die Fische damit.«
Martina wehrte sich ein wenig. Es machte ihr keine Mühe, das leichte Geschöpf von sich fortzustoßen und mit einem einzigen drohenden Ausholen ihres Armes zu zähmen.
Luise kehrte sich ab. Die Enttäuschung trieb ihr Tränen in die Augen. Sie kauerte sich in das Gras und verbarg das Gesicht in der Armbeuge.
»Nicht weinen«, sagte Martina, rasch besänftigt. »Das nächste Mal werde ich dir ein Stück übriglassen.«
Luise biß an ihren Fingerknöcheln und starrte verzweifelt zu Boden. »Wenn die Geiß heute ein Böcklein wirft, dann schlachten wir morgen nicht. Wer weiß, wann wir dann wieder Fleisch in die Suppe bekommen.«
»Nun ja«, sagte Martina ungerührt, »wenn es aber ein Weibchen wird, dann gibt es ein Fest, und du wirst den Bauch voll haben mit Blutkuchen und gesottenen Innereien. Heute bin ich satt und morgen du.«
Luise furchte sorgenvoll die Stirn. »Wenn es nur kein Kümmerer wird, sonst heißt es drei Tage lang fasten.« Dies sprach sie leise und hastig aus wie etwas, worüber man eigentlich nicht reden soll.
»Wir werden ja sehen«, erwiderte Martina. Sie war zu vollgegessen, um sich vor drei Fasttagen zu fürchten.
»Ich habe Hunger«, begehrte Luise von neuem auf. Wahrscheinlich wäre sie leichter zu beruhigen gewesen, wenn sie nicht gewußt hätte, daß ein Stück Räucherfleisch draußen im See lag.
Martina blieb stumm und mitleidlos. Doch als Luise gar nicht aufhörte, ihr anklagend in das Gesicht zu schauen, sagte sie schroff: »Weißt du was? Ich wäre geradezu froh, wenn nur noch Böcklein zur Welt kämen.«
»Was sagst du?«
»Ja, ich würde mich freuen. Wenn wir nichts mehr zu essen haben, muß uns der Alte endlich über die Berge führen.«
Luise riß die Augen auf. »Zu den Geistern der Leere?« flüsterte sie verschreckt.
»Nein!« schrie Martina sie an, »zu Früchten, zu Honig und zu Brot. Zu Häusern, in denen es warm ist. Zu Menschen, die nicht um das letzte Stück Fleisch raufen.«
Die Kleine horchte mit offenem Mund. Sie verstand kaum ein Wort, trotzdem war sie überwältigt.
Martina sagte: »Der Alte lügt. Hinter den Bergen ist die Welt nicht zu Ende. Dort fängt sie erst an.«
Luises Hände zitterten. Sie tappten in das Gras und fanden ein Stück Kiefernborke, das sich zwischen den Handtellern pressen ließ, bis es weh tat. Das beruhigte und gab Halt in einer Welt, die auf einmal aus den Fugen geriet. Bisher waren ihre Grenzen eng und greifbar gewesen. Sie hatte bei einer Felswand begonnen und bei einer anderen geendet. Jetzt weitete sie sich ganz unvorstellbar aus.
Über dem Gebirgskessel ging der Mond auf. Groß und rein stieg er hinter der Wilden Spitze empor und erleuchtete den Himmel über der fahlen Steinlandschaft zwischen den Pfeilern der Wilden Spitze, des Einsamen Königs, des Letzten Kriegers und der weißen, kühl schimmernden Toten Frau.
Martina hob einen flachen Stein aus dem Uferwasser und schleuderte ihn über den See. Klein und dunkel tanzte er über die glasige Fläche und wurde erst weit draußen eins mit der Schwärze. Wo er versunken war, löste sich das Spiegelbild des Mondes in schaukelnde Ringe auf, die sich erst allmählich wieder zu einem unversehrten Bild zusammenfügten. Für die Dauer dieses Lichterspiels stand Martina am Ufer und schaute ihm zu. Dann kam sie zu Luise zurück und packte sie am Arm. »Du! Vergiß aber, was ich geredet habe, und sage ja nichts dem Alten.«
»Warum nicht?« fragte Luise, noch immer ganz verstört.
Martina starrte zu Boden und zog den Kopf zwischen die Schultern. »Weil ich Angst vor ihm habe, verstehst du das nicht? Nein, wie könntest du das auch verstehen? Zu dir ist er immer gut gewesen. Du weißt nicht, wozu er imstande ist. Aber ich weiß es. Ich habe ihn kennengelernt. Wenn du ihm erzählst, was ich dir jetzt gesagt habe, will ich lieber in den See gehen als ihm noch einmal begegnen.« In ihrer Stimme mischten sich Unterwürfigkeit und Selbstverhöhnung zu einem seltsam bitteren Klang. Dann richtete sie sich auf, ihr Zorn brach durch. »Aber vorher würde ich es dir heimzahlen!« schrie sie.
Luise wich zurück und würgte an einer Entgegnung. Es sah aus, als hätte sie etwas Bitteres im Mund und dürfe es nicht von sich geben. Martina griff sich an die Stirn und seufzte tief. Mit einem Kopfschütteln versank sie wieder in Schweigen. Nach einer Weile setzte sie fast demütig hinzu: »Bitte, verrate mich nicht. Vergiß es wieder. Glaub mir kein Wort.«
Luise war nicht imstande, etwas zu sagen oder zu tun. Im Grunde glaubte sie Martina wirklich nicht, aber vergessen konnte sie es nicht mehr.
ALS sie zur Höhle zurückgingen, war es sehr spät. Die Nacht war klar und voller Lichtkälte, die man mehr im Herzen spürte als auf der Haut. Verkrüppelte Bäume standen links und rechts vom Weg. Luise und Martina stiegen über die taunassen Hänge höher. Die Stauden des Weißen Germer standen über die Matten verstreut und streiften sie manchmal mit fleischigen Blättern. Es war eine unheimliche Berührung, kalt und voller Tücke. Die Ziegen und Schafe ließen das Giftkraut stehen, so daß es zu großer Höhe emporwuchs und sich von Jahr zu Jahr vermehrte. Die Menschen rissen alljährlich große Mengen davon aus dem Boden und verbrannten es; doch es ließ sich nicht ausrotten. Wo sie es antrafen, zertraten sie es unter ihren nackten Sohlen. Das Knirschen der derben, saftgefüllten Stengel war ein unheimlicher Ton – beinahe ein erstickter Schrei.
Endlich erreichten sie die Höhle. Auf die Wände des Eingangs, der als ein schräger, mannsbreiter Spalt in den Berg führte, fiel zuckendes Licht. Wie jede Nacht brannte das Feuer auf dem grob aus Steinplatten aufgebauten Herd, und durch eine Öffnung in der Felswand zog der Rauch ab, so daß die Luft zwar stickig, doch erträglich war. Dumpfe Wärme verbreitete anspruchslose Behaglichkeit.
Der Boden der Höhle war zum Teil mit Fellen bedeckt, und längs der Wand waren plumpe Gestelle aufgebaut, darauf lagen grobwollene, mit Heu gefüllte Deckbetten. An den Herd waren zwei einfache Webstühle herangerückt, von welchen der eine leer stand, während auf dem zweiten ein angefangenes Stück Gewebe hing, die niederhängenden Längsfäden durch Steine gespannt, der Querfaden um ein beinernes Schiffchen gewickelt. Aber niemand war jetzt an der Arbeit.
Um einen Tisch, der aus entrindeten Kiefernstämmen zusammengefügt war, saßen drei Menschen: ein sehr alter Mann mit hellen, starken Augen, eine Frau mit einem großen, leeren Magdgesicht und ein Knabe, ein wenig älter als Luise. Vor ihnen auf dem Tisch lag, in vier Teile zerschnitten, der Rest eines Käselaibs.
Der Kessel, welcher sonst dampfend über dem Feuer zu hängen pflegte, war leer, und der Geruch der kochenden Speise fehlte in der Wärme wie die Würze einem Gericht. Der Höhlenraum wirkte leerer und kälter als in anderen Nächten.
Es gab kein Fleisch zum Nachtmahl. Martina hatte es gegessen. Als Martina und Luise eintraten, stieß der Knabe sein Stück Käse von sich und sprang auf. Aller Blicke kehrten sich Martina zu. Jetzt ist es so weit, dachte sie und rang um jenen Zustand innerer Verhärtung, der ihr stets half, solche Augenblicke zu überstehen. Was waren schon Schläge? Ein unbedeutender Schmerz, solange man ihm nur den Körper überließ.
Der Knabe wollte mit geballten Fäusten auf sie zustürzen. Doch der Alte rief ihn zurück. »Georg! Laß sie in Ruhe. Das ist meine Sache.«
Er stand langsam auf und ging auf Martina zu. Unwillkürlich hob sie den Arm zur Abwehr und wich Schritt für Schritt zurück. Der Alte rührte sie nicht an, er sagte nur: »Wir sollten dich an einen Baum binden, damit du uns nichts mehr stehlen kannst.«
»Ja, an einen Baum binden!« bekräftigte die helle, zornige Stimme des Knaben.
Martina duckte sich. Schlagt mich doch, dachte sie. Schlagt alle zu! Ihr seid hungrig, und ich habe Fleisch gegessen. Ihr könnt es nicht mehr aus mir herausschlagen.
Der Alte schaute sie wortlos an. Das ertrug sie nicht. Eine Angst von völlig anderer Art als die Angst vor Schlägen stieg in ihr auf und legte ihr Denken lahm. Der Alte wandte sich von ihr ab und sagte: »Dieses eine Mal soll es dir geschenkt sein, Martina.« Es war, als hätte er einen Bann von ihr genommen. Sie atmete auf und rettete sich in ein törichtes Lachen.
Nun winkte der Alte Luise an seine Seite und legte den Arm um sie. »Morgen schlachten wir ein Tier und geben Herz und Zunge dir ganz allein.« Mit einer Handbewegung bedeutete er ihr, ihm zu folgen.
Sie traten in einen Seitenstollen der Höhle ein, der als Stall diente und scharf nach Schafen und Ziegen roch. In einer Ecke lag die ausgeschundene Muttergeiß und schlief vor Erschöpfung. An ihrer Seite stand ein schönes, kräftiges Kitz und schaute den Eintretenden mit blinden Augen entgegen. Es trug einen dunklen Haarfleck auf der Stirn, als wäre es von unsichtbaren Mächten ausgesucht und gezeichnet worden. Sein Fell war feucht und kraus und wärmte es noch nicht.
»Ein Weibchen«, sagte Luise und griff sich ans Herz.
»Ja«, sagte der Alte, »ein gesundes Tier. Komm und sprich dein Gebet.«
Daraufhin ging mit Luise eine seltsame Wandlung vor. Ihr mageres Gesicht wurde ernst und schön, sie legte dem Kitz die Hände auf, neigte den Kopf tief auf die Brust und sagte: »Geister des Hungers, wir danken euch. Ihr laßt uns das Fleisch, ihr laßt uns Käse und Milch. Verschont uns auch morgen mit eurem Zorn. Wir sind hungrig und arm. Wir haben nichts Böses getan.«
Das junge Tier regte sich unter ihren Händen und antwortete mit einem dünnen, klagenden Laut. Über die nassen Wände, über die Futterraufen und den streubedeckten Boden zuckte der Schein des Talglichts hin.
Martina hatte sich abseits gestellt und kein Wort gesprochen. Ihre Augen waren dunkel vor Schmerz, und ihr Gesicht war wie aus Stein. Noch ehe Luise ihr Gebet vollendet hatte, verließ sie den Stall und den Wohnraum und ging hinaus, um in dieser Nacht unter freiem Himmel zu schlafen.
DER nächste Tag zog schwül und dunstig hinter der Wilden Spitze herauf. Die Sonne war graugelb mit wässerigem Rand, und auf dem Gras lag kein Tau. Es war ein Morgen, der schlechtes Wetter verhieß.
Luise erwachte mit dem Gefühl, als ob sich etwas in ihrem Leben verändert hätte. Sie verspürte eine Unruhe, von der sie noch nicht wußte, ob sie Freude war oder Angst. Widerwillig ertrug sie die stickigen Decken auf ihrem Körper und roch im Halbschlaf das schimmelige Heu. Es störte sie mehr als sonst.
Sie erhob sich mit schweren Gliedern, dehnte und reckte sich und schaute sich benommen in der Höhle um. Niemand war da außer Georg, der tief im Heu vergraben lag und auf eine ablehnende, in sich gekehrte Weise schlief. Auf dem Tisch stand ein Topf Milch. Sie trank daraus, freudlos, obwohl ein Festtag war. Erst als sie sich viel frisches Wasser über das Gesicht geschüttet hatte, fühlte sie sich besser.
Sie ging ein Stück in den unbewohnten Teil der Höhle hinein und kam mit einem Spaten zurück, der vom häufigen Gebrauch schartig war und locker am Stiel saß. Dann trat sie ins Freie und lief über die welligen Hänge zu den Herden hinüber, die unterhalb der Geröllhalden weideten. Sie hatte vor, für ihren kleinen Garten Kräuter und wildes Gemüse auszugraben. Durch Erfahrung wußte sie, welche Arten gediehen, wenn man sie dorthin verpflanzte, und welche zugrunde gingen.
Als sie bei den Herden ankam, stellte sie durch Zählen fest, daß eines der Tiere fehlte. Wahrscheinlich hatten der Alte und die Magd es schon zum Schlachten geholt. Der Mund wässerte ihr bei diesem Gedanken.
Sie ließ sich in einer Mulde nieder und bettete den Kopf auf einen eingesunkenen, von Flechten überzogenen Glimmerbrocken. Dann und wann hörte sie Geröll in die Halden rieseln, sonst blieb es still. Langsam, wie auf Spinnenbeinen, kroch der Tag tiefer in den Kessel. Aus den Schründen der nördlichen Hänge wichen schon die Schatten, und über dem See flirrte die Luft.
Nach einer Weile schoben sich dicke, schiefergraue Wolkenplatten über die westlichen Grate. Luise, die niemals etwas anderes als diese Berge und diesen Himmel gesehen hatte, wußte dieses Zeichen zu deuten. Es verhieß Regen und stellte eine Reihe trüber Tage in Aussicht, an denen nichts anderes zu tun blieb, als im Berg zu hocken, wo tagsüber nicht einmal das Talglicht brennen durfte.
Sie pfiff ein Schaf herbei und vergrub die Arme in seiner Wolle. Müdigkeit überfiel sie und ließ sie in einen leichten Schlaf sinken. Als sie wieder erwachte, sah sie, daß die Schafe sich zerstreut hatten und weiter unten im Schutz der Kiefern weideten. Die Wände hatten sich verfärbt, waren glanzlos und schattenlos geworden, und die regenschwere Wärme war einer ruhigen Kühle gewichen. Auch der Himmel über dem Kessel hatte sich verändert. Er war nicht mehr das scharf begrenzte Stück Blau, das bei den Felsgraten aufhörte und den Kessel abschloss. Er reichte weit über die Felsen hinaus, ließ weder Beginn noch Ende erkennen und wanderte grau und veränderlich von West nach Ost. Woher kam er und wohin ging er? Da fielen ihr wieder Martinas Worte ein: Dort drüben beginnt die Welt. Wie es dort wohl aussah? Sie kannte ja nichts anderes als Berge und Schluchten. Im Geist sah sie weite Wiesen voll mannshohem, tiefgrünem Gras und einen See, der so groß war, daß sein anderes Ufer im Dunst verschwamm. Sie hob den Kopf und sah einen Vogel in Richtung der Felsen fliegen. Er ließ sich vom Wind höher tragen, schwebte lange über dem Letzten Krieger und verschwand plötzlich jenseits der Berge. Luise hielt den Atem an und regte sich nicht. Unverwandt starrte sie auf die Stelle am Himmel, von der der kleine, schwarze, lebendige Punkt ins Ungewisse hinabgetaucht war. Ihre Augen begannen zu tränen. Sie wandte den Blick nicht ab. Sie wollte wissen, ob der Vogel wiederkommen oder ob er drüben bleiben würde, denn wenn er drüben bliebe, war dies ein Zeichen, daß man jenseits der Berge genauso leben konnte wie hier.
Ihre Augen suchten den Himmel ab. Der Vogel blieb verschwunden. Schon wollte sie, müde vom Schauen, den Blick abwenden, da kam der schwarze Punkt wieder, hing zögernd über einer Felsspitze und ließ sich in den Kessel zurückfallen. Luise atmete auf und war beinahe glücklich.
Nach dieser kurzen Rast begann sie mit ihrer Arbeit. Sie suchte sorgsam den Boden ab und fand Scharbockskraut, Gundelrebe und wilde Gewürze. Jede Pflanze stach sie sorgfältig aus, ließ Erde an den Wurzeln und legte sie auf ein ausgebreitetes Tuch. Sie arbeitete behutsam, denn der Spaten mußte geschont werden. Zuweilen klirrte er auf den Steinen oder wurde von einem zähen Wurzelfilz festgehalten, dann löste sie ihn zart und sorgfältig wieder heraus.
Diese geruhsame Tätigkeit hatte sie gern, weil sie dabei nachdenken und träumen konnte. Heute waren es wohlige Gedanken, die sie bewegten. Wie schön, daß das junge Tier ein Weibchen war! Es war ein angenehmes Ereignis, das eine Anzahl anderer angenehmer Ereignisse auslöste.
Die Geburt eines Männchens aber war jedesmal von düsteren und strengen Zeremonien begleitet. Einen Tag lang mußte überhaupt gefastet werden, und nachher gab es bis zur Geburt des nächsten Weibchens nur Käse, Milch und Kräutermus.
Noch ärger war es, wenn ein Kümmerer zur Welt kam. Dies war ein so entsetzlicher Zwischenfall, daß es verpönt war, darüber zu sprechen. Wenn es geschah, schwiegen und fasteten sie drei Tage lang und tranken gegen den Durst nur Tee aus bitteren Kräutern.
Sosehr sie Mangel litten, niemals verzehrten sie das Fleisch dieser krüppelhaften, lebensunfähigen Tiere, die bei aller Erbärmlichkeit so furchterregend aussahen. Der Alte trug sie in den Berg und warf sie in einen Abgrund. Zum Glück ereignete sich dies nur selten. Sie waren darauf gefaßt wie auf die kalten Tage im Winter oder auf den sommerlichen Hagelschlag, es gehörte zu den düsteren Dingen des Lebens und mußte hingenommen werden.
Aber heute mochte Luise nicht daran denken. Sie verscheuchte das bedrückende Bild und freute sich über das Gute, das ihr in naher Zukunft bevorstand. Gegen Mittag trieb der Hunger sie zurück. Schon von weitem sah sie vor der Höhle den Schlachtstein liegen und beschleunigte ihre Schritte. Der Anblick ließ ihr Herz höher schlagen. Nun hatten sie wieder frisches, weiches Fleisch! Der Boden rings um den Schlachtstein war mit geronnenem Blut durchsetzt, daneben lagen, zu einem kleinen Hügel gehäuft, die Klauen und die Gedärme des getöteten Tieres. Nach dem Festmahl mußte Luise sie in einen Tragkorb geben und zum See hinuntertragen. Dort würde sie die vier Klauen nach den vier Himmelsrichtungen werfen, zur Versöhnung der Geister des Hungers, der Kälte, des Ungewitters und der Geister der Leere, die hinter den Bergen wohnten. Dann mußten die Eingeweide in die Erde vergraben werden, an der geschützten Stelle bei den Drei Kleinen Felsen, wo sich Luises Gärtchen befand. Dort vermoderten die Gedärme aller Schafe und Ziegen, die sie jemals geschlachtet hatten, und die Pflanzen gediehen darauf und wurden groß. Wenn ein Unwetter kam, schossen die Sturzbäche links und rechts an den Drei Kleinen Felsen vorbei, ohne die lockere Erde fortzuschwemmen, wie es sonst allerorts geschah. Wer wollte bezweifeln, daß diese Stelle unter dem besonderen Schutz der Dämonen stand? Luise beherrschte die Kunst, durch Weihegaben ihren Zorn zu dämpfen und ihre Gunst zu erhalten. Solange sie nicht versagte, konnte auch den anderen nichts geschehen.
Plötzlich fühlte sie sich trotz des Hungers recht wohl. Er war, wenn baldige Aussicht auf Sättigung bestand, ein wunderbares Gefühl.
In der Höhle saßen alle schon bei Tisch und warteten nur noch auf sie. Erst jetzt konnte das Fest seinen Anfang nehmen.
Sie zerteilte das Fleisch und den Blutkuchen und gab jedem das ihm zustehende Stück. Den kleinsten Anteil erhielt Martina.
Vor Luises Platz stand eine Schüssel mit dem Herzen und der Zunge des geschlachteten Tieres. Als sie hineinstach, quoll duftender Dampf daraus hervor. Saft sprühte aus der Schnittfläche, und das hellrote Fleisch leuchtete, ehe es sich langsam an der Luft verfärbte. Diesen Augenblick erlebte Luise als einen Höhepunkt ihres Lebens. Daß gerade sie das Herz und die Zunge aß, war ein Gesetz und gehörte zu der Zeremonie, die sich nachher ganz im stillen vollziehen würde.
Bisher war sie ihrer Aufgabe immer mit Ernst und heimlichem Hochmut nachgekommen. Was hier geschah, war gerecht und gut. Sie war die Priesterin, und ihr gebührte das Opfermahl. Martina, die Räuberin, hatte sich außerhalb der Gesetze gestellt und mußte sich mit dem begnügen, was die Gnade der anderen ihr zuwies. Luise reichte ihr einen Knochen über den Tisch, an dem wenig Fleischreste und viele Sehnen waren. Dabei schaute sie einen Augenblick in Martinas Gesicht. Da – was war das? Sie hielt empört und erschrocken inne. Hatte Martina sie wirklich angelacht, jetzt, im Augenblick der höchsten Hingabe an ihr Amt? Das war noch nie geschehen. Ihr Gesicht wurde eisig, aber ihr Hochmut zerbröckelte unter einem Ansturm von Unsicherheit und Angst. Es gelang ihr nicht mehr, sich in jenen Zustand überzeugter Priesterschaft zu versetzen, in dem sie den Auftrag und den Vorzug ihres Amtes mit der gleichen Selbstverständlichkeit annahm. Sie wußte, daß sie nun den Tischsegen sprechen sollte, doch sie konnte es nicht tun. Martina störte sie zu sehr. Einem Impuls nachgebend, teilte sie das Herz und die Zunge und schob die Hälfte davon über den Tisch. »Magst du das? Ich schenke es dir.« Schon wollte Martina zugreifen, da kam die Hand des Alten dazwischen und schob die Speise gebieterisch wieder auf Luises Platz zurück. »Den Tischsegen!« befahl er hart.
Luise senkte den Blick, um Martina nicht mehr anschauen zu müssen, dann sagte sie leise, doch ohne Andacht: »Friede sei unserem Mahl. Vergessen wir, was wir verloren haben, und teilen wir, was uns geblieben ist.
Geister des Hungers, haltet euch von uns fern und neidet uns das wenige nicht.«
Danach fing sie hastig und freudlos zu essen an. Unter gesenkten Wimpern hervor beobachtete sie Martina, die vergnügt wie ein Tier an ihrem Knochen nagte. Ihr selber war die Kehle wie zugeschnürt.
Nach der Mahlzeit blieb sie nicht wie gewöhnlich sitzen, um das Gefühl der Sattheit voll auszukosten. Sie erhob sich vorzeitig und eilte hinaus.
Lange strich sie in der Nähe der Höhle umher und konnte sich nicht entschließen, den zweiten Teil ihres Amtes zu beginnen. Unberührt blieben die Klauen und das Gedärm neben dem Schlachtstein liegen. Nach einer Weile sah sie die Magd aus der Höhle kommen und das frische, blutige Fell auf dem Boden ausbreiten. Emsig fing sie an, es mit Hilfe einer steinernen Spachtel sauber zu machen.
Luise stellte sich neben sie und schaute ihr bei der Arbeit zu. Gerne hätte sie geholfen, doch sie hatte jetzt eine andere Aufgabe. Als sie sich umwandte, stolperte sie beinahe über den Korb, der dazu bestimmt war, die Klauen und die Eingeweide aufzunehmen. Was zu tun war, mußte sie tun. Es blieb ihr nicht erspart.
Sie bequemte sich endlich, das Geisteropfer in den Korb zu füllen, doch sie empfand dabei würgenden Ekel vor den schon ausgekühlten Gedärmen. Zuoberst breitete sie die frisch ausgegrabenen Pflanzen, die schon welk aussahen, trotz der Erde an den Wurzeln. Dann lud sie sich den Korb auf und trat ihren Gang zum See an.
Als sie bei den Drei Kleinen Felsen vorbeikam, trat Georg hervor und stellte sich ihr in den Weg. Sie wich erbost zurück, denn es gehörte zu ihrem Auftrag, daß keiner sie dabei störte.
»Was willst du?« fragte sie feindselig.
Er näherte seinen ausgestreckten Zeigefinger dem Tragkorb, ohne ihn jedoch zu berühren, und sagte: »Ich möchte einmal zusehen, wie du das eingräbst.«
Ihr Gesicht verfinsterte sich. Sie ging an ihm vorbei und ließ ihn stehen. Es war das erste Mal, daß jemand mit einem so ungeheuerlichen Wunsch an sie herantrat.
Georg blieb hartnäckig an ihrer Seite. »Wenn du mich mitgehen läßt, zeige ich dir auch etwas, das du noch nie gesehen hast.« Luise blieb streng und abweisend und würdigte ihn keiner Antwort.
»Du wirst dich wundern«, redete Georg weiter auf sie ein. Sie beschleunigte ihren Schritt in plötzlicher Angst vor der Versuchung. Doch die schwache Stelle war aufgedeckt.
»Da drinnen zwischen den Steinen habe ich es versteckt«, raunte ihr Georg zu.
Unschlüssig blieb Luise stehen und folgte seinem Blick. Er lockte sie wie ein mißtrauisches Tier hinter sich her. Schließlich gab sie zaudernd nach. Sie ließ sich hinter die Felsen führen, wo der Stein ein paar natürliche Stufen aufwies, und stieg mit Georg zu einem Felskopf hinauf, der ein wenig überhing. Er mußte ihr helfen, den Korb zu tragen, und beiden fiel es kaum mehr auf, daß sie damit das Gebot verletzten. Gespannt beobachtete sie, wie er zwischen die Steine griff und etwas zum Vorschein brachte. »Nur schauen«, schränkte er ein, »nicht anrühren.«
Langsam öffnete er die Faust und ließ ein seltsames Ding sehen, das von schmutzigweißer Farbe war und in seiner Form etwa einer großen lappigen Flechte glich. Das Sonderbarste war jedoch, daß es, in sehr genauen Reihen geordnet, schwarze, unverständliche Zeichen trug.
Georg zupfte daran, und ein Stück riß ab. Dann zerrieb er es zwischen den Fingern, um zu zeigen, wie mürbe es war. Mit angehaltenem Atem verfolgte Luise seine Bewegungen. »Was ist das?« murmelte sie.
Georg lächelte bedeutungsvoll. Er nahm einen Wurzelstock aus dem Korb, hielt ihn vor Luises Augen und fragte: »Weißt du, warum das so gut in deinem Garten wächst?«
»Weil die Erde geweiht ist«, erwiderte das Mädchen.
Er deutete auf die Eingeweide. »Durch das da?«
Sie nickte beklommen.
Der Knabe schaute um sich, als ob er sich vergewissern wollte, daß niemand ihn hören könnte, dann näherte er seinen Mund ihrem Ohr und flüsterte: »Soll ich dir etwas sagen? Wenn Schafmist in den Boden kommt, wächst es genauso gut. Ich habe das ausprobiert.«
Ihre Augen wurden weit und starr. »Wie bist du auf diesen Gedanken gekommen?« fragte sie fassungslos.
Er flüsterte noch ängstlicher und leiser: »Martina hat mir gesagt, das hätte mit den Geistern gar nichts zu tun.«
»Sei still!« schrie Luise auf. Er fuhr zusammen. Doch nun kam ihm das Mädchen entgegen.
»Zu mir hat Martina auch etwas gesagt«, gestand sie zögernd. Er hob mit einem Ruck den Kopf und starrte ihr in das Gesicht. »Sie hat gesagt, wir brauchen nur über die Berge zu gehen, um nicht mehr hungern und frieren zu müssen«, vollendete sie aufatmend und mit einem Gefühl entsetzlicher Schwäche in den Gliedern.
Georg hatte ihr voll tiefer Erregung zugehört. Er nickte lebhaft und hielt mit einer Gebärde des Triumphes seinen Fund vor Luises Augen.
»Ja«, stieß er hervor, »und das da ist auch von dort drüben. Ich habe es immer gewußt.«
Nun war es ausgesprochen. Ihr Geheimnis bedrückte sie nicht mehr. Aber statt dessen kam die Angst vor den Folgen des Zweifels. Die Geister waren verleugnet und beleidigt worden. Jetzt blieb nur die Hoffnung, daß es sie wirklich nicht gab. Stumm und beklommen hockten der Knabe und das Mädchen nebeneinander. Keines konnte das andere schützen, denn jedes trug schwer genug an seiner eigenen Schuld.
Plötzlich sprang Georg auf. Er mußte Gewißheit haben. In einer Aufwallung von Zorn und Wahnwitz stürzte er sich auf den Tragkorb und kippte ihn mit einem Schwung über den Felskopf. Luise schrie auf und duckte sich wie vor einer Steinlawine an den Felsen. Auch Georg war tief erblaßt. Wenn es Dämonen gab, mußten sie eine solche Herausforderung annehmen. Mit zuckendem Gesicht, doch aufrecht, erwartete er die Vernichtung, die ihnen für solchen Frevel verheißen war.
Aber nichts geschah. Nur ein leichter Wind erhob sich und rauschte in den Baumkronen. Über den See strich mit weichem Flug ein Häher und ließ sein Gefieder in der Sonne leuchten.
»Oh, Georg, was hast du getan?« flüsterte Luise, als sie endlich wagte, das Gesicht zu heben. Er rückte an ihre Seite und ließ es zu, daß ihr Kopf auf seine Schulter sank. So saßen sie lange nebeneinander, bei jedem Laut aufschrekkend, der unerwartet die Stille durchschnitt, doch wurden sie umso ruhiger, je tiefer die Sonne sank. In großem Frieden dehnte sich der Nachmittag hin. Murmeltiere pfiffen vor ihrem Bau, und aus dem Kesselgrund klang bei Windstille das Blöken der Schafe herauf.
Nach Sonnenuntergang erhob sich Georg und warf den ersten Stein. Lautlos fiel er auf das Geschling der Eingeweide, die sich in den Kriechföhren verfangen hatten. Schillernde Fliegenschwärme zuckten empor und begannen zu kreisen. Der zweite Stein flog und traf abermals sein Ziel, und nachher folgten der dritte und der vierte. Nun stand auch Luise auf. Sie packte einen Kalkbrocken und machte die Augen fest zu. Dann ließ sie ihn fallen und hörte seinen dumpfen Aufschlag. Georg stieß einen sieghaften Schrei aus. Da war auch sie nicht mehr zu halten.
Beide gebärdeten sich wie berauscht. Ein Regen von Steinen ging nieder und deckte die Opfer für die Geister des Hungers, der Kälte, des Unwetters und der Leere zu. Sie steigerten sich in einen Taumel der Zerstörungswut. Der Feind konnte sich nicht wehren – er lag da und mußte sich treffen lassen. Schließlich stiegen sie hinunter und begannen Zweige abzureißen, die sie über die Steine und Eingeweide häuften, bis nichts mehr davon zu sehen war.
ALS sie heimkamen, waren alle schon zur Ruhe gegangen. Der Alte hatte sich in einen Seitenstollen der Höhle zurückgezogen, wo sich, durch einen Vorhang vom Schlafraum der anderen getrennt, seine Lagerstätte befand. Auch Martina und die Magd schliefen fest. Nichts war zu hören als ihr lauter Atem und ein stetiger Tropfenfall von den Höhlenwänden.
Georg und Luise tappten zum Tisch hinüber und fanden ihr Nachtmahl, das sie in der Finsternis verzehrten. Dann riefen sie leise Martinas Namen. Sie hatten Georgs Fund mitgebracht, um ihn ihr zu zeigen. Martina war halb aus dem Schlaf gerissen und zog sich mit einer zornigen Gebärde die Decke über. Georg rüttelte sie an der Schulter und zwang sie, ganz aufzuwachen. Noch traumbefangen, stieß sie ihn beiseite, doch er ließ sich nicht einschüchtern. Er flüsterte: »Schau, was wir gefunden haben!«
Luise hatte die Asche vom Herd geräumt und legte ein harziges Scheit in das Feuer. Augenblicklich flammte es auf und warf seinen Schein auf Martina. »Laßt mich schlafen!« fauchte sie gereizt. Da hielt ihr Georg seinen seltsamen Fund vor die Augen. Im nächsten Augenblick war sie hellwach. »Was ist das?« flüsterte sie. »Laß es mich ansehen!«
Sie riß ihm das graue, lappige Ding aus der Hand und starrte darauf nieder. »Mein Gott, ein Stück bedrucktes Papier. Wo habt ihr das gefunden?«
Georg und Luise brauchten keine Antwort zu geben. Martina hatte die Frage schon wieder vergessen und studierte mit glänzenden Augen die schwarzen Zeichen. Plötzlich flog ein Schatten über ihr Gesicht. »Man kann es nicht mehr lesen«, sagte sie traurig.
»Was ist Lesen?« fragte Luise.
Martina stieß einen Laut aus, der halb ein Seufzen und halb ein Lachen war. »Ich soll euch erklären, was Lesen heißt, und ihr wißt nicht einmal, was Leben ist. Aber wartet nur, jetzt sage ich es euch. Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Alten. Ich werde euch alles erzählen.«
Georg und Luise hatten das Feuer mit Schafmist gedämpft und setzten sich zu ihr. Martina packte ihre Handgelenke und spürte unter den Sehnen die Pulse klopfen. Das Gefühl einer kraftvollen Gemeinsamkeit überkam sie. Sie waren zu dritt, sie waren stark und jung. Ein solches Bündnis konnte niemand brechen.
»Wir müssen den Alten zwingen, daß er uns über die Berge führt. Hier ersticken wir ja. Spürt ihr das nicht? Nein, ihr könnt das nicht so spüren wie ich. Ihr seid zwei dumme kleine Tiere, die dort bleiben, wo ein bißchen Futter für sie gedeiht. Was ihr zu erwarten habt, genügt euch wohl, wenn es auch wenig ist. Ihr werdet miteinander leben und Söhne und Töchter bekommen …«
»Was ist das?« fragte Luise.
Martina stockte verwundert mitten im Wort. »Wahrhaftig, es ist, als müßte ich euch erst meine Sprache lehren, ehe ich mit euch reden kann. Kinder werdet ihr haben, kleine nackte Menschen, ähnlich den Lämmchen, die unsere Schafe werfen. Luise wird sie zur Welt bringen.«
Das Mädchen stieß einen leisen Schrei aus und rückte von ihr ab.
»Ihr lebt ja mitten unter Tieren«, setzte Martina hinzu. »Ihr solltet wissen, was ich meine. Alles, was mit ihnen geschieht, wird auch mit euch geschehen.«
Luise fühlte Georgs ungläubigen Blick. »Nein, nein!« rief sie heftig, »das glaube ich nicht.« Dann lachte sie und riß auch Georg mit. Weder Verlegenheit noch Scham war in diesem Lachen, nur ein tiefer Zweifel.
»Glaubt es oder glaubt es nicht«, sagte Martina. »Eines Tages werdet ihr es wissen. Euch steht noch vieles bevor – alles, was mir versagt ist. Ich habe hier nichts mehr zu erwarten. Ich ertrage das nicht mehr. Ich will fort von hier, hinaus in die Ebene, woher ich gekommen bin. Ihr werdet sehen, ich setze es durch. Jetzt bin ich wieder stark. Ich habe etwas in meinen Händen, das von früher ist. Könnt ihr begreifen, was das heißt? Es ist nur ein Stück altes Papier. Aber es hat alles überstanden.«
»Ich verstehe dich nicht«, sagte Georg schroff.
Sie ließ sich in ihre Decken zurückfallen. Wie sollte er sie auch verstehen! Würde sie überhaupt die Worte finden, deren es bedurfte, um ihre Vergangenheit lebendig zu machen?
WÄHREND sie zu erzählen begann, schlug eine Flut über ihr zusammen, helle und dunkle Bilder einer formlosen Erinnerung: ein kleines, steinernes Haus, ein Weg von Heliotrop umsäumt, eine Handvoll Rosenblätter und ein Birnbaum mit dichtbelaubter Krone. Dies alles war nicht mehr als ein Hauch, eine leichte, bunte Glückseligkeit, nicht wirklicher als ein lebhafter Traum. Dann schob sich ein Bild, fest und beständig, vor Martinas inneren Blick und verflüchtigte sich nicht mehr. Es blieb und gewann an Deutlichkeit, bis es sich beinahe mit Händen greifen ließ: ihr guter, fröhlicher Vater! Von ihm ging ein Licht aus, das eine versunkene Landschaft in weitem Umkreis hell machte. Sie sah plötzlich alle Wege, die sie mit ihm gegangen war, offen und sonnig. Er hatte alle Blumen zu benennen gewußt. Sie entsann sich noch heute der schönen, niemals entzauberten Namen: Augentrost und Männertreu, Wundklee und geflecktes Knabenkraut. Am meisten hatte er die Blumen geliebt, die Fuchsien und Geranien und die Pechnelken auf den heißen Sommerwiesen.
Alles Rote und Lebendige hatte er lieb gehabt: das Haar seiner kleinen, hübschen Tochter, das Blut und das Feuer. Vor allem das Feuer. Einmal sagte er im Scherz, er werde sein Haus in Brand stecken, nur um eine große Fackel zu sehen.
Bald darauf erfüllten sich seine Worte auf grauenvolle Art. Es ging nicht nur sein Haus, es ging die ganze Stadt im Feuer zugrunde. Er aber hatte ein paar Tage vorher von ihnen fort müssen, wohin und warum, das hatte Martina nicht verstanden. Nur der Abschied von ihm und seine tiefe, unbegreifliche Trauer waren noch lebendig in ihr. »Wir werden einander nie mehr sehen«, hatte er gesagt. »Wahrscheinlich müssen wir sterben. Du mußt mich noch einmal sehr liebhaben, mein Kind.« Martinas Kopf lag auf seiner Brust, und seine Wärme ging auf sie über wie eine letzte, verschämte Gabe. Dann sagte er: »Ich kann dir nicht einmal Glück für deine Zukunft wünschen. Es gibt keine Zukunft mehr!«
Sie fühlte einen Schmerz – nicht ein kleines, heißes Kinderherzweh, sondern den steinernen Schmerz der Hoffnungslosigkeit. Sie war sehr alt in dieser Minute und wußte dies in einer Schicht ihrer Seele, wo Fühlen und Denken nicht mehr hinreichten. »Wohin gehst du, Vater?« fragte sie.
»In den Krieg. Das heißt überall und nirgends hin.«
Dann verließ er sie, und sie blieben allein in einer Welt, die im Feuer zerrann. Sie hatten nicht einmal Zeit, Angst zu haben. Das Ende kam als ein großer, glühender Regen. Sie flohen erdwärts, weil der Himmel brannte, sie hockten im Keller ihres Hauses wie Tiere in der Fallgrube und hörten, fühlten, witterten den Tod.
Zuerst kamen das Entsetzen und die Gewalt. Die große Stadt, an deren Rand sie wohnten, war brüllend und steinewerfend aufgebrochen wie ein Vulkan. Sie war keine Stadt mehr, sondern ein Krater voll heißem Schmelzfluß, sie quoll über und überflutete das Land mit kochender Glut. Doch von diesem Übermaß an Schrecken wußte Martina nichts mehr. Wann immer sie daran dachte, erfüllte etwas Übergrelles ihren Blick, etwas Überheißes rührte sie an, und ein Abgrund voll Irrsinn und Angst tat sich auf, an dessen Rand sie nicht zu treten wagte. Sie hatte es vergessen müssen, weil es sogar als Erinnerung noch tödlich gewesen wäre.
Nach der Gewalt kam die Tücke, die heimliche, schleichende Bedrohung: das Rieseln in der Mauer, das Knistern im Gebälk, der Qualm und die Atemnot. Früher oder später würde auch ihr Haus vom Feuer erfaßt werden. Es bereitete sich heiß und zitternd darauf vor. Sie waren darin gefangen. Auch die Mutter konnte nichts mehr für sie tun. Sie kauerte schluchzend und qualvoll hustend in einem Winkel, so ganz sich selber zugekehrt, daß weder Trost noch Hilfe von ihr kam.





























