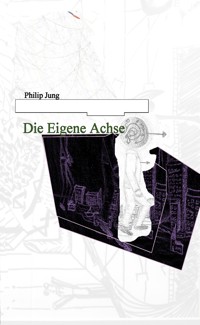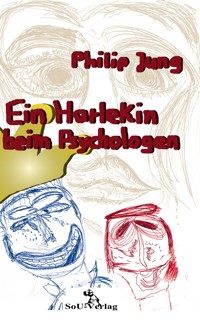9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Neu! E-Book mit aktivem Inhaltsverzeichnis -- Die (Ideologie der) Offenbarung: Nachdem Tutschmann mit einem umfangreichen Dokument dargelegt hat, warum eine Schönheitsoperation nötig wäre, ihn noch einmal Teil der Gesellschaft werden zu lassen, und beim dritten Chirurgen vorgesprochen hat, lässt er sich freiwillig in eine Psychiatrie einweisen. Danach wandelt sich sein bis dahin auf Harmonie ersuchtes Verhältnis zu seinem Schizophren, dem Schauspieler Pete Goldman. Er beginnt ihn zu verachten und zu hassen. Seine Gedanken toben und er macht den Schauspieler für die moderne Gesellschaft verantwortlich, an der er nicht teilhaben darf. Es reißt ihn in einen Strudel zwischen Selbstmordgedanken und manischer Wut um die Themen: Erfolgswahn, äußerer Schein und inneres Sein, Konsum, Humanismus als Markenzeichen, feminine Gewalt, sexuelle Frustration, Individualismus, Identität, Intelligenz, und so weiter; wobei alle Ideologien stets zurückführen auf seine ursprünglichen Konflikte, und diese wiederum auf die schlichte Emotion in ihm, die jede Ideologie hinfällig macht und einstürzen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Die (Ideologie der) Offenbarung 5
WPZ (Willkürheim, Psychiatrisches Zentrum - Herbst 2008) 9
Zurück in Berlin 18
Kapitel III 21
Kapitel IV 28
Kapitel V 31
Kapitel VI 38
Alte Freunde 40
Kapitel VIII 50
Kapitel IX 52
Kapitel X 66
Auslandsbüro 71
Das Dokument 78
Kapitel XIII 87
2009 99
Heute mal wieder 104
Dokument Teil II 146
Ausflug 159
Lasern 170
Unangenehme Verwechslung, aber kein Problem 179
Letzte Vorbereitungen 188
Die Tat 202
Kapitel XXII 216
Kapitel XXIII 223
Das Dorf I 232
Das Dorf II 264
Das Universum 307
Brüder 315
Der Himmel ist die Grenze 323
Everybody 's free 359
Die Mutter mit dem Kind 374
Hallo Vater 404
Kapitel XXXII 413
Am Kudamm 424
Kapitel ZIG 443
Vision und Kirche 444
Alltag 455
Tagebuch 457
Was führt Dich zum Meister....? 464
Kapitel XXXIX 477
Kapitel XXXX 480
Kapitel XXXXI 481
Nachwort 484
Glossar 485
Philip Jung wurde 1981 in der Nähe von Karlsruhe geboren. Heute lebt er als freier Autor in Berlin. Die Atmosphäre in der Stadt, sowie die Begegnung mit gewissen Menschen im inneren Abgleich zu sich selbst, unter Nutzung seiner Phantasiebegabung und psychologischem Wissen inspirierten ihn die drei Romane EinTraum, Die Eigene Achse und Die (Ideologie der) Offenbarung zu schreiben. Er versucht darin, in psychologischen Entwicklungsromanen einige narzisstische Phänomene zu ergründen und spürbar zu machen, jedoch nicht zu erläutern, und somit offen zu halten für eigene Interpretationen des Lesers, da er der Meinung ist, daß das Leben nicht erklärbar und kategorisierbar sein kann. Neben seiner Autorentätigkeit arbeitet er in verschiedenen Berufen, wo ihm häufig die Menschen begegnen, die ihm den Stoff liefern zu seinen Geschichten, denn wie es so schön heißt: Autoren erfinden ihre Geschichten nicht, sie bekommen sie erzählt.
Bücher von Philip Jung im SoU-Verlag (Sozialer Untergrund Verlag) : Wie eine Feministin Buffalo Bill überwältigte – Ein Harlekin beim Psychologen – Der Entenmörder – EinTraum – Die Eigene Achse – Die (Ideologie der) Offenbarung
zum Buchshop
(eBooks und Taschenbücher)
www.sou-verlag.de/shop
Philip Jung
Ein Meister des Narzissmus
Die (Ideologie der) Offenbarung
EMDN III
Roman
Dritte Auflage
®© 2022, Philip Jung
www.sou-verlag.de
facebook.com/philipjung81
Impressum:
Philip Jung
Waghäuseler Strasse 9
10715 Berlin
Mond - Neptun
Die (Ideologie der) Offenbarung
WPZ (Willkürheim, Psychiatrisches Zentrum - Herbst 2008)
Es ist Anfang September. Unter der Woche arbeite ich in der Firma, in der Heinz stellvertretender Geschäftsführer ist. Ich stelle Werbematerial zusammen für ihre regenerativen Energiesysteme.
Heute ist Wochenende und ich bin zu meinem Bruder gefahren. Er hat seine Ausbildung zum Krankenpfleger abgeschlossen, arbeitet weiterhin im Willkürheimer Psychiatrischen Zentrum und wohnt im Heim für Auszubildende und Angestellte auf dem Klinikgelände. Am Abend wollen wir zum Weinfest gehen. Er hat noch Spätdienst.
Ich jogge durch die große Parkanlage zwischen den Stationen. Dahinter erstrecken sich Wiesen am Hügel und ein Wald mit Friedhof für verstorbene Patienten, die ohne Heimat waren. Ich entferne mich vom Angestelltenwohnheim hangabwärts Richtung Friedrichshügel, wo eine kleine Wohnsiedlung aus fünf Häusern gebaut ist. Traditionell waren sie für die Angestellten des WPZ. Inzwischen sind sie vermutlich verkauft.
Es ist später Nachmittag. Ein Paar joggt mit Hund den Berg hinauf Richtung Wald. Mann und Frau wirken astral attraktiv, athletisch, modern und zielstrebig. Vermutlich sind sie Akademiker für Wirtschaft, Medizin oder Wirtschaftsrecht. Sie hat glatte brünette Haare, trägt einen hochgebundenen Zopf. Er ist blond, trägt eine Kurzhaarfrisur, die mit Gel hochgestellt ist. Sie joggen in Funktionssportwäsche. Ihr Hund ist eine Dogge mit glänzendem kurzem graubraunen Fell, sieht fehlerlos gezüchtet aus, und ist sicher intelligent, aber nicht schlau, eigenwillig begabt oder lustig. Die dicken fruchtbaren Eier schlagen gegen die Innenseiten seiner Hinterläufe und hängen empfindlich am dünnen Samenstrang. Es ist beängstigend, wie abgerichtet die drei wirken.
Selbstverständlich würden sie sich im Rahmen angebrachten und angesagten modernen Umgangs immer freundlich und hilfsbereit geben, würden nichts Ausfallendes sagen, und ihren Körper nur im äußersten Notfall zur Verteidigung einsetzen. Trotzdem stählen sie sich noch in der Freizeit. Mit Muskelkraft könnten sie jemanden töten. Mir graut davor, sie bei der Jagd zu sehen.
Es ist herrliches Wetter. Amseln und Zaunkönige zwitschern. Es riecht aus den Hausgärten nach gegossenen Pflanzen. Im Schatten der Bäume nähern sich Schmeißfliegen und Wespen. Eine tote Amsel liegt am Weg. Ich könnte schreien vor Liebe. Es ist purer Luxus, seine Zeit zu verschwenden; auch wenn ich sie gerne allmählich konservieren würde in einer konkreten Leidenschaft, die mir das Gewissen beruhigt, dass ich etwas geleistet habe.
Ein ausgetrockneter Rinnsal voller Erde. Grüne Walnüsse wachsen. Die Reben tragen. Ich jogge ein Stück denselben Weg wie das Paar. Am Waldrand biege ich rechts ab zur vorgelagerten offenen Wiese. Sie schenkt mir einen Blick über die Kleinstadt Willkürheim und die zwei nächsten Dörfer, wo ich die letzten Jahre meiner Kindheit und meine Jugend erlebt habe. Beim Schweifen über die Gebäude und die freien Felder im Hintergrund suche ich die damals von uns unerforschten Waldgebiete zusammen, wo es noch Stollen zum stillgelegten Silberbergwerk geben soll. Im Innenhof des örtlichen Tierheims verdeckte eine schwere Eisenplatte den angeblichen Zugang zum Hauptstollen. Dort wäre ich gerne hinabgestiegen, so tief wie möglich, bis es zu heiß geworden wäre, und ausgestattet hätte ich mich mit einer Taschenlampe und einem langen Seil zum Rückholen.
Ständig kontrolliere ich beim Streifen im Gras meine Waden nach Zecken, und versuche mich zu entspannen mit der Philosophie, dass eine Zecke ein Zufall ist, der unkontrollierbar eintreten wird oder nicht, meiner Erfahrung nach bisher zweimal im Leben. Ich treffe auf einen Schotterweg, der die Wiese schneidet. Dort, auf der Höhe einer Parkbank, kommen mir drei Menschen entgegen. Sie gehen den Hügel nach unten zu den Krankenstationen. Ich bin mir sicher, dass sie Patienten sind. Sie tragen billige Trainingsanzüge und bewegen sich angehalten, als würde der Boden schwimmen. Es sind zwei Frauen und ein Mann, alle Mitte fünfzig. Sie wirken aufgeschwemmt und ruhiggestellt. Er ist ergraut und trägt einen Bart. Eine der Frauen hat eine kupferfarbene Dauerwelle und große Ohrreife. Die andere hat aschblonde lange glatte Haare, lila Fingernägel, und sie raucht. Eigentlich sind sie sympathische, gemütliche Persönlichkeiten mit sicher eigenwilligem und explosiven Temperament. Harmlos sind sie auch, jedenfalls nehme ich das an, denn sie werden auf offener Station behandelt. Sie sehen osteuropäisch aus. Ich vernehme kein Gespräch. Jeder schaut für sich auf den Boden in seine eigene Richtung. Trotzdem wirken sie als Gruppe verbunden. Würde mich der Mann anfallen, könnte ich ihn niedermachen.
Hier in diesem Psychiatrischen Zentrum hatte ich eigentlich meinen Zivildienst begonnen, bevor ich mich in Richtung Berlin versetzen ließ. Schon damals hatte ich die Idee, vielleicht eigenwillig, dass niemand einfach psychisch krank geboren wird und bleibt. Es muss eine Wurzel geben. Erkennt man sie, versteht man seine Ideen.
Ich fand es immer spannend, wie diese außergewöhnlichen Charakter die Nischen meiner Phantasie und die Eigenarten meines Verhaltens herausforderten. Sie stellten seltsame Fragen, die unter sogenannten Normalen außer Acht gelassen werden oder bewusst übergangen, sodass sie in Vergessenheit geraten und mittelfristig eine rätselhafte Sehnsucht nach Erfüllung hervorrufen, mitten in aller Sättigung, in einem stabilen und sterilen und irgendwie beunruhigend überschwänglichen Lebensglück.
Zwischen Wäscherei, Großküche und Tennisplatz bewege ich mich hangabwärts auf die Mauer zu, hinter der ein Teil der Forensik verwahrt ist.
Die gefährlichste Station ist die 07. Mein Bruder erzählte mir von einem derzeit Inhaftierten, der in Mannheim eine Frau mit einem Samuraischwert geköpft hat. Die Pfleger hinter der Mauer sind psychisch hoch belastet, und laufen Gefahr, selbst krank zu werden. Aus Sicherheitsgründen kommt auf der 07 ein Pfleger auf einen Inhaftierten und es ist unbedingte Vorschrift, sich mit dem Rücken entlang der Wand zu bewegen. Die Pfleger sind robust, gewaltbereit und meistens kampfsporterfahren. Als einmal ein Handwerker, der Gardinen anbrachte, von hinten angefallen wurde, stürzte sich sofort ein Pfleger auf den Täter, mit roher Gewalt unter dem tierischen Schrei: „Du Schwein!!“
Die Umgangsformen werden geduldet, weil sie Schaden verhindern, sowie die moralischen Werte und damit die psychische Stabilität des Personals einigermaßen schützen.
Ich komme in die Nähe des Tores, das sich im Moment öffnet. Es ist ein doppeltes schweres Schleusentor und erinnert mich an die Staustufe am Rhein bei Floßheim. Dort waren wir oft als Kinder mit unserem Vater und seiner neuen Frau bei der ansässigen Gaststätte zum Minigolfspielen. Davor oder danach standen wir auf einem Tretgitter über dem Schleusentor und schauten dem Vorgang zu:
Unter uns spritzt ein Wasserstrahl an den Seiten des Tores nach unten. Über dem Tor schwebt in der Luft leichtsinnig ein orangenes Polizeilicht. Ich stelle mir vor, darauf zu sitzen und nach unten zu schauen. Die Halterung knickt ab. Ich falle über zehn Meter tief ins Wasser.
Ich frage mich, ob das Eisentor dicht sein kann. Es ist pechschwarz und hat ein weißes Dreieck in der Mitte. Es wirkt gefährlich. Das Dreieck ist zehnmal oder zwanzigmal so groß ist wie ich, und hat bestimmt etwas zu bedeuten.
Der Wasserpegel ist nicht so hoch und ruhig wie im Urlaub, wenn die Schleuse voll ist. Dann stehen auch die Schiffe oben, und ich könnte leicht von der Mauer auf eines springen und sofort wieder zurück, noch bevor der Pegel sinkt. Sogar wenn ich in der Nähe vom Tor ins Wasser fallen würde, könnte ich schnell über die Leiter am Rand wieder aus dem Becken klettern. Das Tor wäre unter Wasser, und ich wäre geflüchtet, bevor es mich bemerkt.
Jetzt ist das Wasser tief unten. Die Schiffsmotoren sind angelassen.
Das Gitter kann mich nicht halten. Es bricht. Ich falle durch den Rahmen und schlage mir den rechten Ellenbogen auf. Ich versuche mich an der Mauer abzutreten, damit ich auf eines der Boote komme, bevor ich ins Wasser falle. Ich schaffe es nicht, und stürze ins Wasser zwischen dem ersten Schiff und dem Tor. In den Sog der Schrauben darf ich nicht kommen.
Das Wasser ist wild. Die Strahle von beiden Seiten des Tores spritzen auf meinen Kopf. Es gibt Wellen und sprudelndes Wasser an der Torwand.
Die Mauer ist hoch, und glitschig vom Moos. Ich schaue nach oben.
Die Leiter ist zu weit weg, sodass ich sie nicht mehr erreichen kann, auch wenn ich mit voller Kraft aus dem Wasser springen würde; und einen Klimmzug würde ich schaffen, wenn ich um mein Leben kämpfe. Das Wasser ist schmutzig und giftig. Die Wellen schwappen mir in die Nasenlöcher. Den Mund habe ich zu. Ich sehe nicht, was bei meinen Füßen passiert. Ich tauche schnell an den Boden, damit ich endlich weiß, was dort ist, und ob das Wasser unter dem Tor durchfließen kann. Drei Meter kann ich tieftauchen. Das Tor grollt und es bewegt sich schon.
Links ist ein Spalt entstanden, und ich sehe die andere Seite. Sofort halte ich mich mit den Händen an der Torkante fest, und stoße mich mit den Füßen an der Gegenwand ab, solange das Tor noch nicht zu weit aufgefahren ist.
Ich klettere zwischen Vorder– und Rückwand in das Tor. Das müsste gehen. Es wackelt. Ich weiß, dass mir nur etwas passieren kann, wenn ich unten bin, wo das Tor am Boden entlang geht, oder am Anfang, wo das Wasser durchströmt. Ich fahre mit in die Seitenhöhle, wo es trocken ist und wärmer. Das Wasser regnet zwischen den Stangen bis ganz nach unten und dampft hoch. Es riecht nach Rost und Teer. Ich will nicht soviel einatmen.
Hier könnte ich es lange aushalten. Ich muss mich nur so abstützen, dass ich auch schlafen kann. Am hinteren Ende des Tores ist bestimmt ein Schaltraum. Dort gibt es eine Tür, die zur Brücke zurückführt an die frische Luft. Die könnte ich aufbrechen, wenn ich voll dagegen trete, und dann wäre ich im Handumdrehen wieder zurück. Mein Vater mit seiner Frau und meinem Bruder wäre noch gar nicht weggefahren.
Oder es würde mich nach einigen Tagen jemand schreien hören. Aber dann wäre ich eine Memme.
Einmal in der Woche wird Einer da sein und die Maschinen überprüfen: Ich verstecke mich, und schleiche durch die Tür, wenn er mich nicht bemerkt, weil er woanders hinschaut; so könnte ich auch zurückkommen auf die Brücke. Den Hunger halte ich aus. Bis zum Haus von meinem Vater sind es vielleicht zwölf Kilometer. So kann ich es alleine schaffen.
Ich sitze im Tor, rutsche mit dem Fuß ab, schlage mit dem Knie und dem Kinn an die Querverstrebungen und beiße mir auf die Zunge. Durch die Stangen rattere ich nach unten und werde zerquetscht.
Nein! Ich bin da, wo das Wasser ist. Der Strudel treibt mich im Rhein auf die andere Seite. Es ist gar nicht so kalt. Ich muss nichts machen und ich habe frische Luft.
Dann reicht es mir. An einem Rheinfarn halte ich mich fest gegen den Strom. Das Rheinfarn schneidet mir in die Hand. Über die Steine klettere ich ans Ufer. Ich rutsche am Moder ab und schlage mir das linke Schienbein an. Es blutet. Mit nassen klebenden Jeanshosen und Pullover laufe ich den Kiesweg auf dem Damm zurück. Meine Schuhe habe ich noch an. An der stabilen Brücke neben dem Schleusentor muss ich noch hochklettern. Das geht leicht, wenn ich auch weit unten stehe. Dann muss ich über die Brücke rennen und weit weg vom großen Wasser, damit ich nicht ertrinke, wenn die Brücke kracht und der Rhein von oben auf mich fliegt.
Dann würde ich mich lieber bis nach Holland treiben lassen ins Meer.
Weit vor Land bin ich im Wasser. Ich sehe das Rheindelta. An Land stehen Fabriken mit vielen silbernen Rohrleitungen, Masten und orange-rosa Straßenlaternen.
Es wird Nacht. Ich strample, damit ich warm bleibe, und ich will meine Füße nah bei mir haben. So kann ich sie mit den Händen festhalten, auch wenn ich dann Rolle vorwärts mache wie im Schwimmbad. Wenn ich dabei sinke, strecke ich mich schnell und strample, damit ich wieder über Wasser komme. Haie gibt es im Meer bei Holland nicht, glaube ich. Trotzdem weiß ich, dass in der Tiefe unter mir, wo es dunkel ist, etwas Gefährliches mich entdeckt hat und nach oben taucht. Es sieht schon das aufgewühlte Wasser durch meine strampelnden Füße. Aber ich muss ja strampeln. Sonst gehe ich unter. Dann schwimme ich eben an das scheiß Land zurück! -
Das Schleusentor zur Forensik hat sich geöffnet für einen weißen Handwerkerbus, der zum Feierabend zurück zu seinem Betrieb fährt. Die Sonne spiegelt auf seinem Dach. Gleichzeitig kommt eine Frau mit ihrer Tochter aus der kleinen Fußgängerschleuse. Sie waren zu Besuch hinter der Mauer. Erleichtert meint die Frau in Richtung Pförtnerhäuschen: „Da ist man doch froh, wenn man wieder draußen ist!“ Sie gehen Richtung Parkplatz, wo gerade ein dunkler Polo aus der Parklücke wendet, in dem ein Mann sitzt im schwarzen T-Shirt, der ungefähr so alt sein dürfte wie ich, der größer ist, kräftiger, und einen knochigen langem Unterkiefer hat. Er sieht eigenartig aus, wie ein Henker, aber er ist bestimmt cool. Ich tippe, er ist Forensikpfleger. Tief in seinem Fahrersitz hängt er und kurbelt in diesem Moment das Fenster herunter, während aus dem Radio schriller Heavy Metal läuft mit einer grellen Frauenstimme, die schreit: „Dann bin ich lieber Masochistin!! Dsch.Dsch.Dsch. Da.Da.Da. Dsch.Dsch.“ Er gibt Gas und rauscht davon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Beruf so belastend ist, wie mein Bruder meint.
Vom Fuße der Mauer sieht man den oberen Stock eines der orangenen Gebäude. Alle Fenster sind vergittert. Ich versuche, einen dieser Inhaftierten zu sehen, und bin mir sicher: Ich könnte seine Gefährlichkeit im Gesicht lesen oder erkennen an der Art, wie er sich bewegt. Mir würde er nichts tun; denn wer mich angreift, der verachtet sich selbst. Ich habe etwas Heiliges an mir.
Wegen der Hitze sind die Fenster geöffnet und in manchen hängen Handtücher zum trocknen. Es ist niemand zu sehen.
Auf dem Nachbargelände befindet sich eine Apfelplantage. Die Äpfel prahlen schon und locken. Ich steige über den Zaun, und stehle mir einen. Ich überlege, ob ich mehrere mitnehmen soll zum Wohnheim für meinen Bruder. Aber wie transportieren? Ich nehme doch nur einen, und esse ihn gleich, so als Genuss und als Erlebnis. Eigentlich habe ich keinen Hunger; aber in der Großstadt wird es wieder keine Apfelplantagen geben, den ganzen Herbst über.
Auf den Rückweg zum Wohnheim habe ich keine Lust. Ich bin müde, und will nicht ein zweites Mal genau dasselbe sehen. Die Parkanlage wirkt auch nicht immer inspirierend. Ich werde wieder genau wissen, wie weit ich noch joggen muss, und ich stecke mir Häuserecken und Wegkreuzungen als Zwischenziele, damit ich nicht auf der Strecke im Gras liegen bleibe und an innerer Ebbe verdurste. Immer dieses Zwingen und diese Disziplin.
Zurück in Berlin
Anfang Oktober fahre ich zurück nach Berlin, wo ich offiziell, gegenüber meinen Eltern und meinen Freunden, plane, das nächste Semester zu studieren, was ich auch wirklich versuchen will. Ich habe soviel Gepäck mit mir, wie ich tragen kann, und habe zuvor mit Freunden telefoniert, die mich für eine Zeitlang bei sich unterbringen werden, bis ich eine Wohnung gefunden habe.
In der ersten Woche wohne ich bei Konrad und seiner Freundin, in Neukölln, in der Nähe der Boddinstraße.
Meine Möbel stehen noch auf dem Speicher im Haus, in dem Patricia gewohnt hat.
Sie ist inzwischen zurückgezogen nach Frankenstadt, was sie mir im Frühjahr am Telefon mitgeteilt hat, als ich noch in Frankreich war. Sie wohnt jetzt mit Ludwig, Leela und dem Neugeborenen wieder in ihren Haus.
Zuerst hatte ich Angst um meine Sachen, die seitdem unbeaufsichtigt im Prenzlauer Berg stehen, in diesem Speicher. Dann dachte ich mir allmählich: Ich will versuchen keine Angst zu haben und weg von dem Selbstempfinden, ein pedantischer Materialist zu sein, der keinen Halt mehr findet, wenn ihm ein Regal verloren geht. Man hätte seit Frühjahr längst alles mitnehmen können. Sind die Sachen noch da, soll ich das Glück haben. Fürs Erste werde ich mich nicht darum kümmern.
Eigentlich wäre ich lieber in Grenoble geblieben, mitten in den Alpen. Die steilen Felswände am Stadtrand, die dreitausend Meter Gipfel im Panorama. Von der Bastille hat man sogar den Mont Blanc gesehen. Die einzelnen Tage zusammengerechnet war ich fast vier Wochen in den großen Skigebieten. Bei Schneesturm, noch an Ostern, bin ich mit Spaniern abseits der Piste durch den Tiefschnee und über Felsplatten gesprungen, und hatte einmal, als ich zwischen Bäumen stecken geblieben bin, echte Panik, dass ich den Ski nicht mehr finde. Es war kurz vor Liftschluss.
Im Sommer war es vierzig Grad heiß. Die Sonne hat soviel Kraft gegeben, dass ich im Gefühl war, ich bin zu allem fähig. Es gab keine Angst mehr. Im achten Stock eines Hochhauses saßen wir am Nachmittag zum Kaffeetrinken und aßen Pizza, nachdem wir einem Freund beim Umzug geholfen hatten. Der Druck der Hitze hat uns die Sprache verschlagen. Wir lagen matt jeder in seiner Ecke; und in der Gelähmtheit hatte ich trotzdem den geilen Wunsch, einen Dreier zu machen mit Julie und Vanessa, die mit ihren dunklen Augen wie faule rallige Tiere im Sofa hingen und nach Schweiß rochen.
Diese echte Clique hatte ich gegen Ende meines Aufenthalts gefunden - Franzosen, Kolumbianer, eine Vietnamesin und ab und zu zwei Kameruner. Wir trafen uns fast jeden Abend in der Fußgängerzone für gut verträgliche drei Stunden im Freien, keine gewollten Exzesse. Die Stadt war übersichtlich. Wir nahmen jedes Fest aus allen kulturellen Richtungen mit, und unternahmen am Wochenende Ausflüge ins Gebirge.
Ich bin aufgegangen in der französischen Sprache wie ein Kind, hatte immer mehr neue Vokabeln richtig parat mit passendem Artikel, ohne sie bewusst in einem Buch gelesen zu haben. Auf Französisch war ich jemand anderes.
Bis Ende August habe ich die Abreise hinausgezögert, nachdem das Austauschprogramm längst zu Ende war, bis ich den Eindruck hatte, in der Stadt bewegen sich außer mir nur noch die Geister aus diesem Jahr.
Bei einem Ausflug an die Côte d'Azur im Frühling habe ich nach zehn Jahren zum ersten Mal das Meer wiedergesehen.
Jetzt bin ich zurück, und sehe ernüchtert die pragmatisch wirkende, stabile kahle Architektur, und spüre, wie ich im kantigen Deutsch um meine Melodien kämpfe. Die Straßen sind zu breit und zu leer, und ich vermisse die durchtriebenen leuchtenden Augen der Französinnen, wenn sie auch dünne Beine haben. Hätte ich einen Plan, würde ich wieder dorthin gehen. Aber noch habe ich mein Studium, und ich will die Sache mit meinem Gesicht zu Ende bringen. Ich will fachliche chirurgische Informationen über meine Möglichkeiten.
Im frühen Sommer in Grenoble war ich nachmittags auf den Berg zur Bastille gejoggt. Geduscht stand ich danach vor dem Spiegel und band meine Haare zum Zopf. Da kam mir der Gedanke, dass ich meinen körperlichen Zenit erreicht habe, dass ich so stark wie jetzt nie mehr sein werde. Ich sah das Bild, dass ich auf dem Kamm eines Bogens wandere, und fragte mich, ob es für eine ganze Zeitspanne so ist, oder nur für den Moment, in dem ich unvorhergesehen daran gedacht habe. Verändert hat sich fürs Erste nichts. Es gab keine bemerkenswerte Reaktion in meinem Körper, so wie ein Muskelkrampf oder eine Emotion. Einige Wochen später kam ich zu dem Schluss, dass es Zeit ist, konkret zu werden, und nicht mehr zu überlegen, wer alles ich noch werden kann, wenn ich noch ein wenig warte und noch weiter wachse. In vier Wochen hatte ich danach ein Schriftstück verfasst, in dem ich meine Theorie zu meinem Gesicht begründet habe.
Kapitel III
halloooooooooo!
"Ich will mal eben da hin -mal eben nach Ostberlin"...ja, wir wären gerne noch länger dort geblieben!
Es war total schön. Ich habe mich am zweiten Tag selbst angezeigt, weil ich vorher im Supermarkt ein paar Kopfhörer habe mitgehen lassen. Na ja, Du kannst Dir vorstellen, wie dumm der Polizist aus der Wäsche geguckt hat, als meine Cousine und ich ihm das erzählt haben...war schon lustig, und das Verfahren wurde sofort eingestellt, weil wir uns selbst gestellt haben.
Nalli, also die Erbse, hat im Warteraum aus voller Kehle gesungen, bis wir zurück waren - das fand die Polizei natürlich auch merkwürdig. Hm, die werden uns nicht vergessen!
Ach ja, und wir ha'm auf'm Alex gespielt, weil wir Geld brauchten, da die Buße fürs Klauen sehr hoch war.
Und auch sonst haben wir überall gesungen.
Es geht uns soweit gut.
Hoffe, Du hast eine Wohnung gefunden!!Aber selber schuld bist Du schon.
Na denn, bis bald,
übrigens freue ich mich riesig, wir beide, (Erbse und - was neu ist - Lattich) dass Du uns so schnell schon schreibst!!
Liebe Grüße,
Erbse und Lattich
Fürs Erste bin ich im Prenzlauer Berg auf Wohnungssuche. In Patricias alter Wohnung ist ein Zimmer frei geworden. Sie gab mir den Tipp am Telefon, und ich konnte nicht Nein sagen - warum auch - es wäre voreingenommen und unvernünftig in meiner Situation. Überzeugt bin ich nicht, aber ich will auch kein Sturkopf sein.
Es erübrigt sich. Der neue Bewohner will es ziemlich sicher an einen Bekannten vergeben. Ich bin erleichtert. Ich hätte dem Angebot sonst nachgeben müssen.
In der Straßenbahn Richtung Friedrichshain sitzen in einer Vierergruppe neben der Tür, wo ich stehe, zwei Männer in Jeans, Kapuzenpulli und Turnschuhen. Sie sind beide Anfang zwanzig.
Einer schmilzt mit dem Feuerzeug ein Pulver in einem Stück Alufolie, das zu dampfen beginnt. Es interessiert mich, und ich trete näher.
„Folie rauchen, kennst D' nich'? Is' Heroin. Kannst mitrauchen.“
„Nee, danke. Jetzt nicht“, wobei 'jetzt nicht' ein Füllwort ist, um ihm nicht vor den Kopf zu stoßen als einer, der Heroin noch nie probiert hat. Er soll nicht auf die Idee kommen, ich könnte ein Zivilpolizist sein, und vor mir abhauen wollen. Das wäre mir unangenehm.
Ich will mehr erfahren, und bleibe still stehen in Erwartung, was er noch Witziges zu sagen hat. Sein Kumpel, der ihm gegenüber am Fenster sitzt, hat mit Gedanken zu kämpfen, die ihm scheinbar den Verstand zersplittern. Er hat den Kopf nahezu in den Schoß gebeugt, hält die rechte Hand an die Stirn und wippt ununterbrochen.
„Ich bin gerade auf Wohnungssuche.“
„Und, was zahlt man da so heutzutage?“, der mit hellblauen Augen redet mit überraschend klarem Verstand.
„Also so Dreihundert kann ich aufbringen.“
„Das ist ganz schön Kohle, Mensch. In 'nem halben Jahr ist das 'n Urlaub. So musst Du mal rechnen. Geh doch zum Amt. Die bezahlen Dir das.“
„Na ja.“
„Meister, ich wünsch' Dir was.“
Er zieht seinen Kumpel am Arm hoch Richtung Tür, und sie steigen aus.
Ein unverschämter Typ. Er ist jünger als ich und redet väterlich zu mir wie ein weise gewordener Berliner Kiezrentner. Seine Einstellung passt zu gut zum Wetter. Graue geschlossene Wolken schicken seichte Nebel in die Betonschluchten, sodass oben und unten zu einer fade Brühe wird. Gebirge gibt es um Berlin sowieso keine. Die Menschen hier wachsen nicht mit den stolzen Gefühlen auf, die man bekommt, wenn man mit Durchhaltevermögen einen Berg bestiegen hat, wenn man oben steht, knapp unter dem Gipfel oder auf dem absoluten Gipfel, dem höchst sitzenden Stein neben dem Kreuz, das Herzschlagen verschnauft, ins Tal schaut auf die Ortschaften, die von oben nur eine unbedeutende, winzige Möglichkeit sind; mit dem Daumen vor das Gesicht gehalten kann man sie zudecken. An manchen Tagen hat man sogar die Wolken unter sich, die zwischen den Hügeln dampfen wie Lava in der Urzeit.
In Berlin ist es gleichgültig, ob man arbeitet oder nicht. Hier ist alles eben. Wenn jemand an gute Werte glaubt, wird er verlacht, weil sie als massenhaft und kapitalistisch gelten. Die Lebenseinstellung scheint eine Wahl wie die, welche Musik man auflegt. Extravagant oder gegenteilig ist aus Prinzip immer besser.
Dieser Junkie kann sich selbst mit Sicherheit keinen Lebensunterhalt verdienen. Andere müssen ihn finanzieren. Meine Eltern zum Beispiel. Die Süddeutschen.
Es ist, wie mein Onkel, der Baulöwe, gesagt hat. Hier hat sich zur Zeit der Teilung, weil es keine Wehrdienstpflicht gab, eine Kultur aus Verweigerern und Querdenkern etabliert, die eingesessen ist und den wirtschaftlichen Fortschritt blockiert.
Ich strenge mich an, und habe mehr Ärger im Leben als dieser Junkie. Mein Studium muss ich in den Griff kriegen, wobei ich selbst schuld bin, dass mir meine Mutter kein Geld mehr gibt - ich weiß einfach nicht, was ich will.
Ein Nebenjob wird mich zusätzlich belasten, falls ich einen finde. Zweifel habe ich. Ich bin nicht mehr gewohnt, mir Arbeit zu suchen in Berlin. Bald werde ich am Boden sein. Heroin rauchen käme für mich schon alleine nicht in Frage, weil mir die Zeit und das Geld fehlen. Von wegen diese Junkies sind bemitleidenswert. Ihnen gehört gar keine Unterstützung.
na hallo!!
Hm, das war ja 'n toller Anfang!
kurze Frage: hast Du schon mal Heroin genommen??
Ich würde es Dir zutrauen; auch dass Du jetzt noch nicht so ganz clean bist; aber das ist ja egal.
Ich meine, ich finde es interessant, und Du scheinst mit dem Leben zurechtzukommen;
auch wenn Du jetzt gerade vor einem Problem stehst...=) aber das schaffst Du ja auch.
Mensch, und darum, dass Du in Berlin bist, beneide ich dich ganz schrecklich!!
Vielleicht fahre ich in meinen Winterferien auch wieder dorthin...eventuell auch nach Düsseldorf.
Morgen fängt die Schule wieder an, nachdem ich jetzt drei Wochen Ferien hatte.
Ich freue mich nicht so sehr darauf, da ich keine Lust zum Lernen habe...
Aber es wird sich auch wieder einpendeln; und schließlich kann man immer besser leben, je mehr man weiß...
oder von der Welt gesehen hat,
Ich würde jetzt am liebsten einfach loslaufen und niemandem sagen, wo ich hinlaufe - ja, ich würde es selbst nicht wissen!!
na ja...
jedenfalls liebe Grüße,
deine Verena
Ich hätte es mir denken können, dass sie mich so naiv wahrnimmt, dieses Mädchen. Einen richtigen Junkie hätte sie mit so einer schnell gebildeten Meinung wahrscheinlich obendrein gekränkt. Sie ist eine, die alles betrachtet und sich schnell wieder davon distanziert, ohne etwas von sich herzugeben, ohne darin haltlos aufzugehen. Wahrscheinlich denkt sie, dass alles ein Spiel ist, auch schlechte Gefühle.
Sie kann sich nicht vorstellen, dass etwas nie vergeht, weil jemand darin gefangen ist, und damit leben muss, ob er will oder nicht.
Ich habe Verena im Zug kennengelernt, zusammen mit ihrer Cousine Nathalie, als ich zu meinem Bruder ins WPZ gefahren bin.
Sie saßen auf dem Boden, und da sonst kein Platz war, habe ich mich dazugesetzt. Sie schauten mich aus erwartungsvollen Augen an; ich dachte, sie stehen auf mich, und fand sie sympathisch.
Sie kamen aus Bern, und wollten mit dem Schönen Wochenendticket nach Berlin fahren.
Verena hatte eine Gitarre dabei und wir sangen Yellow Submarine von den Beatles. Es hat Spaß gemacht, obwohl ich skeptisch war gegenüber ihrer Hippie Gesinnung, die mir inszeniert schien. Verena trug über ihrer Jeans einen siebziger Jahre Rock mit Blumenvintage und eine Tunika Mokka Bluse, dazu einen Turban. Alles war farblich gut abgestimmt und passte an sich zu dieser Bewegung. Aber die Bewegung ist Vergangenheit und nicht mehr eingebettet ins Zeitgeschehen. Ob Yellow Submarine ein richtiges Hippie Lied von damals ist, fragte ich mich auch. Ich hatte mich nie mit dieser Szene beschäftigt. Intuitiv würde ich sagen, es ist Pop, der die Bewegung kommentiert hat.
Ich wollte daran glauben, was die beiden Mädchen vorgaben zu sein, aber es schien mir, und vor allem jetzt, im Nachhinein betrachtet, austauschbar gegen jede andere Überzeugung, was geschehen könnte nach nur einem kleinen Schlüsselerlebnis, dass ihnen mehr Freude verspricht, worauf sie andere Kleidung tragen würden und von anderen Werten sprechen, zum Beispiel weil ihr neuer Freund sich in einer anderen Szene bewegt.
Verena ist eine Jugendliche, die sich schnell durchsetzen will und vielleicht auch kann.
Ein Hippie mit tieferer Überzeugung wäre wahrscheinlich nicht in der Lage, so selbstverständlich aufzutreten und Gitarre im Zug zu spielen. Dagegen würde er es an Orten tun, die gefährlich sind.
Für Verena ist es kurzes jugendliches Rebellieren gegen das Elternhaus.
Sex war auch Gesprächsthema und sie erzählte mir, wie sie mit ihren Freundinnen Männer in einer Bar schöne Augen machte und sie um ein Getränk bestach.
Sie probiert alles aus und macht es sich passend zu eigen.
Sie nannte sich Erbse nach dem Kitzler, und daneben gab es die Begriffe Pflaume und Rosine.
Ihre Cousine Nathalie mochte ich eigentlich lieber. Sie war zurückhaltender und nicht so lautstark. Ihre Nähe war mir angenehmer. Wir saßen auf dem Boden nebeneinander, haben ins gleiche Liederbuch geschaut, und es war schön, dabei ihr Bein zu berühren mit meinem. Ich hätte sie küssen sollen. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder, wenn die beiden nochmal nach Berlin kommen. Ich habe Verena nach Nathalie gefragt. Aber sie hat nicht darauf geantwortet. Ich schätze, sie ist eifersüchtig. Nathalie dürfte überhaupt eine Frau sein, die Männer lieber mögen als eine wie Verena.
Tja, und der Kommentar mit dem Junkie sollte mich nicht wundern. Mein Gesicht hat sich selbstverständlich nicht geändert, und wird es von alleine auch nicht. Mit vergangener Zeit gerät es nur immer wieder in Vergessenheit, dass es so ist, und ich bilde mir naiv ein, dass sich mein Ruf gebessert hat, weil ich mir mehr Mühe gebe.
In Frankreich habe ich solche Kommentare nicht ein Mal gehört. Das mag an der Mentalität der Franzosen liegen. Vielleicht ebnet so ein Gesichtsausdruck dort andere Bilder in den Köpfen, oder sie dachten sich dasselbe und haben es aus Höflichkeit verschwiegen; obwohl Franzosen einen makaberen Humor auspacken können, der dann, im Gegensatz zum Deutschen, keine Tabuthemen mehr kennt, der mit passendem Sprechrhythmus und Überzogenheit alles ins Komödiantische ziehen will.
Ich werde es Verena nicht übelnehmen, entscheide mich, sie niedlich zu finden, aber nicht ganz ernst zu nehmen.
Kapitel IV
Meine Mutter ruft mich an und fragt noch einmal, ob ich Anfang Dezember zu Besuchen kommen werde. Unsere ehemaligen amerikanischen Nachbarn aus Willkürheim, die inzwischen wieder in den Staaten leben, haben sich angekündigt. Ich sage ihr, dass ich wahrscheinlich nicht kommen werde. Ich könne es mir durchaus noch einmal überlegen, aber sofern ich mich nicht von mir aus noch einmal telefonisch melde, solle sie damit rechnen, dass ich nicht komme.
Für mich selbst spüre ich keinen Bezug zu diesen Leuten. Mein Bruder hat viel mehr mit ihren Kindern gespielt, weil er mehr in deren Alter war. Außerdem wüsste ich nicht, was ich über mich berichten sollte. Es wäre mir peinlich. Sie dachten, wie alle früher, ich hätte große Begabungen und die Fähigkeit zu mehr.
Es ist Freitag Abend. Engin hat mich zu einer Technoparty im Ada-Molg überredet.
Das Ada-Molg ist ein dichter, verrauchter, feuchtwarmer dunkler Club in den Torbögen des S-Bahn Viaduktes, in der Nähe der Jannowitzbrücke. Es hat sich inzwischen etabliert und ist angesagt in der Szene.
Ich stehe da an der Wand und trage demonstrativ Kleidung aus Frankreich, in der ich mich, seit ich den Club betreten habe, als Außenseiter fühle; mein hellblaues, weiß gestreiftes, glänzendes Hemd mit weißen Brusttaschen, eine blaue Jeans und die Schweizer Halbschuhe mit Nähten.
Berlin von früher liegt hinter mir. Gelangweilt drehe ich meine Bierflasche in der Hand, rupfe am Etikett, und will gar nicht nach oben schauen.
Ein junges Mädchen kommt auf mich zu, und spricht mich an:
„Hey, Kann ich mal einen Schluck!?“
„Klar.“
Meine zuvorkommende Geste langweilt mich. Ich bin mir zu passiv, genieße aber ihre Aufmerksamkeit. Sie trinkt einige Schlücke zu viel aus meiner Flasche, um höflich zu sein, und sagt schnippisch:
„Dankeö!", und verschwindet in der Menge der Tanzenden mit einem rebellischen Grinsen, als hätte sie einem kapitalistischen Bänker aus New York das Handwerk gelegt. Es macht mich wütend, und ich würde ihr am liebsten nachlaufen, und das Bein stellen, damit sie auf ihr Mundwerk fällt und wahrscheinlich aus allen Wolken vor Staunen, zu was ich fähig bin.
Ich bin eigentlich der, der die Szene verstanden hat. Seit zwölf Jahren bin ich im Nachtleben unterwegs. Früher hätte sie mich irritiert und voller Ehrfurcht angestarrt, weil ich der Paradiesvogel war, dem sie alles zugetraut hätte, was sie in den Büchern über die Szene gelesen und wovor sie Heidenrespekt gehabt hätte; in ihrem olivfarbenen Top, sportlich blauer Jeans, weißen achtziger Jahre Retro-Turnschuhen und aschblonden kinnlangen Locken.
Ich dachte zuerst, sie sieht ein wenig aus wie Paula. Aber nicht wirklich. Ich vermute, sie ist über ältere Freunde in die Szene gekommen, hat keine Ahnung von Musik, bewegt sich steif zum Rhythmus oder gar nicht, angepasst in der Armee aus Alternativen, die unter sich alle das gleiche denken und reden, auch nicht reflektierter als der Mainstream, der am Kudamm einkaufen geht, alles ohne Wiedererkennungswert. Es geht wieder nur um soziale Anerkennung. Sie ist im Grunde genommen intolerant. Wenigstens hat sie gespürt, dass ich ihr überlegen bin, und hat sich deswegen verzogen.
Ich blicke um mich. Die monotone, fade Musik ist langweilig. Sie kommt nicht in Schwung, und die Partygäste versuchen krampfhaft weiter daran zu glauben. Sie setzen an zu tanzen, brechen wieder ab, stehen herum und schießen von ihren neuen Smartphones Bilder, um sich bei Laune zu halten. Engin gehe ich aus dem Weg, damit ich nicht von der Party heucheln muss. Außerdem will ich ihn nicht nerven, indem ich mich an ihn hänge. Er könnte merken, dass ich sonst keinen kenne, und mich für einen langweiligen, verzichtbaren Typen halten. Ich beschließe zu gehen.
Kapitel V
Am frühen nächsten Nachmittag bin ich auf dem Weg zum Hallenbad an der Landsberger Allee. Ich will fünfzig Meter Bahnen schwimmen. Ich brauche Sport.
In der U-Bahn, wo mittlerweile Monitore angebracht sind, über die Werbung läuft und kurze Schlagzeilen, gibt es wieder einen Bericht über Pete Goldman, wie zur Zeit fast täglich.
Er dreht einen Film in der Stadt, und lebt solange hier mit der Familie. Die Dreharbeiten haben begonnen, als ich noch in Frankreich war, und neigen sich schon dem Ende.
Er äußert sich heute begeistert zu Berlin:
Es sei aufregend mitzuerleben, wie hier eine neue Metropole entsteht.
Da er es ist, der diese Aussage macht, will ich sie ihm nicht übelnehmen, obwohl ich, bei aller gewollten Sympathie für ihn, nicht zustimmen kann.
Nicht für alle entwickelt es sich so gut hier. In Berlin herrscht über zehn Prozent Arbeitslosigkeit. Es gibt kaum Industrie. Die Stadt lebt vom Länderausgleich und meinetwegen ihrem Ruf als Feiermetropole, an dem aber nur die Gastronomie verdient, was nicht allzu viel sein dürfte.
Die Leute werden ihm trotzdem glauben, weil er einen intelligenten und vernünftigen Eindruck macht. Meinetwegen. Andererseits ist es leicht zu behaupten für einen, der sich in der Oberschicht bewegt, und Kapital investieren kann, das sich über Spekulation vermehrt in Projekten, die vielleicht gar nicht greifen, und wofür er trotzdem Gewinne abschöpfen kann. Vielleicht hat er mit dem Bürgermeister angestoßen und ihm diese Schlagzeile versprochen.
Ich vermute, es gab dieselbe massive Werbung für den Ruf der Stadt schon in den Goldenen Zwanzigern, sodass auch diese gar nicht so golden waren und Berlin schon immer eine Blase.
„Berlin jewesen, toll jewesen!“, mein Großvater sagt das immer so neckisch, und es dürfte seinen Grund haben.
Wer will bei diesem dauerhaft schlechten Wetter schon arbeiten gehen und sich entfalten. Die Körper werden träge, und man kann es nur erzwingen. Vielleicht sind deshalb das Militär und die Bürokratie in Preußen besonders kultiviert worden, vielmehr als das Theater, was immer gerne vorne angestellt wird. Hier entsteht keine Metropole.
In der Schwimmarena, an der Kasse spricht mich die Kassiererin mit 'Sie' an, und fragt wegen der Ermäßigung nach meinem Studentenausweis. Das kam noch nie vor. Bin ich auf einmal soviel älter geworden, und könnte ein operiertes Gesicht diesen Eindruck vermeiden?
Im Foyer des Umkleidebereichs schaue ich zweimal für länger in den Spiegel. Damit niemand meine Eigenart bemerkt, simuliere ich, dass ich Pickel auf meiner Haut suche.
Ich ziehe meine Schuhe aus und die Socken, um nicht zu rutschen im Barfußbereich. Ich bin in Gedanken versunken, und habe auch das linke Hosenbein schon ausgezogen, als ich mich besinne, dass ich noch im Foyer stehe. Mit gesengtem Blick und tief ausgehauchtem Atem, wobei ich die ausgestreckten Hände auf Beckenhöhe konzentriert nach außen führe als Meditationsmeister, versuche ich erhaben zu wirken und mir nichts anmerken zu lassen.
Ärger verschafft sich Raum, denn es reagiert keiner auf dieses Missgeschick. Das ist auch typisch für Berlin. Wenigstens Einer könnte lachen oder mich kommentieren, und damit zurückholen. Alle schauen verhalten weg, als würden sie mich verachten. Ich finde nicht, dass so etwas mit Toleranz zu tun hat. Es ist Gleichgültigkeit und Trägheit. Das Wetter dringt in die Menschen ein und macht sie unflexibel, sodass sie nur noch Melancholie kennen als das höchste aller Gefühle.
In meinen Jackentaschen krame ich nach dem Eurostück für den Kleiderschrank, das ich bei der Kassiererin gewechselt habe. Ich will es sicher in der Hand halten.
Eine Frau mit Mann und Kleinkind organisiert gegenüber im Gang ihr Gepäck. Ihr Mann trägt das Kind auf dem Arm und sie kommandiert ihn:
„Kannst Du vielleicht jetzt mal die Tasche nehmen und den Baggi schieben!?So!“
Und was hat sie zu tun? Der Mann nimmt es ohne Worte auf sich, und wirkt hinter seiner Nickelbrille wie ein dünnes Kaninchen. Ich stehe kurz davor, sie in seinem Namen anzubrüllen:
„Eine wie Du frisst Kinder!“
Sie ist einer dieser typisch deutschen Drachen; blond, wuchtig im Körperbau, wuchtiger als er; frustriert, wahrscheinlich auch sexuell, was sie alles vorwurfsvoll auf ihn ablädt.
Ich ziehe mich um, wobei ich mich weiter im Spiegel anschaue. Vor den Spinden weiche ich den Blicken der anderen Männer aus, weil ich den Eindruck habe, sie schauen mich seltsam an. Ich bin nicht der, für den sie mich möglicherweise halten. Sie sollen am besten denken: „Er reagiert nicht, also ist er es nicht.“
In der Schwimmhalle taste ich mit den Füßen in das Wasser. Es ist kalt. Ich brauche mehr als zwanzig Minuten, bis ich mich überwunden habe, währenddessen ich lange auf der Bank am Kopf der Halle sitze und grüble. Zum Glück springe ich noch hinein; als ich schon mit dem Gedanken spiele, dass ich heute einfach nicht kann und vielleicht nach Hause gehen sollte.
Fünfundzwanzig Bahnen will ich möglichst schnell schwimmen; Brust, Kraul, Rücken, Schmetterling.
Beim Wenden am Kopf des Beckens und auch in den Bahnen schaue ich einer Frau nach, wenn immer sie nicht schaut; und ich habe das Gefühl, sie tut dasselbe.
Ab Bahn einundzwanzig sehe ich sie nicht mehr. Als Alibi, ihr nicht hinterherzulaufen, schwimme ich noch eine Bahn, verlasse die Halle und ziehe mich schnell um.
Wie gehofft, sehe ich sie am S-Bahn Steig. Sie fällt mit ihren leuchtenden braunen Augen deutlich auf zwischen dem Rest der Wartenden mit deren mattem, grünstichigem, für mich typisch preußischen Teint.
Noch hält sich in mir die französische Redelust. Sie freut sich, dass ich sie anspreche, und wir fahren zwanzig Minuten gemeinsam bis nach Berlin-Mitte. Ich lüge und ignoriere meine Station, damit ich länger bei ihr bleiben kann. Ich spüre, ich muss behutsam mit ihr umgehen, und frage sie nur nach ihrer E-Mail Adresse. Sie gibt sie mir, und ich bin glücklich.
Hallo Lara-Maria,
hier ist Michael vom Schwimmen gestern. Ich bin vor vier Stunden aufgewacht, habe zwei Stunden im Halbschlaf in diesen verwirrten Gedanken und Träumereien alles Mögliche teilweise in Schwerelosigkeit erledigt, wobei mir immer schwerfällt, doch aufzustehen. Auch die zwei darauf folgenden Stunden, bis jetzt, sind ohne nennenswerte Handlungen verstrichen. Ich sollte besser das Licht in diesem Zimmer einschalten. Es scheint nur mäßig hell durch den Innenhof. Dass wir Tag haben, und immerhin schon halb zwei nachmittags auf der Uhr steht, hat mich persönlich noch nicht erreicht. Eigentlich hab' ich wenig unternommen gestern Abend. Der Tag war mir lebhaft genug. Ich habe zweimal Bekannte auf der Straße getroffen, ein Zufall, der mir in Berlin wohl mein ganzes Leben nicht mehr passieren wird. Einer hatte seine neue Freundin mit, die beiden anderen spielen nun in der zweiten Mannschaft des FC Lichtenberg 08 Fußball, nicht mehr in der dritten.
Eine riesige Schlange gab es noch am Alexanderturm, fast so lang wie gewöhnlich vor der Reichstagsglaskuppel, was, wie ich schon gemeint hatte, an der fortschreitenden Amerikaner Invasion in der Stadt liegen könnte. Mein Kumpel mit seiner Freundin meinte, die Deutschen würden das verwaschene Englisch aus Stilgründen schwadronieren. Ich mag den britischen Akzent mehr, obwohl ich ebenso immer den amerikanischen spreche. Nächste Woche werde ich umziehen, nach Moabit, und dort beim nächsten Kumpel auf der Couch schlafen. Er braucht das Zimmer nicht oft. Was Eigenes zu finden wäre mir trotzdem lieber. Ich schreibe Dir noch meine Telefonnummer auf (0168/65659365678), und meine E-Mail Adresse siehst Du ja. Wenn Du magst, könnten wir morgen oder am Dienstag, oder wenn es Dir gelegen ist, was unternehmen, an irgendeiner Stelle aus der Bahn steigen und durch die Stadt spazieren; danach vielleicht noch Kaffeetrinken würde ich gut finden. Vielleicht weißt Du Bescheid, wo Ausstellungen stattfinden. Da kenne ich mich zu wenig aus. Andere Ideen?
Viele Grüße,
Michael
Sie antwortet einen Tag später.
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Mail.
Bist Du gut ins Semester gestartet? Und kommst Du gut voran mit der Wohnungssuche?
Ich habe viel zu tun bei der Arbeit und bekomme häufigen Besuch aus der Schweiz. Meine Wochen hier in Berlin kann ich bereits an einer Hand abzählen. Von daher habe ich von meiner Seite nicht so das Interesse an einem Treffen. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Eine gute Zeit und liebe Grüße,
Lara-Maria
Das halte ich für eine Ausrede. Sie traut sich nicht zu sagen, dass sie mich nicht gut findet. Oder warum war sie dann so freundlich in der Bahn? Wahrscheinlich hatte sie Angst, unfreundlich zu sein. Sie kann doch nicht, ohne mich zu kennen, mit dem Gedanken an eine feste Beziehung spielen. Das ist überheblich.
Sie ist zu vermenschlicht, ein empfindliches Vöglein. Eine kurze Affäre wäre doch in Ordnung. Sex dauert höchstens zwanzig Minuten! Ich kann nichts anfangen mit Frauen, die so etwas Helles Ängstliches ausstrahlen. Leider bedauere ich das immer wieder, denn ich finde sie reizvoll, weil sie lebendig wirken und verspielt sein können.
Sie provozieren einen Mann, und lassen ihn abblitzen, als sei er ein böser Vergewaltiger. Selbst spielen sie die Hilflosen mit heller Stimme, die voll falschem Herz klingt. Sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, obwohl sie keine Probleme haben, außer dem, dass ihre Schminke nicht richtig sitzt. Auch in Frankreich haben meine Frauen in ihrer Ausstrahlung deutlich Zugang zum Dunklen in der Seele gehabt.
Manchmal wundert es mich, dass solche Pipimädchen dann doch einen Freund haben, der noch größer und breiter ist als ich. Für gewöhnlich sind die Augen dieser Typen aber harmlos. Daran liegt es.
Ich merke, ich steigere mich in die Situation. Lara-Maria war nicht so. Es ist schade, dass sie geht. Und es wundert mich leider nicht, dass ich auf eine Frau stehe, die aus einer Gegend kommt, die nicht weit weg von Grenoble liegt.
Ich habe keine Hoffnung, dass ich in Berlin noch einmal ernsthaft an einer Frau interessiert sein werde. Das Blonde Mädchen aus der Modersohnstraße ist bestimmt weggezogen. Berliner, die ihren Horizont erweitern wollen, sehnen sich auch nach einer anderen Gegend. Sonst bleiben sie Lokalpatrioten, die sich wahrscheinlich für besonders kosmopolite Großstädter halten.
Kapitel VI
lieber Michael,
erst mal vorweg, dass es nicht verletzend gemeint sein kann, denn ich verurteile so ein Leben nicht.
Ja, manchmal wünsche ich mir im Geheimen, so etwas mal zu erleben, auf der Straße wohnen, ums Überleben kämpfen, in Gefahr und abgeschwebt in irgendwelchen Welten.
Ich bin zu vernünftig erzogen, so etwas zu tun, doch oft ruft es mich.
Es ist langweilig in unserer Gesellschaft.
Wir passen uns an, alle sind gleich, wir gehen nur auf Konkurrenz, und tun dabei Dinge, die so hirnlos sind, dass man den Platz sowieso einsparen könnte (für das Gehirn).
Das ist auch der Grund, warum ich einfach loslaufen möchte.
ich will etwas erleben!!!!!!!
Nun dazu, dass ich diese Junkievermutung hatte.
Ich meine, es gibt nicht viele Erwachsene, die so 'rumlaufen wie Du.
Mich hat es sofort interessiert; es sah nicht nach einem angepassten Menschen aus, abenteuerlich; und wer setzt sich auf den Boden, hängt mit irgendwelchen Hippies 'rum (womit wir gemeint sind),
fährt im Zug ohne Fahrkarte los etc. ...
Aber Du siehst schon, das ist auch so ein Klischeedenken...jedenfalls hatte ich den Eindruck, es könnte sein.
Aber was Du ebenfalls merkst, dass Du das durchaus als Kompliment verstehen kannst...
Na ja, so viele Erfahrungen habe ich nicht; ich kiffe ab und zu, und trinke zwei drei Bier, das wär' 's.
Wie läuft bei Dir sonst so das Leben??
Sag mal, wolltest Du dich schon mal ernsthaft umbringen??
Nicht dass ich das vermute, es interessiert mich nur, und das frage ich viele Menschen.
Nur eben meistens Leute in meinem Alter, da sie in deinem Alter nicht mehr offen für solche Themen sind.
Nun ein ebenfalls abrupter Schluss,
viele liebe Grüße,
vreni
Respektabel, dass sie einsieht, dass sie nicht wirklich etwas versteht von den Orten, die sie so faszinierend findet.
Ich kann mir vorstellen, dass es anstrengend sein muss, als Jugendlicher täglich in der Schule zu sitzen und sich die Lebenstriebe unterdrücken zu lassen.
Alte Freunde
Konrad braucht das zweite Zimmer, weil die Eltern seiner Freundin zu Besuch kommen. Mit meiner Reisetasche, dem Koffer und dem Rucksack mache ich mich auf den Weg quer durch die Stadt, zu einem anderen Bekannten aus Willkürheim, Silver, der für seine Diplomarbeit ein halbes Jahr in Berlin wohnt. Er hat das Wohnzimmer frei.
Am Alexanderplatz fällt mir wieder auf, wie viele Amerikaner in die Stadt gekommen sind, seit ich 2007 abgereist bin. Möglicherweise hat es auch mit dem Aufenthalt von Pete Goldman für den Filmdreh zu tun. Er ist sicher auch für sie ein Trendsetter.
Wenn ich durch Menschenmengen gehe, habe ich den Kopf inzwischen meistens gesenkt, um mich auf die Schritte zu konzentrieren.
Blicke ich nach oben, habe ich den Eindruck, sowohl Frauen als auch Männer starren mich für einen Moment zu lange an, um mich nur als belanglosen Passanten wahrzunehmen; sie blicken aus allen Richtungen. Ich verliere mich in den Blicken und erschrecke, sodass ich im Gehen zur Seite wanke. Das ist mir äußerst unangenehm. Es ist eine Verwechslung.
Oft bleibe ich in den Blicken von Frauen mit blauen Augen festhängen, die energisch wirken wie strenge Königinnen. Ich suche den Flirt, halte dem Blick immer stand und fühle nichts, weswegen ich glaube, dass mein Interesse an Frauen allmählich weniger wird. Manchmal kreisen mir dabei die Begriffe Revanche oder Rivalität im Kopf. Das irritiert mich.
Photographieren sich Touristen, mache ich einen großen Bogen mit höflicher Geste, worauf sie niemals reagieren. Ich will auf keinem Bild zu sehen sein, auch nicht im Hintergrund. Es wäre immer verkäuflich an eine Pressagentur.
Ich steige in die S-Bahn, und sehe durch das Fenster und den Glasbogen des Bahnhofdaches die Fassade eines Kaufhauses, über der ein großes Banner hängt mit Werbung für eine hauseigene Modemarke. Ich werde nervös. Das männliche Modell ist so ablichtet, dass es Pete Goldman ähnlich sieht, obwohl die Haarfarbe unterschiedlich ist und der ganze Typ. Ich schreibe ihm weniger Intelligenz und Reflektiertheit zu, als dem Original.
Ich tippe, dieser junge Mann ist begeisterter Surfer, und studiert etwas mit Wirtschaft, sodass er mithalten kann in der Gesellschaft. Den Job als Modell nimmt er nebenbei gerne an, und bildet sich ein, mit naiver Freude, er könne groß werden und Ruhm ernten, obwohl er dafür nicht außergewöhnlich genug aussieht.
Was wäre, wenn ich durch dieses Kaufhaus marschieren würde. Möglicherweise entdeckt man mich gleich, der Kaufhausdetektiv, oder der Manager, der sich wahrscheinlich auch zuweilen in den Verkaufsräumen aufhält; man spricht mich an, und will sich mit mir ins Büro setzen; man zwingt mich dazu, weil man sich diesen Coup mit mir nicht entgehen lassen will. Vielleicht sollte ich dieses Kaufhaus nie wieder betreten.
Nun wieder geistesgegenwärtig merke ich, wie ich einer Frau in den Rücken starre, die neben der Tür steht.
Ich versinke wieder in Gedanken, und sitze unseren ehemaligen amerikanischen Nachbarn aus Willkürheim am Tisch gegenüber, in unserer Wohnung von damals.
Schon mit acht Jahren habe ich sie fasziniert durch meine Fähigkeiten in der Schule und beim Legotechnik spielen, obwohl ich die Modelle immer nur möglichst schnell nach Anleitung aufgebaut habe, und nichts Eigenes entwarf.
Inzwischen habe ich mir das Gesicht umoperieren lassen und gleiche dem größten Idol ihres Landes. Ich bin überzeugt, dass ich sie beeindrucke, und habe Angst, dass ich nichts mehr wert bin.
Neben mir steht der rote Lego-Hubschrauber mit blauen Sitzen. Das Kurbelrad für den Rotor konnte man zusätzlich mit einem Motor versehen. Ich hatte zwei Motoren von einem anderen Modell, und versuchte, nach eigener Erfindung, auch einen für die Rettungsleine einzubauen, fand aber keinen geeigneten Platz, sodass ein Gummi oder Zahnräder die Kraft hätten übertragen können. Die Spielzeug Motoren sind nicht besonders stark. An sich war jeder Baustein im Plan genau passend von einem Profi-Entwickler kalkuliert. Es gab keinen Platz für zusätzliche Ideen.
Ich hätte das ganze Modell von unten her anders aufbauen müssen. Dafür scheute ich die Mühe.
Es hätte zu viel Zeit gekostet.
Ich verdränge das bizarre Bild mit einem blitzartigen Beißen in die Luft.
Realistisch betrachtet werde ich keine Zeit haben, Anfang Dezember nach Bad Kesselstadt zu fahren. Ich kann frei entscheiden, die Bekannten nie wieder zu sehen, auch wenn ich eines Tages berühmt sein sollte und die USA bereise.
In einem Fernsehinterview erkläre ich jetzt der Journalistin, dass wir, als ich Kind war, diese amerikanischen Nachbarn hatten, und ich deshalb mit der amerikanischen Kultur teilweise aufgewachsen bin. Ich kenne Chocolate-Chip Cookies und Dr. Pepper Cola. Ich habe ein bodenständiges Verhältnis dazu.
„Was ist ihnen an den Amerikanern als Erstes aufgefallen.“
„Na ja, ich würde sagen: Sie gehen mit Badehose in die Sauna, wie die Franzosen auch. Wir bei uns haben mit Nacktheit weniger Probleme. Ja, ich bin stolz, deutsch zu sein.““
Es ist die Beobachtung eines Kindes, die mit einfachen Worten viel aussagt, wenn man darüber reflektiert. Das ist cool. So wird mein Ruf sein, wenn ich berühmt bin. Es ist eine Spezialität. Big words fool little people.*1
Die S-Bahn fährt an Richtung Bellevue. Das Muskelgewebe in meinem Gesicht ist stark verkrampft. Eine Operation wäre dringend nötig, aber ich muss mir klarmachen, dass ich mir keine leisten kann, bis ich als Diplomingenieur kreditwürdig bin. Das wird mindestens noch drei Jahre dauern. Gute chirurgische Informationen könnten mich beruhigen. Ich bräuchte dann mittelfristig nichts mehr zu erzwingen, weil der Plan vollendet auf Abruf bereitsteht.
Wenn ich nach oben blicke, habe ich wieder das Gefühl, aus verschiedenen Ecken starren mich Leute an. Es sind wieder die typischen Gesichter, die bei Pete Goldmans Filmpremieren am Zaun stehen würden. Falls mich jemand heimlich photographiert, würde ich eingreifen und ihm die Kamera aus der Hand reißen.
Ein Mann oder ein Junge, ich weiß wieder nicht, wie ich diesen modernen Typ von Mann bezeichnen soll, steht mit einem Mädchen, vermutlich seine Freundin, am Ende des Abteils. Sie halten sich die Hand, und heben sich an der Stange fest. Er hat eine Zeichenrolle um die Schulter gehangen, trägt ordentliche Mode, riskiert also nichts; Turnschuhe, blaue Jeans, ein Hemd, eine Sportliche Jacke und, wie viele seit neustem, eine Beatle-Frisur. Er sieht nicht vollständig unsympathisch aus. Sein heller unsicherer Blick in den blauen Augen wandert mehrmals schüchtern zu mir; und nur ganz vorsichtig schaue ich auf aus meinem Sitz, damit ich ihm nicht zu viel Hoffnung mache, er könnte mich kennenlernen. Ich möchte nur kurz in seiner Verehrung für mich baden. Sein naiver Blick geht mir auf die Nerven. Er ist ein Typ, der dabei sein will, der aber keinen Schneid hat, sich durchzusetzen, weil er zu häuslich ist. Er will seine Freundin haben, und sich geschützt als Pärchen bewegen; sich immer absprechen mit ihr, bevor er etwas äußert, sodass er es harmonisch und sicher hat. Wahrscheinlich ist er überzeugt, dass er ihr für immer treu bleiben kann.
Ich soll ihm scheinbar nun aus diesen Umständen helfen, denn ganz zufrieden scheint er mit der Rolle nicht zu sein; Großstadtluft schnuppern reizt ihn ja scheinbar doch.
In mir sieht er einen, der schon viele unverbindliche sexuelle Beziehungen hatte, Drogen probiert und in Clubs von organisierter Bildung unabhängige Wege gesucht hat, der sich von Mutter und Vater entfernt hat, und der die Schattenseite kennt.
'Übernimmst Du dich nicht?! Du bist doch jetzt schon eifersüchtig; und ich habe deine Freundin nicht eines Blickes gewürdigt. Obwohl ich weiß, dass sie an mich denken wird, wenn sie heute noch mit Dir schläft; falls Du das hinkriegst, und nicht beleidigt davon läufst, wenn sie Dir offen sagt, dass sie mich süß fand.'
Ich fühle mich so geschmeichelt, dass es mir kalt wird. Ich bin soweit oben, und doch geheimnisvoll in der öffentlichen Bahn unterwegs, als sei ich ein gewöhnlicher Stadtbewohner.
Glenn Pablo kenne ich und die ganze Schickeria aus Hollywood. Ich wurde in den Kreisen als Spektakel präsentiert und war auf vielen privaten Geburtstagen, unter anderem in diesem Strandhaus am Pazifik. Kurz stehe ich dort im Wohnzimmer, und schaue weiter diesen jungen Mann aus der S-Bahn an.
'Es wäre durchaus möglich, dass ich die Kontakte habe zur Gesellschaft, die dein Traum ist. Denn ich bin vom Typ her, rein optisch und vom Charakter, nicht weit weg von denen. Aber Du gehörst da nicht dazu. Und sei doch froh! Öffne niemals die Tür zur anderen Seite! Dort wird deine Illusion begraben werden, so eindimensional wie Du denkst; träumst von einem modernen zu Hause, hoch oben, mit wahlweise schwarzem Granitboden im Badezimmer; und das alles denkst Du, kannst Du erreichen, wenn Du nur immer zielstrebig dein Studium machst und an das Gute glaubst, wozu die Liebe scheinbar auch gehört. Wahrscheinlich bist Du vom Land und hast dich gerade an der Uni eingeschrieben.
Ich spiele nicht den begehrenswerten Freund für dich und deine Freundin, den man dann mal schüchtern zum gemeinsamen Essen einladen kann. Meine Freundschaft ist etwas besonderes, das ich nicht jedem geben will und nicht geben kann, der mich gerne kennenlernen will. Was glaubst Du, wie viele sich das wünschen. Wann soll ich denn noch arbeiten gehen?
Kurz und gut: Ich bin einfach keine zwanzig mehr, so wie Du vielleicht, auch wenn ich jung aussehe. Das Vorbild für junge Menschen, weil scheinbar einer wie sie - so denkst Du nämlich - muss sich selbst auch weiterentwickeln. Verstehst Du? Du Träumer. Jaja, ich bin polarisierend, ich weiß. Ein alter ausgedienter Prominenter bin ich, der seine Rolle abschütteln will. Am liebsten würde ich gar nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen; wegen Leuten wie Dir!'
Seine Freundin ist daneben süß und tragisch, weiche blasse Haut, zarte Gesichtszüge, blond rötliche lange Haare, und trägt einen hübschen schwarzen Blouson-Mantel. Es tut mir leid, aber auch mit ihr wüsste ich nicht, was ich anfangen sollte.
'Das ist hier kein Liebesfilm. Glaubst Du, weil ich so weich bin und gutmütig ausschaue, dass ich auch deinen Traum erfülle? Hilfst Du mir dann auch? Du hast keine Vorstellung, was es wirklich kostet, den Traum zu verkörpern. An meiner Seite zu stehen würde dein Albtraum werden. Jahrelang dieselbe Geschichte. Bleib schön bei deinem Freund. Ich werde nicht hastig mit den Händen vor euch gestikulieren und aus meinem Leben erzählen, während Du seine Hand hältst, an seine Seite gekuschelt bist und schweigend zuhörst, wobei ich mir noch unglaubwürdig vorkommen muss, während ihr nur schweigt! Lese ich etwa noch Mitleid in deinen Augen?! Ich bin kein exotisches Tier, das man sich gemeinsam vorsichtig betrachtet, gerne anfassen würde und sich nicht traut. Du jedenfalls.'
Ein Technobeat wallt in in mir hoch und ich bekomme Gänsehaut entlang der Halsschlagader.
Ich bin der Maniac!
Als ich aussteige wünsche ich mir noch ein letztes Mal den Blick der beiden. Die Hand entgleitet mir und öffnet sich zum Winken als Freund. Ich krampfe sie fest und zische ein: „Aäh!" vor mir nieder, was ich sofort kommentiere mit innerer Stimme, als hätte ich etwas Saures verschluckt: „Nicht albern werden!", und ich balle die Faust im Ärger.
Ich bin froh, als die Bahn wegfährt, und senke den Blick wieder zum sicheren Steinboden.
Silver hat gleich für den Abend eine Karte für mich übrig zum Bundesligaspiel. In sieben Jahren war ich nicht einmal im Stadion. Zugezogene haben manchmal gute Ideen, solange sie noch die Möglichkeiten der Großstadt sehen. Wir sind zu fünft. Alles Willkürheimer. Unter anderen kommt Chris, der für eine Tagung in Berlin ist. Er war zwei Jahrgänge unter mir, und ist der Erste, den ich persönlich kenne, der wohlhabend geworden ist. Er ist zweiter Vorstand einer großen Headhunter Firma, und war sogar in einer Fernsehreportage zu sehen. Es ist das große Gesprächsthema, bevor wir ihn am Westkreuz treffen. Silver gibt ihm Zuspruch: Dass er es verdient hat. Er hatte den Mut, obwohl er belächelt wurde. Er arbeite hart. Nach einer durchgezechten Nacht müsse er früh schon wieder Telefonate führen mit einem Scheich; und das sei auch nicht für jedermann. Trotzdem sei er der alte geblieben, auch wenn man ihm den Stress anmerkt. Betrunken wollte er vor zwei Tagen abends in Neukölln einen Einkaufwagen in ein parkendes Auto rammen. Zu dritt hätten sie ihn zurückgehalten. Später gab es auf seine Rechnung für alle Pizza und Getränke.
Ich finde die Begeisterung liebenswert. Wahrscheinlich weil sie von Silver kommt, klingt sie nicht so klischeehaft, wie ich sie erwartet habe. Ich selbst könnte mich so offen nicht äußern.
Wir treffen Chris. Er trägt einen Anzug und einen gelb und violett bestickten Schal aus feiner Wolle. Von früher kenne ich ihn nur in Blue Jeans und College Jacke. Er hat zugenommen, und steht deutlich unter Stress. Alle Ansätze für Gespräche handelt er schnell ab mit einem passenden Kommentar von einem, der geübt ist in unverbindlicher Kommunikation. Dann schaut er wieder in die Bäume, die an der Böschung stehen, und isst seine Bratwurst. Dazu streckt er den Hals nach vorne, damit ihm kein Ketchup auf den Anzug tropft. Er hält die Wurst in der Serviette kraftvoll mit der ganzen Hand von unten, sodass sie, wenn er zum Biss ansetzt und mit der Hand etwas Druck gibt, gleichzeitig in den Mund flutscht.
Er scheint gern mit uns unterwegs zu sein, aber er ist nicht unter uns. Ständig tippt er Nachrichten in sein Smartphone. Er als Geschäftsmann hat selbstverständlich schon eines.