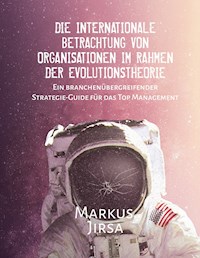
Die internationale Betrachtung von Organisationen im Rahmen der Evolutionstheorie E-Book
Markus Jirsa
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dynamische Zeiten erfordern eine höhere Flexibilität, denn unter immer größerem Veränderungsdruck und zunehmender Unsicherheit stoßen altbewährte Unternehmenskonzepte oft an ihre Grenzen. Durch ihren Fokus auf Stabilität und Ruhe haben gewöhnliche Denkmuster immer weniger Platz in einer sich permanent ändernden Welt. Doch wie macht man sich und sein Unternehmen bereit für die Zukunft? Ein Paradigmenwechsel ist notwendig. Die Evolutionstheorie ist eine dynamische Alternative und ein differenzierter Blickwinkel, um langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Dieses Buch liefert Ihnen ein evolutionstheoretisches Mindset, das innerbetriebliche Zusammenhänge und Interaktionen mit der Unternehmensumwelt ausführlich beleuchtet. Ziel ist es, Organisationen neu kennenzulernen, in ihrer natürlichen Art zu verstehen und diese innovativ auf heute noch unbekannte Probleme vorzubereiten. Aufgebaut als Strategie-Guide für das Management, versorgt Sie diese Publikation mit strategischen Handlungsempfehlungen für eine flexible und zukunftsorientierte Unternehmensführung und -ausrichtung. Völlig unabhängig vom Unternehmenssitz, der Branche und der Größe des Unternehmens dient Ihnen dieses Werk als Kompass bei der Navigation durch eine ungewisse Zukunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Formelverzeichnis
Vorwort
1.
Einleitung
1.1 Problemstellung und Relevanz
1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage
1.3 Methodische Vorgehensweise
1.4 Aufbau der Arbeit
Teil A: THEORIE
2.
Die Evolutionstheorie als Instrument des strategischen Managements
2.1 Die Neoklassik als Ausgangspunkt einer neuen Welt
2.2 Die theoretische Abgrenzung des Evolutionskonzepts
2.3 Grundlagen der Evolutionstheorie
2.3.1 Die Definition der Evolution(stheorie)
2.3.2 Variation, Selektion und Retention – der ewige Kreislauf
2.3.3 Besonderheiten der allgemeinen Evolutionstheorie
2.3.4 Kritikpunkte und Fazit der allgemeinen Evolutionstheorie
3.
Das Unternehmen als mikroökonomische Ebene der Evolutionstheorie
3.1 Die Definition und der Aufbau eines Unternehmens
3.2 Die Genetik eines Unternehmens
3.2.1 Klärung der Begrifflichkeiten
3.2.2 Die kleinste Einheit eines Unternehmens
3.2.3 Die Autopoiese und Selbstreproduktion des Organismus
3.2.4 Routine versus Fähigkeit – der Capability-Based View
3.3 Der Lebenszyklus eines Unternehmens
3.4 Der Mensch in der Evolutionstheorie der Unternehmen
3.5 Zwischenresümee zum Unternehmen in der Evolutionstheorie
4.
Das Wissensmanagement und die Evolution des Wissens
4.1 Die Transformation von Daten zu Wissen
4.2 Die Etablierung einer lernenden Organisation
5.
Die Unternehmensumwelt evolutionärer Organismen
5.1 Vom Unternehmen zur Umwelt – eine Veränderung der Perspektive
5.2 Die Institution als mesoökonomische Ebene der Evolutionstheorie
5.3 Die Population als makroökonomische Ebene der Evolutionstheorie
5.4 Die Messung der Varietät
Teil B: EMPIRIE
6.
Die Wirklichkeit in der Theorie
6.1 Das Forschungsdesign dieser Arbeit
6.2 Der Aufbau der Methodik
6.3 Der Ablauf der empirischen Forschungsprozesse
7.
Die Sekundärdatenanalyse als erste empirische Methode
7.1 Theoretische Ausgangsbasis und Hypothesengenerierung
7.1.1 Der Aktienkurs als Basiswert der Analyse
7.1.2 Aktienindizes und Indikatoren
7.2 Die Erhebung der Sekundärdaten
7.3 Die Analyse der Daten mittels deskriptiver Statistik
7.3.1 Statistische Grundlagen
7.3.2 Anwendung der deskriptiven Statistik
7.4 Kritische Würdigung der Ergebnisse
8.
Das Experteninterview als zweite empirische Methode
8.1 Die Erhebung der Primärdaten
8.1.1 Der Interviewleitfaden als Gerüst der Gespräche
8.1.2 Die Auswahl der Expertinnen/Experten
8.1.3 Die Durchführung der Interviews
8.2 Die Analyse der Daten mittels Themenanalyse nach Froschauer/Lueger
8.2.1 Das neue Weltbild – eine dynamische Betrachtung
8.2.2 Das Unternehmen aus einer prozessorientierten Perspektive
8.2.3 Das Wissensmanagement
8.2.4 Die Unternehmensumwelt
8.3 Kritische Würdigung der Ergebnisse
9.
Conclusio
9.1 Handlungsempfehlungen für das Top-Management
9.1.1 Seien Sie sich Ihrer dynamischen Umwelt stets bewusst
9.1.2 Haben Sie Mut zur Veränderung, sie ist die neue Beständigkeit
9.1.3 Lernen Sie Ihr Unternehmen als Individuum kennen
9.1.4 Häufen Sie ruhig Wissen an, aber tun Sie auch aktiv etwas damit
9.1.5 Ihr Konkurrent ist genau wie Sie, seien Sie nur eben etwas anders
9.1.6 Erkennen Sie die Evolution und erfreuen Sie sich des Erfolgs
9.2 Die Beantwortung der Forschungsfragen
9.3 Limitationen
9.4 Weitere Forschungsthemen
Literatur- und Quellenverzeichnis
Verzeichnis für Internetquellen
Nachwort und persönlicher Dank
Anhang
Anhang A: Interviewleitfaden
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Vergleich einer Trivialmaschine und eines komplexen Systems
Abbildung 2: Der Aufbau von Unternehmen
Abbildung 3: Übersicht über den Transformationsprozess von Daten zum Wissen
Abbildung 4: Der Aufbau der Methodologie
Abbildung 5: Die Phasen des empirischen Forschungsprozesses
Abbildung 6: Der historische Aktienkurs eines Unternehmens
Abbildung 7: Der historische Aktienkurs und die Volatilität eines Unternehmens
Abbildung 8: Die Darstellung des biologischen Dreischritts
Abbildung 9: Der historische Aktienkurs und die Volatilität eines Konkurrenten
Abbildung 10: Ein Vergleich der historischen Kursentwicklungen unter Konkurrenten
Abbildung 11: Die bereinigte Kursentwicklung und Volatilität dreier Unternehmen im Vergleich
Abbildung 12: Der Vergleich eines Unternehmens mit dem Markt
Abbildung 13: Die einjährige Analyse des Evolutionspotenzials
Abbildung 14: Der direkte Vergleich der Kursentwicklung und der Volatilität
Abbildung 15: Die bereinigte Kursentwicklung und die Volatilität der deutschen Volkswirtschaft
Abbildung 16: Die bereinigte Kursentwicklung und die Volatilität der Weltwirtschaft
Abbildung 17: Die Kursentwicklung und Volatilität eines Marktereignisses
Abbildung 18: Befragte Personen der Experteninterviews
Abbildung 19: Ablauf der Themenanalyse nach Froschauer/Lueger
Formelverzeichnis
Formel 1: Die Berechnung einer täglichen Rendite
Formel 2: Das arithmetische Mittel
Formel 3: Die Varianz
Formel 4: Die Standardabweichung
Vorwort
Im Laufe des Lebens ist an jeden Einzelnen von uns der Anspruch zu erheben, bestehende Systematiken, Logiken, Modelle, Gewohnheiten und Muster zu überdenken. Das ist nur natürlich und gesund, nicht jedoch selbstverständlich. Diese Reflexion sollten wir nutzen, um sowohl uns selbst, als auch die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Wir haben die Möglichkeit unseren ganz individuellen Fußabdruck auf dieser Welt zu hinterlassen, denn wir beeinflussen unser Umfeld regelmäßig. Bewusst und unbewusst. Deshalb ist auch jede individuelle Realität immer auch ein Stück weit Teil einer anderen Realität. Das erweitert nicht nur unseren Horizont, sondern zeigt auf, dass wir mehr als nur die Summe unserer Teile sind. Deshalb ist es besonders an uns – also an jeder und jedem Einzelnen – das Beste daraus zu machen.
Bestehende, weit verbreitete Meinungen und Ansichten sind eine mögliche Perspektive unter vielen – ein möglicher Ausgangspunkt. Ein allgemeiner Konsens ist jedoch nur solange etwas Gutes und Wertvolles, solange er regelmäßig hinterfragt und angepasst wird. Diese Überlegungen liegen meiner Abhandlung zugrunde und so ist sie geprägt von einem Weltbild, indem es kein objektives Optimum geben kann. Stattdessen sollte die Dynamik der Optimierung im Vordergrund stehen. Deshalb lade ich dazu ein, auf den kommenden Seiten eine neue Perspektive kennenzulernen. Diese Arbeit soll eine Alternative zu Bestehendem bieten und gleichzeitig dem Anspruch gerecht werden, Mehrwert zu stiften.
Das Streben nach Veränderung wertet das Bestehende nicht ab. Ganz im Gegenteil – es zeigt unsere Liebe für das Detail und unsere Faszination, die uns beflügelt, uns damit zu beschäftigen. Dürfen wir unserer Faszination also folgen, so sollten wir dankbar und glücklich sein. Dankbar nicht nur dort womöglich etwas zu bewegen, wo wir es können, sondern dort, wo es uns auch erfüllt. Bereits im Bachelorstudium haben mich alternative Theoriemodelle zur Neoklassik fasziniert und deshalb bin ich nun froh, meinem Interesse folgen zu können.
So bleibt mir nur noch, die Arbeit all jenen zu widmen, die mich stets zu kritischem Denken motivierten, mich immer ermutigten, Neues zu wagen, mir pausenlos den Rücken stärkten, mich forderten und förderten, mir Verständnis entgegenbrachten, wenn ich mich mit Bestehendem nicht zufrieden geben wollte und mir kostbare Zeit schenkten. Neugierde ist der Motor der Weiterentwicklung und es liegt an jedem von uns, einen eigenen Beitrag zu leisten.
Markus Jirsa, BSc. M.A.
“As many more individuals of each species are born than can possibly survive; and as, consequently, there is a frequently recurring struggle for existence, it follows that any being, if it vary however slightly in any manner profitable to itself, under the complex and sometimes varying conditions of life, will have a better chance of surviving, and thus be naturally selected. From the strong principle of inheritance, any selected variety will tend to propagate its new and modified form.” (Darwin 1861, S. 12)
1 Einleitung
Dynamische Zeiten erfordern höhere Flexibilität und neue Situationen erfordern differenzierte Blickwinkel. Ein Paradigmenwechsel ist notwendig. Die Rede ist vom Wirkungszusammenhang des strategischen Managements, der Unternehmen und ihrer eigenen Umwelt im Rahmen der Evolutionstheorie. Es wird mithilfe der Evolutionstheorie im strategischen Management möglich sein, aus unternehmerischer Sicht auf neue Probleme mit ebenfalls neuen und innovativen Lösungen zu reagieren, auch wenn diese auf den ersten Blick für das heutige Management ungewohnt sind und deshalb befremdlich wirken können. Deshalb kann es sich keine zukunftsorientierte Führungskraft leisten, auf das Verständnis der Evolutionstheorie im Rahmen des strategischen Managements zu verzichten.
1.1 Problemstellung und Relevanz
In Zeiten schneller Veränderung und großer Unsicherheit, ausgelöst durch verschiedene geopolitische und wirtschaftliche Krisen, sowie reaktionsbeschleunigende Trends (Globalisierung, technologischer Wandel, etc.), stoßen Unternehmenskonzepte einer „maschinenorientierten“ Unternehmensführung schnell an ihre Grenzen. Da sich besonders in den letzten Jahren der Veränderungsdruck auf Unternehmen massiv erhöhte, ist es notwendig, das bisherige stabilitätsorientierte Verständnis im strategischen Management mit einem auf Veränderungen basierendem Konzept zu kombinieren (vgl. Baden-Fuller/Volberda 1997, S. 95 f.). Dazu ist es ebenfalls notwendig, dass die mentalen Modelle von Managerinnen/Managern aufgrund verschiedener Umweltveränderungen adaptiert werden (vgl. Barr et al. 1992, S. 16). Diese hohen Ansprüche an das Unternehmen und das Top-Management können mit entsprechenden strategischen Maßnahmen und Überlegungen erfüllt werden. Es ist wichtig zu begreifen, dass Strategien nie vollständig niedergeschrieben sind, sondern sich aus der Kombination externer Events und gemeinsamer interner Handlungsentscheidungen der Managerinnen/Manager entwickeln. Strategien entstehen also zu einem großen Teil in einem evolutionären Prozess (vgl. Quinn 1980, S. 15).
1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Erarbeitung strategischer Empfehlungen für das Top-Management im Rahmen der Evolutionstheorie, die sowohl die Interdependenzen einer Organisation mit ihrer Umwelt, als auch die nach innen gerichteten Beziehungen unter Berücksichtigung des Wissensmanagements behandelt. Bei evolutionstheoretischen Ansätzen wird der Vorteil der größeren Realitätsnähe durch eine höhere Komplexität der Modelle erreicht. Zur Zielsetzung gehört es somit ebenfalls, eine leicht verständliche Verbindung zwischen der hohen Abstraktionsebene und der Praxis zu schaffen. Die besondere Herausforderung ist, dass diese strategischen Handlungsempfehlungen das Top-Management unabhängig von der jeweiligen Branche, Unternehmensgröße oder dem Land des Unternehmenssitzes, bei der Unternehmensführung in dynamischen Umweltbedingungen unterstützen sollen. Auch wenn sich diese Arbeit primär als Strategie-Guide an das Top-Management richtet, soll jede interessierte Leserin/jeder interessierte Leser das Wissen um die Evolutionstheorie in ihrer/seiner jeweiligen Situation anwenden oder zumindest nachvollziehen können (vgl. Müller-Stewens/Lechner 2011, S. 139).
Diese Arbeit soll die oben angeführte Zielsetzung bestmöglich erfüllen. Im Bereich der Evolutionstheorie wird in dieser Arbeit der Versuch unternommen, folgende Forschungsfrage sowie die dazugehörige Unterfrage zu beantworten:
Forschungsfrage:
Gibt es zusätzlich zum klassischen biologischen Dreischritt der Evolutionstheorie (Variation, Selektion, Retention) eine Funktion der Wissensspeicherung (Erinnerung, Gedächtnis) auf die das Top-Management zugreifen kann, um aus vergangenen Selektionsprozessen zu lernen?
Unterfrage:
Wie kann der biologische Dreischritt dazu genutzt werden, eine lernende Organisation zu etablieren, weiterzuentwickeln und für die strategische Führung zu nutzen?
1.3 Methodische Vorgehensweise
Die qualitative Ausarbeitung dieser Arbeit stützt sich auf eine deskriptive und deduktivnomologische Untersuchung im Rahmen mehrerer Experteninterviews. Der deskriptive Charakter ist aufgrund der beschreibenden und analytischen Funktion dieser Arbeit gewählt und soll in weiterer Folge das Gewähren von Handlungsempfehlungen ermöglichen. Der deduktiv-nomologische Charakter wird aufgrund verschiedener, bereits vorhandener, empirischer Untersuchungen des strategischen Managements und der Evolutionstheorie gewählt und soll somit Kausalzusammenhänge erklären. Zusätzlich wird vor den Experteninterviews eine Analyse von Sekundärdaten stattfinden, mit Hilfe derer gegenwärtiges Evolutionspotenzial erkennbar und vergangenes erklärt werden soll. Dazu werden vor dem Teil der quantitativen Datenanalyse Hypothesen aufgestellt, die mit der darauffolgenden Analyse bestätigt oder widerlegt werden sollen. Die Erkenntnisse dieser Datenanalyse werden gemeinsam mit dem Wissen über die Evolutionstheorie in den Experteninterviews behandelt.
Aufgrund der hohen Flexibilität in der Durchführung von Experteninterviews erhofft sich der Autor nicht nur die individuelle Beantwortung der gestellten Fragen, sondern ebenfalls die Einbringung des Praxiswissens und der Erfahrungen der jeweiligen Expertinnen/Experten. Dadurch ergibt sich die Chance, den persönlichen Match zwischen dem Weltbild der Expertinnen/Experten und dem Verständnis über die Evolutionstheorie qualitativ im Rahmen der Befragungen zu erfassen. Durch die kontextbezogene Auswertung der Interviews kann somit neu vermitteltes Wissen flexibel berücksichtigt werden. Aufgrund der zu erwartenden hohen Diversität der Blickwinkel der Expertinnen/Experten und der einfachen Bereicherung des abstrakten Themas um zusätzliche Praxiskomponenten, wird letztendlich das Experteninterview als durchzuführende Methodik gegenüber allen anderen qualitativen Methoden bevorzugt.
1.4 Aufbau der Arbeit
Die Zielgruppe der nachfolgenden Abhandlung ist grundsätzlich das Top-Management, deshalb wird es in den nachfolgenden Seiten auch oft direkt angesprochen. Trotzdem richtet sich diese Arbeit auch an alle interessierten Leserinnen/Leser und ermutigt diese, das eigene Unternehmen aus einem evolutionstheoretischen Blickwinkel zu betrachten. Die Anwendbarkeit der Evolutionstheorie steht dabei stets im Fokus.
Der Aufbau dieser Abhandlung berücksichtigt den notwendigen Perspektivenwechsel der Leserin/des Lesers, weg von der gewohnten Neoklassik hin zur Evolutionstheorie. Aus diesem Grund werden in den ersten beiden Abschnitten des Kapitels 2 die zwei Denkrichtungen vorgestellt und voneinander abgegrenzt. Anschließend werden im Abschnitt 2.3 allgemeine Elemente der Evolutionstheorie behandelt. Das darauffolgende Kapitel 3 behandelt die mikroökonomische Ebene der Evolutionstheorie. Hier liegt der Fokus auf dem Unternehmen als Organismus im Rahmen der Evolutionstheorie, auf dem sämtliche weiteren Abhandlungen zur Evolutionstheorie aufbauen. Das Grundverständnis des Kapitel 2 wird vertieft und mit praxisnahen Beispielen veranschaulicht. Das Kapitel 4 beschäftigt sich schließlich mit der Bedeutung der Ressource „Wissen“ und dem dazugehörigen Wissensmanagement als einer wesentlichen Kompetenz der Unternehmensführung. Dieser Abschnitt dient dazu, bereits wesentliche Systemlogiken der Evolutionstheorie wiederzuerkennen. Eine nachhaltige Unternehmensführung verfügt jedoch nicht nur über Wissen betreffend des eigenen Unternehmens, sondern auch betreffend der Unternehmensumwelt. Deshalb beschäftigt sich das Kapitel 5 dieser Arbeit mit der meso- und makroökonomischen Perspektive der Evolutionstheorie. Die dahinterstehende Logik dieses Aufbaus ist, auf der Basis des Verständnisses des eigenen Unternehmens auch Konkurrenten und ganze Märkte verstehen zu können. Den Theorieteil schließt der letzte Abschnitt des Kapitel 5 ab, in dem mit der Messung der Unternehmensvarietät ein wertvolles Instrument zur evolutionstheoretischen Bewertung vorgestellt wird.
Der empirische Teil dieser Arbeit beschäftigt sich im ersten Schritt mit der Vorstellung des Forschungsdesigns und der verwendeten Methodiken. Dabei wird im Kapitel 7 die Sekundärdatenanalyse als quantitative Methodik und im Kapitel 8 die Experteninterviews als qualitative Methodik vorgestellt und anschließend durchgeführt. Die Sekundärdatenanalyse beschäftigt sich mit der Anwendung eines Messinstruments, mit dessen Hilfe Evolution sichtbar gemacht werden kann. In den Experteninterviews wird das Wissen der befragten Expertinnen/Experten genutzt, um zusätzliche praxisrelevante Informationen zu erhalten. Durch dieses Vorgehen werden sowohl Primär- als auch Sekundärdaten erhoben und in diese Abhandlung eingearbeitet. Dadurch sollen die Evolutionstheorie und die Praxis der Evolution verbunden werden. Das Kapitel 9 bildet mit der Conclusio den Abschluss dieser Arbeit und besteht aus den tatsächlichen Handlungsempfehlungen an das Top-Management, der Beantwortung der Forschungsfrage und der Ausführung zu weiteren interessanten Forschungsbereichen.
Teil A: THEORIE
2 Die Evolutionstheorie als Instrument des strategischen Managements
Die grundlegende Abgrenzung der verschiedenen ökonomischen Schulen voneinander kann auf zwei wesentliche Denkrichtungen heruntergebrochen werden. Dieser Schritt ist möglich, sofern die ökonomischen Schulen nach ihren zentralen Elementen charakterisiert werden. Somit ergibt sich auf der einen Seite des Theoriespektrums die Neoklassik mit ihrer Gleichgewichtsorientierung und auf der anderen Seite des Denkspektrums die evolutionäre Ökonomik mit ihrer Prozessorientierung. Alle weiteren Unterschiede dieser zwei Richtungen – sei es ein unterschiedlicher Ordnungsbegriff oder ein anderes Menschenbild – sind das Ergebnis dieser differierenden Ansatzpunkte in der Erklärung der beobachteten ökonomischen Realität. (vgl. Fehl 2005, S. 78)
Diese Arbeit ist in der evolutionstheoretischen Denkrichtung verwurzelt. Nichtsdestotrotz ist es aus Gründen der besseren Verortung der Evolutionstheorie notwendig, die Grundzüge der Neoklassik im Kapitel 2.1 – Die Neoklassik als Ausgangspunkt einer neuen Welt – zu behandeln. Durch die deutlich stärkere Verbreitung der Neoklassik ist es ohne große Mühe möglich, die Leserinnen und Leser von ihrem jeweiligen Wissensstand abzuholen und langsam an die Materie der Evolutionstheorie heranzuführen. Dazu wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit, im Kapitel 2.2, die Evolutionstheorie gegen die Neoklassik abgegrenzt, um die grundlegenden Unterschiede bereits zu Beginn dieser Arbeit sichtbar zu machen und die interessierten Leserinnen/Leser das erste Mal mit der Evolutionstheorie in Kontakt zu bringen. Dies soll es erleichtern, diese zwei Denkrichtungen in der eigenen Wahrnehmung erfolgreich einordnen und die jeweiligen Vor- und Nachteile der theoretischen Konzepte erkennen zu können. Diese Vorgehensweise erleichtert ein flexibles Umdenken und eröffnet in den verschiedensten Sachverhalten eine neue Perspektive. Die restlichen Kapitel dieser Arbeit behandeln ausschließlich Themen der Evolutionstheorie. Angefangen bei grundlegenden Betrachtungen bis hin zu einem tieferen Verständnis und einer detaillierteren Behandlung des Theorierahmens. Ziel des Kapitels 2 dieser Arbeit – Die Evolutionstheorie als Instrument des strategischen Managements – ist es somit, ein bereits sehr vertiefendes Wissen und Verständnis zur Evolutionstheorie im wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhang zu vermitteln.
2.1 Die Neoklassik als Ausgangspunkt einer neuen Welt
In den Wirtschaftswissenschaften und den jeweiligen Teildisziplinen erfreuen sich Gleichgewichtsmodelle großer Beliebtheit. Klare und eindeutige Wirkungszusammenhänge ermöglichen innerhalb verschiedenster Modelle Analysen der zu untersuchenden Situation. Diese künstliche Reduktion der natürlichen Komplexität hat aber einen Nachteil: sie ist künstlich.
Einige Ökonomen halten dynamische oder statische Gleichgewichtstheorien für realitätsgetreue Abbilder der Wirklichkeit. Sie geben zwar zu, dass das jeweilige Objekt der Betrachtung nie genau im Gleichgewicht sein kann, vertreten aber die Ansicht, dass es sich stets ausreichend nah an diesem Gleichgewicht befindet, um Rückschlüsse auf die jeweils aktuelle Situation ziehen zu können. (vgl. Nelson 1995, S. 49, 50) Ein legitimer Ansatz, der weit verbreitet ist. Ähnlich einer verbreiteten Technik um die Größe eines Objekts in der Ferne zu schätzen: man stellt sich ein Objekt vor, von dem man die Größe kennt und multipliziert dieses mit der eigenen Vorstellungskraft so lange, bis die Größe des Gegenstandes ungefähr abgeschätzt werden kann. Diese Schätzmethode unterliegt jedoch vielen Bedingungen, angefangen beim räumlichen Vorstellungsvermögen, über die Erinnerungskraft und sogar bis zur Sehstärke der/des Schätzenden. Da es für die Beurteilung einer Aussage entscheidend ist, ihre zugrundeliegenden Bedingungen zu kennen und zu berücksichtigen, ist es auch an dieser Stelle notwendig, die Grundlagen der Neoklassik zu kennen. Nur durch das Wissen über das Eine wird eine Abgrenzung des Anderen ermöglicht.
Die Grundbestandteile neoklassischer Ansätze haben ihre Wurzeln in der „Theorie der Unternehmen“. Dabei produzieren Unternehmen in einer, von Konkurrenten geprägten und wettbewerbsorientierten Industrie. Diese Unternehmen können betreffend der Beschaffung ihrer Inputs und der Produktion ihrer Outputs zu jedem Zeitpunkt aus einem vordefinierten Set an Alternativen wählen. Der treibende Gedanke der Unternehmen hinter der tatsächlichen Wahl der einzelfallbezogen richtigen Alternative, aus Sicht der Neoklassik, ist die Maximierung des aktuellen Unternehmenswerts beziehungsweise der Unternehmensgewinne. Während das Unternehmen versucht, durch die bestmögliche Wahl an Input/Output-Kombinationen den eigenen Gewinn zu maximieren, ist es externen Zuständen ausgeliefert. (vgl. Nelson/Winter 1974, S. 887)
Als einer dieser Zustände kann die jeweilige Branche angeführt werden, in der sich das Unternehmen zwangsweise befindet. Dabei wird vorausgesetzt, dass diese Branche im Gleichgewicht ist. Unter der Gleichgewichtssituation der Branche wird verstanden, dass Angebot und Nachfrage auf sämtlichen relevanten Märkten dieser Branche ausgewogen sind. Das bedeutet im neoklassischen Verständnis weiters, dass kein Unternehmen seine Marktstellung verbessern kann, indem etwas getan wird, das bereits Konkurrenten tun. Auf einer makroökonomischen Ebene mit einer einzigen Branche kommt es in diesem System zum Wachstum, wenn die Produktionsfaktoren über die Zeit erhöht werden, es folglich zu einer gesteigerten Produktion und somit zu einer Ausweitung des Angebots kommt. Zusätzlich müssen Nachfrageänderungen ebenfalls berücksichtigt werden. Die gewinnmaximierenden Unternehmen befinden sich somit in einem Gleichgewicht, das durch die Veränderungen der technologischen Bedingungen, des Angebots an Produktionsfaktoren und der Nachfrage nach Produkten bewegt wird. (vgl. Nelson/Winter 1974, S. 887)
Neben dem Gleichgewichtskonzept als Kern der Neoklassik und den Unternehmen als Mengen-anpasser in vollkommenen Märkten gibt es noch zwei weitere zentrale Annahmen dieses Denkansatzes. Dabei geht es bei der ersten Annahme um die Existenz des berühmten Homo Oeconomicus. (vgl. Babos 2015, S. 16) Das Konzept des Homo Oeconomicus handelt vom gänzlich rational denkenden Menschen. Das bedeutet, dass Menschen bei vollständiger Information und begrenzten Ressourcen ökonomisch sinnvoll handeln und dabei gleichzeitig ihren jeweiligen Nutzen maximieren wollen. Dabei werden grundsätzlich nur der persönliche Vorteil und die Erreichung der individuellen Ziele angestrebt. (vgl. Kreuzer 2013, S. 48) Die zweite zentrale Annahme beschäftigt sich mit der optimalen Größe, an die sich ein Unternehmen annähert. Unter der optimalen Größe wird das Produktionslevel verstanden, bei dem der Vorteil der Skaleneffekte die Koordinationskosten der Bürokratie übersteigt und zur Profitmaximierung führt. Sobald dieser Zustand erreicht ist, geht die neoklassische Theorie davon aus, dass es zu keinem weiteren Wachstum kommt. (vgl. Coad 2007, S. 31)
Die Berechnung des Wachstums mittels ökonometrischer Modelle hat besonders durch die Erklärung der für Wachstum verantwortlichen Faktoren sehr schnell Fortschritte gemacht. Der Vorteil der neoklassischen Denkrichtung war die sehr schnell zunehmende Zahl an Forschungsarbeiten in diesem Forschungsfeld. Damit wurde das Wissen um das ökonomische Wachstum weiter ausgebaut und die Neoklassik als theoretischer Ansatz zunehmend gefestigt. (vgl. Nelson/Winter 1974, S. 887) Die eindeutige Stärke der Neoklassik liegt in der Sichtbarmachung der Anpassungsleistungen der Wirtschaftssubjekte an Datenänderungen oder vorgegebenen Daten unter bestimmten Verhaltenshypothesen. Die eigentlich stattfindenden Marktprozesse werden großteils ausgeblendet. (vgl. Fehl 2005, S. 81)
Unter den Begriff „Neoklassik“ fällt eine zwar recht vage definierte, aber sehr große Menge an Forschungsliteratur und theoretischen Abhandlungen. (vgl. Coad 2007, S. 31) Dadurch erhebt das Kapitel 2.1 keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dient lediglich dazu, von einer weit verbreiteten, gemeinsamen theoretischen Basis für ökonomische Zusammenhänge auszugehen. Dies soll es der Leserin/dem Leser erleichtern, die Ideen der Evolutionstheorie im nächsten Kapitel 2.2 von den Ansichten der Neoklassik abgrenzen zu können.
2.2 Die theoretische Abgrenzung des Evolutionskonzepts
Das Konzept der evolutionären Ökonomik hat im Vergleich zur Neoklassik einen differenzierten Fokus. Dabei stehen die eigentlichen Marktprozesse selbst im Vordergrund, und nicht wie in der Neoklassik die Ergebnisse der Anpassungsbemühungen einzelner Wirtschaftssubjekte. Die Evolutionstheorie versucht somit, die verschiedenen im Markt stattfindenden Vorgänge umfassender einzufangen als dies die Neoklassik praktiziert. (vgl. Fehl 2005, S. 81) Das Hauptinteresse evolutionsbasierender Konzepte besteht somit an dynamischen Entwicklungen, wobei soziale und ökonomische Phänomene als Veränderungsprozesse verstanden werden (vgl. Müller-Stewens/Lechner 2011, S. 137).
Typisch für die Betrachtung aus evolutionärer Perspektive ist das reichhaltigere Menschenbild, indem der Mensch als fähig angesehen wird, Dinge stets neu zu interpretieren, innovative Handlungsmöglichkeiten zu erschaffen und diese in weiterer Folge ebenfalls im Markt anzuwenden und durchzusetzen (vgl. Fehl 2005, S. 81). Zu diesem erweiterten Bild gehört zusätzlich das Bewusstsein, dass Menschen in der Lage sind, einen Vorteil aus kumulativ kollektivem Lernen zu generieren. Dabei ist die Bandbreite dessen, was innerhalb der Gemeinschaft bereits gelernt wurde, entscheidend. Besonders, da zukünftiges Lernen wiederum auf dieser Wissensbasis aufbaut. (vgl. Nelson 2015, S. 746)
Zusätzlich unterscheidet sich die Evolutionstheorie gegenüber der neoklassischen Denkrichtung dadurch, dass der Akteurin/dem Akteur das Mittel und der Zweck verschiedener Handlungen bereits von Beginn an bekannt sind, die verfügbaren Ressourcen zur Verfolgung eines bestimmten Zwecks jedoch noch optimal geordnet werden müssen. Die Neoklassik sieht diesen Aspekt als bereits gelöste Bedingung an. (vgl. Fehl 2005, S. 82) Dagegen empfindet es die evolutionäre Denkrichtung als äußerst wichtig, die unterschiedlichen Fähigkeiten der Akteurinnen/Akteure, die sie zu den verschiedenen Entscheidungssituationen mitbringen, im Theoriekonzept zu berücksichtigen. Durch die Anerkennung ihrer Unterschiedlichkeit hinsichtlich Fertigkeiten, Erfahrungen und Wissen ist es für evolutionäre Konzepte möglich, das unterschiedliche Verhalten der Akteurinnen/Akteure in Situationen, die für nicht involvierte Personen grundsätzlich gleich erscheinen, zu untersuchen. (vgl. Nelson 2015, S. 741, 742)
Eine interessante Tatsache ist, dass die Evolutionstheorie Gleichgewichtstendenzen nicht ablehnt. Ganz im Gegenteil: sie involviert Gleichgewichtskräfte in die theoretischen Überlegungen. Der Unterschied ist, dass der anhaltende Marktprozess den Normalzustand des Marktes darstellt und nicht das Gleichgewicht. (vgl. Fehl 2005, S. 82, 83) Außerdem ist die Heterogenität, nicht nur bezogen auf die Unternehmen, sondern ebenfalls auf die Märkte und ihre verschiedenen Marktphasen, ein bedeutender Grundbestandteil der Evolutionstheorie und findet somit deutlich mehr Beachtung als in neoklassischen Theorien. Das gilt ebenfalls für die Erwartungen der Marktteilnehmer, die mit größerer Wahrscheinlichkeit heterogen statt homogen sind. Unterschiede zwischen den beiden Theorien erkennt man auch daran, dass die Neoklassik in der Makroökonomik von repräsentativen Individuen ausgeht und es die Evolutionstheorie im Rahmen des Populationsansatzes als zentrale Aufgabe versteht, einzelne Populationen bezogen auf ihre unterschiedlichen Varianten festzustellen und Erklärungen für stattfindende Umschichtungen zu finden. (vgl. Fehl 2005, S. 84, 85)
Während die Neoklassik das Marktgeschehen als unterschiedliche Optimierungsprozesse darstellt, versteht die Evolutionstheorie die Marktvorgänge als ein Resultat eines flexiblen Verhaltens, basierend auf einer Trial-and-Error-Methodik. Stellt sich ein bestimmter Versuch eines Unternehmens als Fehler heraus, wird dieser korrigiert und in weiterer Folge durch eine neue Maßnahme ersetzt. Somit kommt es nicht zu einer Optimierung, sondern die Unternehmen tasten sich vielmehr ins Ungewisse vor. (vgl. Fehl 2005, S. 86, 87) Ergänzend wird der Wettbewerbsbegriff unterschiedlich wahrgenommen, wobei der Wettbewerbsprozess selbst dynamisch-evolutionäre Komponenten aufweist und Neuheiten sämtliche unternehmerischen Aktionsparameter, sowohl auf dem Markt, als auch in der Unternehmung verändern können (vgl. Fehl 2005, S. 81, 82).
Auch die Erklärung der Existenz von Unternehmen unterscheidet sich. So gehen neoklassische Ansätze von den Transaktionskosten eines Unternehmens aus, während Unternehmen in evolutionären Theorien in Anlehnung an ihre jeweilige Funktion als Wissensspeicher, Wissensverwerter, Wissenserzeuger und Wissensmittler bestehen. (vgl. Fehl 2005, S. 88) Dabei behandeln evolutionäre Ansätze Mechanismen, um einzigartiges Wissen und Kompetenzen auszunutzen. Die Neoklassik beschäftigt sich stattdessen unter anderem mit dem Lösen von Herausforderungen der Principle-Agent-Thematik oder der Transaktionskostenminimierung. (vgl. Baden-Fuller/Volberda 1997, S. 96)
Als letztes Abgrenzungsmerkmal der beiden Denkrichtungen ist die weit größere Bedeutung der Institutionen für die evolutionäre Ökonomik zu nennen. So stellen Institutionen im anhaltenden Wettbewerbsprozess und der daraus resultierenden Situation der Ungewissheit, für beteiligte Akteurinnen/Akteure eine Orientierung in Form von Regeln und Normen dar, die von sämtlichen Wirtschaftssubjekten befolgt und akzeptiert werden. (vgl. Fehl 2005, S. 89)
Tatsächlich stellen die eben erwähnten Punkte eine Abgrenzung der Evolutionstheorie von der Neoklassik dar, die sich auf die Grundpfeiler der zwei Theoriegebilde bezieht. Die Limitierung des Umfangs dieser Arbeit gestattet es an dieser Stelle nicht, ausführlicher auf ebendiese Abgrenzungsthemen und ihre historischen Wurzeln einzugehen. Diese theoretische Abgrenzung lässt bereits erahnen, welch großes Potenzial in evolutionären Ansätzen verborgen ist. Zum einen involvieren evolutionäre Denkansätze theoretische Bedingungen, die in der Neoklassik als gegeben angesehen werden, erklären diese und füllen theoretische Lücken. Zum anderen besteht die Möglichkeit, Sachverhalte, die weit über die Erklärungskraft der Neoklassik hinausgehen, zu erklären und die höhere Komplexität der Realität in einen einheitlichen Theorierahmen miteinzubeziehen. Im folgenden Kapitel 2.3 wird erstmals in dieser Arbeit direkt auf die grundlegenden Aspekte der Evolutionstheorie eingegangen.





























