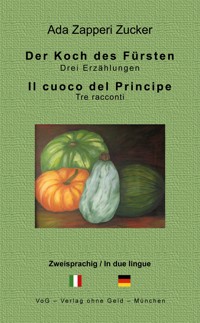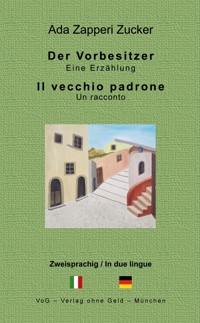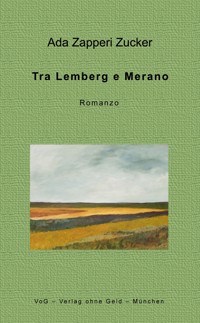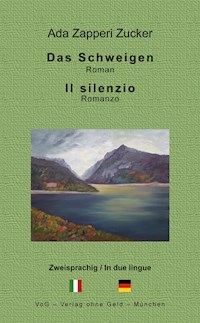Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag ohne Geld
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Acht Erzählungen, in denen sich wie in einem Dolomitenpanorama, der Blick in eine facetten-reiche menschliche Landschaft öffnet. Die weibli-chen Protagonisten steigen aus dem Nichts empor, ein Nichts, an das sie gewöhnt sind, ein Schatten-dasein, in das sie durch Kultur, Bräuche und Reli-gion verbannt wurden. Frauengestalten, die, unbe-achtet von der offiziellen Geschichtsschreibung, durch einen großen Leidensbeitrag, unablässige nie belohnte Arbeit und das Ertragen des harten All-tags, die Fundamente der Geschichte gebildet und deren Konsequenzen erlitten haben. Erzählt werden Geschichten einfacher Frauen, die wenig verlangt und nicht einmal dieses Wenige erhalten haben, obwohl sie die Hauptsache für die nachfolgenden Generationen beigesteuert haben, nämlich das Leben selbst. Dieses Buch ist eine Huldigung dieser kleinen-großen Hauptpersonen der Geschichte, angesiedelt in einem Land großer Schönheit, Mittelpunkt vieler schwer lösbarer Konflikte politischer, sprachlicher und kultureller Art: Südtirol. Auch dies eine Frucht der Ereignisse, die von den Frauen sicherlich nicht gewollt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweise
Ada Zapperi Zucker ist in Catania geboren und hat in Rom Klavier und Gesang studiert und dieses Studium an der Musikhochschule Wien beendet. Gleichzeitig hat sie für Dizionario Biografico degli italiani dell’Istituto Treccani, Enciclopedia dello Spettacolo und Enciclopedia Universo De Agostini gearbeitet. Als Opernsängerin war sie hauptsächlich außerhalb Italiens tätig, derzeit unterrichtet sie Gesang in Deutschland und in Südtirol.
Von dem südtiroler Maler Gotthard Bonell wurde sie in Malerei unterrichtet.
Sie lebt seit vielen Jahren in München.
Ihre Bücher haben verschiedene Auszeichnungen erhalten (Auswahl):
2015
Primo Premio
San Domenichino
per i racconti
La Cucchiara
2012
Primo Premio
Casentino
per il romanzo
Teatro di ombre
2012
Premio
Stiftung Kreatives Alter,
Zurigo, per i racconti
Le inquietudini della sora Elsa
2011
Primo Premio
Chianti
, per il romanzo
Il silenzio
2008
Primo Premio
Giovanni Gronchi,
per i racconti
La scuola delle catacombe
Erster Preis Cerda/Sizilien
Erste Ausgabe in italienischer Sprache 2007, Rom
Die erweiterte italienische Originalausgabe auf der diese
Übersetzung beruht, erschien 2012 unter dem Titel
La scuola delle catacombe
bei VoG Verlag ohne Geld e.K., München
Übersetzung von Sabine Hornung.
Die erste Erzählung Tresl vom Lärchenhof
wurde von Bettina Müller Renzoni übersetzt.
Erste Auflage September 2012 (1000)
Zweite Auflage Oktober 2013 (500)
Dritte Auflage Dezember 2022 (On demand)
Inhalt
Tresl vom Lärchenhof
Die Alte aus der Villa Clara
Das Testament
Das nackte Leben
Der Besuch
Die drei Bergphilosophen
Ein Leben
Die Katakombenschule
Vorwort
Geheimgänge des Lebens
Südtirol ist ein rätselhaftes Land. Wenige andere Kleinregionen suchen derart eindringlich nach klaren Abgrenzungen und markantem Profil, nach Sicherheit und Dauer. Die Politik besteht auf Eigenständigkeit und Autonomie im Verhältnis zu Staat und Nachbarn, die Sprachgruppen achten auf sorgsame Wahrung ihrer Rechte, Landschaft und Berge werden als reinster Ausdruck der Alpen präsentiert.
„Unter den Kleinen der Beste“ – so lautet der unausgesprochene Wahlspruch Südtirols, der stille Lehrplan, dem die meisten Bewohner des Landes zu folgen bestrebt sind. Erfolg, Sicherheit, Abgrenzung gegenüber Nachbarn, anderen Sprachgruppen und Kulturen – das sind jene Leitmotive, von denen die Gesellschaften des Ländchens inmitten der Alpen beseelt sind.
Der Wunsch nach klaren und stabilen Verhältnissen ist das Produkt einer schwierigen Vergangenheit, die das tiefe Bedürfnis nach Sicherheit lebendig erhält. Südtirol hat im Verlauf des 20. Jahrhunderts eine problematische Geschichte mit erstaunlichem Erfolg bewältigt, auf einem oft steinigen Weg, der über die Trennung von Österreich, durch Diktaturen, Armut und das Ringen um Selbstbehauptung geführt hat. Umso stärker ist die Sehnsucht nach Eindeutigkeit, Klarheit und Sicherheit auf vielen Ebenen. Dazu gehört auch der Wunsch nach gefestigten Lebensverhältnissen und Beziehungen, nach wohl geordnetem Familienleben, einem sicheren Horizont von Traditionen, Werten und Verhaltensformen.
Die Wirklichkeit fügt sich freilich nur selten solchen Wünschen, unterhalb des Südtiroler Selbstbildes ist der Boden schwankend. Das Leben der Einzelnen, von Männern und Frauen verläuft nicht linear, sondern folgt oft genug krummen Pfaden, es ist gezeichnet von Brüchen und unerwarteten Wendungen. Die Geschichtsbücher glätten diese Windungen zugunsten großer Erzählungen von Krise, Niedergang und Fall, von Aufstieg und Behauptung. Hinter den breiten Trassen des geschichtlichen Verlaufs verschwinden die Widersprüche und Wellen des Lebens im Fluss der geschichtlichen Darstellungen.
Hier setzen die Möglichkeiten und Aufgaben von Literatur an, die das Widerspenstige und quer Liegende, das Vertraute und Vertrackte in Lebensläufen von Menschen zur Geltung bringt. So liegen auch unter der offiziellen Erfolgsgeschichte von Südtirol Tausende von Einzelbiografien, deren stille Dramatik und Widersprüche sich gegen einfache Deutungen sperren. Diese Leben geben verstörende Rätsel auf, die einfühlsames Erzählen zwar nicht zu lösen, aber sorgsam zu erhellen vermag.
Die Erzählungen von Ada Zapperi Zucker handeln von der Geschichte Südtirols, sie meiden aber ihre großen, grell ausgeleuchteten Gemeinplätze, um verborgenere Orte aufzusuchen. Die Autorin erzählt von Geheimnissen im Leben der Menschen, von ihrem Allerpersönlichsten, das aber in Zusammenhang mit allgemeineren Zeitläuften steht. So ist denn auch der Titel ihres Erzählbands, „Die Katakombenschule“, glücklich gewählt, da er ein grundlegendes Leitmotiv aufgreift: Nur im Abstieg in die unterirdische Welt der Katakomben erschließen sich die geheimen Nischen des Lebens, deren Passage in uns ein Gespür dafür entwickelt, was Leben sein kann: Das Leben von Menschen ist gezeichnet von Schmerz und Entbehrung, aber auch erhellt von Momenten intensiven Glücks, getragen vor allem durch die Fähigkeit, eigenes Scheitern zu erkennen und anzunehmen. „Wieder versuchen / Wieder scheitern / Besser scheitern“, hat der Schriftsteller Samuel Beckett eindringlich formuliert.
„Die Katakombenschule“ – darunter begreift die Südtiroler Geschichtsschreibung jene Geheim- und Notschulen, die Südtiroler Kindern zur Zeit des Faschismus den offiziell streng verbotenen Unterricht in der Muttersprache ermöglichten. Abseits der offiziellen Schule, wohl verborgen vor dem Auge und dem Zugriff der Obrigkeit, erteilten in Bauernhäusern und Scheunen, sogar in der freien Natur meist junge Frauen notdürftigen Deutschunterricht, wobei sie erheblichen Risiken ausgesetzt waren. Es drohten Verhaftung, mitunter auch jahrelange Gefängnisstrafen.
Im Buch von Ada Zapperi Zucker wird der Weg durch die Katakomben, die verborgenen Schutz- und Leidensräume, zur Schule des Lebens und ist damit mehr als ein Kapitel der Südtiroler Schulgeschichte.
Wenige Autorinnen haben so wie Ada Zapperi Zucker mit größter Aufmerksamkeit Südtiroler Lebensgeschichten in ihrer Normalität und Ungeheuerlichkeit registriert. Es sind Biografien und Schicksale, die auf realer Grundlage, auf Erfahrenem und Erzähltem beruhen, aber dank der literarischen Bearbeitung keine Einzelfälle mehr sind. Sie greifen vielmehr allgemeinere Befindlichkeiten des Landes, ja der conditio humana insgesamt auf. Der große Vorzug der Autorin ist ihr doppelter Blick: Zum einen ihre Fähigkeit, als Auswärtige, die nicht in Südtirol, sondern in Catania, Rom und Wien aufgewachsen ist, Distanz und Fremdwahrnehmung aufzubieten. Zum anderen aber vermag es Ada Zapperi Zucker, dank erhöhter Achtsamkeit für ihre zweite Heimat Südtirol, oft übersehene Geschichten aufzugreifen und sie in schmerzlich genauer Sensibilität eindringlich auszugestalten. Ihre Lehrtätigkeit in Südtirol und ihr Gespür für Menschen befähigen die Autorin zu Beobachtungen von seltener Eindringlichkeit, die die Härte des Lebens ebenso erfassen wie die vielfältigen Öffnungen und Chancen, die die menschliche Existenz stets auch ermöglicht. Die Erzählungen sind recht eigentlich Novellen, da sie hinter einer zunächst schlicht anmutenden Oberfläche das Unerhörte hervortreten lassen - die erschreckende Grausamkeit des Alltags, die über viele Jahrzehnte vertieften Abgründe und die Schmerzen, die die Protagonisten einander und sich selbst zufügen.
Die Orte, an denen die Erzählungen handeln, sind meist die Hochtäler des Landes, die Einsamkeit von Dörfern und Höfen, deren Abgeschiedenheit aber eng verflochten ist mit der größeren Geschichte. Ada Zapperi Zucker lässt sich nicht ein auf jene Erzählmuster, die auswärtige Beobachter dem ländlichen Raum und seinen Menschen allzu gerne überstülpen: Aus der Sicht von Städtern sind ländliche Räume oft nur primitive Welten, deren Menschen, getrieben von Instinkten, Traditionen und Hörigkeit, durch ihren brutalen und banalen Alltag taumeln. Solche Darstellungen, die Lebensvollzüge holzschnittartig vereinfachen, sind nichts weiter als voyeuristische Projektionen städtischer Beobachter, Ausweis ärmlicher, oft erbärmlicher Insensibilität. Schriftsteller wie Franz Innerhofer haben in Romanen wie „Schöne Tage“ (1974) diese Welten aus eigener Erfahrung eindringlich und böse seziert, die Epigonen der „Negativen Heimatliteratur“ produzierten hingegen bestenfalls Karikaturen dieser groß- und bösartigen Romane.
Ada Zapperi Zucker spart Härten und Grausamkeit nicht aus, erfasst aber die handelnden Personen in großer Einfühlung, durch genaue Beschreibung ihrer Lebensumstände, vor allem aber in Dialogen, die Umstände und Vorgeschichten entfalten und in denen die Akteure aufleben. Es sind Dialoge, die Leben und Umfeld blitzartig erhellen, zugleich oft auch wie Duelle wirken, in denen Kräfte und Bedürfnisse hervorbrechen und sich große, lange zurückgestaute Gefühle entbinden. Am Ende stehen Scheitern und der denkbar schlimmste Ausgang, aber auch das Aufleuchten von später Hoffnung und großer Gelassenheit. Und es geht stets auch um die oft unversöhnte Beziehung zwischen Menschen unter schiedlicher Sprachgruppen, um Fremdheit und Feindschaft, aber auch um die Chancen der Annäherung, um Verständnis und die aufschließende Kraft der Liebe.
„Die Schule der Katakomben“ ist auch eine Bilanz des 20. Jahrhunderts und seiner Nachwirkungen, das über den Zugang von Familien- und Generationenerfahrungen erschlossen wird. Es ist bezeichnend, dass für Südtirol jüngst vor allem Frauen wie Francesca Melandri, Sabine Gruber oder Astrid Kofler die Geschichte des Landes in literarischer Form aus der Sicht und Erfahrung von Frauen neu erzählen. Sie unterlaufen die Deutungen der Geschichtsschreibung durch einen anderen, oft eindringlicheren Fokus. Ada Zapperi Zucker zielt ins Herz dieses neuen Erzählens, mit großer Überzeugungskraft und in einer Sprache, die einführt in die Irrgänge des Lebens, um sie sorgsam zu erhellen.
Hans Heiss1
1Hans Heiss, Geb. 1952, Historiker und Archivar am Südtiroler Landesarchiv Bozen, seit 2003 Abgeordneter der Grünen/Verdi/Verc zum Südtiroler Landtag. Habilitation 2001, Lehraufträge an den Universitäten Trient, Hildesheim und Innsbruck.
Die Katakombenschule
Gewidmet sind diese Erzählungen meinen südtiroler Schülern:Armin, Elfi, Christine, Gemma, Giulia, Johanna, Joseph, Martina, Valeria.
Tresl vom Lärchenhof
(Übersetzung von Bettina Müller Renzoni)
Wir sind bereits seit einigen Stunden unterwegs; wir haben das Dorf früh am Morgen verlassen, um die vielen Touristen zu meiden, die in den letzten Spätsommertagen in die Stille und Einsamkeit dieser Bergwelt eindringen.
Schweigend sind wir gewandert, ergriffen von der Magie der Landschaft, die wir durchqueren, vom unendlichen Frieden, dem Atem der Erde und Pflanzen, und sind nur hin und wieder mit angehaltenem Atem stehen geblieben, wenn sich im Wald etwas regte: ein aufgeschrecktes Reh, das sofort im Dickicht des Laubwerks verschwindet; ein großer Vogel, der Flügel schlagend lautlos davonfliegt, vielleicht von uns beim Jagen gestört; der entfernte Schrei eines anderen Vogels (ein Signal? Eine Warnung?). Und um uns herum die einzig vom Geräusch unserer Schritte unterbrochene erwartungsvolle Stille. Eine von geheimnisvollem Geraschel, von einem geheimen Leben erfüllte Stille, die wir nicht gewohnt sind.
Aus dem Wald heraus erweitert sich die Aussicht in einen unendlichen Raum zwischen Bergen und Tälern, die sich im Horizont verlieren. Ganz hoch oben, inmitten der Berge erblicken wir einen winzigen Punkt, eine Hütte an einem einsamen unwirtlichen Ort, die sich gleichsam schutzsuchend an eine Felswand lehnt.
Als wir näher kommen, erweist sie sich als halb verfallen, als etwas, was uns als Berghütte gerade noch gut genug erscheint, um einem von Dunkelheit und Schnee überraschten Wanderer Zuflucht zu gewähren. Das Dach des kleinen Stalls daneben wurde vor langer Zeit vom Wind abgedeckt; Schindeln liegen verstreut in einem Umkreis von einigen Metern; Steine, die zum Beschweren dienten, sind weggeflogen wie Strohhalme: ein Zustand allgemeiner Verwahrlosung, und das gewiss nicht erst seit kurzem. Gegen den Wind kann man nichts machen, sagt man im Dorf. Wenn der Nordwind weht, kann man nur warten, bis er aufhört, möglichst an einem geschützten Ort. Allenfalls den Rosenkranz beten.
Der kleine Kamin, der in Felsnähe an einer geschützten Ecke gebaut wurde, vielleicht um zu verhindern, dass er vom Wind weggeblasen wird, lässt auf eine menschliche Anwesenheit schließen: er raucht, wenn auch nur schwach.
Hier oben sinkt die Nachttemperatur wahrscheinlich bereits im Frühherbst auf ein paar Grad unter Null. Das erkennen wir an den vereinzelt gefrorenen Blättern, die an den fast kahlen Ästen hängen, am mit Raureif bedeckten Moos, das unter den Bergschuhen knirscht wie Glasscherben, die zerspringen und sich in Nichts auflösen: Kristallsplitter, strahlend von Licht, die unter der Gewalt unserer Schritte schmelzen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Hier oben ist der Sommer kurz.. Und auch der Herbst. Nur der Winter schlägt Wurzeln.
Der Aufstieg war ziemlich anstrengend. Die letzten Meter, nunmehr über der Baumgrenze, erscheinen uns als die längsten, wir sind außer Atem und können das Keuchen nicht mehr unterdrücken, das wir bis jetzt mit einer Art sportlichem Ehrgeiz unter Kontrolle gehalten haben. Und der leere Magen knurrt (wir haben auf das Frühstück verzichtet, um rasch aufzubrechen) und wartet darauf, dass wir endlich etwas Warmes trinken und das Brötchen essen, das jeder von uns als Proviant mitgenommen hat.
Wir klopfen an die klapprige, von der Zeit und den Unwettern abgenutzte Tür. Kein Geräusch aus dem Innern, niemand antwortet.
»Ist jemand zu Hause? Darf man eintreten?«, ein kleiner Stoß und die Tür geht auf, aber im Raum ist es so finster, dass man nichts sieht: ein schwarzes Loch, weiter nichts. Unsere Augen sind noch vom Licht der Sonne geblendet, das im Hochgebirge heller wirkt als anderswo.
Niemand wagt als erster in die Hütte einzutreten.
»Isch uans do? Konn man innagien?« ruft Mario, der einzige unter uns, der den Südtiroler Dialekt beherrscht, da er halb Deutscher, halb Italiener und in Südtirol aufgewachsen ist. Etwas verunsichert warten wir eine Weile auf ein Geräusch, ein Wort, ein menschliches Zeichen. Nichts, es geschieht nichts. Endlich treten wir, einer nach dem andern ein, vorsichtig, fast ängstlich: Wer, was verbirgt sich in dieser Hütte? Wer lebt hier inmitten dieser schweigenden, bedrohlichen und erhabenen Berglandschaft, die uns Respekt einflößt und in Erstaunen versetzt?
Wer hier wohnt, der Einsamkeit, dem Wind und den Schneestürmen trotzend, muss riesige Kräfte besitzen… oder vielleicht haust hier ein Ungeheuer und unsere Phantasie geht mit uns durch, während das Herz eine Sekunde lang still steht.
Wir brauchen ein paar Minuten, um uns an die Dunkelheit im Hütteninnern zu gewöhnen, denn das Licht fällt nur durch ein kleines Fenster ein, vor dem zum Schutz vor möglichen Dieben zwei gekreuzte Eisenstangen angebracht sind.
In einer Nische zwischen der unglaublich verrußten Wand und dem Ofen, sitzt ein unförmiges Häufchen, das wir im ersten Moment nicht identifizieren können. In dem Sonnenstrahl, der durch das Fensterchen herein leuchtet, erkennen wir zwei unter dem Rock gekreuzte Füße in grob gestrickten Wollsocken, die in zwei von Hand gefertigten Pantoffeln (man nennt sie hier Potschen) stecken. Wir entdecken dann ein dunkel geblümtes Flanellkleid und eine ärmellose, vorn zugeknöpfte Schürze, wie sie alle alten Frauen hier von morgens bis abends tragen und endlich ein helles Baumwollkopftuch, das das Gesicht einer alten Frau halb verdeckt. Runzlig, klein und schmal, mit gebückten Schultern, die knotigen kleinen Hände im Schoß gefaltet, beobachtet sie uns stumm, wie ein überraschtes Tierchen in seiner Höhle.
Unsere Verblüffung ist schwer zu beschreiben.
Mario versucht, ein paar Worte mit ihr zu wechseln. Er entschuldigt sich, weil wir einfach so in ihr Haus eingedrungen sind...
»Na, na, des schtearscht mi net«, erwidert eine hohe, schrille, unheimliche Stimme... Mario, der nicht nur den lokalen Dialekt perfekt spricht, sondern auch die Fähigkeit hat, mit jedem menschlichen Wesen, gleich welcher Herkunft und welchen Alters, umgehen zu können, und dies mit einer Wärme und Anteilnahme, mit der er sich sofort alle Sympathien erwirbt, versucht, etwas mehr zu erfahren: Wie sie heißt, wie der Ort heißt, an dem wir uns befinden, warum sie ganz allein hier oben lebt, und ob er etwas für sie tun kann. Mario übersetzt nach und nach für uns, doch er versteht nicht immer alles, teils wegen ihrer Sprache, die er als archaisch bezeichnet, teils weil sie fast keine Zähne mehr hat, was eine klare und präzise Aussprache erschwert. Aber wahrscheinlich liegt es auch an der mangelnden Übung: Sie hat in dieser Einsamkeit gewiss nicht oft Gelegenheit, mit Leuten zu plaudern, und die Touristen, die sich hierher verirren, sprechen gewiss kein Wort Südtirolerisch.
Sie heißt Tresl und die Hütte, in der sie lebt, ist der Lärchenhof. Mario fragt sie, ob es hier je Lerchen gegeben habe, auf diesem Hof und in dieser Höhe. Die Alte lacht. Ein Lachen, das einem Gänsehaut verursacht, so schrill und unnatürlich ist es. Es klingt beinahe, als käme es nicht aus einem menschlichen, sondern aus einem metallenen Körper.
Lerchen gibt es hier keine, antwortet die Tresl kichernd. Früher vielleicht einmal. Als der alte Kaiser noch lebte. Als die Welt noch in Ordnung war. Da wagten sich sogar die Lerchen bis hierher! Der Name des Anwesens habe aber nichts mit den Lerchen zu tun, und wieder lacht sie über das Missverständnis, sondern mit den Lärchen... bis vor kurzem habe nämlich eine wunderschöne Lärche unmittelbar neben dem Haus gestanden.
Mario fragt sie, ob wir uns draußen hinsetzen dürften, um etwas zu essen: wir haben einen rustikalen Holztisch mit einer Sitzbank gesehen.
»Jo, jo, get la...«, und es ist nicht klar, ob sie uns zum Bleiben oder zum Gehen auffordert.
Noch erstaunt über die unerwartete Begegnung, setzen wir uns auf die baufällige Sitzbank und fallen um ein Haar herunter. Die Bank ist in der Tat wacklig und morsch und die Nägel sind rostig. Wir setzen uns vorsichtshalber auf das Stallmäuerchen, nachdem wir es etwas gesäubert haben, jeder von uns heimlich von dem Wunsch beseelt, diesen Ort so rasch wie möglich zu verlassen.
Ein paar Minuten später erscheint die Alte auf der Schwelle, schließt die Tür mit einem großen Schlüssel ab, der sich erstaunlicherweise im völlig verrosteten Türschloss immer noch drehen lässt, und macht sich, auf einen knorrigen Stock gestützt, auf den Weg, ohne uns eines Blickes zu würdigen (vielleicht denkt sie, wir seien bereits gegangen, oder sie hat uns einfach vergessen).
Sie sieht aus wie die Hexe aus dem Märchen.
Verblüfft blicken wir ihr nach und fragen uns, wie alt sie wohl sein mag und wie sie hier oben allein, in dieser heruntergekommenen Hütte voller Spinnweben und Schmutz hausen kann.
Wovon sie wohl lebt? Nirgends ein Gemüsegarten, nicht einmal ein paar Hühner. Nichts. Wir sehen nur Verlassenheit, Elend. Einsamkeit.
Schweigend machen auch wir uns auf den Weg, der auf der anderen Bergseite ins Tal hinunter führt. Nach einer knappen halben Stunde auf einem schmalen Fußweg erblicken wir einen kleinen Weiler inmitten von Wiesen und Wäldern, in einem Panorama, das überaus idyllisch ist. Wir haben die schroffen Felswände hinter uns gelassen, und vor uns liegen ein paar neu gebaute Bergbauernhöfe, zu denen eine asphaltierte Straße führt. Ein paar Autos stehen auf einem Parkplatz neben einem der Häuser. Dies ist unser Ausflugsziel, das Restaurant, welches Mario am Tag vorher gerühmt hat.
Endlich auf der asphaltierten Straße angelangt, stellen wir fest, dass nur zwei der Häuser jüngeren Datums sind. Ein großer, sorgfältig renovierter herrschaftlicher Hof, an dessen Fassade eine Tafel mit dem Baujahr 1642 prangt, beherrscht mit feierlichem Ernst die übrigen Häuser. Die soliden und dicken, allen menschlichen und meteorologischen Stürmen trotzenden Steinmauern bilden einen Kontrast zur neureichen, traditionsund geschichtslosen Zerbrechlichkeit der anderen Häuser.
Auf einer robusten Sitzbank aus noch jungem Holz sehen wir die Tresl in der Sonne sitzen. Sie ist vor uns angekommen! Mario grüßt sie herzlich, wie eine alte Bekannte. Sie schaut ihn bloß etwas zerstreut an, als sähe sie ihn zum ersten Mal, und murmelt einen Gruß, wie es in den Bergen auch unter Unbekannten üblich ist, wenn man einander begegnet.
Wir brennen inzwischen vor Neugierde. Wir betreten die große dunkle Gaststube, die unverkennbar das Wohnhaus des früheren Bauern war, und Mario ruft nach dem Besitzer, einem Freund von ihm. Mario scheint jedes Lokal, jeden Menschen in ganz Südtirol zu kennen, und alle sind ihm aufgrund wer weiß welcher Freundschaftsgesten und gegenseitiger Wertschätzung verbunden.
Nach einer Weile kommt der Wirt zu unserem Tisch. Ein Bauer mit städtischem Auftreten, das er zweifellos dem Umgang mit den Gästen, alles Touristen, zum Großteil aus Italien, verdankt. Er hat aber auch eine Zeitlang in der Stadt gelebt, in Meran, informiert uns Mario, wo er die Hotelfachschule besucht hat.
Lautstarke Begrüßungen, kräftiges Händeschütteln, das jeden einzelnen Fingerknochen knacken lässt, und schließlich die Aufforderung, sich doch zu einem Aperitif zu uns zu setzen. Er habe viel zu tun, wehrt er ab: Obwohl heute kein Feiertag sei, habe das schöne Wetter die letzten Feriengäste bewogen, einen Ausflug hierher zu unternehmen... doch nachher, wenn das Gröbste vorüber sei, verspricht er, einen Augenblick zu uns zu kommen.
Das Restaurant füllt sich mehr und mehr mit Gästen – es scheint fast, als hätten sich alle Touristen im Tal hier verabredet.
Als wir schließlich jede Hoffnung aufgegeben haben, den Wirt noch einmal zu sehen, tritt er aus der Küche und legt die weiße Kochschürze ab. Auf seinen Wink erscheint ein Kellner mit einem mit Schnapsgläsern beladenen Tablett: Schnaps, den er nur Freunden anbietet, wie er erklärt und setzt sich zu uns an den Tisch.
Von uns ermutigt, bestürmt ihn Mario gleich in reinstem Südtiroler Dialekt mit Fragen. Ab und zu erklärt er etwas und verspricht uns, den Rest später auf dem Heimweg zu erzählen.
Die Tresl sei seine Urgroßmutter, sagt der Wirt, besser gesagt seine Urgroßtante, sie sei die Frau des jüngeren Bruders seines Urgroßvaters.
Ein Leben im Hochgebirge: Könnten wir uns überhaupt vorstellen, was das bedeutet? Die asphaltierte Straße bestehe erst seit einigen Jahren, erzählt der Wirt, vorher sei man zu Fuß gegangen und für schwere Transporte habe man früher ein Pferd benützt. Zur Sonntagsmesse ins Tal hinunter zu kommen bedeutete zwei Stunden Hin- und mindestens drei Stunden Rückweg. Man musste in der Dunkelheit aufbrechen, um rechtzeitig anzukommen, und ein ganzer Vormittag war vertan. Im Winter ging man wegen des Schnees, des Windes und der Stürme, die tage- und nächtelang andauern konnten, lieber erst gar nicht aus dem Haus, so groß war die Lawinengefahr und das Risiko, in eine von Schnee bedeckte Felsspalte zu stürzen. Man erzähle sich heute noch, nach vielen Jahren, von Unglücksfällen, von Menschen, die für immer verschwunden, von Felsspalten verschluckt worden seien; von Geistern Verstorbener, die in Mondnächten herumzögen und den leichtsinnigen Wanderer beim Namen riefen... wehe dem der stehen bleibt und horcht. Das lässt das Blut in den Adern erstarren!
Die Einsamkeit, das auf ein Minimum beschränkte Leben, die Genügsamkeit durch die ärmlichen Mittel verursacht, isolierte die Leute von der bürgerlichen Gemeinschaft. Er erzählt, dass sie das Ende des Ersten Weltkriegs hier mit großer Verspätung erfahren hätten. Erst als der Frühling längst da war. Auch das Dorf sei vom Rest der Welt abgeschnitten gewesen, keine Nachricht sei bis hier herauf gelangt.
Wie war die Tresl in ihrer Jugend, gibt es eine Fotografie von ihr? Der Wirt ist überrascht, er hat sich nie gefragt, wie seine Uroma ausgesehen haben mag, er hat nie an sie als an eine junge Frau gedacht... Er ruft nach seiner Frau, einer knapp Vierzigjährigen, deren Art sich zu kleiden, an die Eleganz der italienischen Touristinnen erinnert, wäre da nicht das für Tirol so typische Gesicht. Die Vorstellung eines Interviews belustigt sie, sie schmunzelt befriedigt und ist gerne bereit, unsere Fragen zu beantworten. Sie spricht sehr gut Italienisch, mit gedehntem R und dem typischen Südtiroler Akzent.
»Die Urgroßmutter Tresl stammt aus dem Ahrntal und muss über neunzig sein, da sie noch zur Zeit der Donaumonarchie zur Welt gekommen ist. Einmal, vor ein paar Jahren, als sie noch einigermaßen bei klarem Verstand war – heute lässt ihr Erinnerungsvermögen sehr zu wünschen übrig – erzählte sie uns neben den vielen äußerst merkwürdigen, fast unglaublichen Geschichten aus ihrer Vergangenheit, dass ihr Vater die Nachricht vom Tod des Kaisers mit der Bemerkung kommentiert habe, dass nun alles zusammenbrechen, dass nichts bleiben würde wie vorher. Sie sei damals acht oder neun Jahre alt gewesen und habe nicht verstanden, wie der Tod einer so weit weg lebenden Person bei ihnen in den Bergen wer weiß was für ein Unheil anrichten könne, und sie habe begonnen, das Haus, die Mauern, das Dach zu beobachten und nach Rissen und anderen Zeichen abzusuchen, die deren Verfall und vielleicht sogar das Ende der Welt ankündigen könnten! Damals waren die Mädchen sehr naiv«, fügt sie mit einem überlegenen Lächeln hinzu.
Nein, sie besitze keine Fotografie von der Tresl, nicht einmal ein Hochzeitsfoto, das doch eigentlich üblich war, aber sie wisse, dass die Tresl ein hübsches blondes Mädchen gewesen war, hoch gewachsen und voller Energie, und dass sie sogar in Sizilien gewesen sei.
Es war im Jahr 1926 oder 27, niemand weiß es genau, sie selber erst recht nicht. Sie ging wie viele andere junge Mädchen nach Sizilien in Stellung: In den Zwanziger Jahren setzte eine starke Auswanderungswelle junger Tirolerinnen in verschiedene Regionen Italiens ein, insbesondere ins Piemont und in die Lombardei, aber auch nach Florenz und Rom sowie in einige große Städte im Süden. Es herrschte damals eine große Nachfrage nach deutschsprachigen Hausangestellten, Kindermädchen, Köchinnen, Haushälterinnen, aber auch Kellnerinnen und Zimmermädchen in den Hotels. Die Tirolerinnen waren als hervorragende Arbeitskräfte bekannt, fleißig, redlich, gutmütig und – was in einem Land wie Italien, wo der Analphabetismus weit verbreitet war, nicht zu unterschätzen war – sie konnten lesen und schreiben.
Die Tresl, im Unterschied zu vielen ihrer Altersgenossinnen, die Norditalien oder sogar Deutschland vorzogen, ging nach Sizilien, genau gesagt nach Catania, um dort in einem Hotel zu arbeiten. In einem Luxushotel im Stadtzentrum. Und sie blieb ein paar Jahre dort. Es war nicht ganz klar, wie lange, drei oder vier Jahre vielleicht, sie erinnert sich selber nicht mehr genau.
****
In der Tat eine interessante Geschichte, die von der Tresl, die in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts den Mut hatte, allein durch ganz Italien zu reisen, die Meerenge zu überqueren und Arbeit zu suchen unter Menschen, die nicht ihre Sprache sprachen.
Dieses Häuflein Mensch war früher einmal von ganz anderer Gestalt gewesen, die beiden heute noch im Nacken geknoteten Zöpfe unter dem hellen Kopftuch waren dick und glänzend gewesen. Eine Krone aus purem Gold, die die Blicke aller, Männer und Frauen, auf sich gezogen hatte. Sie hatte die Haare nie geschnitten. Ihre Mutter hatte gesagt, sie seien ihre einzige Mitgift, das einzige Gold, das sie besäße, und sie solle sie gut sichtbar tragen, und zwar auf dem Kopf, wie die Königinnen ihre Krone.
Als sie etwa dreizehn Jahre alt war, begleitete sie der Vater am 5. Februar 1921, dem so genannten Schlenggeltag2, zum Jahrmarkt, um eine Stelle für sie zu finden, wie es Brauch war. Einer der Bauern auf der Suche nach Arbeitskräften bemerkte gleich dieses Gold, die aufrechte Haltung des Kopfes und das runde, noch kindliche Gesicht mit den nur leicht angedeuteten Gesichtszügen eines in Holz geschnitzten Barockengels. Das ganze Persönchen hatte etwas Würdevolles, Stolzes und auch Entschlossenes an sich. Zwei andere Bauern traten ebenfalls interessiert vor, aber der erste bot sofort einen Jahreslohn, der über dem üblichen lag. Die anderen beiden Bauern lächelten und warfen sich verstohlene Blicke zu. Auch der Vater verstand.
»Die Tresl isch fleißig, sie isch giweint zi orbatn...« Dann schaute er ihm direkt in die Augen und fügte, von Mann zu Mann, hinzu: »und an ördntlicha Gitsche ischs a!«
Auf dem Hof betrachtete die Bäuerin den Neuerwerb ihres Mannes argwöhnisch: Das Mädchen war zu jung, eine Kleindirn, der man alles erst beibringen musste. Außerdem, dieses Gesicht, diese blauen Augen, das fein gezeichnete Näschen, der kleine, aber volle Mund… nein, das passte ihr nicht. Der dicke, auf dem Kopf hoch aufgesteckte Zopf war für sie eine Provokation, eine Beleidigung, denn sie hatte aufgrund der ständigen Schwangerschaften – zwölf Kinder – viele Haare verloren und ihre dünnen ergrauten Zöpfe erinnerten an die einer alten Frau. Aber nicht nur das Gold der Haare ärgerte sie. Mehr noch vergällte sie der Anblick des jungen Körpers, der, obwohl eindeutig unterernährt, geschmeidig und stark war, mit kleinen, aber festen und spitzen Brüsten, auf die sich die begierigen Blicke der Männer auf dem Hof sofort hefteten. Ihre Brüste hingegen, zwei schlaff herabhängende Beutel, erfüllten nur noch den Zweck, ihren ewig hungrigen Säuglingen etwas Milch zu geben und zogen niemandes Blicke mehr auf sich.
Nach knapp einer Woche befahl sie ihr mit schneidender Stimme, den Zopf im Nacken zusammenzubinden, wie es sich für ein anständiges Mädchen gezieme.
»Mein Muito hot gsog, i sött die Zöpfn austelln«, antwortete die Tresl mit trotzig gerecktem Kinn.
Die Bäuerin verpasste ihr mit der flachen Hand einen Schlag auf die Wange, dass sie taumelte. Ihre Wange war zwei Tage lang geschwollen und sie hätte beinahe einen Zahn verloren.
»Du frechs Luido, asöi learnsche, wie man se aufirscht.« Eine Lektion, die Tresl nicht vergaß.
Der Bauer stellte mit Befriedigung fest, was sich unter der männlichen groben Jacke verbarg: Ein ausgezeichneter Erwerb, dachte er.
Sein scheeler und begieriger Blick ließ nicht mehr von ihr ab.
Sie ging ihm nicht aus dem Kopf, Tag und Nacht, er wusste jedoch, dass er ein beträchtliches Risiko einging. Der Vater schien ihn durchschaut zu haben. Wenn er sich ihm gegenüber kompromittierte, könnte dies eine Schadenersatzforderung nach sich ziehen, zum Beispiel eine Geldsumme für eine eventuelle Mitgift. Ganz abgesehen von anderen möglichen Erpressungen. Doch er wollte nicht verzichten.
Andererseits hatte noch keine Frau je einen Bauern wegen Vergewaltigung verklagt, versuchte er sich zu beruhigen. Niemand würde ihr Glauben schenken. Außerdem würde sie vor den Leuten das Gesicht verlieren.
Angesichts all dessen war es klüger, dem jüngeren Bruder den Vortritt zu lassen, Der Seppl, mit seinen sechzehn Jahren, noch minderjährig, würde das Mädchen entjungfern müssen.
Und so geschah, was geschehen musste. Eines Morgens, in aller Frühe, als die Tresl sich noch ganz schlaftrunken anschickte, eine der ihr zugeteilten Kühe zu melken, spürte sie zwei kräftige Arme, die sie an den Schultern packten. Ein heftiger Stoß reichte aus, um sie auf das von Jauche durchnässte Stroh zu werfen. Es war der stämmige Junge, der sie bis dahin kaum einmal eines Blickes gewürdigt hatte und sich jetzt schlimmer als ein brünstiges Tier stumm auf sie warf. Es dauerte nur wenige Minuten. Sie war fassungslos und hatte weder Zeit zu protestieren noch sich zur Wehr zu setzen. Sie winselte nur wegen des brennenden Schmerzes, wegen der Brutalität, mit der sie entzweigerissen wurde. Auch Seppl war mehr oder weniger unerfahren. Und es kam ihm gar nicht in den Sinn, auf eine Dirn besondere Rücksicht zu nehmen.
Am Ende war sie völlig blutbeschmiert.
Der Junge, keineswegs peinlich berührt von dem ganzen Blut, zog sich die Hose hoch und ging ohne ein Wort, vermied aber, ihr in die Augen zu sehen. Er hatte den Auftrag des älteren Bruders ausgeführt. Was gab es da noch zu sagen?
Die Tresl, noch ganz benommen, voller Schmerzen und gedemütigt, zupfte ihr Kleid zurecht, schluckte die Tränen hinunter und machte sich erneut ans Melken der Kuh, die sie die ganze Zeit aufmerksam betrachtet hatte, als verstände sie, was sich da abspielte.
Ein paar Tage später überfiel sie der Bauer im Stall – und bevor Tresl auch nur einen Gedanken fassen konnte, lag sie schon wieder auf einem Heuhaufen.
Nachts fand der Bauer keinen Schlaf, weil er so besessen war vom Gedanken an das Mädchen. Er stand auf, und auf die Frage seiner Frau antwortete er barsch, er habe im Stall ein Geräusch vernommen. Ruhelos ging er im Hof umher und suchte nach einer Lösung: Tresl schlief mit anderen Mägden in einer Kammer. Wie konnte er sie zu sich rufen, ohne die anderen zu wecken? Tagsüber fand sich immer eine Möglichkeit, sie allein anzutreffen, aber nachts... unmöglich, wenn er keinen Skandal hervorrufen wollte. Doch gerade nachts spürte er das dringende Verlangen nach dem widerspenstigen und ungebärdigen Körper. Ein Fohlen, ja, das war sie, ein unzähmbares wildes Fohlen. Denn nach einiger Zeit, fing das Mädchen an sich zu wehren, knurrte wütend und traktierte ihn mit Tritten, die ihn noch mehr erregten.
Die Tresl wusste nicht, wie sie sich dieser Gewalt entziehen sollte; sie versuchte sich zu widersetzen, aber sie traute sich nicht zu schreien oder zu beißen, wie sie es in einem anderen Fall gemacht hätte: der Bauer war der Herr und erlaubte keinen Widerstand. Auf jeden Tritt antwortete er sofort mit Ohrfeigen, Schlägen und der Drohung sie zu entlassen. Aber sie konnte seine ständigen Attacken nicht ertragen und ihr Körper wehrte sich, fast ohne ihr Zutun. Und was sollte sie ihrer Familie sagen? Und wie vor den Leuten ihre Entlassung rechtfertigen? Sie wusste genau, wie alle reagieren würden: sie allein war an allem Schuld… aus Prinzip.
Auch der Seppl war auf den Geschmack gekommen und nahm jede sich ihm bietende Gelegenheit wahr.
Sie wähnte sich in einem Albtraum: Tagsüber, wenn alle beieinander waren, behandelten die beiden Brüder sie wie Luft, und wenn sich ihre Blicke einmal zufällig kreuzten, las sie in ihren Augen nur Gleichgültigkeit und Verdruss. Sie war verwirrt und wusste nicht, wie sie sich verhalten sollte, denn es folgten immer wieder Tage, an denen nichts passierte. Dann beruhigte sie sich und glaubte schon, es sei alles vorbei und vergessen. Bis zum nächsten Zusammentreffen, bis zur nächsten Gewalttätigkeit. Sie vermied es nach Möglichkeit, alleine zu sein und suchte immer häufiger die Gesellschaft der anderen Mägde, die ihr mit Verachtung begegneten, sie als schuldig ansahen, für das Vergehen anderer. Aber nicht immer gelang es ihr, denn es stand in der Macht des Hofbauern, sie zu rufen, wann und wo er wollte, ohne sich um die missbilligenden Blicke der anderen Frauen zu kümmern.
Der Bäuerin war nichts entgangen, doch da sie die Reaktion des Ehemannes fürchtete, rächte sie sich an der Tresl und herrschte sie für jede Kleinigkeit an. Es war für die ganze Familie, den ganzen Hof eine Hölle aus bösen Blicken, strengen Gesichtern, Missmut und bedrückendem Schweigen. Die Tresl musste Schläge und Misshandlungen einstecken, obwohl sie sie nicht verdiente. Schließlich griff die Mutter des Bauern ein, die bereits seit einiger Zeit einen Verdacht hegte, auch was den jüngeren Sohn anging, an dem sie besonders hing, und es wurde beschlossen, das Mädchen zu entlassen. Der Bauer war außer sich vor Wut: Er hatte dem Vater versprochen, die Tresl für ein paar Jahre anzustellen, bis ihre Lehrzeit zu Ende war, außerdem konnte man sie nicht vor dem fünften Februar nach Hause zurückschicken. Auch fürchtete er den Pfarrer des Dorfes, wohin die Tresl zweimal im Jahr zur Messe hinunterging: vielleicht hatte sie gebeichtet.
Auch Seppl protestierte. Er hatte sich zu sehr an sie gewöhnt.
Gegen Ende Januar, nach einem der endlosen Schneefälle, der die Berge und Felder erneut mit einer makellosen weißen Schicht bedeckt hatte, sah man eine kleine schwarze Gestalt von Weitem mühsam bergauf stapfen und dabei auf dem mit Stangen abgesteckten Pfad immer wieder einsinken. Die Sonne, der klare und arglose Himmel sowie die beleibte schwarze Gestalt, der breitkrempige Hut, der flatternde Talar – jeder wußte sofort wer es war und niemand zweifelte am Grund dieses Besuchs.
»In dein Haus leb man in do Toatsinte!«, erklärte der Pfarrer nach einem Schnaps, den ihm der Bauer sogleich gereicht hatte. Es waren keine weiteren Worte nötig.
So kam es, dass die Tresl den Seppl heiratete, ohne dass er ihr je einen richtigen Heiratsantrag gemacht hatte. Der Bursche hatte nichts zu melden, im Grunde wurde er nicht einmal gefragt. In aller Eile wurde Hochzeit gehalten, schließlich handelte es sich nur um eine Magd, die außerdem in Todsünde lebte. Eine Hochzeit ohne Gäste und ohne Fotografie, denn es gab nur einen Fotografen in dem nahen Städtchen, und niemand dachte ernsthaft daran, zu ihm zu gehen und dadurch einen ganzen Arbeitstag zu verlieren. Ganz zu schweigen von den unerschwinglichen Kosten. Um nicht ins Gerede zu kommen, musste ein Brautkleid genäht werden, das so genannte Bairische Gwand, lang, schwarz, mit einem hohen Kragen, umrandet von einem schmalen, weißen Spitzenbesatz und eine helle Schürze aus glänzender Kunstseide, die bis zum Rocksaum reichte. Die Bäuerin, sehr verärgert, musste wenigstens diese Tradition bewahren.
Aber selbst nach ihrer Heirat war der Bauer nicht gewillt, auf die Tresl zu verzichten. Wenngleich etwas seltener, fand er doch immer wieder eine Möglichkeit, ihr aufzulauern und fürchtete weder die Vorhaltungen des Bruders (seit er verheiratet war, wurde der sogar eifersüchtig, da er sich als alleiniger Besitzer der Frau fühlte) noch die der Mutter oder der Bäuerin.
Nicht einmal das Machtwort des Pfarrers nützte etwas.
Als letzten Ausweg schickte man sie so weit wie möglich fort, eben nach Sizilien.
Der Pfarrer hatte ihr die Stelle verschafft, wenn auch widerwillig. Die Südtiroler Pfarrer waren gegen die Abwanderung der jungen Mädchen in die großen Städte, Orte des Verderbens. Doch um die Seelen jener Familie zu retten, musste die Quelle der Sünde entfernt werden. Er hatte nie geglaubt, die junge Frau sei unschuldig, im Gegenteil.
Dieser Ansicht war auch die Schwiegermutter, die ihr mehrfach vorwarf, dass ihr ein Mann nicht genüge. Die Tresl hatte die bösartig gezischten Worte noch immer im Ohr: Alle ihre Söhne dieser Maultasch3 hörig. Die nahm sie bei lebendigem Leib aus, das Luder. Die Tresl wusste nicht einmal, wer die Maultasch war, in der Schule hatte sie den historischen Ereignissen ihrer Region kein besonderes Interesse entgegengebracht, doch sie hatte verstanden, dass es sich um eine schändliche Person handeln musste, wenn die Schwiegermutter sie mit ihr verglich.
Sie war erleichtert abgereist.
Schlimmer kann es nicht werden, hatte sie gedacht. Ans Arbeiten war sie seit der Kindheit gewohnt, und an Männer auch.
Es wurde eine zweitägige Reise in einem fast nur mit Männern überfüllten Zug, und alle blickten sie mit den gleichen gierigen Augen, wie der Bauer, an. Nachts kam es zu verschiedenen Annäherungsversuchen. Die Tresl, trotz ihrer Jugend, wegen der schweren Bauernarbeit ungewöhnlich kräftig, konnte sich mit Händen, Fingernägeln und notfalls auch Zähnen zur Wehr setzen. Sie war nicht mehr das naive und unbedarfte junge Mädchen von früher. Die Jahre und Erfahrungen hatten sie gelehrt, sich zu verteidigen.
Welche Gefühle, welche Eindrücke für diese junge Frau, die bis zu diesem Moment in den Bergen gelebt, nur den Ausblick auf die Alpen als letzte Grenze zum Rest der Welt gehabt hatte! Nur schneebedeckte Felsen und Windstürme. Die mit Eiskrusten überzogenen Wände der Schlafkammer, die nie geheizt wurde, blieben auch im Sommer gefroren. Die kurzen Sommer; der blaue, klare Himmel, dem man nur am Morgen einen flüchtigen Blick zuwarf, bevor man den Kopf beugte, zum Acker hinunter, den es zu bestellen galt. Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang. Das war die Vergangenheit, die sie hinter sich gelassen hatte, eine Vergangenheit voller Mühe, Ungerechtigkeiten, Gewalt und anderen kleinen Ereignissen ihres kurzen Lebens.
Quer durch die ganze Halbinsel, mit unendlich vielen Aufenthalten an immer anderen Bahnhöfen, unter Menschen, die ein- und ausstiegen und fremde Dialekte sprachen, die sie nicht verstand; eine ungewohnte Landschaft, die mit großer Geschwindigkeit am Fenster vorbeizog; eine Vegetation, die ihr vollkommen unbekannt war, Bäume mit seltsamen, schirmartigen Formen und vereinzelte oder grüppchenweise auf Hügeln verstreute Zypressen. Märchenlandschaften. Schließlich das Meer, ein grenzenloser See, dessen Ufer man nicht sehen konnte, weil er so groß war, und die Fähre, die sie zu der Insel brachte, deren Name sie vielleicht einmal, als Kind in der Schule, gehört hatte.
Die Überfahrt bei besonders stürmischem Seegang, war ein Albtraum: Alles hätte sie vergessen können, doch nie die Angst, von diesen Wellen verschlungen zu werden, die Übelkeit und den schrecklichen Brechreiz, bei dem sich ihr die Eingeweide umstülpten. Bei der Landung in Messina konnte sie sich kaum auf den Beinen halten und war ganz grau im Gesicht. Noch nie in ihrem Leben hatte sie sich so elend gefühlt. Zwei Frauen mittleren Alters, zwei Bäuerinnen vielleicht, reichten ihr etwas Wasser zu trinken und ein Stück Brot, stützten und trösteten sie in einer Sprache, die sie nicht verstand.
Die letzte Fahrt von Messina nach Catania setzte ihr noch mehr zu: Die Bahn fuhr nur ein paar Meter vom Meeresufer entfernt, die Bahngleise lagen wenig über dem Wasser, hinzu kam das Schwappen der Wellen direkt neben dem Eisenbahnwagen... und wenn der Zug nun entgleiste und im Meer landete? Die endlose Wasserfläche, die sich ununterbrochen bewegte und nur von einem weit entfernten Horizont begrenzt wurde, jenseits dessen sie sich das Ende der Welt vorstellte, wartete nur darauf, sie und den Zug zu verschlucken. Sie würde in dieser Wassermasse verschwinden. In einem eisernen Sarg versinken. Niemand hätte von ihr etwas gewusst, niemand hätte an sie gedacht: Ein Leben, das sich in nichts aufgelöst hätte.
Wie der Pfarrer gesagt hatte, erwartete sie ein Priester am Bahnhof von Catania. Er kam auf sie zu, erkannte sie auf den ersten Blick unter den Passagieren, die aus den Bahnwagen dritter Klasse stiegen: Ein hochgewachsenes blondes Mädchen, mit einem dicken, um den Kopf gelegten Zopf und dem typischen runden Gesicht der Südtirolerinnen. Selbst in der buntesten Menschenmenge war sie unmöglich zu übersehen.