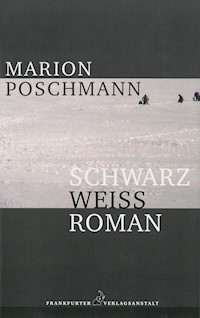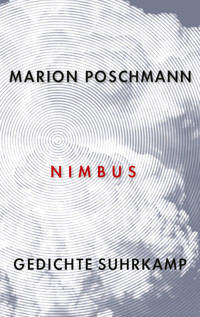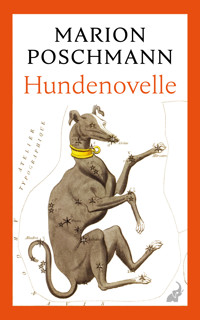11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman von meisterhafter Leichtigkeit: tiefgründig, humorvoll, spannend, zu Herzen gehend. Im Teeland Japan mischen sich Licht und Schatten, das Freudianische Über-Ich und die dunklen Götter des Shintōismus. Und die alte Frage wird neu gestellt: Ist das Leben am Ende ein Traum?
Gilbert Silvester, Privatdozent und Bartforscher im Rahmen eines universitären Drittmittelprojekts, steht unter Schock. Letzte Nacht hat er geträumt, dass seine Frau ihn betrügt. In einer absurden Kurzschlusshandlung verlässt er sie, steigt ins erstbeste Flugzeug und reist nach Japan, um Abstand zu gewinnen. Dort fallen ihm die Reisebeschreibungen des klassischen Dichters Bashō in die Hände, und plötzlich hat er ein Ziel: Wie die alten Wandermönche möchte auch er den Mond über den Kieferninseln sehen. Auf der traditionsreichen Pilgerroute könnte er sich in der Betrachtung der Natur verlieren und seinen inneren Aufruhr hinter sich lassen. Aber noch vor dem Start trifft er auf den Studenten Yosa, der mit einer ganz anderen Reiselektüre unterwegs ist, dem Complete Manual of Suicide.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Marion Poschmann
Die Kieferninseln
Roman
Suhrkamp
Inhalt
Tokyo
Takashimadaira
Aokigahara
Senju
Sendai
Shiogama
Matsushima
Die Kieferninseln
Willst du etwas über Kiefern wissen —
geh zu den Kiefern. Matsuo Bashō
Tokyo
Er hatte geträumt, daß seine Frau ihn betrog. Gilbert Silvester erwachte und war außer sich. Das schwarze Haar Mathildas breitete sich neben ihm auf dem Kissen aus, Tentakel einer bösartigen, in Pech getauchten Meduse. Dicke Strähnen bewegten sich sachte mit ihren Atemzügen, krochen auf ihn zu. Er stand leise auf und ging ins Bad, starrte dort eine Weile fassungslos in den Spiegel. Ohne zu frühstücken, verließ er das Haus. Als er abends aus dem Büro kam, fühlte er sich immer noch wie vor den Kopf geschlagen, beinah betäubt. Der Traum hatte sich im Laufe des Tages nicht verflüchtigt und war nicht einmal ausreichend verblaßt, um die alberne Redensart »Träume sind Schäume« auf ihn anwenden zu können. Im Gegenteil war der Eindruck der Nacht stetig stärker geworden, überzeugender. Eine unmißverständliche Warnung des Unbewußten an ihn, das naive, ahnungslose Ich.
Er betrat den Korridor, ließ theatralisch die Aktentasche fallen und stellte seine Frau zur Rede. Sie stritt alles ab. Dies bewies nur, wie sehr sein Verdacht begründet war. Mathilda kam ihm verändert vor. Unnatürlich vehement. Aufgeregt. Verschämt. Sie bezichtigte ihn, daß er sich am frühen Morgen hinausgeschlichen und sich nicht von ihr verabschiedet habe. Sorgen. Gemacht. Wie. Konntest. Du. Nur. Endlose Vorwürfe. Ein fadenscheiniges Ablenkungsmanöver. Als läge die Schuld plötzlich bei ihm. Sie ging zu weit. Das ließ er nicht mit sich machen.
Er wußte später nicht mehr, ob er sie angeschrien hatte (wahrscheinlich), geschlagen (eventuell) oder bespuckt (nun ja), es konnte sein, daß ihm beim erregten Sprechen etwas Speichel aus dem Mund gesprüht war, jedenfalls hatte er ein paar Sachen zusammengerafft, seine Kreditkarten und seinen Paß an sich genommen und war weggegangen, am Haus vorbei den Bürgersteig entlang, und als sie ihm nicht hinterherkam und nicht nach ihm rief, war er weitergegangen, etwas langsamer erst und dann schneller, bis zur nächsten U-Bahn-Station. Er war im Untergrund verschwunden, traumwandlerisch, würde man im nachhinein sagen, durch die Stadt gefahren und erst am Flughafen wieder ausgestiegen.
Er verbrachte die Nacht in Terminal B, unbequem hingelagert auf zwei Schalenstühle aus Metall. Immer wieder überprüfte er sein Smartphone. Mathilda hatte ihm keinerlei Nachricht zukommen lassen. Sein Flug ging am nächsten Morgen, der früheste Interkontinentalflug, den er so kurzfristig hatte buchen können.
Im Airbus auf dem Weg nach Tokyo trank er grünen Tee, sah zwei Samuraifilme in der Rückenlehne des Vordersitzes und überzeugte sich immer wieder davon, daß er nicht nur alles richtig gemacht hatte, sondern daß sein Handeln unausweichlich gewesen war, daß es weiterhin unausweichlich war und unausweichlich sein würde, nach seiner persönlichen Meinung und nach der Meinung der Welt.
Er nahm sich zurück. Er pochte nicht auf sein Recht. Er machte den Weg frei. Für wen auch immer. Einen miesepetrigen Macho, ihren Chef, den Schulrektor. Einen gutaussehenden Jüngling, gerade erst volljährig, den sie angeblich betreute, einen Referendar. Oder eine ihrer penetranten Kolleginnen. Gegen eine Frau könnte er nichts ausrichten. Bei einem Mann wäre eventuell die Zeit auf seiner Seite. Er könnte die Entwicklung abwarten, alles aussitzen, bis sie sich besönne. Es lag ja nahe, daß der Reiz des Verbotenen früher oder später verflog. Aber bei einer Frau war er machtlos. Leider war der Traum in diesem Punkt nicht ganz deutlich gewesen. Allerdings war der Traum insgesamt deutlich genug. Sehr deutlich. Als hätte er es geahnt. Im Grunde hatte er es geahnt. Schon lange. War sie nicht auffallend gut gelaunt gewesen in den letzten Wochen? Geradezu fröhlich? Und auch betont freundlich zu ihm? Von einer diplomatischen Freundlichkeit, die von Tag zu Tag unerträglicher wurde, unerträglicher geworden wäre, hätte er früher gewußt, was dahintersteckte. So aber war es ihr gelungen, ihn lange in Sicherheit zu wiegen. Und er, er hatte sich einlullen lassen, ein klares Versagen seinerseits. Er war nicht ausreichend auf der Hut gewesen, er hatte sich täuschen lassen, weil sein Mißtrauen nicht ins Unendliche ging.
Die japanische Stewardeß, langes schwarzes Haar zu einem Geisha-Knoten aufgesteckt, schenkte ihm mit bezauberndem Lächeln Tee nach. Natürlich galt dieses Lächeln nicht ihm persönlich, aber er fühlte sich davon ganzkörperlich berührt, als habe man einen Eimer Balsam über ihn ausgegossen. Er nippte am Tee und beobachtete, daß sie dieses Lächeln auf ihrem Weg durch den Gang beibehielt, daß sie es jedem einzelnen der Fluggäste schenkte, unwandelbar, ein maskenhafter Liebreiz, der mit erschütternder Effizienz seinen Zweck erfüllte.
Er hatte immer gefürchtet, für Mathilda zu langweilig zu sein. Rein äußerlich schien ihre Beziehung intakt. Aber er konnte ihr auf Dauer nicht viel bieten, keine gesellschaftliche Abwechslung, keine genialische Spannung, keine charakterliche Tiefe.
Er war ein unscheinbarer Wissenschaftler, Privatdozent. Für eine Professur hatte es nicht gereicht, weil ihm der richtige Familienhintergrund fehlte, weil er keine nützlichen Kontakte zu knüpfen wußte, weil er nicht zu schmeicheln verstand, sich nicht andienen konnte. Weil er viel zu spät begriffen hatte, daß es im universitären Betrieb nur zweit- oder drittrangig um die Sache ging, sondern in erster Linie um Machtausübung in einem hierarchischen System. Hier hatte er Fehler gemacht, eine Unzahl von Fehlern. Seinen Doktorvater kritisiert. Es im ungeeigneten Moment immer besser gewußt. Sich dann, eingeschüchtert, in den Augenblicken zurückgehalten, in denen es darum gegangen wäre, zu prahlen.
Während unter ihm eine dichte Wolkendecke vorüberzog, glitten in seiner Erinnerung die vergangenen Jahre vorbei, eine bedrückende graue Masse aus Demütigungen und Mißerfolgen. Als junger Mann hatte er geglaubt, überdurchschnittlich intelligent zu sein, aus der Menge der spießigen, angepaßten Leistungsträger herauszustechen und die Angelegenheiten der Welt mit philosophischem Scharfsinn zu durchdringen. Jetzt fand er sich in prekären Verhältnissen wieder, hangelte sich von einem Projektvertrag zum nächsten und sah sich von seinen ehemaligen Freunden, die weitaus schlechtere Noten geschrieben und niemals eigene Ideen geäußert hatten, beruflich abgehängt. Freunde, die, man mußte es so deutlich sagen, fachlich inkompetenter waren als er. Sie besaßen aber im Gegensatz zu ihm diese gewisse Cleverneß im Verhalten, die in Karrieredingen das einzig Nützliche war.
Während die anderen es sich mit ihren Eigenheimen, Familien und Routinen gemütlich machten, sah er sich gezwungen, idiotische und nur mäßig bezahlte Arbeiten auszuführen, ihm aufdiktiert von Leuten, die er im Grunde des Herzens verachtete. Jahrelang hatte er in der Angst gelebt, sich dabei so zu verbiegen, daß er keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Dann hatte die Angst nachgelassen und war einer allgemeinen Gleichgültigkeit gewichen. Er führte aus, was von ihm verlangt wurde, wandte seinen Scharfsinn an die schwachsinnigsten Aufgaben und konnte sich inzwischen, leider um Jahre, Jahrzehnte zu spät, auch den Anstrich geben, er sei mit allem einverstanden, sei nicht dagegen, sondern dafür.
Die japanische Stewardeß kam mit einem Korb, aus dem es dampfte. Sie reichte ihm mit einer langstieligen Metallzange ein aufgerolltes heißes Frotteetuch. Er wischte sich mechanisch damit die Hände ab, wrang das Tuch um seine Handgelenke, ließ die stechende Hitze in seinen Puls dringen, die reinste Wohltat, diese Sitte, dachte er, ein seltsamer Flug, bei dem man alles daransetzte, ihn zu beruhigen, er fuhr sich mit dem Tuch über die Stirn, eine Mutterhand bei Fieber, erstaunlich angenehm, aber schon begann es abzukühlen, er legte es sich aufs Gesicht, ein paar Sekunden nur, bis es nichts war als ein feuchter, kalter Lappen.
Das aktuelle Projekt hatte ihn zu einem Experten für Bartfrisuren gemacht. An Fragwürdigkeit kaum noch zu überbieten, sicherte es ihm immerhin über Jahre ein festes Einkommen. Und es war ihm mit der Zeit sogar gelungen, an dem unsäglichen Thema Gefallen zu finden, wie es im übrigen dem regelhaften Verlauf entsprach, daß das Interesse an den Einzelheiten wuchs, je mehr man sich in ein Gesamtsystem vertiefte. In der Fahrschule hatte er sich für Verkehrsregeln begeistert, in der Tanzschule für Schrittfolgen, es war keine Hexerei, sich mit einer Sache zu identifizieren.
Gilbert Silvester, Bartforscher im Rahmen eines Drittmittelprojekts, gesponsert von der nordrhein-westfälischen Filmindustrie sowie zu kleineren Teilen von einer feministischen Organisation in Düsseldorf und der jüdischen Gemeinde der Stadt Köln.
Das Projekt untersuchte die Wirkung von Bartdarstellungen im Film. Es ging dabei um Aspekte der Kulturwissenschaft und Gendertheorie, um religiöse Ikonographie und Fragen nach der Möglichkeit philosophischer Expressivität im Medium des Bildes.
Wie immer handelte es sich um ein Forschungsprojekt, bei dem die Ergebnisse schon vorher feststanden. Er erledigte die Fleißarbeit, trug Details zusammen, bewies mit der Reichhaltigkeit des Materials zugleich dessen Bedeutsamkeit, er bestätigte die allgemeine Anwendbarkeit kulturtheoretischer Schlußfolgerungen und bediente damit letztendlich die Manipulation der Zuschauer weltweit.
Morgens ging er in die Bibliothek, stellte sein Mobiltelefon aus und versank in den Bildern italienischer Meister, in Mosaiken und mittelalterlichen Buchillustrationen. Abbildungen von Bärten waren allgegenwärtig, und er fragte sich längst, wie es überhaupt sein konnte, daß zu solch grundlegenden Fragestellungen nicht schon längst geforscht worden war. »Bartmode und Gottesbild« lautete sein Themenschwerpunkt, den er je nach Tagesform als enorm ergiebig, ja elektrisierend, oder aber als vollkommen absurd und zutiefst deprimierend empfand.
Als letzte Bastion seines persönlichen Widerstands hielt er an gewissen nostalgischen Gewohnheiten aus seiner Schulzeit fest. Handschriftliche Aufzeichnungen nur mit Füllfeder und Tinte, in schwarze Kladden mit Fadenheftung. Jahrzehntelang nachgedunkelte Ledertasche, niemals einen Nylonrucksack. In jeder Lebenslage Hemd und Jackett. Als Schüler war es ihm gelungen, damit Eindruck zu schinden und den Status des empfindsamen Intellektuellen zu behaupten. Jetzt waren diese Eigenheiten nur mehr Ausdruck seiner Niederlage. Er klammerte sich an längst hinfällige Wertvorstellungen und an Gerätschaften einer vergangenen Zeit, ihn umgab etwas Altbackenes. Zwar hatte er versucht, hier mit postmodernen Krawatten und neonfarbenen Einstecktüchern auszugleichen. Es hatte nichts genützt. Er galt an der Uni als reaktionärer Ästhetizist. Zigarettenrauch verursachte ihm Kopfschmerzen. Er interessierte sich nicht für Fußball, und er aß kein Fleisch.
Er wischte noch einmal über seine Handflächen, breitete das weiße Frotteequadrat auf seinem Klapptisch aus und ließ es so liegen.
Unten riß die Wolkendecke auf und gab den Blick auf Sibirien frei. Der mächtige Strom Ob mit seinen vielen Zuflüssen schlängelte sich erhaben durch Sumpfland und Wälder. Auf dem Bildschirm bewegte sich die Flugzeugattrappe ruckartig von Tomsk ein Stück in Richtung Krasnojarsk und weiter nach Irkutsk.
Das europäische Rußland, Sibirien, die Mongolei, China, Japan — eine Flugroute, die ausschließlich über Teeländer führte. Gilbert Silvester hatte Länder mit überdurchschnittlichem Teekonsum bisher kategorisch abgelehnt. Er reiste in Kaffeeländer, Frankreich, Italien, gefiel sich darin, nach einem Museumsbesuch in Paris einen Café au lait zu bestellen oder in Zürich nach Café crème zu verlangen, er mochte Wiener Kaffeehäuser und die gesamte kulturelle Tradition, die damit verbunden war. Eine Tradition der Sichtbarkeit, der Vorhandenheit, der Deutlichkeit. In Kaffeeländern lagen die Dinge offen zutage. In Teeländern spielte sich alles unter einem Schleier der Mystik ab. In Kaffeeländern konnte man Dinge erwerben, auch mit geringen geldlichen Mitteln in einem gewissen punktuellen Luxus schwelgen, in Teeländern erlangte man dergleichen ausschließlich mit Hilfe der Einbildungskraft. Niemals wäre er freiwillig nach Rußland gereist, in ein Land, das einen nötigte, sich die Grundausstattung des täglichen Lebens herbeizuphantasieren, und wenn es sich auch nur um eine Tasse normalen Bohnenkaffees handelte. Mit der Wende hatte sich die DDR zu ihrem Glück von einem Tee- zu einem Kaffeeland gewandelt.
Er aber, Gilbert Silvester, sah sich von seiner eigenen Frau dazu gedrängt, in ein ausgesprochenes Teeland zu reisen. Er war sogar bereit, dieses Japan mit seiner aufreibend langatmigen, äußerst kleinteiligen, ja niederschmetternd manierierten Teekultur als höchste Steigerungsstufe des Teelandes zu betrachten, um so peinigender für ihn, um so sadistischer von Mathilda, ihm dergleichen zuzumuten, aber er ließ sich nun nicht mehr abhalten, er reiste hin, aus reiner Unabhängigkeit, aus Trotz.
Er nahm sein Smartphone aus der Brusttasche und sah nach, ob eine Nachricht eingegangen war. Dann fiel ihm ein, daß er den Flugmodus hatte einstellen müssen und mit Nachrichten bis auf weiteres nicht zu rechnen war. Trotzdem öffnete er sein Postfach, trotzdem war er enttäuscht, nichts vorzufinden. Er fühlte sich nicht gut. Ihm war ein wenig übel, von der Luft, von dem Tee auf nüchternen Magen. Genaugenommen hatte er seit über dreißig Stunden nichts gegessen. Ein Signal des Bedauerns von seiten Mathildas wäre normal gewesen. Eine höfliche Nachfrage, eine minimale Kontaktaufnahme. Aber es kam nichts. War Mathilda verrückt geworden? Wieso waren ihr die fundamentalen Konstanten zwischenmenschlichen Umgangs nicht mehr geläufig? Wieso hatte sie es so weit kommen lassen, daß er sich jetzt zu einer Interkontinentalreise gezwungen sah, quer über Sibirien hinweg? Er spürte, wie der grüne Tee schwer in seinem Magen lag und bei jedem Ruckeln des Flugzeugs schwappte.
Viel wußte er nicht über Japan, es war nicht gerade das Land seiner Träume. Zu Samuraizeiten hatte dieses Land seine mißliebigen Intellektuellen auf abgelegene Inseln verbannt oder sie gezwungen, Seppuku, eine blutrünstige Form des Selbstmords, auszuüben. Wie die Dinge lagen, reiste er an den passenden Ort.
Er ließ noch einen Samuraifilm laufen, sah aber nicht hin. Die weitere Flugzeit verbrachte er in einem anstrengenden Dämmerzustand. Er nahm seine Umgebung nicht mehr wahr, er blendete die Mitreisenden aus, alles erschien ihm undeutlich, wie in dichten Nebel gehüllt, nur daß dieser Nebel auf ihm lastete und er ihn mit allen Kräften stemmen mußte, damit er nicht davon erdrückt wurde. Er spannte die Schultern an, den Nacken, ein Atlas, der langsam petrifizierte. Es gelang ihm nicht, auch nur eine Minute zu schlafen.
Nach der Landung rief er seine Nachrichten ab, aber niemand hatte sich bei ihm gemeldet. Allerdings waren noch Semesterferien, er versäumte in den kommenden Wochen keine Termine, und seitens der Universität vermißte man ihn nicht. Die Vorlesungen begannen erst wieder Ende Oktober. Bis dahin hatte er nur einen Vortrag auf einem Kongreß in München zu halten. Noch während er auf den Koffer wartete, sagte er seine Teilnahme ab.
Er tauschte Geld und kaufte sich im Presseshop einen Reiseführer und ein paar japanische Klassiker in englischer Übersetzung. Die Werke Bashōs, das Genji Monogatari, das Kopfkissenbuch. Bei japanischen Klassikern hatte er immer das Gefühl, jedermann einschließlich seiner selbst kenne diese Klassiker in- und auswendig, aber vor dem Regal mit den Taschenbüchern mußte er sich eingestehen, daß er in seinem Leben höchstens ein paar japanische Filme gesehen hatte und noch nicht einmal ein Haiku hätte aufsagen können.
Er verstaute die Bücher in seiner Ledertasche und fuhr mit dem Narita-Flughafenexpreß ins Zentrum von Tokyo. Am Hauptbahnhof nahm er ein Taxi zu seinem Hotel. Es war alles so einfach. Wie von selbst fuhr er um die halbe Welt, kein Widerstand, keine Verzögerung, keine Probleme. Der Taxifahrer trug weiße Handschuhe und eine Uniform mit Schirmmütze und blanken Knöpfen. Er sprach kein Englisch, hatte aber wissend genickt, als Gilbert ihm einen Zettel mit der Adresse zeigte. Die Fahrt verlief in tiefem Schweigen, Gilbert war das angenehm. Sämtliche Sitzpolster waren mit weißer Häkelspitze umkleidet, der Wagen schwebte wie eine Kreuzung aus Hochzeitstorte und Barbie-Prinzessinnenkutsche dahin. Es gab keine Staus oder Ampeln, keinen Verkehr, keine Außenwelt. Als sie angelangt waren, überreichte der Fahrer ihm unter vielen Verbeugungen sein Gepäck. Eine Glastür glitt lautlos zur Seite.
Sein Zimmer, ein weißer Kubus, wirkte ausgesprochen leer. Es enthielt ein weißes Bett mit weißer Decke, und irgendwo standen zwei weiße Würfel, die offenbar als Mobiliar dienten. Sehr schlicht, sehr modern. Er stand eine Weile mitten im Zimmer und wußte absolut nicht, was er hier sollte. Dann legte er sich auf das Bett und schlief sofort ein.
Tagesrestträume. Teeländer, Samurais. Der Schwertkämpfer kleidet sich am Abend vor dem entscheidenden Kampf in ein Seidengewand und begibt sich zum Teemeister. Er schreitet über die polierten Trittsteine zur Teehütte, die sich in dem winzigen Garten hinter einer Bambuswand versteckt, muß sich niederbeugen, um durch die viel zu kleine Tür zu kommen, fast kriechen muß er vor dem Meister. Der Teemeister macht wenig Worte, schlägt den Tee schaumig, reicht ihn dem Gast, und der Gast hat Gelegenheit, vor seinem nicht unwahrscheinlichen Tod noch einmal das Blumengesteck zu betrachten, das Rollbild mit einer kostbaren Kalligraphie, hat Gelegenheit, sich im Raum zu verlieren, in den die unsteten Schatten von Pflanzen fallen, in dem eine atemberaubende Stille herrscht.
Am nächsten Morgen gürtet er sich und zieht in die Schlacht. Er verfügt über mystische Kräfte, nicht nur bewegt sich sein Schwert wie ohne sein Zutun, auch kann er fliegen, wo andere bestenfalls einen Sprung zustande bringen. Diese Fähigkeiten haben ihm den Ruf eines unbesiegbaren Schwertmeisters eingetragen, und doch sind die anderen in der Überzahl, und seine Partei unterliegt. Voller Trauer schwebt er über dem Schlachtfeld, sieht all jene unnatürlich verrenkten Körper, die er nicht retten konnte, entfernt sich von ihnen und steigt höher, bis er in der Ferne das schimmernde Meer erblickt. Japan von oben, die ungezählten Inseln, dichtbewaldeten Berge, ein samtenes Grün, von diesem mitreißend feierlichen Blau umspült, noch ein letztes Mal fliegt er über die grausame Schönheit dieses Landes, bevor er sich, wie die Sitte es fordert, als Verlierer des Kampfes mit seinem Kurzschwert den Bauch aufschlitzt.
Gilbert Silvester hatte beim Anflug die japanischen Inseln von oben gesehen, im Licht der gerade aufgehenden Sonne, und in der Tat hatte ihn dieser Anblick für einen Moment überwältigt. Jetzt erwachte er in einem kahlen Hotelzimmer, das er zunächst nicht wiedererkannte. Wo kamen diese beiden kniehohen Würfel her, die zu nichts zu gebrauchen waren? Kurze Ohnmacht im Fitneßstudio? Eiswürfelwerbung, in die er zu seiner eigenen Überraschung hineingeraten war? Drehte er in unbekannten Tiefen seiner selbst neuerdings Fernsehspots? Er trat an das bodentiefe Fenster, zog den eisweißen Vorhang beiseite und sah auf die hochgetürmten Glasfronten Tokyos. Wie war er so umstandslos in diese Stadt geraten? Was wollte er hier? Die verspiegelten Scheiben gegenüber schickten Lichtblitze in seine Augen, so daß er heftig blinzeln mußte, blaue Sonnenbrillen über Etagen und Etagen, abweisend natürlich, kühl. Was sollte er hier? Er war, dies sagte er sich plötzlich vor, sehr weit weg von allem, mit dem er sich jemals vertraut gemacht hatte. Er hatte sich direkt ins Unvertrauteste begeben, in die denkbar unvertrauteste Umgebung, und das Unheimliche bestand darin, daß diese Umgebung nicht im geringsten unheimlich wirkte, nur funktional, etwas protzig und etwas steril. Er ging unter die Dusche, zog ein frisches Hemd an und fuhr mit dem Fahrstuhl 24 Stockwerke hinab.
Es war früher Abend, die Luft noch warm, die ersten Lichter in den Großraumbüros gingen an. Gilbert schlenderte an dichtbefahrenen Straßen entlang und ließ sich mit den Feierabendjapanern über riesige Kreuzungen treiben. Er hätte sich gern etwas zu essen gekauft, aber er fühlte sich zu durchlässig, um einen klaren Entschluß zu fassen, ja, er fühlte sich regelrecht transparent, und diese Transparenz hatte nichts mit Leichtigkeit zu tun, sondern war Ausdruck seiner Kraftlosigkeit. Seine Fähigkeit, Raum einzunehmen, Luft zu verdrängen, um mit seinem Körper an ihre Stelle zu treten, schien seltsam beeinträchtigt. Deshalb fiel ihm das Gehen schwer, und er spürte, daß es die hektische Aufgeregtheit nach Büroschluß war, die ihn dennoch Schritt für Schritt vorwärts trieb, als partizipiere er vampiristisch an der Energie, die die Menschen um ihn her ausstrahlten, während er selbst keinerlei Antrieb verspürte, nicht wußte, wohin er sich wenden sollte, und sich willenlos mitziehen ließ.
Mathilda hatte sich nicht bei ihm gemeldet. Im Hotel hatte er noch ein letztes Mal kurz vor dem Fahrstuhl die Nachrichten überprüft. Seine Absage bezüglich des Kongresses war mit Bedauern zur Kenntnis genommen worden. Kein Wort von Mathilda. Er mußte davon ausgehen, daß sie die Entwicklung, die für ihn selbst eher unerwartet gekommen war, durchaus befürwortete und nun freie Bahn hatte, ihre eigenen Pläne zu verfolgen. Sie war eine vielbeschäftigte Frau, und es hatte immer wieder Tage gegeben, an denen sie, überhäuft mit Verpflichtungen, für ihn überhaupt nicht zu sprechen war.
Sie unterrichtete Musik und Mathematik an einem Gymnasium und bildete Lehrkräfte aus. Sie galt als Koryphäe der Fachdidaktik, als Kommunikationsgenie und Wunderwaffe, sie wurde, gemessen an seinem eigenen Gehalt, sehr gut bezahlt und war äußerst gefragt.
Aber selbst im Falle unwägbarer Widrigkeiten müßte es ihr möglich sein, irgendwann eine freie Minute zu finden, um mit ihm Kontakt aufzunehmen. Er nahm sich vor, seinerseits hart zu bleiben und zu warten. Nach allem, was passiert war, lag es klar bei ihr, den ersten Schritt zu tun. Gut möglich, daß sie es nicht wagte, an ihn heranzutreten, jetzt, da er über ihre Fehltritte Bescheid wußte und sie seines Zornes sicher sein konnte. Nun, es wäre ihre Aufgabe, ihn dazu zu bewegen, ihr zu verzeihen. Schon allein, daß sie sich überhaupt nicht meldete, war ein unerhörter Affront. Er würde ihr auf keinen Fall nachlaufen, er würde nicht zu Kreuze kriechen, niemals wollte er es mit den Demütigungen so weit kommen lassen, daß er auch in diesem Punkt noch nachgab und quasi die andere Wange hinhielt. Er bedauerte allerdings, daß sie unter diesen Umständen nicht einmal erfuhr, daß er diese Reise auf sich genommen hatte, Gilbert Silvester, einsam in Tokyo, so weit von zu Hause weg, wie er noch nie gewesen war. Es gab sonst niemanden, dem er davon erzählen konnte. Und auch Mathilda wäre vom Anblick der japanischen Inseln aus großer Höhe entzückt gewesen.