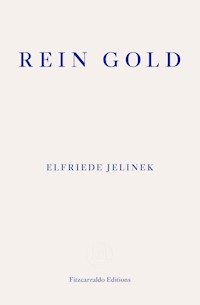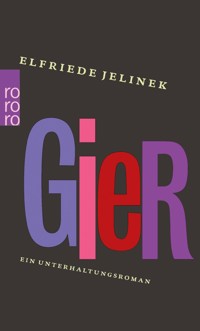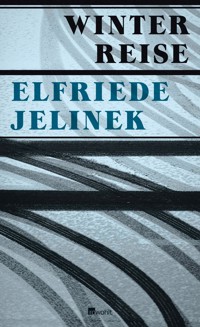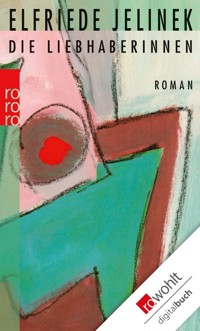9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von ihrer Mutter wurde sie unerbittlich zur Pianistin gedrillt. Und nun findet die Klavierlehrerin Erika Kohut nicht mehr aus der Isolation heraus. Unfähig, sich auf das Leben einzulassen, wird sie zur Voyeurin. Als einer ihrer Schüler ein Liebesverhältnis mit ihr anstrebt, erkennt sie, dass sie nur noch im Leiden und in der Bestrafung Lust empfindet. «Die Klavierspielerin» brachte Elfriede Jelinek den endgültigen Durchbruch. Michael Hanekes Verfilmung triumphierte auf dem Filmfestival 2001 in Cannes: Grand Prix der Jury und Darstellerpreise für Isabelle Huppert und Benoît Magimel. Die Autorin wurde für ihr Werk im Jahr 2004 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. «Eine literarische Glanzleistung.» (Süddeutsche Zeitung) «Die Bilder einer geradezu tödlichen Mutter-Tochter-Beziehung im Roman ‹Die Klavierspielerin› von Elfriede Jelinek können einen schon weit über den Buchdeckel hinaus verfolgen.» (Der Spiegel) «Mich hat das Buch von der ersten bis zur letzten Seite in einen verführerischen Bann gezogen ... Wichtig ist das Buch nicht, weil es die (auch pornographischen) Phantasien des lesenden Voyeurs stimuliert, sondern weil der Roman ein besseres Verstehen über perverse Formen ‹abweichenden› Verhaltens bewirkt.» (Norbert Schachtsiek-Freitag, Frankfurter Rundschau) «Aggressive Lakonismen, bitterer Witz, die Nähe zur Sprache der Bürokratie und zum Kalauer, die kalte, fast denunziatorische Art der Personenzeichnung – all diese Stilzüge fanden sich auch schon früher in den Werken dieser Autorin und machten ihren Ton unverwechselbar. Nie zuvor hat jedoch diese Sprachdeformation das Erzählte derart adäquat und meisterhaft abgebildet.» (Die Weltwoche)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Elfriede Jelinek
Die Klavierspielerin
Roman
Über dieses Buch
Von ihrer Mutter wurde sie unerbittlich zur Pianistin gedrillt. Und nun findet die Klavierlehrerin Erika Kohut nicht mehr aus der Isolation heraus. Unfähig, sich auf das Leben einzulassen, wird sie zur Voyeurin. Als einer ihrer Schüler ein Liebesverhältnis mit ihr anstrebt, erkennt sie, dass sie nur noch im Leiden und in der Bestrafung Lust empfindet.
«Die Klavierspielerin» brachte Elfriede Jelinek den endgültigen Durchbruch. Michael Hanekes Verfilmung triumphierte auf dem Filmfestival 2001 in Cannes: Grand Prix der Jury und Darstellerpreise für Isabelle Huppert und Benoît Magimel. Die Autorin wurde für ihr Werk im Jahr 2004 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.
«Eine literarische Glanzleistung.» (Süddeutsche Zeitung)
«Die Bilder einer geradezu tödlichen Mutter-Tochter-Beziehung im Roman ‹Die Klavierspielerin› von Elfriede Jelinek können einen schon weit über den Buchdeckel hinaus verfolgen.» (Der Spiegel)
«Mich hat das Buch von der ersten bis zur letzten Seite in einen verführerischen Bann gezogen ... Wichtig ist das Buch nicht, weil es die (auch pornographischen) Phantasien des lesenden Voyeurs stimuliert, sondern weil der Roman ein besseres Verstehen über perverse Formen ‹abweichenden› Verhaltens bewirkt.» (Norbert Schachtsiek-Freitag, Frankfurter Rundschau)
«Aggressive Lakonismen, bitterer Witz, die Nähe zur Sprache der Bürokratie und zum Kalauer, die kalte, fast denunziatorische Art der Personenzeichnung – all diese Stilzüge fanden sich auch schon früher in den Werken dieser Autorin und machten ihren Ton unverwechselbar. Nie zuvor hat jedoch diese Sprachdeformation das Erzählte derart adäquat und meisterhaft abgebildet.» (Die Weltwoche)
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2012
Copyright © 1983 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung Cathrin Günther
ISBN Buchausgabe 978-3-499-15812-4 (44. Auflage 2012)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-01871-6
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
I
Die Klavierlehrerin Erika ...
In Straßenbahnen hineingezerrt ...
Erika, die Heideblume. ...
Die wie immer ...
Es brausen Ströme ...
Das ganz private ...
In grausiger Unbeholfenheit ...
Gleich draußen vor ...
Liebt das ehemalige ...
II
Das letzte Stück ...
Im Wiener Wurstelprater ...
Mit der einen ...
Von Bachs sechs ...
Die Stufen des ...
Während des Unterrichtens ...
Walter Klemmer gibt ...
Die Mutter schnarcht ...
Nicht schlecht erstaunt ...
Es wird wieder ...
Walter Klemmer steht ...
Der neue Tag ...
I
Die Klavierlehrerin Erika Kohut stürzt wie ein Wirbelsturm in die Wohnung, die sie mit ihrer Mutter teilt. Die Mutter nennt Erika gern ihren kleinen Wirbelwind, denn das Kind bewegt sich manchmal extrem geschwind. Es trachtet danach, der Mutter zu entkommen. Erika geht auf das Ende der Dreißig zu. Die Mutter könnte, was ihr Alter betrifft, leicht Erikas Großmutter sein. Nach vielen harten Ehejahren erst kam Erika damals auf die Welt. Sofort gab der Vater den Stab an seine Tochter weiter und trat ab. Erika trat auf, der Vater ab. Heute ist Erika flink durch Not geworden. Einem Schwarm herbstlicher Blätter gleich, schießt sie durch die Wohnungstür und bemüht sich, in ihr Zimmer zu gelangen, ohne gesehen zu werden. Doch da steht schon die Mama groß davor und stellt Erika. Zur Rede und an die Wand, Inquisitor und Erschießungskommando in einer Person, in Staat und Familie einstimmig als Mutter anerkannt. Die Mutter forscht, weshalb Erika erst jetzt, so spät, nach Hause finde? Der letzte Schüler ist bereits vor drei Stunden heimgegangen, von Erika mit Hohn überhäuft. Du glaubst wohl, ich erfahre nicht, wo du gewesen bist, Erika. Ein Kind steht seiner Mutter unaufgefordert Antwort, die ihm jedoch nicht geglaubt wird, weil das Kind gern lügt. Die Mutter wartet noch, aber nur so lange, bis sie eins zwei drei gezählt hat.
Schon bei zwei meldet sich die Tochter mit einer von der Wahrheit stark abweichenden Antwort. Die notenerfüllte Aktentasche wird ihr nun entrissen, und gleich schaut der Mutter die bittere Antwort auf alle Fragen daraus entgegen. Vier Bände Beethovensonaten teilen sich indigniert den kargen Raum mit einem neuen Kleid, dem man ansieht, daß es eben erst gekauft worden ist. Die Mutter wütet sogleich gegen das Gewand. Im Geschäft, vorhin noch, hat das Kleid, durchbohrt von seinem Haken, so verlockend ausgesehen, bunt und geschmeidig, jetzt liegt es als schlaffer Lappen da und wird von den Blicken der Mutter durchbohrt. Das Kleidergeld war für die Sparkasse bestimmt! Jetzt ist es vorzeitig verbraucht. Man hätte dieses Kleid jederzeit in Gestalt eines Eintrags ins Sparbuch der Bausparkassen der österr. Sparkassen vor Augen haben können, scheute man den Weg zum Wäschekasten nicht, wo das Sparbuch hinter einem Stapel Leintücher hervorlugt. Heute hat es aber einen Ausflug gemacht, eine Abhebung wurde getätigt, das Resultat sieht man jetzt: jedesmal müßte Erika dieses Kleid anziehen, wenn man wissen will, wo das schöne Geld verblieben ist. Es schreit die Mutter: Du hast dir damit späteren Lohn verscherzt! Später hätten wir eine neue Wohnung gehabt, doch da du nicht warten konntest, hast du jetzt nur einen Fetzen, der bald unmodern sein wird. Die Mutter will alles später. Nichts will sie sofort. Doch das Kind will sie immer, und sie will immer wissen, wo man das Kind notfalls erreichen kann, wenn der Mama ein Herzinfarkt droht. Die Mutter will in der Zeit sparen, um später genießen zu können. Und da kauft Erika sich ausgerechnet ein Kleid!, beinahe noch vergänglicher als ein Tupfer Mayonnaise auf einem Fischbrötchen. Dieses Kleid wird nicht schon nächstes Jahr, sondern bereits nächsten Monat außerhalb jeglicher Mode stehen. Geld kommt nie aus der Mode.
Es wird eine gemeinsame große Eigentumswohnung angespart. Die Mietwohnung, in der sie jetzt noch hocken, ist bereits so angejahrt, daß man sie nur noch wegwerfen kann. Sie werden sich vorher gemeinsam die Einbauschränke und sogar die Lage der Trennwände aussuchen können, denn es ist ein ganz neues Bausystem, das auf ihre neue Wohnung angewandt wird. Alles wird genau nach persönlichen Angaben ausgeführt werden. Wer zahlt, bestimmt. Die Mutter, die nur eine winzige Rente hat, bestimmt, was Erika bezahlt. In dieser nagelneuen Wohnung, gebaut nach der Methode der Zukunft, wird jeder ein eigenes Reich bekommen, Erika hier, die Mutter dort, beide Reiche säuberlich voneinander getrennt. Doch ein gemeinsames Wohnzimmer wird es geben, wo man sich trifft. Wenn man will. Doch Mutter und Kind wollen naturgemäß immer, weil sie zusammengehören. Schon hier, in diesem Schweinestall, der langsam verfällt, hat Erika ein eigenes Reich, wo sie schaltet und verwaltet wird. Es ist nur ein provisorisches Reich, denn die Mutter hat jederzeit freien Zutritt. Die Tür von Erikas Zimmer hat kein Schloß, und kein Kind hat Geheimnisse.
Erikas Lebensraum besteht aus ihrem eigenen kleinen Zimmer, wo sie machen kann, was sie will. Keiner hindert sie, denn dieses Zimmer ist ganz ihr Eigentum. Das Reich der Mutter ist alles übrige in dieser Wohnung, denn die Hausfrau, die sich um alles kümmert, wirtschaftet überall herum, während Erika die Früchte der von der Mutter geleisteten Hausfrauenarbeit genießt. Im Haushalt hat Erika nie schuften müssen, weil er die Hände des Pianisten mittels Putzmittel vernichtet. Was der Mutter manchmal, in einer ihrer seltenen Verschnaufpausen, Sorgen bereitet, ist ihr vielgestaltiger Besitz. Denn man kann nicht immer wissen, wo genau sich alles befindet. Wo ist dieser quirlige Besitz jetzt schon wieder? In welchen Räumen fegt er allein oder zu zwein herum? Erika, dieses Quecksilber, dieses schlüpfrige Ding, kurvt vielleicht in diesem Augenblick irgendwo herum und betreibt Unsinn. Doch jeden Tag aufs neue findet sich die Tochter auf die Sekunde pünktlich dort ein, wo sie hingehört: zuhause. Unruhe packt oft die Mutter, denn jeder Besitzer lernt als erstes, und er lernt unter Schmerzen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist dennoch angebracht. Das Hauptproblem der Mama besteht darin, ihr Besitztum möglichst unbeweglich an einem Ort zu fixieren, damit es nicht davonläuft. Diesem Zweck dient der Fernsehapparat, der schöne Bilder, schöne Weisen, vorfabriziert und verpackt, ins Haus liefert. Um seinetwillen ist Erika fast immer da, und wenn sie einmal fort ist, weiß man genau, wo sie herumschwirrt. Manchmal geht Erika abends in ein Konzert, doch sie tut es immer seltener. Entweder sitzt sie vor dem Klavier und drischt auf ihre längst endgültig begrabene Pianistinnenkarriere ein, oder sie schwebt als böser Geist über irgendeiner Probe mit ihren Schülern. Dort kann man sie dann notfalls anrufen. Oder Erika sitzt zu ihrem Vergnügen, zum Musizieren und Jubilieren, beim Kammermusizieren mit Kollegen, welche gleichgesinnt sind. Dort kann man sie auch anrufen. Erika kämpft gegen mütterliche Bande und ersucht wiederholt, nicht angerufen zu werden, was die Mutter übertreten kann, denn sie allein bestimmt die Gebote. Die Mutter bestimmt auch die Nachfrage nach ihrer Tochter, was damit endet, daß immer weniger Leute die Tochter sehen oder sprechen wollen. Erikas Beruf ist gleich Erikas Liebhaberei: die Himmelsmacht Musik. Die Musik füllt Erikas Zeit voll aus. Keine andere Zeit hat darin Platz. Nichts macht so viel Freude wie eine musikalische Höchstdarbietung, von Spitzenkräften erzeugt.
Wenn Erika einmal im Monat in einem Café sitzt, weiß die Mutter in welchem und kann dort anrufen. Von diesem Recht macht sie freizügig Gebrauch. Ein hausgemachtes Gerüst von Sicherheiten und Gewöhnungen.
Die Zeit um Erika herum wird langsam gipsern. Sie bröckelt sofort, schlägt die Mutter einmal mit der Faust gröber hinein. Erika sitzt in solchen Fällen mit den gipsernen orthopädischen Kragenresten der Zeit um ihren dünnen Hals herum zum Gespött der anderen da und muß zugeben: ich muß jetzt nach Hause. Nach Hause. Erika ist fast immer auf dem Heimweg, wenn man sie im Freien antrifft.
Die Mutter erklärt, eigentlich ist mir die Erika schon recht so wie sie ist. Mehr wird wohl nicht draus. Sie hätte zwar, und leicht auch noch bei ihren Fähigkeiten, wäre sie nur allein mir, der Mutter anvertraut geblieben, eine überregionale Pianistin werden können! Doch Erika geriet, wider Willen der Mutter, manchmal unter fremde Einflüsse; eingebildete männliche Liebe drohte mit Ablenkung vom Studium, Äußerlichkeiten wie Schminke und Kleidung reckten die häßlichen Häupter; und die Karriere endet, bevor sie sich noch richtig anläßt. Aber etwas Sicheres hat man sicher: das Lehramt für Klavier am Konservatorium der Stadt Wien. Und sie hat nicht einmal für Lehr- und Wanderjahre in eine der Zweigstellen, eine Bezirks-Musikschule müssen, wo schon viele ihr junges Leben ausgehaucht haben, staubgrau, buckelig – flüchtiger, rasch vergehender Schwarm vom Herrn Direktor.
Nur diese Eitelkeit. Die verflixte Eitelkeit. Erikas Eitelkeit macht der Mutter zu schaffen und bohrt ihr Dornen ins Auge. Diese Eitelkeit ist das einzige, auf das zu verzichten Erika jetzt langsam lernen müßte. Besser jetzt als später, denn im Alter, das vor der Tür steht, ist Eitelkeit eine besondre Last. Und das Alter allein ist doch schon Last genug. Diese Erika! Waren die Häupter der Musikgeschichte etwa eitel? Sie waren es nicht. Das einzige, was Erika noch aufgeben muß, ist die Eitelkeit. Notfalls wird Erika zu diesem Zweck von der Mutter ganz glattgehobelt, damit nichts Überflüssiges an ihr haften kann.
So versucht die Mama heute ihrer Tochter das neue Kleid aus den zusammengekrampften Fingern zu winden, doch diese Finger sind zu gut trainiert. Loslassen, sagt die Mutter, gib es her! Für deine Gier nach Äußerlichkeiten mußt du bestraft werden. Bisher hat dich das Leben durch Nichtbeachtung gestraft, und nun straft dich deine Mutter, indem sie dich ebenfalls nicht beachtet, obwohl du dich behängst und bemalst wie ein Clown. Hergeben das Kleid!
Erika stürzt plötzlich zu ihrem Kleiderschrank. Sie wird von einem finstren Argwohn ergriffen, der sich schon einige Male bestätigt hat. Heute zum Beispiel fehlt wieder etwas, das dunkelgraue Herbst-Complet nämlich. Was ist geschehen? In der Sekunde, da Erika merkt, es fehlt etwas, weiß sie auch schon die dafür Verantwortliche zu benennen. Es ist die einzige Person, die dafür in Frage kommt. Du Luder, du Luder, brüllt Erika wütend die ihr übergeordnete Instanz an und verkrallt sich in ihrer Mutter dunkelblond gefärbten Haaren, die an den Wurzeln grau nachstoßen. Auch ein Friseur ist teuer und wird am besten nicht aufgesucht. Erika färbt der Mutter jeden Monat die Haare mit Pinsel und Polycolor. Erika rupft jetzt an den von ihr selbst verschönten Haaren. Sie reißt wütend daran. Die Mutter heult. Als Erika zu reißen aufhört, hat sie die Hände voller Haarbüschel, die sie stumm und erstaunt betrachtet. Die Chemie hat diese Haare ohnehin in ihrem Widerstand gebrochen, aber auch die Natur hatte an ihnen nie ein Meisterwerk vollbracht. Erika weiß nicht gleich, wohin mit diesen Haaren. Endlich geht sie in die Küche und wirft die dunkelblonden, oft fehlfarbigen Büschel in den Mistkübel.
Die Mutter steht mit reduziertem Kopfhaar greinend im Wohnzimmer, in dem ihre Erika oft Privatkonzerte gibt, in denen sie die Allerbeste ist, weil in diesem Wohnzimmer außer ihr nie jemand Klavier spielt. Das neue Kleid hält die Mutter immer noch in der zitternden Hand. Wenn sie es verkaufen will, muß sie das bald tun, denn solche kohlkopfgroßen Mohnblumen trägt man nur ein Jahr und nie wieder. Der Kopf tut der Mutter dort weh, wo ihr die Haare jetzt fehlen.
Die Tochter kehrt zurück und weint bereits vor Aufregung. Sie beschimpft die Mutter als gemeine Kanaille, wobei sie hofft, daß die Mutter sich gleich mit ihr versöhnen wird. Mit einem liebevollen Kuß. Die Mutter schwört, die Hand soll Erika abfallen, weil sie die Mama geschlagen und gerupft hat. Erika schluchzt immer lauter, denn es tut ihr jetzt schon leid, wo die Mutti sich bis auf die Knochen und Haare aufopfert. Alles, was Erika gegen die Mutter unternimmt, tut ihr sehr schnell leid, weil sie ihre Mutti liebhat, die sie schon seit frühester Kindheit kennt. Schließlich lenkt Erika, wie erwartet, ein, wobei sie bitterlich heult. Gern, nur allzu gern, gibt die Mutti nach, sie kann ihrer Tochter eben nicht ernsthaft böse sein. Jetzt koche ich uns erst einmal einen Kaffee, den wir gemeinsam trinken werden. Bei der Jause tut Erika die Mutter noch mehr leid, und die letzten Reste ihrer Wut lösen sich im Guglhupf auf. Sie untersucht die Löcher im Haar der Mutter. Sie weiß aber nichts dazu zu sagen, genau wie sie auch nicht gewußt hat, was sie mit den Büscheln anfangen sollte. Sie weint wieder ein bißchen zur Nachsorge, weil die Mutter schon alt ist und einmal enden wird. Und weil ihre, Erikas Jugend auch schon vorbei ist. Überhaupt weil immer etwas vergeht und selten etwas nachkommt.
Die Mutter beschreibt jetzt ihrem Kind, weswegen ein hübsches Mädel sich nicht aufzuputzen braucht. Das Kind bestätigt es ihr. Diese vielen vielen Kleider, die Erika im Kasten hängen hat und wozu? Sie zieht sie niemals an. Diese Kleider hängen unnütz und nur zur Zierde des Kastens da. Das Kaufen kann die Mutter nicht immer verhindern, doch über das Tragen der Kleider ist sie unumschränkte Herrscherin. Die Mutter bestimmt darüber, wie Erika aus dem Haus geht. So gehst du mir nicht aus dem Haus, bestimmt die Mutter, welche befürchtet, daß Erika fremde Häuser mit fremden Männern darin betritt. Auch Erika selber ist zu dem Entschluß gekommen, ihre Kleider nie anzuziehen. Mutterpflicht ist es, bei Entschlüssen nachzuhelfen und falschen Entscheidungen vorzubeugen. Dann muß man später keine Wunden mühsam kleben, denn der Verletzung hat man nicht Vorschub geleistet. Die Mutter fügt Erika lieber persönlich ihre Verletzungen zu und überwacht sodann den Heilungsvorgang.
Das Gespräch ufert aus und schreitet zu dem Punkt, da Säure über jene verspritzt wird, die Erika links und rechts vorkommen oder vorzukommen drohen. Das wäre nicht nötig, man darf sie eben nicht lassen wie sie wollen! Du läßt es auch noch zu! Dabei könntest du gut als Bremserin fungieren, aber dazu bist du zu ungeschickt, Erika. Wenn die Lehrerin es entschlossen verhindert, kommt, zumindest aus ihrer Klasse, keine Jüngere hervor und macht unerwünschte und außerfahrplanmäßige Karriere als Pianistin. Du selbst hast es nicht geschafft, warum sollen es jetzt andere an deiner Stelle und auch noch aus deinem pianistischen Stall erreichen?
Erika nimmt, immer noch aufschnupfend, das arme Kleid in ihre Arme und hängt es unerfreut und stumm zu den anderen Kleidern, Hosenanzügen, Röcken, Mänteln, Kostümen in den Schrank. Sie zieht sie alle nie an. Sie sollen nur hier auf sie warten, bis sie am Abend nach Hause kommt. Dann werden sie ausgebreitet, vor den Körper drapiert und betrachtet. Denn: ihr gehören sie! Die Mutter kann sie ihr zwar wegnehmen und verkaufen, aber sie kann sie nicht selber anziehen, denn die Mutter ist leider zu dick für diese schmalen Hülsen. Die Sachen passen ihr nicht. Es ist alles ganz ihres. Ihres. Es gehört Erika. Das Kleid ahnt noch nicht, daß es soeben jählings seine Karriere unterbrochen hat. Es wird unbenutzt abgeführt und niemals ausgeführt. Erika will es nur besitzen und anschauen. Von fern anschauen. Nicht einmal probieren möchte sie einmal, es genügt, dieses Gedicht aus Stoff und Farben vorne hinzuhalten und anmutig zu bewegen. Als fahre ein Frühlingswind hinein. Erika hat das Kleid vorhin in der Boutique probiert, und jetzt wird sie es nie mehr anziehen. Schon kann sich Erika an den kurzen flüchtigen Reiz, den das Kleid im Geschäft auf sie ausübte, nicht mehr erinnern. Jetzt hat sie eine Kleiderleiche mehr, die aber immerhin ihr Eigentum ist.
In der Nacht, wenn alles schläft und nur Erika einsam wacht, während der traute Teil dieses durch Leibesbande aneinandergeketteten Paares, die Frau Mama, in himmlischer Ruhe von neuen Foltermethoden träumt, öffnet sie manchmal, sehr selten, die Kastentür und streicht über die Zeugen ihrer geheimen Wünsche. Sie sind gar nicht so geheim, diese Wünsche, sie schreien laut hinaus, wieviel sie einmal gekostet haben und wofür jetzt das Ganze? Die Farben schreien die zweite und dritte Stimme mit. Wo kann man so etwas tragen, ohne von der Polizei entfernt zu werden? Normalerweise hat Erika immer nur Rock und Pulli oder, im Sommer, Bluse an. Manchmal schrickt die Mutter aus dem Schlaf empor und weiß instinktiv: sie schaut sich wieder ihre Kleider an, die eitle Kröte. Die Mutter ist dessen sicher, denn zu seinem Privatvergnügen quietscht der Schrank nicht mit seinen Türen.
Der Jammer ist, daß diese Kleiderkäufe die Frist ins Uferlose verlängern, bis man endlich die neue Wohnung beziehen kann, und stets ist Erika dabei in Gefahr, daß Liebesbande sie umschlingen; auf einmal hätte man ein männliches Kuckucksei im eigenen Nest. Morgen, beim Frühstück, erhält Erika bestimmt eine strenge Abmahnung für Leichtsinn. Die Mutter hätte gestern an den Haarwunden direkt sterben können, am Schock. Erika wird eine Zahlungsfrist erhalten, soll sie eben ihre Privatstunden ausbauen.
Nur ein Brautkleid fehlt zum Glück in der trüben Kollektion. Die Mutter wünscht nicht, Brautmutter zu werden. Sie will eine Normalmutter bleiben, mit diesem Status bescheidet sie sich.
Aber heute ist heute. Jetzt wird endgültig geschlafen! So verlangt es die Mutter vom Ehebett her, doch Erika rotiert immer noch vor dem Spiegel. Mütterliche Befehle treffen sie wie Hacken in den Rücken. Rasch befühlt sie jetzt noch ein flottes Nachmittagskleid mit Blumen, diesmal am Saum. Diese Blumen haben noch nie frische Luft geatmet, und auch Wasser kennen sie nicht. Das Kleid stammt aus einem, wie Erika versichert, erstklassigen Modehaus in der Innenstadt. Qualität und Verarbeitung sind für die Ewigkeit, die Paßform hängt von Erikas Körper ab. Nicht zu viele Süßigkeiten oder Teigwaren! Erika hat gleich beim ersten Anblick des Kleides die Vision gehabt: das kann ich jahrelang tragen, ohne daß es auch nur ein Haarbreit von der Mode abweicht. Das Kleid hält sich jahrelang auf dem Pfad der Mode! Dieses Argument wird an die Mutter vergeudet. Es wird überhaupt nie altmodisch werden. Die Mutter soll streng ihr Gewissen erforschen, ob sie ein ähnlich geschnittenes Kleid nicht in ihrer Jugend selbst getragen habe, Mutti? Diese bestreitet es aus Prinzip. Erika leitet trotzdem den Schluß ab, daß sich diese Anschaffung rentiert hat; aus dem Grund, daß das Kleid nie veraltet, wird Erika das Kleid noch in zwanzig Jahren genauso tragen wie heute.
Die Moden wechseln schnell. Das Kleid bleibt ungetragen, wenn auch bestens in Schuß. Doch keiner kommt und verlangt es zu sehen. Seine beste Zeit ist nutzlos vorbeigegangen und kommt nicht mehr zurück, und wenn, dann erst in zwanzig Jahren wieder.
Manche Schüler setzen sich gegen ihre Klavierlehrerin Erika entschieden zur Wehr, doch ihre Eltern zwingen zur Kunstausübung. Und daher kann das Fräulein Professor Kohut ebenfalls die Zwinge anwenden. Die meisten Klavierhämmerer allerdings sind brav und an der Kunst interessiert, die sie erlernen sollen. Sie kümmern sich sogar um diese Kunst, wenn sie von Fremden ausgeführt wird, ob im Musikverein oder im Konzerthaus. Sie vergleichen, wägen, messen, zählen. Es kommen viele Ausländer zu Erika, jedes Jahr werden es mehr. Wien, Stadt der Musik! Nur was sich bisher bewährt hat, wird sich in dieser Stadt auch hinkünftig bewähren. Die Knöpfe platzen ihr vom weißen fetten Bauch der Kultur, die, wie jede Wasserleiche, die man nicht herausfischt, jedes Jahr noch aufgeblähter wird.
Der Schrank nimmt das neue Kleid in sich auf. Eins mehr! Die Mutter sieht nicht gern, wenn Erika aus dem Hause geht. Dieses Kleid ist zu auffallend, es paßt nicht zum Kind. Die Mutter sagt, irgendwo muß man eine Grenze ziehen, sie weiß nicht, was sie jetzt damit gemeint hat. Bis hierher und nicht weiter, das hat die Mutter damit gemeint.
Die Mutter rechnet Erika vor, sie, Erika, sei nicht eine von vielen, sondern einzig und allein. Diese Rechnung geht bei der Mutter immer auf. Erika sagt heute schon von sich, sie sei eine Individualistin. Sie gibt an, daß sie sich nichts und niemandem unterordnen kann. Sie ordnet sich auch nur schwer ein. Etwas wie Erika gibt es nur ein einziges Mal und dann nicht noch einmal. Wenn etwas besonders unverwechselbar ist, dann nennt man es Erika. Was sie verabscheut, ist Gleichmacherei in jeder Form, auch beispielsweise in der Schulreform, die auf Eigenschaften keine Rücksicht nimmt. Erika läßt sich nicht mit anderen zusammenfassen, und seien sie noch so gleichgesinnt mit ihr. Sie würde sofort hervorstechen. Sie ist eben sie. Sie ist so wie sie ist, und daran kann sie nichts ändern. Die Mutter wittert schlechte Einflüsse dort, wo sie sie nicht sehen kann, und will Erika vor allem davor bewahren, daß ein Mann sie zu etwas anderem umformt. Denn: Erika ist ein Einzelwesen, allerdings voller Widersprüche. Diese Widersprüche in Erika zwingen sie auch, gegen Vermassung entschieden aufzutreten. Erika ist eine stark ausgeprägte Einzelpersönlichkeit und steht der breiten Masse ihrer Schüler ganz allein gegenüber, eine gegen alle, und sie dreht am Steuerrad des Kunstschiffchens. Nie könnte eine Zusammenfassung ihr gerecht werden. Wenn ein Schüler nach ihrem Ziel fragt, so nennt sie die Humanität, in diesem Sinn faßt sie den Inhalt des Heiligenstädter Testaments von Beethoven für die Schüler zusammen, sich neben den Heros der Tonkunst mit aufs Postament zwängend.
Aus allgemein künstlerischen und individuell menschlichen Erwägungen heraus extrahiert Erika die Wurzel: nie könnte sie sich einem Mann unterordnen, nachdem sie sich so viele Jahre der Mutter untergeordnet hat. Die Mutter ist gegen eine spätere Heirat Erikas, weil sich meine Tochter nirgends ein- und niemals unterordnen könnte. Sie ist eben so. Erika soll nicht einen Lebenspartner wählen, weil sie unbeugsam ist. Sie ist auch kein junger Baum mehr. Wenn keiner nachgeben kann, nimmt die Ehe ein schlimmes Ende. Bleibe lieber nur du selber, sagt die Mutter zu Erika. Die Mutter hat Erika schließlich zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Sind Sie noch nicht verheiratet, Fräulein Erika, fragt die Milchfrau und fragt auch der Fleischhauer. Sie wissen ja, mir gefällt niemals einer, antwortet Erika.
Überhaupt stammt sie aus einer Familie von einzeln in der Landschaft stehenden Signalmasten. Es gibt wenige von ihnen. Sie pflanzen sich nur zäh und sparsam fort, wie sie auch im Leben immer zäh und sparsam mit allem umgehen. Erika ist erst nach zwanzigjähriger Ehe auf die Welt gestiegen, an der ihr Vater irr wurde, in einer Anstalt verwahrt, damit er keine Gefahr für die Welt würde.
Unter vornehmem Schweigen kauft Erika ein Achtel Butter. Sie hat noch ein Mütterlein und braucht daher keinen Mann zu frei’n. Kaum ist dieser Familie ein neuer Verwandter erwachsen, wird er auch schon ausgestoßen und abgelehnt. Der Verkehr mit ihm wird abgebrochen, sobald er sich, wie erwartet, als unbrauchbar und untauglich erwiesen hat. Die Mutter klopft die Mitglieder der Familie mit einem Hämmerchen ab und sondert sie einen nach dem anderen aus. Sie sortiert und lehnt ab. Sie prüft und verwirft. Es können auf diese Weise keine Parasiten entstehen, die dauernd etwas haben möchten, das man behalten will. Wir bleiben ganz unter uns, nicht wahr, Erika, wir brauchen niemanden.
Die Zeit vergeht, und wir vergehen in ihr. Unter einer gläsernen Käseglocke sind sie miteinander eingeschlossen, Erika, ihre feinen Schutzhüllen, ihre Mama. Die Glocke läßt sich nur heben, wenn jemand von außen den Glasknopf oben ergreift und ihn in die Höhe zieht. Erika ist ein Insekt in Bernstein, zeitlos, alterslos. Erika hat keine Geschichte und macht keine Geschichten. Die Fähigkeit zum Krabbeln und Kriechen hat dieses Insekt längst verloren. Eingebacken ist Erika in die Backform der Unendlichkeit. Diese Unendlichkeit teilt sie freudig mit ihren geliebten Tonkünstlern, doch an Beliebtheit kann sie es mit jenen beileibe nicht aufnehmen. Erika erkämpft sich einen kleinen Platz, noch in Sichtweite der großen Musikschöpfer. Es ist ein heißumkämpfter Ort, denn ganz Wien will ebenfalls hier zumindest eine Schrebergartenhütte aufstellen. Erika steckt sich ihren Platz des Tüchtigen ab und fängt an, die Baugrube auszuheben. Sie hat sich diesen Platz durch Studieren und Interpretieren ehrlich verdient! Schließlich ist auch der Nachschöpfer noch eine Schöpferform. Er würzt die Suppe seines Spiels stets mit etwas Eigenem, etwas von ihm selber. Er tropft sein Herzblut hinein. Auch der Interpret hat noch sein bescheidenes Ziel: gut zu spielen. Dem Schöpfer des Werks allerdings muß auch er sich unterordnen, sagt Erika. Sie gibt freiwillig zu, daß das für sie ein Problem darstellt. Denn sie kann und kann sich nicht unterordnen.
Ein Hauptziel hat Erika jedoch mit allen anderen Interpreten gemeinsam: Besser sein als andere!
In Straßenbahnen hineingezerrt wird SIE vom Gewicht von Musikinstrumenten, die ihr vorne und hinten vom Leib baumeln, dazu die prall gefüllten Notentaschen. Ein sperrig behangener Falter. Das Tier fühlt, daß Kräfte in ihm schlummern, denen die Musik allein nicht genügt. Das Tier ballt die Fäustchen um Tragegriffe von Geigen, Bratschen, Flöten. Es lenkt seine Kräfte gern ins Negative, obwohl es die Wahl hätte. Die Auswahl bietet die Mutter an, ein breites Spektrum von Zitzen am Euter der Kuh Musik.
SIE schlägt ihre Streich- und Blasinstrumente und die schweren Notenhefte den Leuten in die Rücken und Vorderfronten hinein. In diese Speckseiten, die ihr die Waffen wie Gummipuffer zurückfedern lassen. Manchmal nimmt sie, je nach Laune, ein Instrument samt Tasche in die eine Hand und setzt die Faust der anderen voll Heimtücke in fremde Wintermäntel, Umhänge und Lodenjoppen hinein. Sie schändet die österreichische Nationaltracht, die sie aus ihren Hirschhornknöpfen anbiedernd angrinst. In Kamikazemanier nimmt sie sich selbst als Waffe zur Hand. Dann wieder prügelt sie mit dem schmalen Ende des Instruments, einmal ist es eben die Geige, dann wieder die schwerere Bratsche, in einen Haufen arbeitsverschmierter Leute hinein. Wenn es sehr voll ist, so um sechs Uhr, kann man schon beim Schwungholen viele Menschen beschädigen. Zum Ausholen ist kein Platz. SIE ist die Ausnahme von der Regel, die sie ringsum so abstoßend vor Augen hat, und ihre Mutter erklärt ihr gerne handgreiflich, daß sie eine Ausnahme ist, denn sie ist der Mutter einziges Kind, das in der Spur bleiben muß. In der Straßenbahn sieht SIE jeden Tag, wie sie nie werden möchte. SIE durchpflügt die graue Flut derer mit und ohne Fahrschein, der Zugestiegenen und der sich zum Aussteigen Anschickenden, die dort, woher sie kommen, nichts bekommen haben und dort, wo sie hingehen, nichts zu erwarten haben. Schick sind sie nicht. Manche sind schon ausgestiegen, bevor sie noch richtig drinnensitzen.
Zwingt man SIE aufgrund von Volkszorn an der einen Haltestelle hinaus, wo sie noch zu weit von zu Hause entfernt ist, so verläßt sie auch wirklich folgsam den Waggon, weicht der geballten Wut, die ihr in die geballte Faust gelaufen ist, doch nur, um geduldig auf die nächste Elektrische zu warten, die wie das Amen im Gebet sicher einherkommt. Das sind Ketten, die nie abreißen. Dann geht sie erneut zum frisch aufgetankten Angriff über. Sie torkelt mühselig und instrumentenübersät in die Arbeitsheimkehrer hinein und detoniert mitten unter ihnen wie eine Splitterbombe. Sie verstellt sich fallweise absichtlich und sagt bitte ich muß hier aussteigen. Da sind sie dann alle gleich dafür. Sie soll das saubere und öffentliche Verkehrsmittel auf der Stelle verlassen! Für Leute wie sie wurde es nämlich nicht bereitgestellt! Zahlende Fahrgäste lassen so etwas gar nicht erst einreißen.
Sie blicken die Schülerin an und denken, die Musik habe ihr Gemüt schon früh erhoben, dabei erhebt es ihr nur die Faust. Manchmal wird ein grauer junger Mann mit abstoßenden Dingen in einem abgeschabten Seesack ungerecht beschuldigt, denn ihm wird es eher zugetraut. Er soll aussteigen und zu seinen Freunderln verschwinden, bevor er von einem kräftigen Lodenjoppenarm eine fängt.
Der Volkszorn, der schließlich genauestens bezahlt hat, hat immer recht für seine jeweils drei Schilling und kann es bei einer Fahrscheinkontrolle auch beweisen. Stolz reicht er den markierten Schein und hat eine Tramway für sich ganz allein. Er erspart sich damit auch Wochen des unangenehmsten Fegefeuers voller Angst, ob ein Kontrolleur kommt.
Eine Dame, die wie du den Schmerz fühlt, jault hell auf: ihr Schienbein, dieser lebenswichtige Teil, auf dem teilweise ihr Gewicht ruht, ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Bei diesem lebensgefährlichen Gedränge ist der Schuldige getreu dem Verursacherprinzip nicht ausforschbar. Die Menge wird mit einem Sperrfeuer aus Beschuldigungen, Flüchen, Injurien, Beschwörungen, Klagen eingedeckt. Die Klagen fließen aus geifernden Mündern über das eigene Los, die Beschuldigungen werden über andere ausgegossen. Sie stehen dicht wie Fische in einer Sardinenbüchse, aber im Öl sind sie deswegen noch lange nicht, das kommt erst nach Feierabend.
SIE tritt wütend gegen einen harten Knochen, der einem Mann gehört. Freundlich fragt an einem Tag eine ihrer Mitschülerinnen, ein Mädchen, unter dem in zwei ewigen Flämmchen wunderbare hohe Absätze lodern, und das einen neuen pelzgefütterten Ledermantel neuester Bauart trägt: Was schleppst du hier und wie nennt es sich? Ich meine diesen Kasten hier und nicht deinen Kopf dort oben. Es ist eine sogenannte Bratsche, erwidert SIE höflich. Was ist das, eine Baatsche? Ich habe dieses seltsame Wort noch nie gehört, spricht ein geschminkter Mund belustigt. Da geht eine hin und trägt etwas spazieren, das sich Baatsche nennt und zu nichts Erkennbarem dient. Jeder muß ausweichen, weil diese Baatsche so viel Platz rundherum benötigt. SIE geht damit öffentlich auf der Straße und keiner verhaftet sie auf frischer Tat.
Die schwer in den Haltegriffen der Straßenbahn Hängenden und jene wenigen beneideten Glückspilze, die sitzen können, recken sich hoch droben vergebens aus ihren abgenutzten Rümpfen heraus. Sie erspähen keinen in weitem Rund, an dem sie es auslassen können, wie man ihre Beine mit etwas Hartem malträtiert. Jetzt ist mir jemand auf die Zehen getreten, weht ein Schwall schlechter Literatur aus einem Mund hervor. Wer ist der Täter? Zusammentritt das in aller Welt berüchtigte Erste Wiener Straßenbahngericht, um eine Abmahnung und eine Verurteilung auszusprechen. In jedem Kriegsfilm meldet sich wenigstens einer freiwillig, und sei es für ein Himmelfahrtskommando. Doch dieser feige Hund verbirgt sich hinter unseren geduldigen Rücken. Ein ganzer Schub rattenartiger Handwerker dicht vor der Pensionierung, mit Werkzeugtaschen über den Schultern, drängt sich unter Schubsen und Treten aus dem Wagen. Jetzt gehen diese Leute zu Fleiß eine ganze Station zu Fuß! Wenn ein Widder unter all den Schafen im Wagen die Ruhe stört, benötigt man dringend frische Luft, und draußen findet man sie. Das Gebläse des Zorns, mit dem man dann zu Hause die Gattin traktieren wird, benötigt frischen Sauerstoff, sonst funktioniert es vielleicht nicht. Etwas von unbestimmter Farbe und Form gerät ins Schwanken, rutscht, etwas anderes schreit wie abgestochen auf. Ein dichter Sprühnebel von Wienerischem Gift dunstet über diese Volkswiese hin. Einer ruft gar nach einem Henker, weil sein Feierabend vorzeitig verdorben worden ist. So sehr ärgern sie sich. Ihre abendliche Ruhe, die schon vor zwanzig Minuten hätte beginnen sollen, ist heute nicht eingetreten. Oder die Ruhe ist jäh abgebrochen worden, abgebrochen wie die bunt bedruckte Lebenspackung des Opfers – mit Gebrauchsanweisung –, die es jetzt nicht mehr ins Regal zurückstellen kann. Das Opfer kann sich jetzt nicht einfach unauffällig eine neue und unversehrte Packung greifen, es würde von der Verkäuferin als Ladendieb arretiert. Folgen Sie mir unauffällig! Doch die Tür, welche ins Büro des Filialleiters führt, zu führen schien, ist eine Scheintür, und außerhalb des nagelneuen Supermarkts gibt es keine Sonderangebote der Woche mehr, sondern dort ist nichts, absolut gar nichts, nur Dunkel, und ein Kunde, der nie geizig war, stürzt ins Bodenlose ab. Jemand sagt in der hier üblichen Schriftsprache: Verlassen Sie auf der Stelle den Wagen! Aus seiner Schädeldecke wuchert ein Gamsbart heraus, denn der Mann ist als Jäger verkleidet.
SIE bückt sich jedoch rechtzeitig, um einen neuen üblen Trick anzuwenden. Vorher muß SIE den Sperrmüll ihrer Musikgeräte erst abstellen. Er bildet eine Art Zaun rings um sie her. Es geht um das scheinbare Zubinden des Schuhbands, aus dem sie dem Nachbarn in der Tramway einen Strick dreht. Sie zwickt wie nebenbei die eine oder die andere Frau, die genauso aussieht wie die eine, kräftig in die Wade. Dieser Witwe sind blaue Flecke so gut wie sicher. Die derart Verunstaltete schießt empor, ein strahlend heller, erleuchteter Hochstrahlbrunnen bei Nacht, der endlich im Brennpunkt der Aufmerksamkeit stehen darf, umreißt kurz und präzise ihre Familienverhältnisse und droht, daß sich diese Verhältnisse (vor allem ihr toter Ehemann) noch schrecklich für ihre Peinigerin auswirken werden. Sie fordert sodann Polizei! Die Polizei kommt nicht, weil sie sich nicht um alles kümmern kann.
Ein harmloser Musikerinnenblick wird über ein Gesicht gestülpt. SIE tut als gebe sie sich soeben jenen geheimnisvoll wirkenden, immer auf Steigerung bedachten gefühlsbetonten Kräften der musikalischen Romantik hin und habe für nichts sonst einen Gedanken übrig. Das Volk spricht daraufhin wie mit einer Stimme: das Mädchen mit dem Maschinengewehr ist es sicher nicht gewesen. Wie so oft irrt das Volk auch diesmal.
Manchmal denkt einer etwas genauer nach, und das Ergebnis ist, daß er auf die wahre Täterin deutet: du bist es gewesen! SIE wird gefragt, was sie unter der grellen Sonne erwachsenen Verständnisses dazu zu sagen habe. SIE spricht nicht. Die Plombe, die ihre Konditionierer hinter ihrem Gaumensegel hineinoperiert haben, verhindert jetzt wirksam, daß sie sich unbewußt selbst bezichtigt. Sie verteidigt sich nicht. Einige fallen übereinander her, weil eine Taubstumme beschuldigt wurde. Die Stimme der Vernunft behauptet, jemand, der Violine spiele, könne auf keinen Fall taubstumm sein. Vielleicht ist sie nur stumm oder trägt die Violine zu jemand anderem hin. Sie werden sich nicht einig und lassen von ihrem Vorhaben ab. Ein Heuriger am Wochenende spukt bereits in ihren Köpfen herum und vernichtet mehrere Kilo Gedankenmaterial. Der Alkohol wird den Rest besorgen. Land der Alkoholiker. Stadt der Musik. Dieses Mädchen schaut in die Weite von Gefühlswelten, und ihr Ankläger schaut bestenfalls zu tief ins Bierglas, und so schweigt er bang vor ihrem Blick.
Drängeln ist unter IHRER Würde, denn es drängt der Mob, es drängt nicht die Geigerin und Bratschistin. Um dieser kleinen Freuden willen nimmt sie es sogar in Kauf, zu spät nach Hause zu kommen, wo die Mutter mit der Stoppuhr steht und abmahnt. Solche Strapazen nimmt sie noch auf sich, obwohl sie schon den ganzen Nachmittag lang musiziert und gedacht, gegeigt und Schlechtere als sie verlacht hat. Sie will den Leuten das Erschrecken und den Schauder beibringen. Von solchen Gefühlen strotzen die Programmhefte der Philharmonischen Konzerte.
Ein philharmonischer Besucher nimmt die einführenden Worte seines Programms zum Anlaß, einem anderen Besucher zu erklären, wie sein Innerstes vom Schmerz dieser Musik erbebt. Gerade vorhin hat er das und ähnliches gelesen. Beethovens Schmerz, Mozarts Schmerz, Schumanns Schmerz, Bruckners Schmerz, Wagners Schmerz. Diese Schmerzen sind nun sein alleiniger Besitz, und er wieder ist der Besitzer der Schuhfabrik Pöschl oder der Baustoffgroßhandlung Kotzler. Beethoven bewegt die Hebel der Furcht, und sie lassen dafür ihre Belegschaft furchtsam springen. Eine Frau Doktor steht mit dem Schmerz schon lang auf du und du. Sie ergründet jetzt seit zehn Jahren das letzte Geheimnis von Mozarts Requiem. Bis jetzt ist sie noch keinen Schritt weitergekommen, weil dieses Werk unergründlich ist. Begreifen können wir es nicht! Die Frau Doktor sagt, es sei das genialste Auftragswerk der Musikgeschichte, das steht für sie und wenige andere fest. Frau Doktor ist eine von wenigen Auserwählten, welche wissen, daß es Sachen gibt, die sich beim besten Willen nicht ergründen lassen. Was gibt es da noch zu erklären? Es ist unerklärlich, wie so etwas je entstehen konnte. Das gilt auch für manche Gedichte, die man ebenfalls nicht analysieren sollte. Das Requiem hat ein geheimnisvoller Unbekannter in einem schwarzen Kutschermantel angezahlt. Die Frau Doktor und andere, die diesen Mozartfilm gesehen haben, wissen: es war der Tod selber! Mit diesem Gedanken beißt sie ein Loch in die Hülse eines der ganz Großen und zwängt sich in ihn hinein. In seltenen Fällen wächst man an dem Großen mit.
Miese Menschenmassen umdrängen SIE ununterbrochen. Ständig zwängt sich jemand in IHRE Wahrnehmung. Der Pöbel bemächtigt sich nicht nur der Kunst ohne die leiseste Bezugsberechtigung, nein, er zieht auch noch in den Künstler ein. Er nimmt Quartier im Künstler und bricht sofort ein paar Fenster zur Außenwelt durch, um gesehen zu werden und zu sehen. Mit seinen Schweißfingern tappt dieser Klotz Kotzler etwas ab, das doch IHR allein gehört. Sie singen ungerufen und ungefragt Kantilenen mit. Sie fahren mit befeuchtetem Zeigefinger ein Thema nach, suchen das passende Seitenthema dazu, finden es nicht und begnügen sich daher mit dem kopfnickenden Auffinden und erneuten Wiederholen des Hauptthemas, welches sie schweifwedelnd wiedererkennen. Für die meisten besteht der Hauptreiz der Kunst im Wiedererkennen von etwas, das sie zu erkennen glauben.
Eine Fülle der Empfindung überschwemmt einen Herrn Fleischereibesitzer. Er kann sich nicht wehren, obwohl er ein blutiges Handwerk gewohnt ist. Er ist starr vor Staunen. Er sät nicht, er erntet nicht, er hört nicht gut, aber er kann in einem öffentlichen Konzert besichtigt werden. Neben ihm die weiblichen Teile seiner Familie, die mitgehen wollten.
SIE tritt eine alte Frau gegen die rechte Ferse. Jeder Phrase vermag sie den vorherbestimmten Ort zuzuordnen. Nur SIE allein kann jegliches Gehörte an die richtige Stelle schieben, wohin es gehört. Sie packt die Unwissenheit dieser blökenden Lämmer in ihre Verachtung und straft die Lämmer damit. Ihr Körper ist ein einziger großer Kühlschrank, in dem sich die Kunst gut hält.
IHR Sauberkeitsinstinkt ist unheimlich empfindlich. Schmutzige Leiber bilden einen harzigen Wald ringsumher. Nicht nur der körperliche Schmutz, die Unreinlichkeit gröbster Sorte, die sich den Achselhöhlen und Schößen entringt, der feine Uringestank der Greisin, das aus dem Leitungsnetz der Adern und Poren strömende Nikotin des Greises, jene unzählbaren Haufen von Nahrung billigster Qualität, die aus den Magen heraufdünsten; nicht nur der fahle Wachsgestank des Kopfschorfs, des Grinds, nicht nur der haardünne, doch für den Geübten durchdringende Gestank von Scheißemikrotomen unter den Fingernägeln – Rückstände der Verbrennung farbloser Nahrungsmittel, jener grauen, ledrigen Genußmittel, wenn man es Genuß nennen kann, die sie zu sich nehmen, peinigen IHREN Geruchssinn, IHRE Geschmacksknospen – nein, am schlimmsten trifft es SIE, wie sie einer im anderen hausen, sich einer den anderen schamlos aneignen. Einer drängt sich sogar noch in die Gedanken des anderen hinein, in seine innerste Aufmerksamkeit.
Dafür werden sie bestraft. Von IHR. Und doch kann sie sie niemals loswerden. Sie reißt an ihnen, schüttelt sie wie ein Hund seine Beute. Und dennoch wühlen sie ungefragt in ihr herum, sie betrachten IHR Innerstes und wagen zu behaupten, daß sie nichts damit anfangen können und daß es ihnen auch nicht gefällt! Sie wagen ja auch zu behaupten, daß ihnen Webern oder Schönberg nicht gefällt.
Die Mutter schraubt, immer ohne vorherige Anmeldung, IHREN Deckel ab, fährt selbstbewußt mit der Hand oben hinein, wühlt und stöbert. Sie wirft alles durcheinander und legt nichts wieder an seinen angestammten Platz zurück. Sie holt etliches nach kurzer Wahl heraus, betrachtet es unter der Lupe und wirft es dann weg. Anderes wieder legt sich die Mutter zurecht und schrubbt es mit Bürste, Schwamm und Putztuch ab. Es wird dann energisch abgetrocknet und wieder hineingeschraubt. Wie ein Messer in eine Faschiermaschine.
Diese alte Frau ist jemand, der neu zugestiegen ist, obwohl sie sich nicht beim Schaffner meldet. Sie denkt, sie kann es verheimlichen, daß sie hier hereingetreten ist, in diesen Waggon. Eigentlich ist sie längst ausgestiegen aus allem und ahnt es auch. Das Zahlen lohnt sich gar nicht mehr. Die Fahrkarte ins Jenseits hat sie ja schon im Handtascherl. Die muß auch in der Straßenbahn Gültigkeit besitzen.
Jetzt wird SIE von einer Dame nach einem bestimmten Weg gefragt und antwortet nicht. SIE antwortet nicht, obwohl SIE den Weg genau kennt. Die Dame gibt nicht Ruhe damit, den ganzen Wagen zu durchstochern und Leute zu vertreiben, um unter deren Sitzen nach der gesuchten Straße herumzustieren. Eine grimmige Wanderin ist sie auf Waldwegen, die es sich zur Gewohnheit gemacht hat, mithilfe eines dünnen Stöckchens unschuldige Ameisenhaufen aus ihrer Beschaulichkeit zu kitzeln. Sie fordert es heraus, daß die aufgestörten Tiere Säure spritzen. Sie ist eine von den Leuten, die prinzipiell jeden Stein umwenden, ob vielleicht eine Schlange darunter ist. Jede Lichtung, und sei sie noch so klein, wird von dieser Dame gewiß nach Pilzen oder Beeren durchkämmt. Solche Menschen sind das. Aus jedem Kunstwerk müssen sie noch den letzten Rest herauspressen und allen lauthals erklären. Im Park werden Bänke mit Taschentüchern abgestaubt, bevor sie Sitz nehmen. Bestecke im Gasthaus polieren sie mit der Serviette nach. Den Anzug von einem nahen Verwandten durchwühlen sie mit dem Staubkamm nach Haaren, Briefen, Fettflecken.
Und diese Dame regt sich jetzt lautstark darüber auf, daß keiner ihr Auskunft geben kann. Sie behauptet, keiner wolle ihr Auskunft erteilen. Diese Dame steht stellvertretend für die unwissende Mehrheit, die aber ein einziges im Übermaß besitzt: Kampfesmut. Sie legt sich mit jedem an, wenn nötig.
SIE steigt genau in jener Gasse aus, nach der die Dame gefragt hat, und mustert die Fragerin höhnisch dabei.
Die Büffelin begreift, und ihre Kolben fressen sich fest vor Zorn. Gleich wird sie dieses Stück ihres Lebens bei einer Freundin und bei Rindfleisch mit Fisolen repetieren, das Leben gleichsam um diese kleine Spanne des darüber Berichtens verlängernd, wäre nicht die Zeit während ihrer Erzählung, die ja ihrerseits unaufhaltsam verstreicht. Und der Dame damit Raum für neues Erleben nimmt.
SIE wendet sich mehrmals nach der vollkommen desorientierten Dame um, bevor SIE einen vertrauten Weg in ein vertrautes Zuhause einschlägt. SIE grinst die Dame dabei an, vergessend, daß SIE in ein paar Minuten unter der heißen Flamme des mütterlichen Schneidbrenners zu einem Häufchen Asche verbrennen wird, weil sie zu spät nach Hause gekommen ist. Dabei wird die ganze Kunst SIE nicht trösten können, obwohl der Kunst vieles nachgesagt wird, vor allem, daß sie eine Trösterin sei. Manchmal schafft sie allerdings das Leid erst herbei.
Erika, die Heideblume. Von dieser Blume hat diese Frau den Namen. Ihrer Mutter schwebte vorgeburtlich etwas Scheues und Zartes dabei vor Augen. Als sie dann den aus ihrem Leib hervorschießenden Lehmklumpen betrachtete, ging sie sofort daran, ohne Rücksicht ihn zurechtzuhauen, um Reinheit und Feinheit zu erhalten. Dort ein Stück weg und dort auch noch. Instinktiv strebt jedes Kind zu Schmutz und Kot, wenn man es nicht davor zurückreißt. Für Erika wählt die Mutter früh einen in irgendeiner Form künstlerischen Beruf, damit sich aus der mühevoll errungenen Feinheit Geld herauspressen läßt, während die Durchschnittsmenschen bewundernd um die Künstlerin herumstehen, applaudieren. Jetzt ist Erika endlich fertig zurechtgezartet, nun soll sie den Wagen der Musik in die Spur heben und auf der Stelle zu künsteln anfangen. So ein Mädchen ist auch nicht geschaffen, Grobes auszuführen, schwere Handarbeit, Hausarbeit. Sie ist den Finessen des klassischen Tanzes, des Gesanges, der Musik von Geburt an vorherbestimmt. Eine weltbekannte Pianistin, das wäre Mutters Ideal; und damit das Kind den Weg durch Intrigen auch findet, schlägt sie an jeder Ecke Wegweiser in den Boden und Erika gleich mit, wenn diese nicht üben will. Die Mutter warnt Erika vor einer neidischen Horde, die stets das eben Errungene zu stören versucht und fast durchwegs männlichen Geschlechts ist. Laß dich nicht ablenken! An keiner Stufe, die Erika erreicht, ist es ihr gestattet auszuruhen, sie darf sich nicht schnaufend auf ihren Eispickel stützen, denn es geht sofort weiter. Zur nächsten Stufe. Tiere des Waldes kommen gefährlich nah und wollen Erika ebenfalls vertieren. Konkurrenten wünschen Erika zu einer Klippe zu locken, unter dem Vorwand, ihr die Aussicht erklären zu wollen. Doch wie leicht stürzt man ab! Die Mutter schildert den Abgrund anschaulich, damit das Kind sich davor hütet. Am Gipfel herrscht Weltberühmtheit, welche von den meisten nie erreicht wird. Dort weht ein kalter Wind, der Künstler ist einsam und sagt es auch. Solange die Mutter noch lebt und Erikas Zukunft webt, kommt für das Kind nur eins in Frage: die absolute Weltspitze.
Die Mutti schiebt von unten, denn sie steht mit beiden Beinen fest im Erdboden verwurzelt. Und bald steht Erika schon nicht mehr auf dem angestammten Mutterboden, sondern auf dem Rücken eines anderen, den sie bereits hinausintrigiert hat. Ein wackliger Grund ist das! Erika steht zehenspitzig auf den Schultern der Mutter, krallt sich mit ihren geübten Fingern oben an der Spitze fest, welche sich leider bald als bloßer Vorsprung im Fels entpuppt, eine Spitze vortäuschend, spannt die Oberarmmuskulatur an und zieht und zieht sich hinauf. Jetzt guckt schon die Nase über den Rand, nur um einen neuen Felsen erblicken zu müssen, schroffer noch als der erste. Die Eisfabrik des Ruhmes hat hier aber schon eine Filiale und lagert ihre Produkte in Blöcken ab, auf diese Weise kosten sie nicht soviel Lagerkosten. Erika leckt an einem der Blöcke und hält ein Schülerkonzert bereits für den Gewinn des Chopin-Wettbewerbs. Sie glaubt, nur Millimeter fehlen noch, dann ist sie oben!
Die Mutter stichelt Erika wegen zu großer Bescheidenheit an. Du bist immer die allerletzte! Vornehme Zurückhaltung bringt nichts ein. Man muß immer zumindest unter den ersten dreien sein, alles, was später kommt, wandert in den Müll. So spricht die Mutter, die das Beste will und ihr Kind daher nicht auf die Straße läßt, damit es an sportlichen Wettkämpfen nur ja nicht teilnimmt und das Üben vernachlässigt.
Erika fällt nicht gern auf. Sie hält sich vornehm zurück und wartet, daß andere etwas für sie erreichen, klagt das verletzte Muttertier. Die Mutter beklagt bitter, daß sie alles alleine für ihr Kind besorgen müsse, und stürzt sich jubelnd in den Kampf. Erika setzt sich nobel selbst hintan, wofür sie nicht einmal ein paar Geschenkmünzen für Strümpfe oder Unterhosen erhält.
Die Mutter klappert Freunden und Verwandten, und viele sind es nicht, denn man hat sich frühzeitig vollkommen von ihnen abgesondert und auch das Kind von ihrem Einfluß abgetrennt, eifrig entgegen, daß sie ein Genie geboren habe. Sie merke es immer deutlicher, kommt aus dem Schnabel der Mutter. Erika ist ein Genie, was die Betätigung des Klaviers betrifft, nur wurde sie noch nicht richtig entdeckt. Sonst wäre Erika längst, einem Kometen gleich, über den Bergen hochgestiegen. Die Geburt des Jesusknaben war ein Dreck dagegen.
Die Nachbarn pflichten dem bei. Sie hören gern zu, wenn das Mädchen übt. Es ist wie im Radio, nur kostet es keine Gebühren. Man braucht bloß die Fenster und eventuell die Türen zu öffnen, schon dringt Klang herein und verbreitet sich wie Giftgas in die letzten Ecken und Winkel. Die über Lärm empörte Umwelt spricht Erika auf Wegen und Stegen an und bittet um Ruhe. Die Mutter spricht zu Erika von der nachbarlichen Begeisterung wegen hervorragender Kunstausübung. Erika wird von einem schütteren Bächlein mütterlicher Begeisterung dahingetragen wie ein Patzen Spucke. Später wundert sie sich, wenn ein Anrainer sich beklagt. Von Klagen hat ihr die Mutter nie etwas berichtet!
Im Lauf der Jahre übertrifft Erika ihre Mutter noch darin, wenn es gilt, auf jemanden herabzusehen. Auf diese Laien kommt es letztlich nicht an, Mama, ihr Urteil ist roh, auch ihr Empfinden nicht ausgereift, nur die Fachleute zählen in meinem Beruf. Die Mutter entgegnet: Spotte du nicht des Lobes einfacher Menschen, die mit dem Herzen Musik hören und sich daran mehr freuen als die Überzüchteten, Verwöhnten, Blasierten. Die Mutter versteht selbst nichts von Musik, doch sie zwingt ihr Kind ins Geschirr dieser Musik. Es entwickelt sich ein fairer Rachewettkampf zwischen Mutter und Kind, denn das Kind weiß bald, daß es über seine Mutter musikalisch hinausgewachsen ist. Das Kind ist der Abgott seiner Mutter, welche dem Kind dafür nur geringe Gebühr abverlangt: sein Leben. Die Mutter will das Kinderleben selbst auswerten dürfen.
Mit einfachen Menschen darf Erika nicht verkehren, doch auf ihr Lob darf sie immer hören. Die Fachleute loben Erika leider nicht. Ein dilettantisches, unmusikalisches Schicksal hat sich den Gulda herausgegriffen und den Brendel, die Argerich und den Pollini u.a. Aber an der Kohut ging das Schicksal abgewandten Gesichts beharrlich vorüber. Das Schicksal will schließlich unparteiisch bleiben und sich nicht von einer feschen Larve täuschen lassen. Hübsch ist Erika nicht. Wollte sie hübsch sein, die Mutter hätte es ihr sofort verboten. Vergebens streckt Erika ihre Arme dem Schicksal entgegen, doch das Schicksal macht keine Pianistin aus ihr. Erika wird als Hobelspan zu Boden geschleudert. Erika weiß nicht, wie ihr geschieht, denn so gut wie die Großen ist sie schon lange.
Dann versagt Erika einmal bei einem wichtigen Abschlußkonzert der Musikakademie völlig, sie versagt vor den versammelten Angehörigen ihrer Konkurrenten und vor ihrer einzeln angetretenen Mutter, die ihr letztes Geld für Erikas Konzerttoilette ausgegeben hat. Nachher wird Erika von ihrer Mutter geohrfeigt, denn selbst musikalische Voll-Laien haben Erikas Versagen an ihrem Gesicht, wenn schon nicht an ihren Händen ablesen können. Erika hat zudem kein Stück für die breit sich dahinwälzende Masse gewählt, sondern einen Messiaen, eine Wahl, vor der die Mutter entschieden warnte. Das Kind kann sich auf diese Weise nicht in die Herzen dieser Masse schmuggeln, welche die Mutter und das Kind immer schon verachtet haben, erstere, weil sie immer nur ein kleiner, unscheinbarer Teil jener Masse war, letztere, weil sie niemals ein kleiner, unscheinbarer Teil der Masse sein möchte.
Unter Schimpf taumelte Erika vom Podium, unter Schande empfängt sie ihre Adressatin, die Mutter. Auch ihre Lehrerin, eine ehemalige bekannte Pianistin, rügt Erika auf das heftigste wegen Konzentrationsmangels. Eine große Chance ist nicht genützt worden und kommt nie mehr zurück. Es wird bald ein Tag herannahen, da Erika von niemandem mehr beneidet wird und der Wunsch von niemand mehr ist.
Was bleibt ihr anderes übrig, als in das Lehrfach überzuwechseln. Ein harter Schritt für den Meisterpianisten, der sich plötzlich vor stammelnden Anfängern und seelenlosen Fortgeschrittenen wiederfindet. Konservatorien und Musikschulen, auch der private Musiklehrbereich, nehmen in Geduld vieles in sich auf, was eigentlich auf eine Müllkippe oder bestenfalls ein Fußballfeld gehörte. Viele junge Menschen treibt es immer noch, wie in alten Zeiten, zur Kunst, die meisten von ihnen werden von ihren Eltern dorthin getrieben, weil diese Eltern von Kunst nichts verstehen, gerade nur wissen, daß es sie gibt. Und darüber freuen sie sich so! Viele drängt die Kunst allerdings wieder von sich ab, denn es muß auch Grenzen geben. Die Grenze zwischen den Begabten und den Nichtbegabten zieht Erika besonders gern im Laufe ihrer Lehrtätigkeit, das Aussortieren entschädigt sie für vieles, ist sie doch selbst einmal als Bock von den Schafen geschieden worden. Erikas Schüler und Schülerinnen sind gröbstens aus allen möglichen Sorten zusammengemischt, und keiner hat sie vorher auch nur andeutungsweise abgeschmeckt. Nur selten ist eine rote Rose darunter. Manchen entreißt Erika schon im ersten Lehrjahr mit Erfolg die eine oder andere Clementi-Sonatine, während andere noch grunzend in den Czerny-Anfängeretüden herumwühlen und bei der Zwischenprüfung abgekoppelt werden, weil sie absolut kein Blatt und kein Korn finden wollen, während ihre Eltern fest glauben, bald werden ihre Kinder Pastete essen.
Erikas gemischte Freude sind die tüchtigen Fortgeschrittenen, die sich Mühe geben. Ihnen entringen sich Schubert-Sonaten, Schumanns Kreisleriana, Beethoven-Sonaten, jene Höhepunkte im Klavierschülerleben. Das Arbeitsgerät, der Bösendorfer, sondert intrikates Mischgewebe ab, und daneben steht der Lehrer-Bösendorfer, den nur Erika bespielen darf, es sei denn, man übt etwas für zwei Klaviere ein.
Nach jeweils drei Jahren muß der Klavierschüler in die nächsthöhere Stufe eintreten, zu diesem Zweck besteht er eine Übertrittsprüfung. Die meiste Arbeit mit dieser Prüfung hat Erika, die den trägen Schülermotor durch heftigeres Gasgeben auf höhere Touren schrauben muß. Manchmal springt der so Bearbeitete nicht richtig an, weil er lieber etwas ganz anderes täte, das mit Musik nur insofern zu tun hat, als er Worte wie Musik in das Ohr eines Mädchens träufelt. So etwas sieht Erika nicht gern und unterbindet sie, wenn sie kann. Oft predigt Erika vor der Prüfung, daß ein Danebengreifen weniger schädlich sei, als das Ganze im falschen Geist wiederzugeben, der dem Werk nicht gerecht wird; sie predigt tauben Ohren, die sich vor Angst verschließen. Denn für viele ihrer Schüler ist Musik der Aufstieg aus den Tiefen der Arbeiterschaft in die Höhen künstlerischer Sauberkeit. Sie werden später ebenfalls Klavierlehrer und Klavierlehrerinnen. Sie fürchten, daß bei der Prüfung ihre angstgedopten, schweißnassen Finger, vom rascheren Pulsschlag angetrieben, auf das falsche Tastenbrett rutschen. Da kann Erika von Interpretation reden, soviel sie will, sie wollen es nur bis zum Ende richtig durchspielen können.
Erikas Gedanken wenden sich erfreut Herrn Walter Klemmer zu, einem hübschen blonden Burschen, der neuerdings als erster in der Früh kommt und abends als letzter geht. Er ist ein fleißiges Lieschen, muß Erika zugeben. Er ist Student an der Technik, wo er den Strom und seine wohltätigen Eigenschaften studiert. Er wartet in letzter Zeit sämtliche Schüler ab, und zwar vom ersten zögernden Fingerübungspicken bis zum letzten Kracks von Chopins Phantasie f-Moll, op. 49. Er sieht aus, als habe er sehr viel überflüssige Zeit, was bei einem Studenten in der Endphase seines Studiums unwahrscheinlich ist. Erika fragt ihn eines Tages, ob er nicht lieber den Schönberg ausüben wolle, anstatt hier unproduktiv herumzusitzen. Ob er nichts fürs Studium zu lernen habe? Keine Vorlesungen, Übungen, nichts? Sie erfährt von Semesterferien, an die sie nicht gedacht hat, obwohl sie viele Studenten unterrichtet. Die Klavierferien decken sich nicht mit den Universitätsferien, strenggenommen gibt es von der Kunst niemals Urlaub, sie verfolgt einen überall hin, und dem Künstler ist das nur recht.