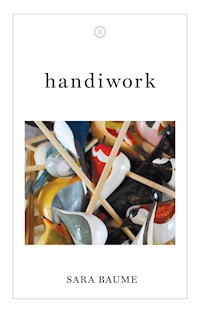9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein einsamer Mann Mitte fünfzig kommt ins Tierheim. Ray braucht einen Hund, wegen der Ratten in seinem Haus, und er sucht sich den traurigsten Köter von allen aus: Im Kampf mit einem Dachs hat Einauge den Kürzeren gezogen, daher sein Name. Er ist sehr schreckhaft, immer hungrig, und wenn andere Hunde in der Nähe sind, wird er aggressiv. Ray, der das von seinem Vater ererbte schäbige Haus an der See bisher kaum verlassen hat, findet in dem armen Kerl einen Gefährten und ein Spiegelbild. Frühmorgens unternehmen die beiden lange Strandspaziergänge – bis eines Tages eine Frau mit Hund ihren Weg kreuzt. Einauge fällt den Rivalen an, und das Unheil nimmt seinen Lauf. Bald darauf steht eine Polizistin vor der Tür. Ray wimmelt sie ab und flieht mit Einauge in seinem klapprigen Auto. So fahren die beiden, Menschen meidend, die irische Atlantikküste hinab, während es draußen immer kälter und das Geld immer weniger wird … Eine traurige, eine herzzerreißende Geschichte, die Sara Baume in eine so klare wie schöne Sprache gehüllt hat. Ray und sein Hund bewegen sich durch ein wenig idyllisches Irland, Raffinerien, Parkplätze, Dreck – die Kunst der Autorin und ihre überragende Beobachtungsgabe machen aus dieser Flucht eine Reise voll dunkel strahlendem Glanz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Sammlungen
Ähnliche
Sara Baume
Die kleinsten, stillsten Dinge
Roman
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein einsamer Mann Mitte fünfzig kommt ins Tierheim. Ray braucht einen Hund, wegen der Ratten in seinem Haus, und er sucht sich den traurigsten Köter von allen aus: Im Kampf mit einem Dachs hat Einauge den Kürzeren gezogen, daher sein Name. Er ist sehr schreckhaft, immer hungrig, und wenn andere Hunde in der Nähe sind, wird er aggressiv. Ray, der das von seinem Vater ererbte schäbige Haus an der See bisher kaum verlassen hat, findet in dem armen Kerl einen Gefährten und ein Spiegelbild. Frühmorgens unternehmen die beiden lange Strandspaziergänge – bis eines Tages eine Frau mit Hund ihren Weg kreuzt. Einauge fällt den Rivalen an, und das Unheil nimmt seinen Lauf. Bald darauf steht eine Polizistin vor der Tür. Ray wimmelt sie ab und flieht mit Einauge in seinem klapprigen Auto. So fahren die beiden, Menschen meidend, die irische Atlantikküste hinab, während es draußen immer kälter und das Geld immer weniger wird …
Eine traurige, eine herzzerreißende Geschichte, die Sara Baume in eine so klare wie schöne Sprache gehüllt hat. Ray und sein Hund bewegen sich durch ein wenig idyllisches Irland, Raffinerien, Parkplätze, Dreck – die Kunst der Autorin und ihre überragende Beobachtungsgabe machen aus dieser Flucht eine Reise voll dunkel strahlendem Glanz.
Über Sara Baume
Sara Baume, geboren 1984 in Lancashire, ist in Cork aufgewachsen. Sie studierte Kunst, Design und Creative Writing. Vor ihrem Debütroman hat sie preisgekrönte Short Storys veröffentlicht. Ihr Roman stieg auf Platz 4 der irischen Bestsellerliste. Das Buch gewann viele Preise, unter anderem den Rooney Prize for Irish Literature, den Davy Byrnes Award und den Hennessy New Irish Writer Award. In der Irish Times schrieb Joseph O’Connor: «Dieses Buch ist das atemberaubende und wunderbare Werk einer großen Autorin. Es ist das stärkste Debüt, das ich seit Jahren gelesen habe.»
Dirk van Gunsteren, 1953 geboren, übersetzte u.a. Jonathan Safran Foer, Colum McCann, Thomas Pynchon, Philip Roth, T.C. Boyle, John Dos Passos und Oliver Sacks. 2007 erhielt er den Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis.
Für Mum natürlich.
Prolog
Er rennt, rennt, rennt.
Und es ist kein Rennen, wie er es kennt. Er ist die Flutwelle, die den Damm durchbricht, er ergießt sich den Hügel hinab, gräbt einen schulterbreiten Kanal durch das hohe Gras. Er tritt in Hufabdrücke. Er reißt Kreuzkrautstängel um. Löwenzahn und Vogelmiere, Nesseln und Bitterkraut.
Diesmal kein Schnüffeln, Stöbern, Schlingen. Diesmal keine Gitterstäbe, die seinen Ausflug beenden, keine Kette, die sich spannt und an ihm reißt, kein Gebrüll, das ihn mit Tricks und Drohungen zurückholt. Diesmal rennt er viel weiter, als er je geschaut hat, diesmal hat er jede Markierung am Horizont, alle vertrauten Hügel und Felszacken, hinter sich gelassen.
Es ist die Zeit des Aufgrabens. Es ist ein Regentag. So viel Wind, dass die dünneren Bäume schwanken, so viel Nieselregen, dass das lange Deckhaar auf seinem Rücken sich zu feuchten Locken kräuselt. So viel Blut, dass es in seinen Bart und auf die wirbelnden, ausgreifenden Pfoten rinnt. Und etwas Warmes, Nasses, das gegen seinen Hals schlägt. Es ist so groß wie ein Schneckenhaus und macht bei jedem Aufprall ein leises, schmatzendes Geräusch. Es baumelt an einem knorpeligen Band, das aus einem Loch in ihm hängt, aber das Was und Wo kann er dabei nicht erkennen.
Würde er anhalten und Abhang, Hufabdrücke, Kreuzkraut, Löwenzahn, Vogelmiere, Nesseln und Bitterkraut betrachten, dann würde er feststellen, dass sein Gesichtsfeld halbiert und nach rechts gerückt ist, während links alles schwarz bleibt, bis er den Kopf dreht. Aber er hält nicht an und bemerkt nur die hinderlichen Grashalme, die Stiche der Regentropfen, das Aufstieben winziger Insekten und das Blut, das auf der falschen Seite seiner Haut fließt, nicht innen, sondern außen.
Er rennt, rennt, rennt. Und es gibt keinen Kurs, keine Strömung, die ihn hemmt. Und es gibt zwischen Stammhirn und Schädeldecke keinen anderen Impuls als: RENN.
Er ist jetzt Einauge.
Er ist unterwegs.
Frühling
Du findest mich an einem Dienstag, bei meiner dienstäglichen Fahrt in die Stadt.
Du bist mit Klebestreifen von innen an der Schaufensterscheibe des Trödelladens befestigt. Ein Foto deines versehrten Gesichts und darunter der Appell an einen TOLERANTEN, LIEBEVOLLEN MENSCHEN OHNE ANDERE HAUSTIERE ODER KINDER UNTER 4 JAHREN. Der Zettel teilt sich den Schaufensterplatz mit einem Schaffellmantel, einem Tamburin, einer ausgestopften Pfeifente und einem Kalligraphie-Set. Aus der Ente rieselt Sägemehl, und in dem Kalligraphie-Set fehlen vermutlich Tinten, Federn oder Papier, ziemlich sicher aber die Anleitung. Der Trödelladen hat etwas Trauriges, doch mir gefällt er. Mir gefällt, dass er ein winziges Refugium der Unvollkommenheit ist. Jedes Mal bleibe ich stehen und sehe mir das Schaufenster an, und jedes Mal fühle ich mich ein bisschen weniger schrecklich, weniger sonderbar. Aber die Zettel habe ich nie zuvor bemerkt. Es gibt mehrere, jeder mit ein paar Zeilen Text unter einem unscharfen Foto. Es ist ein Sammelsurium von flehenden Augen, gerunzelten Pelzstirnen und mitten im hoffnungsvollen Wedeln erstarrten Schwänzen. Im erläuternden Text kommen Wörter wie STERILISIERT, GEIMPFT, GECHIPT und STUBENREIN vor. Jede feuchte Nase im Schaufenster sucht angeblich nach einem HEIM FÜR IMMER.
Ich bin hier, um einen Karton Glühbirnen zu kaufen, denn ich finde das trübe Licht der Energiesparbirnen unerträglich und mag es nicht, wie sie erst zögern und dann ein parasitisches Summen verströmen, so leise, dass ich denke, mit meinem Innenohr stimmt etwas nicht oder eine wichtige Ader im Stirnlappen ist geplatzt. Ich bleibe stehen, falte die Hände und mustere den feuerspeienden Drachen auf dem Trommelfell des Tamburins und die leuchtend roten, auf einem Brettchen aus Zedernholz befestigten Füße der Pfeifente, die ihre Schwingen ausgebreitet hat und doch nie abheben wird. Und ich frage mich, ob in dem Kalligraphie-Set wohl eine Anleitung ist.
Du klebst ganz unten, in der Ecke. Dein Foto ist das verschwommenste und dein Gesicht das hässlichste. Ich muss mich bücken, um dich in Augenschein zu nehmen, und dabei legt sich mein Schatten über das Glas des Schaufensters, sodass ich mein Spiegelbild sehe. Ich sehe meinen Kopf wie einen bizarren Auswuchs aus deinem Rücken ragen. Ich sehe mein eigenes zerstörtes Gesicht, das mich aus der Schwärze anstarrt.
Die Fahrt zum Tierheim dauert eine Dreiviertelstunde und drei dicke, kurze, von zu Hause mitgenommene Zigaretten. Es steht auf einem Stück Land entlang der unsichtbaren Grenze, an der Fabriken und Siedlungen aufhören und Wald und Feld beginnen. Auf der einen Seite Hausdächer, auf der anderen Baumwipfel. Der Boden ist aus Beton, und das Ganze ist mit Maschendraht eingezäunt. Der kunststoffummantelte Draht erbebt vom erregten Zittern der Tiere, die VERNACHLÄSSIGT, AUSGESETZT, MISSHANDELT worden sind. Neben den Zwingern steht auf Hohlblocksteinen ein flaches, unsolide wirkendes Gebäude. Im Beton steckt ein Pfosten mit einem Hinweisschild. BÜRO, steht darauf, BITTE ANMELDEN.
Ich gehöre nicht zu den Menschen, die imstande sind zu handeln. Dass ich die Stufen hinaufgehen und die Tür aufstoßen soll, macht mir kein gutes Gefühl, aber Anweisungen zu missachten, macht mir ebenfalls kein gutes Gefühl. Meine rechte und meine linke Hand finden und umschließen einander. Jetzt bin ich oben, und sie klopfen gemeinsam. Die Tür schwingt auf. Drinnen sitzt eine Frau hinter einem großen Bildschirm zwischen zwei Aktenschränken. Sie hat etwas Sprödes. Im Verhältnis zum Bildschirm wirkt sie klein, aber daran liegt es nicht. Eher daran, dass an ihren Schläfen die Adern hervortreten und ihre Lider die Farbe von frischen Blutergüssen haben.
«Welchen?», fragt sie und hält mir einen Ausdruck mit kleinen Fotos hin. Als ich den Finger auf deine verkleinerte Nasenspitze lege, sehe ich auf ihrem Gesicht die Andeutung eines Lächelns. Ich unterschreibe ein Formular und gebe eine Spende. Die spröde Frau spricht in ein Funkgerät, und dann wartet vor dem flachen Gebäude ein Wärter. Ich hätte nicht gedacht, dass es so unkompliziert sein würde.
Er ist ein dreieckiger Mann. Massige Schultern und Beine wie Flaggenstöcke, die Silhouette einer Rübe. In der Hand hat er Halsband und Leine. Er lässt sie baumeln und spricht mit lauter Stimme, während er mich durch den Zwinger führt. «Ich hab gleich gesagt, der ist reif für die Spritze, und richtig – kaum sieht er diesen anderen total freundlichen Hund, da stürzt er sich auf ihn und verbeißt sich. In den da.»
Er zeigt auf einen Zwinger mit einem kupferroten Cockerspaniel, daneben eine Babydecke und ein Quietschspielzeug in Form eines Burgers. Der Spaniel blickt auf, als wir vorbeigehen, und ich sehe zwei rote Löcher in seinen Lefzen. «Ein bösartiger kleiner Scheißkerl. Musste ihm das Maul aufhebeln und hab selbst noch was abgekriegt. Wenn einer mal so ist, kriegt man das nie mehr aus ihm raus. Noch einen Tag, und er wäre dran gewesen.»
Ich nicke, obwohl der Wärter mich gar nicht ansieht. Ich stelle ihn mir am Feierabend vor, in einem Haus, in dem alle Topfpflanzen seiner Frau gehören und der Vorgarten in einen großen, asphaltierten Parkplatz verwandelt worden ist. Die Wände sind magnolienfarben gestrichen, und im Küchenschrank hat er einen Vorrat Toastbrot, das er nicht nur zum Toasten, sondern für alles verwendet.
«Ist er gut gegen Ratten?», frage ich.
«Erstklassig», sagt der Wärter. «Wenn er was kann, dann das.» Und jetzt sehe ich, dass er auf dich zeigt.
Du bist in einem Einzelzwinger neben den Recyclingtonnen. Es stinkt nach verfaultem Fleisch, nach den Hunderten eingetrockneter Bröckchen, die an den Innenwänden der nachlässig gereinigten Tonnen kleben. Staub, Folien von Schokoriegeln und Pappbecher werden von den Luftwirbeln der vorbeifahrenden Wagen umhergeweht. Um die Ecke, außer Sicht, winseln und jaulen die anderen Hunde. Es ist ein trauriger Ort, und du bist kleiner, als ich gedacht habe.
Du knurrst, als der Wärter dich am Genick packt und dir das Halsband anlegt, aber du schnappst nicht nach ihm. Und dein Gang, deine Bewegungen zeugen nicht von Aggressivität oder Bosheit. Nichts deutet auf den Raufbold hin, den ich erwartet habe. Du duckst dich, du kriechst beinahe, als würdest du einen schweren Klumpen Furcht tragen.
«Ruhig», sagt der Wärter zu dir. «Schön ruhig.»
Wie sehe ich wohl durch dein einsames Guckloch aus? Du gehst mir gerade mal bis zur Wade, und ich bin ein großer Kerl. Schäbig gekleidet und unrasiert. Mit zerknittertem Gesicht und Bartstoppeln wie Eisenspänen. Wenn ich stehe, bin ich gebeugt, niedergedrückt von meinem eigenen Klumpen Furcht. Wenn ich gehe, lassen meine unförmigen Füße und unproportionierten Beine mich stampfen und schwanken. Durch die Löcher in der Jeans sieht man schwielige Kniescheiben, und meine Hände fuchteln plump und dumm. Meine Hände waren schon immer ein Problem. Ich weiß eigentlich nie, was ich mit ihnen anstellen soll, außer rumfuchteln. Ich habe die schlechte Angewohnheit, an der Haut um meine Fingernägel zu zupfen, bis nach und nach ein Niednagel entsteht. Wenn ich mich draußen in der Welt bewege, schwenke ich die Arme, um nicht an meinen Nägeln herumzuzupfen, und wenn ich stehen bleibe, lege ich die Hände über dem Bauch zusammen. Ich verschränke die Finger, damit sie stillhalten. Wenn ich drinnen bin, allein und ohne mich zu bewegen, rauche ich, damit sie nicht zupfen.
In einem bestimmten Licht, wenn es in einem bestimmten Winkel einfällt und bestimmte Partien hervorhebt, bin ich ein alter Mann. In der Windschutzscheibe des Wagens und auf der Rückseite meines Suppenlöffels bin ich ein alter Mann. Nachts im Wohnzimmerfenster bin ich ein alter Mann, und auch in den schmalen Spiegeln zu beiden Seiten der Kühltheke im Lebensmittelladen. Immer wenn ich die Vorhänge zuziehe oder mich vorbeuge, um nach Milch oder Margarine oder Waldfruchtjoghurt zu greifen, bin ich ein alter Mann. Meine Brauen wölben sich über die Augen und kitzeln die Lider, meine Zähne sind ockerbraun, meine Stirnfalten sind so tief eingegraben, dass sie nie verschwinden, nicht mal, wenn ich lächle. Obwohl ich meinen eigenen Geruch nicht wahrnehme, bin ich sicher, dass ich alt rieche. Mehr Mief, Porridge und Pisse, nehme ich an, als Zucker, Äpfel und Seife.
Ich bin siebenundfünfzig. Zu alt, um noch mal von vorn anzufangen, und zu jung, um aufzugeben. Mein Name bezeichnet im Englischen sowohl einen Sonnenstrahl als auch einen wie auf Flügeln dahingleitenden Knorpelfisch. Dabei bin ich für beides viel zu ernst und unelegant, und außerdem ist mein Name bloß ein weiteres Geräusch aus dem Mund von Männern, das dich verwirrt und von den Befehlen ablenkt, die du verstehst. In einem meiner Regale ist ein infolge von Feuchtigkeit aufgequollenes Buch, und darin wird beschrieben, wie Vögel, Fische und andere Tiere miteinander kommunizieren. Irgendwo dort steht, dass ein Tier wie du imstande ist, fünfundsechzig Wörter zu verstehen, etwa so viele wie ein zweijähriges Kind. Ich habe da meine Zweifel, aber so steht es in dem aufgequollenen Buch.
Es gab eine Zeit, da war mein Haar rabenschwarz und hatte, wenn ein bestimmtes Licht in einem bestimmten Winkel einfiel, einen bläulichen Schimmer, aber jetzt ist es mit Grau durchsetzt wie das Gefieder einer zerrupften Dohle. Ich flechte es zu einem Zopf, der mir über den findlingsartigen Rücken hängt, und manchmal denke ich, wenn es Leute gäbe, mit denen ich herumalbern würde, dann würden sie mich HÄUPTLING nennen, weil mein Gesicht so breit ist und ich eine Frauenfrisur habe und meine Augen diesen Ausdruck wässriger Sehnsucht haben. Aber ich habe niemand, mit dem ich herumalbern könnte. Mein Gefängnis besteht nicht aus kunststoffummanteltem Maschendraht, sondern aus Wänden, Fenstern und Türen, aber trotzdem habe ich eine Einzelzelle. Ich bin ganz allein, wie du.
Wo ich gehe und stehe, ist es, als würde ich einen Raumanzug tragen, der mich von anderen Menschen isoliert. Einen großen, schimmernden, einteiligen Anzug, der verbirgt, wie klein und langweilig ich mich fühle. Ich weiß, dass du ihn nicht siehst; ich sehe ihn ja selbst nicht, aber wenn ich stampfend und schwankend und mit den Armen rudernd eine Straße entlanggehe, weichen ausgewachsene Männer in den Rinnstein aus, um nicht von meinem unsichtbaren Raumanzug gestreift zu werden. Wenn ich mich im Supermarkt in die Kassenschlange stelle, drückt die Kassiererin auf die Klingel und geht zur Toilette. Wenn ich an einem Spielplatz vorbeifahre, gibt es fast immer ein Au-pair-Mädchen, das sich mein Kennzeichen einprägt. 93-OY-5731.
Sie denken, ich merke es nicht. Aber ich merke es.
«Rein!», sagt der Wärter zu dir.
Wir stehen zu dritt auf dem Beton, und du willst nicht in den Wagen steigen. Der dreieckige Mann wird langsam ärgerlich. Es muss beinahe Mittag sein, und darum ist er in Gedanken wohl schon in der Kantine und isst die dicken Sandwiches. Er hebt dich hoch und setzt dich auf den Rücksitz.
«Na siehst du», sagt er. Seine Stimme ist tonlos und unaufrichtig. «Viel Glück.»
Du willst gegen die zuschlagende Tür springen, wendest den Kopf und suchst nach anderen Fluchtwegen. Wonach riecht mein alter Wagen? Nach Salz und Öl und Staubmäusen, nach schalem Popcorn und vertrockneten Apfelschalen? Auf dem Rücksitz liegt eine rote Decke, zwischen deren Fasern Sandkörner stecken. Hast du schon mal Sand gesehen? Vermutlich nicht. Du beugst den Kopf, als würdest du diese winzigen, perlenartigen Steine betrachten. Ich setze mich ans Steuer, lege den Sicherheitsgurt an und stecke den Schlüssel ins Zündschloss. Als der Motor zu tuckern beginnt, hebst du den Kopf zum Rückfenster. Du siehst, wie das flache Gebäude erst auf Postkarten- und dann auf Briefmarkengröße schrumpft und schließlich verschwindet.
Jetzt fahren wir aus der Stadt und in die Vorstadt. Entlang der Straße stehen blühende Kirschbäume und spucken kleine rosarote Blütenprisen auf den Verkehr. Sieh dir die Rhododendren und die Goldregensträucher an, deren Knospen sich gerade öffnen, die Forsythien und die trauernden Weiden. Es gibt hier genug Lorbeer, um eine Stadionarena einzufassen, und jedes Mal, wenn wir beschleunigen, verschwimmt alles zu einem Brei aus Erdfarben und verzerrten, gestreckten Umrissen. Doch du wendest dich davon ab und streckst dich. Du kletterst über Handbremse und Beifahrersitz nach vorn und kauerst dich im Fußraum zusammen, hinter dir die Wärme des Motors und unter dir, nur durch ein dünnes Stahlblech von dir getrennt, der dahinrasende Asphaltstrom. Jetzt wird aus Vorstadtsträßchen eine Schnellstraße, und aus Kirschbäumen wird ein Grünstreifen mit wucherndem Gras. Wo es kürzer ist, liegt ein Schaum aus Gänseblümchen. Es ist ein hübsches Stück Wildnis, ein winziges Refugium der Unvollkommenheit.
Aber du willst nicht heraufkommen und es dir anschauen. Du bleibst unter dem Armaturenbrett, nur deine Nase sieht hervor. Die Art, wie sie sich bewegt, erinnert mich an eine sich windende Made. Wonach riecht es aus den Lüftungsschlitzen? Nach Pollen, Benzin und Farbe? Jetzt fahren wir an Häusern mit Menschen vorbei, an Geschäften mit Waren, an Kirchen mit gemalten Göttern, und jetzt fahren wir in einen Kreisverkehr und biegen auf die wenig befahrene Straße nach Hause ein. Mach dich auf Schlaglöcher und Kurven gefasst, auf Holpern und Schaukeln. Du stößt dir den Kopf am Handschuhfach und grunzt – es klingt genau wie bei einem Schwein. Wenn dein verlorenes Auge in deiner Madennase sitzen würde, könntest du jetzt ein Rapsfeld in voller Blüte sehen, vor einem samtig grauen Hintergrund. Das ist der Himmel. Du würdest sehen, wie der Raps sich in ein endloses Blau ergießt. Das ist das Meer. Hat deine Madennase jemals das Meer gesehen? Vermutlich nicht. Wir fahren an der Bucht entlang, wir parken mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig vor einem lachsroten Haus. Es ist das lachsrote Haus meines Vaters, meine Einzelzelle. Es ist mein Zuhause.
Manchmal denke ich, wenn ich irgendwo auf der Welt die Handbremse lösen würde, dann würde der Wagen widerwillig, aber unbeirrt hierher rollen, zu dem Bürgersteig vor den Reihenhäusern an der Bucht. Allerdings bin ich nie irgendwo auf der Welt gewesen. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich dorthin gelangen sollte.
Jetzt willst du nicht aussteigen. Ich gehe in die Hocke, und du starrst mich aus dem Fußraum an. Ich mache die Tür weit auf und lasse die salzige Luft ein. Sie ist kräftig und belebend, gesättigt mit dem Geruch von Fäulnis und Fisch, Tang und Nässe. Deine Madennase nimmt den Geruch auf und erwacht zitternd zum Leben. Jetzt zieht sie deine Vorderbeine voran, und die ziehen den Rest von dir hinter sich her. Wieder grunzt du, doch diesmal klingt es anders, diesmal ist es ein neugieriges Grunzen. Widerwillig, aber unbeirrt springst du aus der schützenden Höhle auf die Straße am Meer.
Willkommen daheim, Einauge, mein guter kleiner Rattenfänger.
Ich weiß nicht genau, wo ich geboren wurde. In einem Krankenhaus wahrscheinlich. In grellem Licht, auf frisch gewaschenen Laken und neben einem Rolltisch voll sterilisierter Geburtshilfe-Instrumente. Die Vorstellung, dass ein verhüllter Fremder meinen nackten, schreienden Körper hochgehoben hat wie einen gekochten Schinken, fällt mir schwer. Stattdessen tue ich lieber so, als wäre ich ganz allein und ohne Schleim und Aufregung zur Welt gekommen. Und zwar hier, im Haus meines Vaters. Ich stelle mir vor, dass das Haus selbst mich geboren hat, dass ich durch den Kamin gefallen und unsanft auf dem Rost gelandet bin und mit dem ersten Atemzug kalte, wirbelnde Asche eingeatmet habe.
Das Haus meines Vaters ist eines der ältesten im Dorf. Es hat zwei Stockwerke und ein schräges Schieferdach. Manche Schiefer sind zerbrochen, und manche fehlen ganz, aber alle sind mit einem grünen Flaum bestäubt, und an den Rändern hocken winzige Moosigel. Die Fassade ist in diesem knalligen Lachsrot gestrichen, und das Dach ist ein künstlicher kahler Hügel, der durch die Bewegungen der Erde darunter außer Form geraten ist. Der größte Teil des Erdgeschosses ist ein Ladenlokal, und das ist auch der Grund für das Schild zwischen den beiden Blumenkästen. Es ist ein Friseursalon, und deshalb kann ich in meiner Wohnung laufendes Wasser und summende Trockenhauben hören, Popmusik und hochhackige Schuhe und das schneidende Lachen der polnischen Friseurin, mit dem sie jemandem, der gerade reinkommt, Freundlichkeit vorspielt.
Als ich ein Junge war, gab es im Erdgeschoss des Hauses meines Vaters ein Geschäft für Damenmoden. Die Dame, die es führte, stellte immer zwei kopflose Schaufensterpuppen ins Fenster, und ich verstand nicht, warum sie die Puppen so modisch kleidete, sich aber nicht die Mühe machte, die Köpfe zu ersetzen. Ich hatte Angst, ihre vergessenen Gesichter könnten nachts ein Loch in eine Schranktür nagen und zwischen den schlafenden Kleiderbügeln herumgeistern. Ich hätte schwören können, dass ich hörte, wie sie nagten und auf den Augenbrauen über den Teppich robbten. Als die Frau das Geschäft aufgab, stellte der Makler im Schaufenster seine Angebote aus. Mehrere Jahre lang konnte ich in jedem Haus, das im Umkreis von drei Dörfern zu verkaufen oder zu vermieten war, nach Herzenslust umherschleichen, ohne den Bürgersteig vor dem Haus zu verlassen. Als Junge stellte ich mir vor, ich würde in jedem einzelnen davon leben. Und in jeder frisch renovierten Doppelhaushälfte mit voll ausgestatteter Küche und cremefarbenen Wänden war ich ein anderer, neuer, besserer Junge.
Außer dem Friseursalon gibt es hier einen chinesischen Lieferservice, einen Lebensmittelladen, einen Schnellimbiss und zwei Pubs. Im Dorf leben viele Vogelliebhaber und Leute mit absonderlichen Gangarten, viele Alte und Alkoholiker und Männer mit signalroten Overalls. Am einen Ende erhebt sich ein Hügel aus riesigen Tanks. Das ist die Ölraffinerie. Am anderen Ende steht ein hoher Schornstein, der rot und weiß angemalt ist und aussieht wie eine Zuckerstange. Das ist das Kraftwerk. Dazwischen ist ein Naturschutzgebiet. Stockenten und Haubentaucher paddeln unverdrossen durch den Nieselregen. Reiher stehen stockstill und knietief im Schlick und tun, als wären sie Statuen. Raffinerie und Kraftwerk legen ein Murmeln über das Dorf. Eingerahmt vom tonlosen Summen der Industrie, singen und kreischen trotzig die Vögel. Komm mit, durch das Stahltor und über den schmalen Weg zur Vordertür. Da ist der Flur, wo es aussieht wie in der Altkleidersammlung. Wolle und Tweed und Ölzeug hängen von den Haken über meine Gummistiefel, den Heizkörper und das Treppengeländer. Fast keines der Kleidungsstücke gehört mir, jedenfalls nicht ursprünglich.
Da ist die Küche, eng und dunkel, mit gesprungenen Fliesen an den Wänden und Flecken unbekannter Herkunft auf dem Linoleumboden. Sie riecht nach Knoblauch und Kaffee und Zigarettenrauch und Abfall, und der Abfall riecht nach Knoblauchschalen und Kaffeesatz und Zigarettenkippen. Geh nicht an den Abfall, okay? Du darfst nicht zwischen leeren Dosen, Hühnerknochen und schleimverkrusteten, zu abstrakten Gebilden erstarrten Papiertaschentüchern wühlen. Das hier ist mein Kaffeebecher mit der unauslöschlichen schwarzen Patina. Wenn ich ein Zigeuner wäre, könnte ich für dich daraus lesen, und wenn ich Visionen hätte, könnte ich dir das Gesicht von Jesus auf dem Boden des Bechers zeigen. Siehst du es, siehst du das Gesicht von Jesus?
Komm mit, die Treppe an der Trennwand zum Friseursalon hoch in den oberen Flur. Siehst du die Zierteller an den Wänden mit dem bröckelnden Putz? Sie kommen aus allen Ecken der Welt. Der hier, mit dem heiligen Georg, ist aus Bermuda. Der mit dem Lachenden Hans ist aus Australien, und die beiden schnurrbärtigen Männer, die um Kampfhähne feilschen, sind aus Puerto Rico. Aus Andorra ist die Seilbahn, aus Mallorca sind die Mandelbäume, Hawaii hat HAWAII in Gold eingeprägt, aber mein Lieblingsteller ist aus Dschibuti. Keine Ahnung, wo das ist.
Das hier ist mein Schlafzimmer, wo der Teppichboden unter den vielen Läufern kaum zu sehen ist. Jeder Läufer ist von Fremden in fernen Ländern aus zerrissenen Lumpen gewebt worden. Diese fremden Weber haben größere Familien, aber weniger Habseligkeiten, buntere Kleider, aber trübere Aussichten, und irgendwie fühle ich mich ihnen näher als den Leuten auf der Straße, die mein Raumanzug von mir fernhält. Da ist das Bett, der Schaukelstuhl, der Schrank, der Kamin, der Kaminrost, auf den das Haus mich geboren hat. Die Eimer rechts und links davon sind für Kohle und das Holz, das ich hinter dem Haus auf einem Hackklotz aus Eschenholz spalte. Eschenholz ist härter als alle anderen Hölzer; der Klotz, auf dem alle Scheite erbarmungslos zerteilt werden. Wonach riecht mein Schlafzimmer? Nach feuchten Sporen, Staub und eingetrocknetem Saft? Sieh dir den schwarzen Schimmel an der Stirnwand an, der zum Negativ einer Sternenkarte erblüht ist: Die weiße Wand ist der Nachthimmel, und die Sterne sind schwarz, feucht und pelzig.
Hinter diesem Vorhang aus Holzperlen verbirgt sich das Badezimmer, und wenn er bewegt wird, machen die Perlen ein Geräusch wie eine Bonbonlawine, wie ein Loch in einer Knopffabrik. Du darfst nicht ins Badezimmer, okay? Du darfst keine Spritzer von der Kloschüssel lecken. Holzleisten mit bunten Bändern sind hier an jedem zweiten Vorsprung befestigt. Ich habe diese Regenbogen erst aufgehängt, als mein Vater nicht mehr da war. Manchmal trete ich auf das Ende eines Bandes, dann schnalzt es wie eine winzige Reitpeitsche. Manchmal verwickle ich mich im Vorbeigehen und reiße die ganze Leiste herunter. Die Bänder sind nervig. Ich weiß, dass sie nervig sind, aber ich nagle sie jedes Mal wieder an. Der Laubenvogel in mir besteht darauf.
Und jetzt zum Wohnzimmer, das seinem Namen gerecht wird und wo sich der größte Teil des Lebens abspielt. Ich habe im Radio gehört, dass Hunde die Welt wie Farbenblinde sehen, dass deine Welt gelber, blauer und grauer ist als meine. Wenn das stimmt, sind meine Wohnzimmerwände eine Beleidigung für dein einsames Guckloch. Tut mir leid. Sie sind dottergelb. Das vordere Fenster geht nach Süden und berührt mit der Oberkante die Dachbalken. Da sind das Sofa und der Sofatisch, und da ist der Fernseher, der aber meist ausgeschaltet ist, sodass der Bildschirm ein dunkler Spiegel ist und das winzige Bild eines Raums zeigt, aus dem alles Leben geflossen ist. Im Bildschirm des ausgeschalteten Fernsehers sehe ich alt aus. Es ist einer der Orte, wo ich ein alter Mann bin. Da sind die Vorhänge, die Hängepflanzen, die Bilder in ihren Rahmen. Ich vergesse immer, die Pflanzen zu gießen, bis die Erde so ausgetrocknet ist, dass das Wasser einfach durchläuft und auf den Teppich tropft. Manchmal ist eine Pflanze auch so ausgedörrt, dass sie zu viel trinkt und ihre Blätter bleich und schlaff und schwammig werden; sie trinkt, bis sie ertrunken ist. Da ist meine Aloe vera, sieh dir die Blasen unter der durchscheinenden Haut an. Sieh dir das Bild da an. Ich habe keine Ahnung, wer die lächelnden Fremden darauf sind. Ich kaufe die Rahmen und lasse die Bilder der Menschen drin. Es sind vom Rahmenhersteller ausgesuchte Fotomodelle, die angewiesene Posen eingenommen haben.
Laubenvögel sind die Künstler des Tierreichs; sie besitzen einen unglaublichen Sinn für Schönheit und schmücken ihr Nest wie einen Weihnachtsbaum. In einem der mit Buchrücken in allen Größen, Farben und Zerfallsstadien beladenen Regale ist ein Buch mit einem Bild von einem solchen Nest. Buchrücken über Buchrücken, zu Türmen gestapelt auf dem Sofatisch und in langen Reihen entlang der Fußleiste aufgestellt. Wonach riechen sie? Nach Buchwürmern und rissigem Leim, nach schalem Toast und altersschwachem Klebeband.
Und hier, am hintersten Ende des Flurs, ist der letzte Raum, der mit der Klappleiter, die durch die Falltür auf den Dachboden führt, wo die Sache mit den Ratten passiert ist. Siehst du den abgegriffenen Türknauf und das schlüssellose Schlüsselloch? Siehst du die Zugluftschlange, die auf der Schwelle liegt und deren rosige, schlampig genähte Filzzunge bedrohlich gespalten ist? Hier darfst du nicht rein, hast du verstanden? Ich gehe auch nicht rein.
Ich sehe, dass du mich beobachtest und bei der kleinsten unvermittelten Bewegung zusammenzuckst. Ich sehe, dass du noch immer Angst hast, obwohl ich nicht mal die Stimme erhoben habe. Wartest du darauf, dass ich eine Würgekette hervorziehe? Dass ich dir einen Schlag auf die Nase oder einen Tritt gebe? Jetzt muss ich dich zur Küchentür hinausschieben und in den Hof sperren, nur für kurze Zeit. Ich muss einkaufen und bin mir noch nicht sicher, ob ich dich allein im Haus lassen kann. Dosennudeln und Ingwerkekse, eine Tüte Milch und Sardinen.
Der Hof ist ein gestauchtes Rechteck mit einer Steinmauer ringsherum und einem Holztor zum Nachbargarten. Der Boden besteht aus rissigem Beton und Kalksteinstücken, hier und da wächst Unkraut: Ruprechtskraut, Wolfsmilch, Erdrauch und noch ein paar andere, weniger schöne Arten. Die meisten der grünen oder braunen oder kaum Blätter tragenden Pflanzen in den Töpfen entlang der Mauer sind Überreste vom letzten Sommer. Da ist ein grünblau sprießender Brokkoli, die Stiele sind geschossen, die Röschen haben bereits Samen gebildet. Zwischen den Skeletten wirbeln kleine Windräder. Vom Wind abgebrochene Flügel liegen zuckend herum. Hackklotz, Holzhaufen und Gartenschlauch sind mit einer rissigen Persenning abgedeckt. Da sind der drehbare Wäscheständer, der Tisch mit der Glasplatte und die Plastikstühle, und da sind ein paar Dutzend verbeulte oder kaputte Bojen in ausgebleichtem Gelb und Rot und da noch ein paar Dutzend Bruchstücke von Bojen. Manche haben noch immer scharfe Kanten, aber die meisten sind harmlos, das Meer hat sie abgeschliffen. Es ist eine Sammlung, meine Sammlung. Bitte pinkle nicht drauf, während ich weg bin.
Als ich gehe, sitzt du auf der Fußmatte. Dein ganzer Körper ist angespannt, wie in Erwartung eines Schlags. Du wirkst so traurig und hilflos. Du hebst den Kopf und siehst zu, wie die Küchentür sich schließt.
Ich gehe zur Vordertür hinaus und ins Dorf. Von der Bucht weht ein böiger, salziger Wind, eine leere Chipstüte wirbelt auf dem Bürgersteig vorbei, an einem Telefonmast flattern ein paar Fähnchen. Im Lebensmittelladen spricht April, die Tochter des Besitzers, laut ins Telefon, während sie meine Einkäufe scannt, und vergisst, mir eine Papiertüte zu geben. Ich stelle mir immer vor, dass April im April geboren ist und drei Schwestern namens May, June und July hat und vielleicht auch einen Bruder namens December, denn wenn der Sommer eine Frau ist, muss der Winter wohl ein Mann sein.
Ich stehe wieder am Tor und suche den richtigen Schlüssel, unter dem einen Arm Milch und Kekse, unter dem anderen die Fischkonserven, als ich dich sehe, als ich sehe, dass du ausgebrochen bist. Du bist auf dem Weg zur Vordertür meines Nachbarn. Jetzt schießt du über die Straße zu der Mauer, die der Biegung des Ufers folgt, und rennst an ihr entlang, vorbei an Straßenlaternen und Blumenkübeln.
Woher nimmst du die Willenskraft, so hoch zu springen? Das Holztor ist mindestens einen Meter fünfzig hoch. Als du im identischen Hof nebenan gelandet bist, warst du da enttäuscht, dass es auch dort nur Beton, Erdrauch, einen Wäscheständer und eine weitere Mauer mit einem weiteren Tor gibt?
Du rennst, rennst, rennst jetzt, als könntest du durch Rennen verstehen. Und ich blicke dir hilflos nach. Du erreichst das Ende des Dorfs und scheinst langsamer zu werden. Jetzt bleibst du stehen, drehst dich um und schaust zurück auf die Strecke, die du gerannt bist. Kannst du mich auf dem Bürgersteig sehen? Ich habe die Kekse fallen lassen und bin auf die Knie gesunken. Ein Rinnsal aus verschütteter Milch erfasst die Chipstüte und spült sie in den Rinnstein. Plötzlich ist es mir egal, ob die Leute mich sehen oder hören oder wissen, wer ich bin; es ist mir egal, was sie denken. Ich strecke die Arme aus und rufe immer wieder deinen Namen, immer lauter, ich schreie ihn über die Bucht, dass die Austernfischer aufstieben.
EINAUGE EINAUGE EINAUGE EINAUGE!
Warum bist du so plötzlich stehen geblieben? Weißt du nicht mehr, wohin du willst, fällt dir kein Ort ein, der ein Zuhause ist, erscheint dir das, was du vor dir siehst, fremder als das, was hinter dir liegt? Der Mann aus Mief und Porridge und Findling und Zopf, der Wagen, das Lachshaus, das murmelnde Dorf. Jetzt setzt du dich am Rand des Wegs. Jetzt wartest du, bis ich bei dir bin. Ich greife nach deinem Halsband, und als ich dich nach Hause führe, gehst du willig mit.
Zum Abendessen gibt’s bei uns Dosennudeln und Sardinen, dazu Berge von braunem Toast mit Butter. Jeder kriegt eine Dose Sardinen. Ich zupfe die bröckeligen Mittelgräten aus dem Fleisch auf meinem Teller und werfe sie in dein erwartungsvoll geöffnetes Maul. Spinnwebdünne Fäden hängen von deinem Bart, und wenn sie den Küchenboden erreicht haben, bilden sie kleine, zähflüssige Speichelpfützen. Die Art, wie du sabbernd dasitzt, hat etwas Prächtiges und steht dir. Prächtig steht dir gut.
Du bleibst in der Wohnzimmertür stehen, als ich den alten Sessel hole.
Mit meiner Schneiderschere und einem Tacker, einem Knäuel Bindfaden und einem Haufen verschlissener Vliesdecken werde ich dir ein Bett bauen. Der alte Sessel ist ungewöhnlich breit und niedrig und sieht aus, als hätte er mal einem Kind gehört und in einem Kinderzimmer gestanden – damals, als man Kinder noch in solche Zimmer schicken und sie anweisen konnte, still zu sein. Ich habe den Verdacht, dass das Kind, das still auf diesem Sessel saß, mein Vater war und dass er ihn hierher gebracht hat, in dieses Haus, obwohl er ihm längst entwachsen war. Bei genauerem Hinsehen bemerke ich, dass winzige Fingernägel Spuren im Holz der geschwungenen Armlehnen hinterlassen haben.
Alles steckt voller Geschichten, hat eine alte Nachbarin mal zu mir gesagt, dieselbe alte Nachbarin übrigens, die mir das Nähen beigebracht hat. Das war, als ich noch ganz klein war, zu klein, um zu verstehen, dass das meiste nicht genau das bedeutet, was es zu bedeuten scheint, und dass Bedeutung etwas Flüchtiges ist. Weil sie das mit den Geschichten gesagt hatte, trennte ich mit einem gezackten Küchenmesser die Rückennaht meines Lieblingsteddys Mr. Buddy auf. Ich wollte Geschichten, ich wollte, dass Worte herauspurzelten und sich zu Zeilen wie denen in meinen Kinderbüchern zusammenfanden, musste aber feststellen, dass Mr. Buddy voll winziger Wolken war. Ich stopfte sie wieder hinein und versteckte ihn hinter der Waschmaschine, damit mein Vater nicht sah, was ich getan hatte. Er fand es auch nie heraus, aber noch jahrelang hörte ich Mr. Buddys Nase klackend an die Kacheln schlagen, wenn die Maschine in den Schleudergang wechselte. Die Waschmaschine funktioniert nicht mehr, aber sie steht noch an derselben Stelle in der Küche, und ich nehme an, dass Mr. Buddy noch immer dahinter eingeklemmt ist.
Die Rückenlehne des alten Sessels ist mit einem schmutzigen Geflecht bezogen. Die Öffnung unter der linken Armlehne ist mit einer durchbrochenen Sperrholzplatte ausgefüllt, die auf der rechten Seite fehlt. Auch das Sitzkissen ist verlorengegangen, und als Ersatz falte ich ein löchriges Stück Stoff und ein paar Vliesdecken und nähe sie zusammen. Über die schmutzige Rückenlehne werfe ich eine fransenverzierte Tagesdecke mit einem Schachbrettmuster in Blau und Rosa. Siehst du, wie weich und bunt der Sessel jetzt ist, wie angenehm und bequem er sein wird?
Ich trage dein neues Bett runter in die Küche. Ich hatte noch nie ein Haustier, das größer war als eine Kiwi, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass für ein Tier die Küche der richtige Schlafplatz ist. Ich stelle das Bett in die Ecke, wo die Handtücher hängen. «Ins Bett», sage ich zu dir. «Guter Junge.» Jetzt schalte ich das Licht aus und schließe die Tür. Du auf der einen Seite, ich auf der anderen.
Du magst es nicht, verlassen zu werden. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Vermutlich bist du noch nie allein in einer Küche gewesen, wo der Boden kalt und rutschig ist und die Wände aus aufragenden Geräten bestehen, die seufzen und beben und piepen. Hörst du den tropfenden Wasserhahn? Jetzt knacken die sich ausdehnenden oder zusammenziehenden Rohre, als würden die Wände sich recken, jetzt hört man das Scharren kleiner Krallen hinter den Fußleisten – ein, zwei Ratten, die letzten der Plage. Kannst du mich oben hören? Wasser rinnt durch den Abfluss im Badezimmer, Hausschuhe treten von Linoleum auf Teppich, die Schranktür quietscht beim Öffnen und fällt von allein mit einem dumpfen Schlag zu. Jetzt herrscht Stille, denn ich rauche. Dies sind die Geräusche des Zubettgehrituals, das ich jeden Abend wie in Trance vollziehe, immer zur selben Zeit, immer in derselben Reihenfolge. Zähne, Füße, Hausschuhe, Schlafanzug, Zigarette. Schließlich drücke ich auf den Schalter der Nachttischlampe und lasse die letzte Glühbirne des Abends erlöschen.
Jetzt lausche ich ebenfalls. Ich höre, dass du von deinem Bett aufstehst und zur Küchentür gehst. Ich höre, dass du stehen bleibst und winselst. Es ist ein Laut, der irgendwo zwischen Gurren und Wehklage liegt und von irgendwo zwischen Bauch und Lunge kommt. Ich höre genau dreizehn Minuten lang zu. Ich sehe die leuchtenden Ziffern meines Digitalweckers umspringen. Genau dreizehn Minuten lang liege ich stocksteif und wie gebannt auf meiner alten Matratze.
Ich stehe auf, gehe die Treppe runter und öffne die Küchentür. Du sitzt auf dem kalten Linoleum und siehst mich mit einem großen Auge an. Ich kraule dich zwischen den Ohren – es soll dich trösten, aber du zuckst zusammen. Ich nehme den niedrigen Sessel, trage ihn hoch ins Schlafzimmer und stelle ihn in die Lücke zwischen Schrank und Bett. Als ich mich umdrehe, stehst du zögernd auf der Schwelle. Ich sehe, dass deine Nase bebend den Geruch von Motten, Kleinholz und Kohlenstaub aufnimmt. Ich gehe in die Hocke und klopfe auf die fransenverzierte Decke.
«Komm», sage ich zu dir, «komm her.»
Du trippelst über den Teppich und kletterst auf den Sessel. Du siehst zu, während ich die Nachttischlampe ausschalte, und siehst noch immer zu, während ich mich unter der Decke ausstrecke. Jetzt sehe ich das schwache Schimmern deines einsamen Gucklochs. Es glänzt matt im grünen Licht des Digitalweckers. Ich frage mich, ob du all die Dinge hören kannst, die ich nicht mehr höre, all die Dinge, die durch Vertrautheit lautlos geworden sind – so wie ich den Geruch meines Vaters nie wahrgenommen habe, obwohl er bestimmt einen hatte. Das Summen des Generators im Hof des Lebensmittelladens, den leisen Widerhall kratzender Federn im Schornstein, wo die Dohlen nisten, meinen unregelmäßigen Atem und das Rasseln meiner verteerten Lunge. Ich frage mich, ob du durch die offenen Vorhänge die Umrisse der Kontinente auf dem Mond erkennen kannst. Die Mondozeane, die Mondberge, die Seen voll Mondwasser. Jetzt sehe ich zu, während das Glänzen flackert und verschwindet. Jetzt lausche ich deinem leisen Schnarchen und Grunzen, den knurrenden Einschlafgeräuschen eines fremden Tiers, das eigentlich in die Küche gehört.
Schlaf gut, Einauge.
Ich habe einen seltsamen Traum. Ich träume, dass es stockdunkel ist und ich durch Wald und über Felder renne. Ziellos und wie verrückt. Ich träume Grashalme, die gegen meine Beine peitschen, und einen Fliegenschwarm, der meine Ohren umsummt. Ich träume das Trommeln und Klatschen von unsichtbarem Regen. Ich träume Eisenkraut, Habichtskraut, Flachskraut, Greiskraut, Steinkraut. Jetzt komme ich an den Fuß eines Hügels, wo eine Straße verläuft, und bleibe erschöpft stehen. Die Straße führt zu einem Haus mit einem erleuchteten Fenster. Die Vorhänge sind offen, und ich sehe auf dem Fensterbrett die Silhouette einer Vase mit verwelkten Osterglocken und an der Wand dahinter einen Spiegel und im Spiegel die Dunkelheit vor dem Fenster und einen zornigen Wolkenfetzen. Meine Beine knicken ein, und ich breche zusammen. Jetzt bin ich in einem Rohr, einem schwarzen Tunnel. Er ist tausend Meilen lang und endet in einem vollkommenen Kreis aus gleißendem Licht, als hätte jemand die Sonne vom Himmel gepflückt, sie in einen Grill gelegt, der über mir hängt, nur um mich zu wärmen. Aus der Nähe rieche ich versengten Pelz und glimmendes Zeitungspapier. Weiter entfernt, aber alles beherrschend, ist ein Geruch nach Fäkalien, Desinfektionsmittel und Sekreten aus den Angstdrüsen schreckstarrer Tiere. Im Traum bedeutet Geruch mir alles, er ist meine Muttersprache. Ich höre Stimmen und wende den Kopf nach rechts, aber da ist nur eine kahle Wand, von der weiße Farbe blättert. Ich sehe, dass ich hinter einer verschlossenen Tür bin, der Tür eines Käfigs, der irgendwo hoch oben ist. Mir ist ganz schwindlig, und mein Gesicht schmerzt und pocht. Jetzt merke ich: Wenn ich den Kopf nach links drehe, ist da nichts.
In meinem Traum ist es Frühling. Anfangs denke ich, dass ich das einfach weiß, aber eigentlich weiß ich kaum etwas einfach – meist habe ich vergessen, woher das Wissen stammt. Und dann fällt es mir ein: Es waren die Osterglocken, die mir verraten haben, dass Frühling ist.
Du bist etwa so groß wie ein Dachs, würde ich sagen, nur anders proportioniert. Im Lauf der Jahre habe ich Dutzende Dachse gesehen, leblos auf dem Seitenstreifen, so tot wie der Dreck, mit dem sie bespritzt waren. In der Zeitung habe ich gelesen, dass die Straßenbaubehörde eine besondere Unterführung anlegen muss, wenn eine Schnellstraße durch das Revier eines Dachses verläuft. Trotzdem werden im Jahr neunhundertsechsundneunzig Dachse überfahren, stand da. Jedes Jahr ignorieren neunhundertsechsundneunzig Dachse die für sie gebauten Unterführungen und nehmen den Weg, den sie immer genommen haben. Ich finde, das ist eine riesige, entsetzliche Zahl.
Wie groß war dein Dachs? War es eine große Dächsin, wütend wie eine gereizte Wespe, weil sich im Dunkel hinter ihr ein Wurf neugeborener Jungdachse drängte? Hat sie sich darum mit ihren langen, gekrümmten Klauen auf dich gestürzt? Dir scheint gar nicht bewusst zu sein, dass du mager wie ein Wiesel bist. Du hast eine Präsenz, als wärst du drei Meter groß, aber du bist so dünn wie ein junger Kater. Dein Brustkorb verjüngt sich zum Bauch, dein Rumpf läuft in einen um drei Viertel kupierten Schwanz aus, und der größte Teil deines Gewichts liegt vorn, wie bei einer Schubkarre. Deine Beine sind nichts als Knochen, deine Schultern nichts als Muskeln. Dein Hals ist zu dick für deinen Körper, dein Maul ist zu breit für deinen Kopf, deine Ohren sind gerade so lang, dass sie umknicken. Dein Gesicht ist verheilt, und da, wo einmal dein linkes Auge war, sind eine Höhle und eine weiß leuchtende Narbe. Auch ein Teil deiner unteren Lefze fehlt, sodass dein Maul zu einer unbeweglichen Grimasse verzogen ist. Abgesehen von einem flaumigen weißen Bart, der vom Unterkiefer bis zu den ersten Brustwarzen reicht, bist du pechschwarz, so schwarz wie ein Loch im Weltall.
Eine Woche ist vergangen. Es ist wieder Dienstag, Zeit für meine dienstägliche Fahrt in die Stadt.