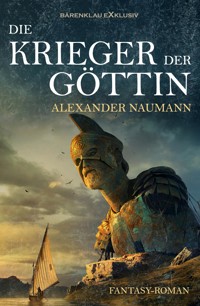
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Schreckliche Dinge passieren in Paraskion.
Um ihre Heimatstadt aus der Gewaltherrschaft des Stierkönigs und dessen wilden Satyrn zu befreien, suchen der Mechanikus Sikulus und der Krieger Theomedes nach dem »Atem der Palladaia«. Dieser Odem gab dem Menschen einst Verstand und Sprache. Doch diesmal soll er eine mechanische Armee für den Kampf gegen den Stierkönig und dessen Schergen beleben. Nicht nur das Schicksal von Paraskion steht auf dem Spiel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Alexander Naumann
Die Krieger der Göttin
Fantasy-Roman
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Vladimir Manyukhin mit Kathrin Peschel, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Krieger der Göttin
Kapitel 1 – Der Kampf um Eukion
Kapitel 2 – Die Reise des Narndak
Kapitel 3 – Rückkehr nach Paraskion
Kapitel 4 – Der Atem der Palladaia
Kapitel 5 – Automaton
Kapitel 6 – Die Insel Chrysos
Kapitel 7 – Im Labyrinth
Kapitel 8 – Angeklagt
Kapitel 9 – Der Beginn einer Reise
Kapitel 10 – Atalena, die Jägerin
Kapitel 11 – Die Küsten der Agros-Bucht
Kapitel 12 – Der Verfluchte
Kapitel 13 – Die Rätseleule
Kapitel 14 – Der Schrecken
Kapitel 15 – Der Mann aus Metall
Kapitel 16 – Atalenas Begegnung
Kapitel 17 – die Rückkehr nach Paraskion
Kapitel 18 – Das Erwachen
Kapitel 19 – Aufstand
Kapitel 20 – Paraskion im Krieg
Kapitel 21 – Duell im Palast
Kapitel 22 – Zurück im Labyrinth
Epilog
Der Autor Alexander Naumann
Weitere Werke des Autors sind bereits erhältlich oder befinden Sich in Vorbereitung
Das Buch
Schreckliche Dinge passieren in Paraskion.
Um ihre Heimatstadt aus der Gewaltherrschaft des Stierkönigs und dessen wilden Satyrn zu befreien, suchen der Mechanikus Sikulus und der Krieger Theomedes nach dem „Atem der Palladaia“. Dieser Odem gab dem Menschen einst Verstand und Sprache. Doch diesmal soll er eine mechanische Armee für den Kampf gegen den Stierkönig und dessen Schergen beleben. Nicht nur das Schicksal von Paraskion steht auf dem Spiel …
***
Die Krieger der Göttin
Fantasy-Roman
Kapitel 1 – Der Kampf um Eukion
Theomedes schaute auf die Mauern von Eukion. Der weiße Stein ragte bis zu fünf Metern in die Höhe und umhüllte die gesamte Stadt. Mächtige Mauern, deren Standhaftigkeit Eukion vor vielen Feinden bewahrt hatte. Hinter ihnen erhob sich Eukions Oberstadt einem Hügel, mitsamt seinem Tempel, dem Palast und anderen prächtigen Gebäuden, deren Zweck Theomedes unbekannt war.
Vermutlich blieben nach dem heutigen Tag nur noch Ruinen übrig. Er nahm die Augen von der Stadt und blickte auf das merkwürdige Kriegsgerät: Bronzene Rohre, die in brennenden Öfen steckten und mit ihren Öffnungen auf die Mauern zielten. Um die Öfen anzutreiben, hatten sie eine weite Fläche vor der Stadt abgeholzt. Danach entledigten sie sich ihrer Kleidung, schaufelten das Holz in die Öfen und schwitzten neben der Glut.
Theomedes wusste nicht, ob die Bewohner von Eukion diese Waffen bereits gesehen, ihre zerstörerische Wucht schon zu spüren bekommen hatten. Sie ahnten nicht, dass ihre Mauern bald wie von einem Donnerschlag getroffen niedergerissen würden.
Sikulus nannte sie »Dampfkanonen«. Der Mechanikus, der von manchen für ein Genie gehalten wurde, rannte zwischen diesen Kanonen hin und her und inspizierte die mittlerweile glühenden Bronzekessel. Gelegentlich sprach er mit einigen der Männer, welche daraufhin bronzene Kugeln in die Münder der Rohre hievten und die Öffnungen mit Lehm verstopften.
Theomedes setzte sich seinen Helm auf. Er war damals dabei, als Sikulus die Kanonen dem König vorgeführt hatte, und wusste, welche Lautstärke die Dampfkanonen verursachten. Der Helm würde den Lärm etwas dämpfen.
»Sikulus!«, rief Demetros, einer der Anführer des Heeres. »Wann?!«
Der Tüftler schaute verwirrt zu Demetros hinüber. Auf Theomedes wirkte Sikulus immer so, als wäre er gerade ganz woanders. Nach einigen Sekunden schien er jedoch verstanden zu haben und rief zurück: »Gleich!«
Demetros drehte sich zu Theomedes um und verdrehte die Augen. »Mit Leitern wären wir schon längst auf den Mauern. Was ist, Junge? Du siehst blass aus. Wenn du glaubst, dass die Verteidiger von Eukion verbissen kämpfen werden, dann liegst du wahrscheinlich richtig. Bleib einfach dicht bei mir, dann stehen wir das gemeinsam durch. Und heute Abend speisen wir zwischen den Ruinen ihres Tempels!«
Der alte Demetros klopfte ihm auf die Schulter und setzte dann ebenfalls seinen Helm auf. Theomedes musste sich eingestehen, dass ihm vor dem bevorstehenden Kampf tatsächlich bange war. Es war nicht sein erster Kampf, denn zwischen den Reihen seiner Brüder und Freunde hatte er schon mehrmals dem Feinde die Stirn geboten. Doch wenn sich dem Feind keine Flucht mehr bot, erfüllt sie die Verzweiflung mit neuer Kraft.
Die Kessel glühten mittlerweile so sehr, als würde die Hitze sie bald zum Bersten bringen. Dennoch schaufelten die Männer unaufhörlich weiter. Der nächste Schritt bestand darin, von oben über ein Ventil Wasser in die glühenden Kessel fließen zu lassen. Das Ventil hielt das Wasser bis zum letzten Moment zurück. Auf einen Befehl von Sikulus hin öffneten sie die Ventile, das Wasser strömte hinein und verdampfte augenblicklich. Ein Knall und die Kugeln schossen aus den Dampfkanonen heraus. Das Unglück geschah: Ein paar der Dampfkanonen zersprangen und die Schaufler schrien auf, als der siedende Dampf herausschoss.
Mehrere hundert Meter entfernt erschütterten die Geschosse die Mauern von Eukion. Doch noch schienen sie standzuhalten.
»Kümmert euch um die Verletzten!«, rief Demetros. »Die anderen Kanonen sollen weiterschießen!«
Und so ging die Arbeit weiter. Sie beheizten Kessel um Kessel, beluden sie erneut mit Geschossen und ließen sie abermals auf die Mauern von Eukion prallen. Brocken lösten sich von der Mauer, während sich die Kanonen auf bestimmte Stellen einzuschießen begann. Immer wieder ließ Sikulus die Kanonen neu ausrichten, während ihnen die Zahl der Dampfkanonen schwand, nachdem der Druck weitere zerrissen hatte.
Theomedes hörte ein Sirren in den Ohren und fürchtete schon, dass es niemals mehr fortgehen würde.
Für Minuten, die sich wie Ewigkeiten anfühlten, schlugen die Dampfkanonen auf die Mauer ein wie der Schlägel auf die Trommel. Doch letztlich gab das Bauwerk nach. Unter dem Jubel des Heeres bildete sich eine offene Wunde im Leib der Stadt. Demetros befahl, die Kanonen kühlen zu lassen und kein Holz mehr hinein zu schütten.
Die Zeit des Sturmes war gekommen. Ihr König Nekarios fuhr auf einem Wagen vor das Heer. Vier Pferde mussten das Gefährt ziehen, denn Nekarios war kein normaler König. Er war von riesiger Gestalt, von der Hüfte aufwärts stark behaart und statt des Kopfes eines Menschen war da ein Stierkopf, samt Maul, Nüstern und langen, spitzen Hörnern. Sein Oberkörper war mit bronzenen Platten geschützt. Mit einer grünlich schimmernden Axt zeigte er auf die Breche in der Mauer.
Dieser Stiermensch war ihr König. Und so sehr Nekarios auch Abscheu und Entsetzen bei unvorbereiteten Gemütern hervorrief, so war er es doch, der sie zum Sieg führte. Ihr König stieg vom Wagen und sprach mit tiefer, kehliger Stimme: »Das ist unsere Beute! Lange Kriege haben wir miteinander geführt, unzählige Männer erschlagen und den Boden gemeinsam mit unserem Blut getränkt. Doch heute steht unsere Beute schutzlos da, eine empfindliche Wunde haben wir ihr mit Metall und Dampf zugefügt. Waidwund haben wir Eukion geschossen, wir müssen es uns nur noch packen, ausweiden und uns an ihr laben!«
Die Soldaten stimmten mit einem Kriegsschrei zu und formierten sich. Auch Theomedes reihte sich ein, dicht neben Männern, deren Namen er nicht kennen mochte, auf die er sich dennoch verlassen konnte.
»Heute ist ein Bluttag«, sprach der Stiermensch Nekarios weiter. »Und ich bin hungrig. Holen wir uns, was von Eukion noch zu kriegen ist!«
Nekarios setzte sich in Bewegung und das Heer folgte. Es verwandelte sich in eine Welle, dessen Sogkraft sich Theomedes nicht entziehen konnte. Gegen diese Naturgewalt anzukämpfen war zwecklos; mitsamt all den anderen Soldaten würde er gegen die Verteidigung auf der anderen Seite der Mauer branden und immerfort gegen deren Schilde schlagen. Bis auch diese letzte Verteidigung von Eukion brach.
Schon sah Theomedes die Soldaten auf der anderen Seite, Schild an Schild, die Speere auf sie gerichtet. Verzweiflung und Mut stand in ihren Gesichtern geschrieben. Nekarios setzte zu einem Sprint an und das Heer tat es ihm gleich. Das Herz schlug Theomedes bis zum Hals, Schild und Speer wogen schwer in den Händen.
Der Stiermensch stürzte sich in den Speerwall, brach Schäfte und begrub Leiber unter sich. Auch sein Heer krachte gegen ihre Schilde, quetschte sich durch die Bresche, stieg über Steinhaufen und über die Gefallenen. Mechanisch stieß Theomedes’ Speer nach vorne, immer wieder über die Schultern seiner Kameraden hinweg. Er wurde an der Schulter getroffen und spürte doch keinen Schmerz. Ständig hörte er Demetros »Weiter, nach vorne!« wiederholen, während sich der Druck von hinten erhöhte und vor ihm die Eukioner zugrunde gingen.
Heute war Bluttag.
*
Stunden später neigte sich die Sonne über die brennenden Ruinen von Eukion. Theomedes sank erschöpft auf den Boden und besah zum ersten Mal seine Wunde. Der Schnitt war nicht tief, hatte jedoch stark geblutet. Er überlegte, sich aus der Stadt zurückzuziehen und im Lager mit frischem Wasser die Wunde auszuwaschen. Hier gab es für ihn nichts mehr zu tun – Lust am Plündern hatte er keine. Bedächtig erhob er sich. Demetros kam mit ein paar Begleitern auf ihn zu. Auch ihn hatte die Schlacht gezeichnet: Der alte Heerführer trug seinen verbeulten Helm unter dem Arm und Blut tropfte ihm oberhalb der Augenbraue über das Gesicht.
»Mein Herr«, sprach Theomedes. »Ihr seid verletzt?«
Demetros tippte sich auf die Stirn. »Ein Stein. Verdammte Schleudern. Und was ist mit dir, mein Junge? Lass mich mal die Wunde anschauen.«
Demetros packte ihn an der Schulter und schloss schnell: »Nicht tief. Wir haben etwas Verbandsmaterial und Wasser.« Er deutete auf einen Mann: »Du.«
Und schon stand einer der Männer bereit, ihm die Wunde mit einem Wasser auszuwaschen und sie daraufhin zu verbinden. Theomedes fragte nach etwas zu trinken, bekam sogleich etwas zu trinken und bedankte sich. Dann packte ihn Demetros abermals.
»Endlich liegt das verdammte Eukion in Trümmern! Aber freut euch nicht zu früh, bald kehren sie wieder heim und bauen die Stadt erneut auf. Es wird wieder Krieg geben, den gibt es immer. Doch heute wollen wir unseren Sieg feiern! Theomedes, du hast dich tapfer geschlagen. Was man sich von dir erzählt, könnte der Wahrheit entsprechen! Jedenfalls kommst du ganz nach deinem Vater, mit dem ich ebenfalls Seite an Seite gekämpft habe. Sag, hast du den König gesehen?«
Das letzte Mal, als Theomedes den Stiermenschen gesehen hatte, den sie als König bezeichneten, hatte der sich gleich mehrere Tote auf seinen Wagen gepackt und war damit weiter in die Stadt gefahren. Nekarios war mit seinem Wagen durch die Stadtmauer gefahren, nachdem sie die Tore von innen geöffnet hatten.
»Ich glaube, er war in diese Richtung gefahren …«
»Geh zu ihm und sage ihm, dass wir bis zur Dämmerung die Stadt plündern werden. Dann ziehen wir uns vor den Mauern zurück.«
Innerhalb dieser Ruinen nach dem König Nekarios zu suchen, gefiel ihm eigentlich nicht, doch Theomedes wollte gehorchen und nickte einfach. Demetros lächelte ihn daraufhin an und zog mit seinen Männern ab.
Theomedes nahm an, dass Nekarios die Hauptstraße in die Stadt genommen hatte, denn die anderen Wege waren zu schmal für seinen übergroßen Wagen. Er folgte der breiten, gepflasterten Straße, schritt vorbei an rauchenden Ruinen und umgestürzten Säulen, welche einst den Weg hinab ins Zentrum säumten, nun aber von seinen Kameraden in blinder Wut umgestürzt wurden. Auf ihnen standen einst Statuen von großen Männern und Frauen, Helden und Göttern; ihre Überreste lagen verstreut auf der Straße. Er erkannte einzelne Füße, Hände, den Torso einer Frau, den behelmten Kopf eines Mannes, welcher wohl einen Krieger darstellen sollte, steinerne Speere und Schilde.
Zwei Männer kamen lachend mit einer Truhe aus einem Haus gerannt. Auf seinem Weg durch die Stadt kamen ihm weitere Plünderer entgegen, mit Stoffen auf den Schultern oder die Arme voll mit Kelchen, Tellern und Krügen aus Bronze, Silber oder gar Gold. Schreiende Kinder wurden, an Haaren oder den Armen gepackt, an ihm vorbeigezerrt. Wer noch am Leben und nicht längst geflohen war, der fand sich in der Sklaverei wieder.
Feuer legten sie dort, wo sie glauben mussten, schon alles geplündert zu haben. Dass von der Stadt nichts weiter als Schutt und Asche übrigbleiben sollte, war bereits vor der Schlacht beschlossene Sache gewesen. Die Eukioner hatten es mit Theomedes’ Heimat nicht anders gehalten. Von Weitem konnte Theomedes den Tempel brennen sehen. Das Heiligtum leuchtete weithin für alle sichtbar. Bald würden die Flammen den Tempel verschlungen haben und nur noch einen rauchenden Haufen übriglassen.
Schließlich fand er den König. Sein Wagen stand neben einer Villa mit einem Garten und das hölzerne Tor zum Anwesen war zerstört. Sicherlich mit der Axt des Königs, wobei es Theomedes auch nicht verwundert hätte, wenn der Stiermensch das Tor mit seinen bloßen, behaarten Händen auseinandergerissen hätte.
Vorsichtig betrat er den Hof. Sogleich hörte er, dass er hier in der Tat richtig war: Ein lautes Schmatzen drang aus dem Garten. Nekarios saß, umringt von toten Eukionern, im Schatten eines Baumes, zwischen Beeten und neben einem kleinen Teich.
Der Stiermensch zerstörte dieses idyllische Bild, indem er mit beiden Händen einen Eukioner gepackt hatte und sich an seinem Leib labte. Nekarios hatte den Rücken zu ihm gewandt und schien seine Anwesenheit nicht bemerkt zu haben.
Theomedes wollte etwas sagen, musste aber zuerst seine Übelkeit herunterwürgen, die ihm aus dem Bauch den Hals nach oben zu kriechen drohte. Eigentlich hatte Theomedes geglaubt sich längst an den Umstand gewöhnt zu haben, dass ihr König ein Menschenfresser war. Doch es mit den eigenen Augen zu sehen …
»Mein König.«
Ruckartig wandte sich der Stierkopf zu ihm und spießte ihn mit gierigen Augen auf. Vom Maul tropfte Blut herab. Es spritzte aufs Gras, als er sprach: »Was?!«
»Der Heerführer … Demetros schickt Euch Kunde. Er will die Männer noch bis zur Dämmerung plündern lassen …« Theomedes spürte, dass er sich gleich erbrechen würde. »Danach werden sie sich vor die Mauer zurückziehen.«
Das Bestienhafte wich langsam aus den Augen des Stiermenschen, klarer Verstand kehrte ein. Nekarios wischte sich das Blut vom Maul. »Gut. Du darfst gehen, Theomedes.«
Dass Nekarios seinen Namen nannte, gab ihm den Rest. Theomedes versuchte es nicht wie eine Flucht aussehen zu lassen, als der Stiermensch sich wieder den toten Eukionern zuwandte und seine Zähne ins Fleisch stieß. Außerhalb des Anwesens übergab sich Theomedes schließlich an der Mauer, noch immer den Geruch des Blutes in der Nase und das Schmatzen des Königs im Ohr.
*
Auf schwachen Beinen, mit verkrampftem Magen und durstiger Kehle machte sich Theomedes auf den Weg aus Eukion. Sein Ziel war das Lager, aber wenigstens erst einmal weg von Nekarios und seinem Mahl. Das Heer zog sich langsam aus der Stadt zurück, nur noch vereinzelt traten ihm Plünderer entgegen. Über Nacht würden die Feuer von Eukion verlöschen und sich eine gespenstische Stille über die Ruinen legen.
Da traf er ein ihm bekanntes Gesicht: Irgendwie hatte Sikulus es geschafft, auf ein Haus zu steigen. Der Tüftler schaute mit blassem Gesicht auf das, was von der Stadt noch übriggeblieben war. Er war in einen Harnisch gekleidet und trug auf seinem Kopf den Helm mit dem Federbusch, neben ihm lagen ein breiter Schild und ein Speer. Aber auf Theomedes machte der Wirrkopf nicht den Eindruck eines Kriegers. Der Harnisch war ihm zu groß, der schlanke Leib füllte ihn kaum aus und der Helm saß schief. Sikulus selbst schien gänzlich unverletzt zu sein. Gewiss hatten sie ihn genötigt, sich in die Schlachtordnung einzureihen, aber nicht erwartet, dass er seinen Mann stehen würde, und ihn deshalb in die hintersten Reihen gepackt.
Da bemerkte Sikulus ihn und hob die Hand. »Theomedes. Ihr seht nicht gut aus.«
Das musste der gerade sagen. Doch dann fiel ihm ein, dass er eben erst sein letztes Mahl ausgespien hatte und wahrscheinlich nicht weniger blass war als der Mechanikus.
»Ihr auch nicht, wenn ich das so anmerken darf. Was macht Ihr dort oben?«
»Ich schaue mir die Stadt an, bevor das Feuer sie ganz verschlungen hat. Eukion soll einst eine schöne Stadt gewesen sein.«
»Vielleicht wird sie das wieder«, antwortete Theomedes. »Und dann kommen wir wieder, um sie erneut niederzureißen.«
Er versuchte dabei grimmig dreinzublicken, doch Sikulus erwiderte die Herausforderung nur mit ausdruckslosen Augen. Die Stille, welche sich zwischen den beiden ausbreitete, wurde durch ein jähes Schreien und Kreischen aus der Luft unterbrochen. Beide richteten den Blick in nach oben.
Sikulus verzog das Gesicht: »Die Harpyien kommen.«
»Und sie werden sich an dem satt essen, was Nekarios ihnen übriggelassen hat. Ich werde aus der Stadt verschwinden und Euch würde ich dasselbe raten. In ihrem Hunger unterscheiden sie vielleicht nicht zwischen Freund und Feind.«
»Werden wir die Toten also wieder nicht bestatten, so wie es eigentlich Brauch ist?«
»Nur, wenn Nekarios es will.« Mit diesen Worten wandte sich Theomedes ab und verließ die Stadt, so schnell er konnte.
Kapitel 2 – Die Reise des Narndak
Sikulus schaute Theomedes noch eine Weile hinterher und dann zum Himmel hoch. Bilder, wie die Harpyien sich nach früheren Schlachten am Fleisch der Gefallenen satt aßen, stiegen in ihm auf. Nekarios war ein grausamer Sieger und so konnte es vorkommen, dass der Stierkönig den Toten keine angemessene Beisetzung angedeihen ließ und sich stattdessen diese Vogelbiester über sie hermachen durften.
Die Bibliothek! Sikulus war aufgesprungen. Er hatte sich gerade daran erinnert, warum er überhaupt in der Stadt geblieben war, nachdem sie die Schlacht gewonnen hatten. Normalerweise hätte ihn nichts mehr hier gehalten, doch er wollte noch die Bibliothek von Eukion aufsuchen und einige wertvolle Schriften retten. Insbesondere hatte er es auf ein bestimmtes Werk abgesehen, von dem es nur noch wenige Exemplare geben sollte. Doch dann hatte ihn das Bild der untergehenden Stadt übermannt und er konnte nicht anders, als vom Dach aus einen letzten Blick auf Eukions Überreste zu werfen.
Speer und Schild ließ er auf dem Dach liegen, sie waren ihm nicht wichtig. Stattdessen hob er die fragile Windbüchse auf, dieses technische Wunderwerk, das er mit seinem erfinderischen Geist geschaffen hatte. Mit der Waffe eilte er das Gebäude hinunter, drehte sich dann zur Straße und lief in die entgegengesetzte Richtung, in welche Theomedes die Stadt verließ. Soweit er wusste, befand sich die Bibliothek auf halbem Wege zwischen dem Marktplatz und dem Tempel. Vor dem Einbruch der Nacht sollte er es bis zur Bibliothek schaffen und genügend Schriften sammeln können, doch musste er auch wieder aus der Stadt heraus … Vielleicht sollte er sich an den Gedanken gewöhnen, sein Nachtlager zwischen Schriftrollen und Papyrus aufzuschlagen. Für ihn, der Wissen und Schriften liebte, eigentlich ein schöner Gedanke.
Die Flügelschläge und das Gekreische der Harpyien drangen lauter an sein Ohr. Sikulus beeilte sich, geriet jedoch schnell außer Atem. Das war wohl einer der wenigen Momente, in denen er sich verfluchte, nicht über die Konstitution seiner Landsleute zu verfügen. Endlich erreichte er den Marktplatz. Er neigte sich zu Boden und holte erst einmal tief Luft. Der Marktplatz war wie leergefegt, eine breite, offene Fläche und in der Mitte der Sockel, gesäumt von den Überresten der Statue, die einst darauf errichtet war.
»Die Bibliothek …«, sprach er zu sich selbst und drehte sich auf der Stelle. Mehrere große Gebäude waren mit einem Portikus zum Marktplatz hin erbaut, die Säulen und das Gebälk mit leuchtenden Farben bemalt. Sie alle machten den Eindruck wichtiger städtischer Einrichtungen. Dann klatschte Sikulus in die Hände und rief: »Beim heiligen Somokles!«
Die Statue des göttlichen Gelehrten Somokles hatte den Kampf überraschend gut überstanden. Zirkel und Schriftrolle waren deutlich zu erkennen, der kahle Kopf und lange Bart ließen ihn wie den weisen Mann aussehen, der er zu Lebzeiten gewesen sein musste. Seine Statue war direkt vor einem der Gebäude errichtet, woraus sich sofort schließen ließ, dass es sich um einen Hort des Lernens handeln musste. Sikulus schöpfte sogleich neue Kraft und hielt auf den Eingang zu. Im Vorbeigehen küsste er sich auf die Finger und drückte sie auf den Sockel von Somokles’ Statue.
Sikulus hätte sich ein Licht mitbringen sollen. Das Innere war nur schwach erleuchtet, seine Augen mussten sich erst an das Halbdunkel gewöhnen. Doch sogleich erkannte er an den unzähligen Schriftrollen, dass es sich hierbei um die gesuchte Bibliothek handelte. Die Regale waren umgeworfen, der Papyrus lag überall verstreut. Sicherlich hatten die Soldaten auch diesen Ort nach wertvollen Schätzen durchsucht, doch in ihrer Oberflächlichkeit den größten Schatz – das Wissen – links liegen gelassen.
Sikulus beugte sich hinunter und hob eine der Schriftrollen auf. Er musste die Buchstaben nahe ans Gesicht halten, um sie genauer lesen zu können.
»Das Problem der Würfelverdopplung und die Lösung durch die Kurve des Alchios …«, las er laut vor. »Ein alter Hut.« Dann ließ er die Schriftrolle fallen. Das Problem war ihm wohlbekannt.
Er hob die nächste auf. »Die Handlichen Tabellen des Parthemedes. Habe ich schon.« Aus Respekt vor diesen mathematischen Tabellen, welche er oft zur Hand genommen hatte, legte er die Schriftrolle wieder sorgsam zu Boden.
So kam er nicht weiter. Er konnte nicht jedes Werk vom Boden aufheben und erwarten, irgendwann etwas Interessantes zu finden. Etwas, das es wert war, vor der etwaigen Zerstörung gerettet zu werden. Er watete durch das Papyrus-Meer und versuchte an den Regalen zu erkennen, wie die Schriften angeordnet waren. Sicherlich hatten die Eukioner ein System und so ganz durcheinander dürften die Schriften auch nicht gekommen sein, eine Rolle dürfte unweit ihres vormaligen Lagerplatzes liegen. Anscheinend befand er sich hier im Bereich der Mathematik. Normalerweise sein liebstes Fach, dem er die meiste Aufmerksamkeit widmen würde. Doch suchte er nach etwas anderem.
»Narndak!«, rief er den fremdartigen Namen des Autors, von dem er gehört hatte, dass hier eine seiner seltenen Werke aufbewahrt wurde. Da es sich um einen Reisebericht handelte, sollte sie sich im Bereich Geographie befinden.
Sikulus hob Schriftrolle um Schriftrolle auf und versuchte, sich von Bereich zu Bereich vorzuarbeiten.
»Die weisen Lehren des Paojian. Nein. Von der Anatomie des Menschen. Kenne ich auch schon. Geist und Herz – Das Strömen des Lebens. Humbug. Alles ist Licht – die Güte der Sonne … Verfasser unbekannt, das nehme ich mal lieber mit. Die Tierwelt hinter östlich des Drachenwirbels. Sehr interessant.«
So kam es, dass Sikulus mehr und mehr Schriftrollen mit sich herumtrug und bald kaum noch in der Lage war, einen seiner Arme freizumachen, um eine weitere vom Boden aufzuheben. Doch schließlich schien er sich zum Bereich der Geographie durchgekämpft zu haben. Er schob einige Rollen zur Seite und machte Platz für seinen eigenen Stapel. Wie viel Zeit er bereits damit verbracht hatte, diese Werke anzuhäufen. Er musste sich auf die Suche nach Narndaks Werk konzentrieren.
Sikulus merkte kaum, wie es in der Bibliothek immer dunkler wurde, als er eine Schriftrolle nach der anderen in Augenschein nahm und mit zusammengekniffenen Augen versuchte, Titel und Autor zu lesen. Unter all dem Papyrus befand sich ein in Tuch gewickelter Gegenstand. Zuerst hatte er ihn ignoriert, kam dann jedoch auf die Idee, dass sich unter dem Stoff genau das befinden könnte, was er suchte. Vorsichtig enthüllte er den Stoff, bis er der zusammengerollten Schrift im Inneren gewahr wurde. Sogleich wurde offensichtlich, warum sie in dieses Tuch gehüllt war: Der Papyrus war bereits löchrig und zur Gänze vergilbt. Die Seiten waren nicht zu einer Buchrolle zusammengefügt, sondern lagen lose aufeinander. Mit den Fingerspitzen nahm Sikulus die erste Seite auf und hielt sie nahe ans Gesicht.
»Die Lange Fahrt des Narndak …«, las er. »Ich hab’s gefunden!«
In seinen Jubel mischte sich ein Schrei. Jemand stieß sich an Regalen, fiel auf die Schriftrollen, schrie erneut auf und kämpfte sich durch das Schriftenmeer. Papyrusseiten und Rollen flogen umher. Sikulus packte die Seite wieder ins Tuch und nahm darauf seine Windbüchse zur Hand. Er fragte sich, warum diese Person so einen Lärm veranstalte, bis er den Flügelschlag hörte.
Dann kreischte die Harpyie laut auf, ein schauerliches Geräusch, das dem einer menschlichen Frau zu ähneln versuchte, doch dem eines Monstrums näher kam. Sikulus wagte einen Blick ins Innere der Bibliothek und sah, wie die Harpyie mit ihren riesigen Klauen über die Regale stakste. Ihr menschliches Antlitz folgte den Bewegungen des Mannes, welcher über die Schriftrollen stolperte und einen hilfesuchenden Japser nach dem anderen ausstieß. Die obere Hälfte der Harpyie glich der einer jungen Frau, nur Gefieder wuchs ihr über den freien Brüsten und dem Gesicht fehlte die Ausstrahlung eines Menschen, stattdessen steckte in ihrem Blick die Gier und Grausamkeit einer Bestie.
Sikulus schlug das Herz kräftiger und seine Gedanken rasten. Sollte er sich in dieser Ecke der Bibliothek verstecken und warten, bis die Harpyie ihre Klauen in den Mann dort geschlagen und sich an seinem Fleisch satt gegessen hatte?
Er würde hier sitzen und zuhören, wie sich das Biest an dem Leib gütlich tat, womöglich noch während der Mann lebte und um Hilfe schrie …
Er hob seine Windbüchse. Eine Waffe, die er selber konstruiert hatte, getestet und für effektiv befunden. In seinen Händen hielt er ein Mittel, diesen Mann vor der Bestie zu retten, wer auch immer er sein sollte. Er fasste sich ein Herz, betete zu Somokles und sprang aus seiner Deckung.
Dass er dabei auf einer der Schriftrollen ausrutsche und zu Boden fiel, dürfte bestimmt die Harpyie ebenso überrascht haben wie ihr Opfer, was allerdings nicht Sikulus’ Absicht gewesen war. Er rappelte sich auf und hoffte, der Sturz hatte seine empfindliche Waffe nicht beschädigt. Die Windbüchse gab ein beunruhigendes Klacken von sich, während er sie anlegte und auf die Harpyie zielte.
»B-bestie!«, versuchte Sikulus, die Harpyie einzuschüchtern. »Verschwinde, oder ich schieße dir die Federn vom Leib!«
Interessiert hob sie ihren Frauenkopf und blickte ihn eindringlich an. Die Harpyie stelzte nun über den auf dem Boden kauernden Mann hinweg auf Sikulus zu.
Sikulus machte sich bereit, den Rückstoß der Schusswaffe abzufangen. Es klackte, als er den Abzug betätigte. Klack, klack. Aber die Luft presste nicht das Geschoss heraus. Die Harypie kam immer näher, den Mann unter sich vergessend, während Sikulus auf die Mechanik der Windbüchse schlug. Das spärliche Licht fiel auf die Klauen der Harpyie und Sikulus wurde sich ihrer Schärfe und Größe bewusst. Wie Dolche würden sie in ihr Ziel stechen.
Irgendetwas klackte … anders! Das musste es gewesen sein! Erneut legte er die Windbüchse an, betete zu Somokles und betätigte den Abzug.
Der Windstoß riss ihn um und ließ ihn in ein Pergamentbett fallen. Das Gekreische der Harpyie betätigte ihm den Treffer. Als er sich aufrichtete, krümmte sich die Gestalt vor ihm und flatterte wild mit den Flügeln, sodass die Federn durch den ganzen Saal flogen. Sikulus hatte sie im oberen Brustbereich getroffen. Der Schuss war nicht sofort tödlich, dennoch würde die Harpyie verbluten. Der Papyrus um sie herum färbte sich bereits rot.
Neben ihr lag der Mann, der sich wegen des Geschreis die Ohren hielt und gleichzeitig mit großen Augen auf die Waffe in Sikulus’ Händen schaute.
»Du befehligst die Winde …«, bemerkte der Mann schließlich. »Wer bist du? Bist du ein Halbgott?«
»Oh je, nein, natürlich nicht! Das Gekreische …« Er deutete mit dem Lauf der Windbüchse auf die sich windende Harpyie. »Habt Ihr etwas, um …«
»Dem Biest den Garaus zu machen?« Der Mann verstand sofort und zog ein Messer. Jede Furcht schien wie verflogen, als er sich das Mischwesen packte und ihm den gefiederten Hals durchtrennte. Die beiden sahen der Kreatur noch eine Weile dabei zu, wie sie ihren letzten Lebensfunken ausröchelte – der Fremde mit einer Spur von Genugtuung, welche man ihm nicht nachtragen konnte, während Sikulus sich jedoch halb abwenden musste.
Die Harpyie starb und Sikulus erinnerte sich daran, warum er eigentlich hier war.
»Narndak!«, rief er aus. Der Kampf hatte alles durcheinandergebracht, selbst sein sorgsam hergerichteter Haufen an Schriften, die er ebenfalls mit sich nehmen wollte.
»Narndak?«, fragte der Mann. »Ist das Euer Name, mein Herr?«
»Nein! Das ist der Name des Reisenden, dessen Aufzeichnungen ich hier suche. Es ist äußerst wichtig. Bitte helft mir, sie zu finden! Die Notizen sind in ein Tuch gehüllt.«
Wortlos machte sich der Mann an die Arbeit. Gemeinsam wühlten sie sich durch den Wust an Papyrus.
»Mein Herr«, begann der Mann. »Wenn ich fragen darf: Was war das für eine Waffe? War sie verantwortlich für den Windstoß?«
»Das war kein Windstoß«, erklärte Sikulus, während er einige Rollen zur Seite schob. »In den Lauf der Windbüchse, so der Name meiner Erfindung, wird eine Kugel gesteckt. Sie kann aus Eisen oder aus Stein bestehen, was immer man will. In den hinteren Teil der Windbüchse kommt ein Behälter gefüllt mit Pressluft. Wenn ich den Abzug betätige«, er imitierte das stoßartige Austreten der Luft mit den Händen, »dann schießt die Kugel aus dem Lauf mit einer Wucht, die selbst die einer gut geführten Schleuder übersteigt.«
»Ist nicht wahr.«
»Ihr habt es gerade gesehen. Aber das Gerät ist empfindlich, sehr zerbrechlich und … noch nicht ganz ausgereift. Ihr habt vielleicht bemerkt, wie ich mehrmals versuchte, auf die Bestie zu schießen. Ich muss mich wieder an die Werkbank setzen und die Mechanik neu einstellen.«
»Also seid Ihr es, der diese Waffe erfunden hat?«
»Meine Ideen basieren auf den Errungenschaften des göttlichen Somokles, der uns die Kraft von Dampf und Druckluft geschenkt hat. Aber ja, diese Waffe stammt aus meinen Händen. Die Dampfkanonen da draußen wurden jedoch von Somokles erfunden. Die Kanonen vor den Mauern wurden aber unter meiner Anleitung hergestellt und aufgebaut.«
»Da draußen …«, sprach der Mann und seine Miene verfinsterte sich. »Ihr seid nicht aus Eukion, richtig?« Er hörte mit seiner Suche auf und mit stockendem Atem schaute er zu dem Mann.
Was für ein Narr Sikulus doch war! Jeder in seiner Heimat kannte ihn, jedoch kümmerte ihn das nur wenig. Hier allerdings hätte er sich darüber wundern müssen, dass der Fremde ihn nicht kannte. Nur langsam dämmerte es ihm, dass es sich bei dieser Person nicht um einen Landsmann handelte, sondern um einen Bürger von Eukion. Der diese Stadt wahrscheinlich mit seinem Leben verteidigte hatte und gerade noch so davongekommen war. Nach der Schlacht fand er jedoch keinen Frieden, stattdessen jagte ihn eine der Harpyien bis in die Bibliothek.
Der Mann hatte unterdessen Narndaks Notizen gefunden. In seinen Händen hielt er das Tuch. »Ist es das?«, fragte er. Jede Spur von Freundlichkeit und Dankbarkeit in seiner Stimme wich einer scharfen Kälte.
Auch in Sikulus machte sich ein kaltes Gefühl breit, als wiche ihm langsam alles Blut aus den Adern. Zögernd streckte er die Hände nach dem Tuch aus, welches der Mann ihm bereitwillig hinhielt. Sikulus lüftete ein paar Lagen und sah die Notizen darunter. Er hatte, wozu er hergekommen war, sah sich aber nun von dem Mann, einem Feind seines Stadtstaates, in die Ecke gedrängt. Das Messer lag in greifbarer Nähe. Sie schauten es beide an, dann sich gegenseitig in die Augen.
»Ich bin dankbar«, sprach der Mann, »dafür, dass Ihr mich gerettet habt und schulde Euch mein Leben. Wenn Ihr es jedoch seid, der diese schrecklichen Waffen da draußen gebaut und auf Eukion gerichtet habt …« Seine Hand glitt zum Messer. »Dann würde ich der Welt wahrscheinlich einen großen Gefallen tun, würde ich Euch hier umbringen. Und wohl auch viele meiner Landsmänner rächen.«
»Hilft es vielleicht … wenn ich Euch sage, dass ich eigentlich kein Interesse an den Dampfkanonen und anderen Waffen habe? Ich baue die nur, weil ich von unserem König dazu gezwungen werde.«
»Nein, das hilft nicht.«
Pferdehufe, das Rollen von Rädern. Ein Wagen hielt vor der Bibliothek. Etwas Schweres stieg von ihm ab. Sikulus kannte dieses Geräusch nur zu gut.
»Wollt Ihr meinen König treffen?«, fragte er.
Der Mann wurde bleich im Gesicht. »Nekarios, der menschenfressende Stiermensch?«
Sikulus rollte mit den Augen. »Ach, von dem hast du gehört …«
Nekarios schob seinen massigen Körper durch den Eingang der Bibliothek. Er hob die Nüstern schnüffelte.
»Dafür haben wir keine Zeit!«, zischte der Mann leise. »Was soll ich nur tun!«
»Versteckt Euch zwischen den Schriftrollen. Da, in die Ecke!«
Der Mann nickte, warf sich zwischen die Regale und machte sich so klein wie möglich. Sikulus warf Schriftrollen auf ihn, versuchte ihn so gut wie möglich zu begraben. Er gab sich nicht einmal Mühe, dabei irgendwie leise zu sein; Nekarios näherte sich ihm bereits mit mächtigen Schritten.
»Habe ich dich!«, brummte der Stiermensch. »Was ist hier geschehen? Sikulus, bist du das? Ich roch Menschenfleisch und glaubte, einer der Eukioner verstecke sich hier drinnen. Dabei ist es einer meiner eigenen Untertanen. Die anderen haben die Stadt bereits verlasse.«
»Ja, mein König. Ich bin noch auf der Suche nach ein paar brauchbaren Schriften, um neue Waffen zu konstruieren!«
»Und das hier?«, fragte Nekarios und deutete mit seiner Axt auf die Harpyie.
»Ach, das! Ja, ich bin untröstlich, doch hatte mich diese Harpyie angegriffen. Ihr freut Euch sicherlich zu hören, dass meine Windbüchse gut funktioniert hatte.«
Der Stiermensch lachte, es hörte sich eher wie das Blöken eines Rindes an.
»Das werde ich dir nicht übelnehmen, kleiner Erfinder. Ja, wenn die Harpyien hungern, dann vergessen sie manchmal, wer Freund und Feind ist. Zu deinem Glück bin ich bei klarem Verstand! Nun los, Mechanikus, sammle alles zusammen, ich nehme dich auf meinen Wagen mit. Allein schaffst du es wahrscheinlich nicht aus der Stadt.«
Sikulus, froh darüber, dass seine List geglückt war, sprach: »Jawohl!«. Er nahm seine Windbüchse und die Schriften des Narndak auf. Er konnte noch ein paar der Schriftrollen finden, die er sich zuvor zusammengesucht hatte. Die wertvollen Papyri reichten ihm bis zum Kinn, während er sie aus der Bibliothek trug. Draußen wartete Nekarios in seinem breiten Wagen. Sikulus legte seine Beute ab und platzierte sich neben den König. Es war bereits dunkel geworden, nur einzelne Feuer und der Mond erhellten die Straßen, die aus der Stadt führten.
Kapitel 3 – Rückkehr nach Paraskion
Ihre Heimatstadt empfing die Sieger feierlich. Nekarios führte den Zug auf seinem Wagen an. Ihm folgten die von Ochsen gezogenen Dampfkanonen, die nicht vor Eukions Mauern zerbarstet waren, eine Reihe von Sklaven und danach das Heer.
Das Heer zog über die gepflasterte Hauptstraße, zuerst durch das große Haupttor von Paraskion, dann durch die Stadt selbst. Die Menschen kamen aus den Häusern, Kinder drängten aus den Eingängen und selbst die Alten mühten sich hinaus, um mit einem Lächeln die Verteidiger der Stadt zu empfangen. Links und rechts von ihnen kamen immer mehr Menschen zusammen, jubelten, grüßten Freunde und Verwandte, gaben vorbeikommenden Soldaten etwas zu Essen oder zu Trinken. Wer auf der Straße keinen Platz fand, der rief aus dem Fenster oder schaute vom Dach aus zu, wie die Armee zum Zentrum der Stadt zog.
»Theomedes!«, hörte er eine ihm wohlbekannte Stimme, doch er konnte sie nicht sogleich in der Menge ausmachen. »Theomedes! Hier!«
Dann sah er eine Hand, die winkend über den Köpfen der Menschen auf und ab sprang. Er folgte dem Arm und fand im dichten Gedränge das strahlende Gesicht seiner jüngeren Schwester.
»Ephianessa!«, rief er aus und brachte das Heer in Unordnung, als er sich zu ihr durchschlug. Bei ihr angekommen nahm er sie in die Arme und wusste erst einmal nicht, was er sagen sollte. Es war Monate her, dass er sie zuletzt gesehen hatte. Vielleicht war es seine Freude, sie wiederzusehen, oder ihre Freude, die sie strahlender erscheinen ließ, doch sie kam ihm ein Stück hübscher vor, auch wenn sie kaum älter geworden war. Ihren sechzehnten Geburtstag hatte er nun verpasst. Er musste sich etwas einfallen lassen, um das wiedergutzumachen.
»Mutter und Vater sind zu Hause«, sprach sie plötzlich. »Bitte kehre so schnell heim, wie du kannst.«
»Glaub mir, das ist das Erste, was ich vorhabe.«
»Und dir …«, fragte sie, »geht es auch gut? Wurdest du verletzt?«
»Nur leicht«, antwortete Theomedes, »sonst hätte es sich nicht gelohnt.«
Ephianessa nickte, als hätte sie nichts verstanden. »Hast du Sikulus bei seinen Kanonen gesehen?« Sie lachte. »Er versuchte noch nicht einmal zu verbergen, dass er da ganz fehl am Platze war.«
Warum sie das Gespräch auf diesen Wirrkopf lenken wollte, war ihm unverständlich. Beinahe raubte es ihm die gute Laune.
»Ich muss weiter«, sprach er.
»Ich gehe nach Hause«, erwiderte sie, »und sage Mutter und Vater Bescheid. Jeden Morgen und jede Nacht haben sie um dich gebetet. Jetzt kann ich diese Last endlich von ihnen nehmen.«
»Mach dich auf, bevor jemand schneller ist und dir den Spaß vermasselt.«
»Richtig! Aber …« Sie schaute unschlüssig an ihm vorbei. »Ich muss dazu auf die andere Straßenseite.«
Theomedes überlegte kurz und überreichte ihr dann seinen Speer: »Halte das fest.« Anschließend hob er seine kleine Schwester auf die Schulter und brachte das Heer erneut in Unordnung, als er mit ihr auf die andere Seite zu kommen versuchte. Die Soldaten reagierten teils lachend, teils verwundert über das Geschwisterpaar.
Ephianessa schien der Scherz sehr zu gefallen, mit dem stumpfen Ende des Speeres dirigierte sie die Soldaten auseinander.
»Macht Platz, ihr Tapferen von Paraskion und lasst mich auf die andere Straßenseite!«
Gute Erziehung war ihr in Fleisch und Blut übergegangen; sie zupfte an ihrem Rock und hielt die Beine geschlossen. Theomedes war gar nicht in den Sinn gekommen, dass er durch diesen Scherz seine Schwester vielleicht in Verlegenheit gebracht haben könnte.
Ihr Lachen war klar und hell, als er sie auf der anderen Straßenseite wieder absetzte, und ihre Wangen gerötet. Sie händigte ihm seinen Speer aus und hielt sich die Brust.
»Danke Fährmann Theomedes«, sagte sie, »dass Ihr mich über diesen reißenden Fluss gebracht habt. Wir sehen uns dann später!«
Sie nahmen sich nochmals in die Arme. Ephianessa verschwand und Theomedes reihte sich wieder ein. Noch eine Weile trug er das Lächeln mit sich herum.
Nach einigen hundert Metern fühlte er sich beobachtet. Ihm war, als folgte ihm ein Augenpaar in der Menschenmenge. Die meisten blieben auf der Stelle stehen, suchten nach dem einen Freund oder Verwandten, liefen vielleicht ein paar Meter mit. Aber diese eine Person, wenn sich Theomedes nicht täuschte, war ihm jetzt schon seit einer Weile gefolgt. Stets hinter den Jubilierenden verborgen, blitzten die Augen zwischen Köpfen und Schultern immer wieder auf. Theomedes versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Es kam ihm auch in den Sinn, dass er gar nicht das Ziel dieser Bespitzelung war.
Als er glaubte, die Person wäre ihm nun ganz nahe, wandte er ruckartig den Kopf – und versank in die dunklen Augen von Danaea. Das Mädchen stand dort zwischen den anderen Paraskionern, als befände sie sich die ganze Zeit schon dort. Theomedes ließ sich nichts anmerken und deute nicht durch ein wissendes Lächeln an, wie er ihre Verfolgung mitbekommen hatte. Doch noch etwas länger in diese dunklen Augen schauen, das ließ er sich nicht nehmen, bis er den Hals nicht mehr nach ihr wenden konnte und sie aus seinem Blickfeld verschwand.
Schließlich erreichten sie die Agora von Paraskion. Als Erster Nekarios auf seinem Streitwagen; er bog nach links und drehte innerhalb des Platzes eine Runde. Ihm folgten die von den Ochsen gezogenen Dampfkanonen. Die Sklaven führte man weiter, bis sie in den Straßen der Stadt verschwanden. Der Rest des Heeres, welches sich auf dem Platz einfinden konnte, folgte seinem König und befüllte somit nach und nach die Agora. Wer es nicht mehr auf den Platz schaffte, beendete den Triumphzug in der Straße, welche zur Agora führte.
Theomedes befand sich relativ weit vorne und durfte somit auf der Agora Aufstellung nehmen. In der Nähe befanden sich auch die verbliebenen Dampfkanonen, einschließlich Sikulus. Der saß auf einem Ross, etwas steif und äußerst blass. Die Leute munkelten, dass er freie Plätze des öffentlichen Lebens vermied, da er bei großen Menschenansammlungen Panik bekam. Der Heereszug musste ihm nicht gut bekommen sein. Nun war Theomedes doch froh, von seiner Schwester auf den Wirrkopf aufmerksam gemacht worden zu sein. Er bot tatsächlich einen witzigen Anblick.
»Bürger von Paraskion«, sprach Nekarios mit seiner tiefen Tiermenschenstimme. »Eukion liegt in Trümmern!«
Das Volk nahm diese Worte mit Jubel auf.
»Mit Dampf und Stahl besiegten wir den alten Feind von Paraskion erst auf dem Felde und dann schleiften wir dessen Stadt! Die Mauern rissen wir nieder und ein Feuer verschlang den Rest!«
Propaganda. Das Feuer griff nicht auf die gesamte Stadt über, zerstörte nur Teile von Eukion. Wer an den Kämpfen teilgenommen hatte, wusste das. In diesem Moment mochte es egal gewesen sein. Diese Worte klangen ruhmvoller und nach Genugtuung.
»Endlich, nach Jahrzehnten, ist der Befreiungskampf abgeschlossen. Als Paraskion noch ein kleines Dorf war, knechtete die Feindstadt es, behandelte das Volk wie Untertanen. Kein freies Volk war Paraskion damals. Doch dann habt ihr mich zu eurem König erwählt und gemeinsam trutzten wir der Fremdherrschaft.«
Das war eine dieser Ansprachen, bei der sich der König selbst legitimierte. Doch konnte Theomedes dem Stiermensch nicht absprechen, dass sein Auftreten sehr zur Unabhängigkeit von Paraskion beigetragen hatte.
»Aus dem Dorf wurde eine Stadt mit einem eigenen Heer, voll mit mutigen und tugendhaften Menschen. Mit blutigem Kampf, neuen Technologien und meiner Kraft hatten wir uns die Freiheit erkämpft. Nun, da wir Eukion dem Feuer übergeben haben, haben wir unsere Unabhängigkeit besiegelt. Das Volk von Paraskion ist frei!«
Erneuter Jubel. Wie eine Woge brauste es durch Theomedes’ Körper. Er musste sich eingestehen, mit allzu geschwellter Brust in diesem Jubelschwall zu baden. Auch er war an diesem Befreiungskampf beteiligt gewesen, wenn auch wegen seiner Jugend nur in den letzten Phasen. Doch er warf sein Leben in die Bresche und sein Speer kostete Blut.
»Darum sei versichert, Volk von Paraskion«, endigte der Stiermensch. »Solange ich euer König bin, braucht ihr keinen Feind zu fürchten!«
Theomedes schaute zu Nekarios hinüber. Er mochte mit diesen Worten recht gehabt haben. Nekarios brachte ihnen den Sieg und die Sicherheit vor äußeren Feinden. Doch wusste Theomedes so gut wie jeder andere Bürger dieser Stadt, dass er sich gerne am Menschenfleisch gütlich tat. Und wenn es keine Feinde zu fressen gab, wie jene Soldaten in Eukion, dann musste eben die eigene Bevölkerung herhalten. Bald würde es wieder so weit sein …
*
Theomedes’ Elternhaus befand sich weit von der Agora entfernt, auf einem Hügel gelegen, auf dem sich die vermögenden und angesehenen Familien von Paraskion angesiedelt haben. Die dichtgedrängten Häuser der Stadt wichen hier weitläufigen Villen. Er folgte zielstrebig der Straße und grüßte hin und wieder Bürger, sobald sie freundlich das Wort an ihn richteten. Theomedes trug noch immer seinen Harnisch, den Helm hatte er abgenommen und unter den Arm geklemmt. Seinen Schild hatte er sich auf den Rücken geschnallt, der Speer ruhte lässig auf seiner Schulter. Von Weitem erkannten die Bürger ihn als einen heimgekehrten Krieger und Theomedes versuchte auch gar nicht, einen anderen Eindruck zu vermitteln. Mit der Zeit wich der Stolz und machte einem freudigen Herzschlag Platz. Er kam seinem Elternhaus immer näher.
Schließlich stand er vor dem Eingang zum Hause. Er lehnte den Speer gegen die Mauer und klopfte mehrmals kräftig an die Tür. Sofort wurde ihm aufgemacht, der Diener musste gewartet haben.
»Der junge Herr ist zurück«, bemerkte der ältere Diener.
Theomedes nahm es ihm nicht übel, dass der Bedienstete nicht so erfreut wirkte. Sein Kommen war bestimmt bereits von Ephianessa angekündigt worden. Er trat ein, unterließ es aber, dem ihm seinen Speer und den Helm zu übergeben. Die wollte Theomedes seinem Vater selber überreichen.
»Dolethos, gut dich zu sehen. Sind mein Herr Vater und die ehrenwerte Mutter zugegen?«
»Gewiss«, antwortete der Diener. »Sie warten bereits auf Euch im Hof.«
»Dann ist meine Schwester schon hier?«
»Ephianessa hat mich hierhergestellt.«
»Verstehe.«
Theomedes trat durch den Eingang ins Innere des Anwesens. Der Weg zum zentralen Säulenhof führte ihn durch einen länglichen Nebenraum. Seine Freude war groß, sich stolz seinen Eltern präsentieren zu können, doch versuchte er mit Würde in den offenen Hof zu treten.
Sein alter Vater saß dort auf einem Stuhl, seine Mutter und Schwester Ephianessa auf Hockern neben ihm. Auf diese Art beliebten seine Eltern hohe Gäste zu empfangen; entweder um gleich hier etwas zu besprechen oder um anschließend die Versammlung in einen anderen Raum zu geleiten.
Auf dem mit kunstvollen Voluten geschmückten Stuhl lag ein purpurnes Kissen, über die Hocker seiner Mutter und Schwester waren feine, blaue Tücher gebreitet.
Menenias, der Herr und momentane Stammhalter dieses hohen Hauses, erwartete seinen einzigen Sohn mit auf den Oberschenkeln ruhenden Händen und mit leicht nach vorne geneigtem Oberkörper. Sein Haupthaar war bereits ergraut, nur der lange Bart trug noch einen goldenen Schimmer, welcher ihn von den zumeist dunkelhaarigen Bürgern von Paraskion unterschied. Auch seine Kinder hatten die hellen Haare geerbt. Seine Mutter hingegen hörte sich das Getuschel ihrer Tochter stumm an, während sie die Freudentränen kaum verhehlen konnte.
»Vater, Mutter, ich bin heimgekehrt.«
Menenias erhob sich. »Das bist du in der Tat, mein Sohn. Siegreich bist du heimgekehrt und was noch wichtiger ist: wohlbehalten.«
Sein Vater besah ihn von unten nach oben. »Noch alles dran, wenn mich meine alten Augen nicht trügen. Und die Wunde an der Schulter verheilt gut?«
»Soweit keine Schwierigkeiten«, antwortete Theomedes. »Die Stelle wurde genäht, mit Salben eingerieben und von fähigen Händen verbunden.«
Menenias nickte, fasste seinen Sohn an die andere Schulter und sprach: »Schön, dass du wieder zu Hause bist.« Dann nahm er Theomedes in den Arm.
Das war das Zeichen dafür, dass auch seine Mutter sich erheben durfte und ihn ebenfalls unter Tränen begrüßte. Hethemesia begrub ihn unter Küssen, die sich für Theomedes als heimgekehrten Krieger nicht ganz ziemten. Doch wer war er, seiner Mutter diese Liebesbezeugungen abzusprechen? Auch seine Schwester machte munter mit, aber mehr zum Spaß und um ihn etwas zu ärgern.
»Jetzt ist genug«, sprach Menenias, jedoch ohne Strenge in der Stimme. »Theomedes ist bestimmt noch müde von dem Marsch, oder? Ihr seid doch gerade erst angekommen. Wenn du willst, kannst du dich im Garten oder auf einer der Klinen (Liegebank) ausruhen, bis das Mittagessen bereitsteht. Und heute Abend feiern wir ein Fest.«
»Ich denke«, sprach Theomedes, nachdem seine Mutter von ihm abgelassen hatte, »heute feiert die ganze Stadt.«
»Wir haben jedoch Gäste geladen«, meinte daraufhin seine Mutter. »Aber jetzt, da du hier bist, wird der Kreis noch größer werden. Sollten wir nicht auch etwas den Göttern opfern?«
»Ich werde selber für eine Ziege zahlen«, sagte Theomedes. »Ich bin ihnen genauso dankbar wie Palladaia, gesund zurückgekommen zu sein.«
»Wir teilen sie uns«, schloss Menenias. Widerworte waren unangebracht.
*
Theomedes und sein Vater gingen gemeinsam auf den Markt und unterhielten sich währenddessen über die vergangenen Kämpfe. Er erzählte seinem Vater alles, was der wissen wollte, auch wenn er wahrscheinlich später einiges davon wiederholen würde. Sie kauften nicht nur eine Ziege, sondern gleich zwei. Die eine gaben sie dem Diener Dolethos, er sollte mit ihr gleich nach Hause zurückkehren und sie für das abendliche Mahl zubereiten. Mit der anderen gingen Vater und Sohn, jeder von einer anderen Art von Stolz erfüllt, hoch zum Tempel von Paraskion.
Der Tempel war der Göttin Palladaia gewidmet, ihre Statue thronte vor dem Altar. Die göttliche Jungfer zeigte sich von ihrer wehrhaften Seite: Der mit Gold überzogene Helm war in den Nacken gelehnt, an der Seite des Thrones ruhten ein runder Schild und ein langer Speer, dessen Ende sie mit ihrer Rechten gefasst hatte. Mit leuchtend blauen Augen sah sie auf den Altar herab, auf dem Vater und Sohn ihr eine Ziege opferten und ihr für den Sieg und die sichere Heimkehr dankten. Eine große Menschenansammlung wartete vor dem Portikus außerhalb des Tempels, mit Ziegen, Schafen oder nur Obst. Es war Brauch, bei solchen Gelegenheiten der Palladaia zu opfern, und viele Paraskioner wollten sich an diesem Tag dankbar zeigen.
Theomedes und Menenias traten danach aus dem Tempel, ihre Stimmung wechselte wieder von andächtig zu fröhlich. Der Tag neigte sich langsam dem Ende entgegen, als sie zu Hause angekommen waren. Die Dienerschaft bereitete bereits die Mahlzeit zu, sorgsam von Hethemesia überwacht. Auch wenn sie nicht an der Versammlung teilnehmen sollte – nur Männer waren zugelassen – so oblag ihr doch die Verwaltung dieses Teils des Hauses.
Die Gäste kamen, einer nach dem anderen. Auch Demetros, der alte Heerführer, ließ es sich trotz der verbundenen Stirn nicht nehmen, an dem Gelage teilzunehmen.
Zu Theomedes’ Überraschung trat auch Sikulus in den Versammlungsraum. Der Mechanikus blickte mit wirren Augen um sich, reagierte nicht, als einer der Diener ihn auf eine leere Kline verwies und schaffte es noch nicht einmal, alle Anwesenden zu grüßen. Der Diener schob ihn schließlich zu seinem Platz. Sikulus legte sich steif auf die Seite, hantierte eine Weile mit dem Kissen herum, fand jedoch keine bequeme Position, was wahrscheinlich eher an seiner Unfähigkeit lag, es sich in der Versammlung gemütlich zu machen, als an der Weichheit des Kissens. Theomedes musste sich eingestehen, dass es wenigstens Spaß machte, den Tüftler zu beobachten.
Der Diener Dolethos reichte eine Runde Schale herum. Das Wasser darin diente zur rituellen Reinigung. Dolethos und ein anderer Diener trugen daraufhin das schwere, bauchige Gefäß heran, indem der Wein mit Wasser vermischt schwappte. Sie bekamen alle ihre Becher, tranken einen Schluck aus dem Gefäß und sprachen ein paar Dankesworte an die Götter, besonders an Palladaia; Dann verschütteten sie den restlichen Wein auf dem Boden. Alles Rituelle war nun abgeschlossen, man durfte sich entspannen und mit den Reden beginnen.
Es kam, wie Theomedes es vorausgesehen hatte: Das Gespräch fiel sofort auf den kürzlichen Sieg. Die Gäste, welche nicht an dem Feldzug gegen Eukion teilgenommen hatten, sprachen sogleich Theomedes und Demetros an, ihnen doch etwas über die Kämpfe zu erzählen. Sikulus wurde dabei geflissentlich übergangen.
»In der Stadt erzählt man sich«, begann da Demetros, »dass Ihr göttliches Blut in den Adern fließen habt, geehrter Menenias. Euer Sohn hat Euch gewiss keine Schande gebracht. Tapfer stand er in den vordersten Reihen, Schulter an Schulter mit seinen Landsmännern. Er hat sich mit dem Feind geschlagen und war ihm sein Verderben.«
»Wir führen unsere Stammreihe auf einen Reitergott aus dem Norden zurück, das ist wahr«, antwortete Menenias. »Aber zügelt die Erwartungen etwas, das göttliche Blut hat sich verdünnt, so ist das nach jeder Generation. Bemisst uns daher nach den Maßstäben eines Sterblichen.«
»Ach, dabei hätte ich schwören können, einer der Heroen aus alten Zeiten wäre unter uns«, sprach Demetros mit einem Zwinkern an Theomedes.
Der war langsam der Schmeichelreden überdrüssig. Theomedes hatte sich nicht bedeutend besser geschlagen als die anderen Paraskioner. Stolz war Theomedes heimgekehrt, aber es war kein persönlicher Stolz, der allein auf seine Taten beruhte. Er teilte ihn mit der ganzen Stadt und dem siegreichen Heer. Wieso war der alte Feldherr nur so erpicht darauf, ihn an diesem Abend so zu preisen? War das eine Form von Dankbarkeit, zu diesem Fest geladen worden zu sein? Mit der Zeit zerstreuten sich die Gespräche und man redete nicht nur über den Feldzug. Menenias unterhielt sich unterdessen mit Sikulus. Ausgerechnet ihm.
Langsam stieg Theomedes selbst der mit Wasser verdünnte Wein zu Kopf. Er machte den Marsch und die Strapazen der letzten Tage dafür verantwortlich. Schließlich war er erst heute in Paraskion eingetroffen. Die seitliche Liegeposition, das weiche Kissen, die einlullenden Gespräche – das alles machte ihn nur schläfrig. Seine schweren Augenlider senkten sich unbarmherzig, eine wohlige Wärme stieg in ihm auf. Lautes Gelächter ließ ihn aus dem kurzen Schlummer aufwachen. Theomedes war nicht imstande zu sagen, ob das Gelächter ihm gegolten hatte. Sein Vater saß neben ihn, gütig lächelnd.
»Niemand wird es dir übelnehmen, wenn du dich lieber schlafen legen möchtest«, sprach er leise, sodass die anderen Gäste es nicht hören konnten.
Theomedes richtete sich auf und rieb sich die Stirn. Er bemerkte, dass Sikulus’ Platz verweist war, schenkte dieser Tatsache aber keine weitere Beachtung.
»Das wäre vielleicht das Beste«, antwortete er und erhob sich. Die Gäste verstummten, erwarteten etwas von ihm. »Meine Herren, ich werde mich zur Ruhe begeben. Es war ein langer Tag für mich.«
»Dir sei es gegönnt«, war einer der Rufe, welcher ihm entgegenschallte.
Ohne weiteres Aufsehen zu erregen, trat er aus der Versammlungshalle heraus und überlegte, ob er wirklich sogleich sein Bett aufsuchen sollte. Ihm kam stattdessen in den Sinn, sich zuerst in den Garten des Hauses zu begeben, etwas frische Luft zu schnappen und den Sternenhimmel zu betrachten.
Theomedes war nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen war; er wollte gerade in den Garten treten, da bemerkte er zwischen den Hecken eine Gestalt. Der Mond verbarg sich hinter Wolken, daher konnte er nur Umrisse ausmachen. Sicherlich war es nicht ungewöhnlich, dass sich Hausbewohner im Garten aufhielten. Doch heute waren auch Gäste anwesend und er fragte sich, wer sich denn im Garten befinden könnte. Seine Neugierde war geweckt, er verbarg sich im Gang und lugte zum Garten hinaus.
Die Person stand still. Von der Größe her hätte er auf einen Mann getippt, doch war die Gestalt auch recht schlank. Bald bemerkte Theomedes, dass die Gestalt nicht allein im Garten war: Etwas bewegte sich in der Dunkelheit, die Umrisse einer zweiten Person wurden deutlich. Kleiner, zierlicher … war das seine Schwester?
Theomedes ließ jegliche Vorsicht fahren und trat auf den Hof.
»Was ist hier los?«
Seine Schwester – er erkannte sie sogleich an dem Schreckenslaut, den sie ausstieß – wich einen Schritt zurück. »Theomedes … das ist …«
»Was?!«, zischte er und versuchte den anderen genauer zu betrachten. Der Mann wandte sich ab, die Dunkelheit verhüllte noch immer seine Identität. Theomedes packte ihn an den Schultern und zehrte ihn zu sich heran.
Er konnte es kaum glauben. »Sikulus?!«
»Derselbe«, antwortete dieser und befreite sich aus Theomedes’ Griff. »Und glaubt nicht, dass ich Eure ehrenwerte Schwester unsittlich berührt hätte oder etwas derart. Wir … hatten nur geredet.«
»Geredet?« Theomedes fasste seine Schwester scharf ins Auge. »Geredet? Um diese Zeit? Hier, allein im Garten?«
»Es ist wahr«, beteuerte seine Schwester. »Hier ist nichts vorgefallen, was dich beunruhigen könnte.«
»Ephianessa, du sollst dich doch nicht im Haus herumtreiben, während wir Gäste haben. Erst recht nicht während eines Gelages. Einige der Gäste sind betrunken, selbst der redlichste Mann kann da zum Tier werden.« Er blickte zu Sikulus, welcher sich das Handgelenk hielt, das Theomedes noch gerade unsanft angefasst hatte. »Er vielleicht nicht. Bestimmt nicht. Dennoch: Was, wenn dich einer der anderen Gäste hier draußen bemerkt hätte? Die Gerüchte könnten dein Ansehen ruinieren, das Ansehen unseres Hauses.«
»Sehr lebhafte Fantasie«, gab da Sikulus von sich.
Die Wut wallte wieder in Theomedes auf. Er griff erneut das Handgelenk von Sikulus, genau dieselbe Stelle, aber noch fester. Mit Genugtuung sah er zu, wie sich Sikulus unter dem Griff wand und das Gesicht verzog.
»Theomedes!«, rief Ephianessa. »Lass ihn los! Er hat sich redlich verhalten!«
»Höre auf deine Schwester«, sprach da eine ihm ebenfalls vertraue Stimme. Seine Mutter erschien mit einer Lampe. »Alles hier geschieht unter meinen achtsamen Augen. Deine Sorge um deine kleine Schwester ist rührend, doch in diesem Falle unangebracht. Wir haben Sikulus eingeladen, damit er und Ephianessa sich abseits des Festes etwas kennenlernen können.«
»Mutter«, sprach Theomedes und ließ aus Fassungslosigkeit Sikulus los. »Was geht hier vor sich?«
Hethemesia trat zwischen die drei. »Wir hätten es dir später gesagt, auch wenn du wahrscheinlich nicht anders reagiert hättest. Wir planen, Ephianessa und Sikulus miteinander zu verloben. Er stammt aus einem guten Haus und hat noch eine vielversprechende Zukunft vor sich.«
»Wenn ihm nicht der Dampf seiner Maschinen um die Ohren fliegt.«
»Oh, wenn es das ist«, sagte Sikulus in einem leicht beleidigten Tonfall. »Ihr könnt mich jederzeit in meiner Werkstatt besuchen und ich zeige Euch, wie zuverlässig meine Erfindungen sind. Die meisten von ihnen, jedenfalls. Die Erfindungen, welche schon Einsatz bereit sind.«
Theomedes versuchte ihn zu ignorieren. »Wieso er?«
»Das habe ich gerade erklärt«, antwortete seine Mutter.
»Und wieso nicht ein anderer?«
»Es ist nicht Sache des Bruders, den Gatten auszuwählen.«
»Und weiß Vater …«
»Das habe ich nicht allein entschieden.«
Theomedes seufzte, was anderes blieb ihm nicht übrig. Gegen den Beschluss seiner Eltern zu protestieren, war zwecklos und seine Schwester machte nicht den Eindruck, gegen diese Vermählung zu sein. Auf sein Seufzen war eine unangenehme Stille in den Garten getreten, bei der ein jeder lieber auf seine eigenen Füße schaute, als das Wort zu erheben. Nur seine Mutter Hethemesia mahnte Theomedes mit ihrem Blick, keine weiteren Wiederworte zu sprechen.
Es war Sikulus, der das Wort erhob: »Ein schöner Abend. Ich gedenke trotzdem, mich nun zurückzuziehen. Theomedes, wehrte Frau Mutter.« Er nickte beiden zu und wandte sich dann an Ephianessa. Was auch immer er vorhatte, ein Seitenblick zu Theomedes ließ ihn innehalten und er beließ es bei einem Nicken. Dann machte er sich davon.
Die drei schauten ihm noch lange nach. »Wieso er …?«, wiederholte Theomedes. Mutter und Schwester ließen ihn mit dieser Frage, welche ihm eine schlaflose Nacht bereitete, in dem Garten allein.
Kapitel 4 – Der Atem der Palladaia
Mehrere Dinge störten Sikulus daran, wie dieses Fest zu Ende gegangen war: Zum einem fand er die Unterhaltungen nicht intellektuell stimulierend. Es war verständlich, dass die vergangenen Schlachten, Kämpfe und andere Gräueltaten den Hauptteil des Gesprächsstoffs ausmachten, doch kannten diese Rohlinge keine anderen Themen? Lediglich Menenias, Vater von Theomedes, schien seine Langeweile bemerkt zu haben und kam auf andere Dinge zu sprechen. Für den Vater eines so hitzköpfigen Jungens war er ein ausgesprochener Feingeist, das sollte man ihm gar nicht zutrauen. Vielleicht lag es auch am Alter, jugendliche Kraft wurde an seinen Sohn weitergegeben, um der Weisheit Platz zu machen.
Die zweite Sache war die jähe Unterbrechung seines Zwiegesprächs mit Ephianessa. Bei diesem Wort schwelgten seine Gedanken dahin zu ihrem süßen Lächeln und ihrem klaren Lachen, sodass er den hervorstehenden Stein im Boden nicht bemerkte und beinahe zu Boden gefallen wäre. Wären Zuschauer zugegen, hätten sie ihn für einen Betrunkenen gehalten, der es kaum nach Hause schaffte. Dabei war er nur etwas – durfte er diesen Gedanken wirklich schon wagen? – Liebestrunken. Möge Theomedes oder wer auch immer schlecht von dieser Verbindung denken, es war ihm einerlei. Wer sagt denn, dass in seiner Werkstatt, zwischen all diesen Maschinen, Öfen und Werkzeugen, nicht auch Platz wäre für dieses Kleinod einer Frau? Gewiss, er würde die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen müssen … das hatte er eh vor.
Er stolperte erneut, diesmal begleitet von leisen Flüchen. Es diente ihm als Mahnung, Palladaia legte ihm in ihrer Weisheit Steine in den Weg, damit er sich wieder auf das Wesentliche konzentrierte. Dennoch ließen ihn die Geschehnisse des Abends nicht los.
Das dritte, was ihn störte, war Theomedes schlechte Meinung über ihn. Sikulus war daran gewöhnt, dass man über ihn spottete, ihn als Eigenbrötler und Individualisten schief ansah.
Wann immer es möglich war, zog Sikulus es vor, Tage bis Wochen in seiner Werkstatt zu verbringen und die vielen Versammlungen und Feste zu meiden. Ein einzelner Mann brachte durchaus kluge und sinnvolle Gedanken zustande. Befand er sich jedoch in der Masse, dann sank er schnell zum Tier hinab. Schlimmer noch, wenn verschlagene Redner ihm den Verstand vernebeln, wird aus ihm schnell nichts weiter als ein Sklave, der einem fremden Willen gehorcht. Und in der Masse war der Mensch noch immer leichter zu manipulieren, denn die meisten ziehen lieber mit der Herde, als einsam auf der Weidefläche zurückzubleiben.
Diesmal stieß er auf äußerst schmerzhafte Weise gegen einen der Steine. Er ließ dem Fluchen freien Lauf, mehr an sich selbst gerichtet als an die Pflasterung der Straße. Aber wo war er?
Ja, es störte ihn nicht, wie andere über ihn dachten. Doch es freute ihn, dass er mit Ephianessas Eltern auf gutem Fuß stand. Leider war es mit ihrem Bruder anders. Das Traurige daran war, dass Sikulus Theomedes gerne zum Freund hätte. Sikulus hatte ihn beobachtet, wenn Gepflogenheiten und Gebräuche ihn zwangen, doch mal aus dem Haus zu treten. Theomedes war klüger, als er sich selbst zugestand, und skeptisch gegenüber den Autoritäten. Sikulus sah ihn, wie er bei Nekarios’ Reden mit der Stirn runzelte, die Arme verschränkte und sich innerlich zurückzog. Daher glaubte er, dass der Sohn des Menenias genauso eine Abneigung gegen den König hegte wie er selbst. Nicht zufälligerweise war Nekarios auch einer dieser Redner, über den er vor ein paar Minuten noch nachgedacht hatte. Trotz seiner monströsen Gestalt wusste der Stiermensch, die Menschen mit seinen Worten zu überzeugen.
Plötzlich blieb er stehen und schaute sich um. Palladaias gütige Warnung war nicht bei ihm angekommen: Sikulus hatte sich verirrt.
*
Sikulus musste sich nur kurz orientieren, um nach diesem kleinen Umweg zurück zu seinem Anwesen zu finden.





























