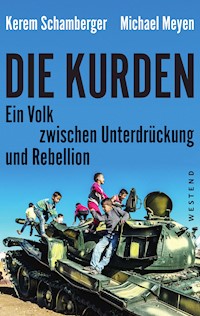
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer weiß um den Krieg, den die Regierung in Ankara seit 2015 gegen die Kurden führt? Wer erinnert sich an die Repressionen in den 1990ern? Hierzulande kennt man allenfalls die PKK und fragt sich vielleicht verwundert, warum immer noch Tausende mit den Farben und Symbolen dieser "Terrororganisation" in ganz Europa auf die Straßen gehen. Schamberger und Meyen zeigen, dass die Verfolgung der Kurden in der Gründungsgeschichte der Türkei wurzelt und dass der eigentliche Putsch dort schon 2015 stattfand - ein ziviler Putsch durch die AKP. Doch der Westen will sein Bündnis mit dem Erdogan-Regime nicht gefährden und lässt deshalb ein 25-Millionen-Volk im Stich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ebook Edition
Kerem SchambergerMichael Meyen
Die Kurden
Ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-701-6
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2018
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Für Mehmet Aksoy, Anna Campbell und all die anderen
Vorwort
Die Kurden sind das größte staatenlose Volk der Welt. Mehr als 30 Millionen Menschen, die bei uns als Türken, Syrer, Iraner oder Iraker gelten (um nur die vier wichtigsten Siedlungsgebiete zu nennen), weil sie einen entsprechenden Pass haben. Dieses Buch erzählt die Geschichte dieser Menschen. Es erzählt, wie sich die Westmächte den Nahen und Mittleren Osten nach dem Ersten Weltkrieg zurechtgeschnitten haben und warum die neuen Staaten in der Region kein Interesse an einer kurdischen Nation hatten. Im Gegenteil. Sie haben alles getan, damit Sprache, Kultur und Identität verschwinden.
Geschichte wiederholt sich nicht, sagt man. Die Unterdrückung der Kurden aber geht weiter. Die Türkei führt seit Sommer 2015 Krieg im eigenen Land. Sie zerstört kurdische Städte und Dörfer, bringt dabei Zivilisten um, sperrt gewählte Bürgermeister ein. Die Türkei trägt diesen Krieg auch nach Europa. Allein in Deutschland sollen mehr als eine Million Kurden leben. Wenn diese Menschen hier auf die Straße gehen, ist der türkische Geheimdienst nicht weit. Der Mord an drei Kurdinnen im Januar 2013 in Paris ist nur die Spitze des Eisbergs.1
Die Türkei kann diesen Krieg führen, weil die Weltöffentlichkeit wegschaut. Weil Deutschland diesen Krieg durch die Brille der Regierung in Ankara sieht. Die PKK bleibt verboten, weil die Türkei von Terroristen spricht. Deutsche Polizisten verfolgen Menschen, die Symbole dieser Partei zeigen oder von Organisationen, die mit der PKK verbandelt sein sollen. Deutsche Firmen liefern Waffen in die Türkei, die in der Nato ist und überhaupt ein Paradies für Investoren. Die Türkei war schon immer unser Partner. Das zählt mehr als alle Menschenrechte.
Eigentlich sollte dieses Buch »Das vergessene Volk« heißen. Zu negativ, haben die Experten gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Und: nicht mehr zeitgemäß. Spätestens seit der Befreiung von Kobanê im Februar 2015 stehen die Kurden im Scheinwerferlicht. Sie haben dem Islamischen Staat getrotzt. Ihre Frauen vor allem. Und sie versuchen, etwas Neues aufzubauen, eine neue Form der Demokratie jenseits aller Staatlichkeit, in Rojava, im Norden Syriens, mitten im Krieg, bekämpft von allen Seiten.
Wir sind für dieses Buch nach Rojava gefahren und in den Nordirak. Wir haben in Deutschland Journalistinnen und Wissenschaftler interviewt, Deutsche, Türken, Kurden, die gegen den Mainstream schwimmen. Und wir haben zwei Blickwinkel zusammengebracht: Kerem Schamberger, halb Deutscher, halb Türke, politischer Aktivist und Streiter für Gerechtigkeit, dem die kurdische Frage schon lange auf den Nägeln brennt, und Michael Meyen, als Ostdeutscher und als Kommunikationswissenschaftler bisher weit weg von dieser Frage, als gelernter Journalist aber in der Lage, Schambergers Wissen in eine lesbare Fassung zu gießen. Und wir haben zwei Fotografen gefunden, die den Text nicht kannten und trotzdem Bilder hatten, die wunderbar dazu passen. Ein Dank an Willi Effenberger und Flo Smith,2 ein Dank an alle, die mit uns gesprochen haben.
1 Auftakt in Kassel. Oder: Was gehen uns die Kurden an? Und was will dieses Buch?
Es ist heiß an diesem 29. August 2017 in Kassel. Noch einmal über 30 Grad, selbst nach Feierabend. Man könnte an der Fulda sitzen oder am Parthenon der Bücher auf der documenta. Im Sandershaus, weit weg von Fluss und Bier, spricht Ercan Ayboğa über Rojava. 45 Minuten und ganz viele frische Bilder, sagt er in die Schwüle hinein. Bilder aus Diyarbakir in der Türkei, wo er zwei Jahre in der Provinzverwaltung gearbeitet hat, Bilder aus den Kurdengebieten im Norden Syriens, wo er 2014 unterwegs war und gerade jetzt erst wieder. Vielleicht werden es auch 55 Minuten, okay. »Demokratischer Konföderalismus« steht an der Wand. Die Vision der Kurden für die Region und vielleicht auch für den Rest der Welt, zumindest der Kurden, die auf Abdullah Öcalan schwören, seine Bücher kennen und fordern, Öcalan endlich, endlich freizulassen. Ein Thema, das zu groß ist für eine knappe Stunde. Ercan Ayboğa übersieht die Uhren, die im Saal hin und wieder hochgehalten werden. Ein bisschen schwitzen für die Befreiung. Wenn es damit nur getan wäre.
Eigentlich wird im Sandershaus heute Geburtstag gefeiert. Kassel liest seit genau einem Jahr Jenseits von Staat, Macht und Gewalt.1 Nicht ganz Kassel natürlich. Man muss vermieten für die documenta und überhaupt: ein Buch von diesem Öcalan, der seit 1999 auf der Insel Imrali im Marmarameer sitzt und lange die PKK geführt hat, die Arbeiterpartei Kurdistans, die in Deutschland seit 1993 verboten ist. Terroristen, sagt die Türkei. Terroristen, sagen auch die EU, die USA, Großbritannien. In Kassel diskutieren die Kurden und ihre Sympathisantinnen gerade, was mit den Fahnen von YPG und YPJ ist, mit den Symbolen ihrer Kämpferinnen und Kämpfer in Syrien. Roter Stern auf Gelb und Grün: Wer darf das wann und wo noch zeigen, ohne sich strafbar zu machen? Kein Nährboden für einen Bestseller.
Leyla ist trotzdem stolz. Ein Jahr Lesekreis, jeden Montag um 19 Uhr. Ein harter Kern, der immer kommt, plus Laufkundschaft. 130 Teilnehmer stehen auf Leylas Liste. Dazu ein Ableger in Rostock. Jenseits von Staat, Macht und Gewalt ist harte Kost, selbst für Akademiker. 600 Seiten Abrechnung und Neuanfang. Eine Eingabe an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, in der Öcalan mit der marxistisch-leninistischen Vergangenheit der PKK bricht und den Staat als Wurzel allen Übels ausmacht. »Manchmal lesen wir nur drei oder vier Zeilen und reden dann zwei Stunden«, sagt Leyla, eine Kurdin, Ende 20 ungefähr, die als Kind in der Türkei gesehen hat, wie ihr Vater erschossen wurde. Heute scheint die Sonne. Heute ist Ercan Ayboğa nach Kassel gekommen, Mitautor von Revolution in Rojava.2 Er wird erklären, wie Öcalan sich das alles gedacht hat und was bisher daraus geworden ist. Dem Baby Lesekreis soll es besser gehen als einst der kleinen Leyla.
Vermutlich gibt es in Kassel keinen besseren Ort für diesen Geburtstag. Ein Fabrikgebäude aus der Weimarer Zeit, ganz auf neu getrimmt, aber so schwer zu finden, dass das Einzelzimmer selbst in diesem Sommer nur 37,50 Euro kostet. Billiger geht die documenta nicht. Im Internet wirbt das Sandershaus mit Goethe (»Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein«), mit Tango und mit der Nähe zu Menschen, die nach Deutschland geflohen sind. Neben dem Hostel gibt es eine Gemeinschaftsunterkunft, die Amal heißt. Hoffnung auf Arabisch. Jan ist heute zum ersten Mal hier. Er hat Ercan Ayboğa mit dem Auto vom Bahnhof abgeholt und ihn zuerst ins Kurdische Kulturzentrum gebracht. Es gab Tee, Joghurt und Menemen – Eier mit Zwiebeln, Paprika und Tomaten. Den Tee hat Jan genommen. Straight Edge, sagt er. Keine Drogen, kein Alkohol, nichts vom Tier. Also auch keine Eier und keine Milch. Wenn er Ercan Ayboğa in der Nacht zum Schlafplatz fährt, wird die Polizei ihn trotzdem anhalten. So ein Punk, komisch gekleidet, mit Piercings in der Nase. Man weiß ja nie. Jan macht seinen Bachelor in Kassel. Politik und Soziologie. Nicht so schlecht, sagt er. Ein Seminar über die Kurden und auch eins zu den Zapatisten in Mexiko. Morgen geht Jan ins Rathaus und kreuzt die DKP an. Die Bundestagswahl ist zwar erst in knapp vier Wochen, aber er ist sich jetzt schon ganz sicher.
Jenseits aller Grenzen: die Unterdrückung der Kurden
Dieses Buch handelt von Menschen wie Jan, Leyla und Ercan Ayboğa. Von Menschen, die die kurdische Frage in Deutschland stellen – weil sie selbst Kurden sind, weil sie sich den Kurden verbunden fühlen, weil sie wissen, dass es weder in der Türkei noch in den anderen Staaten der Region so etwas wie Demokratie geben kann, wenn ein ganzes Volk unterdrückt, ausgegrenzt, entrechtet wird. Dieses Buch zeigt, dass die kurdische Frage älter ist als alle Politiker, über die wir heute streiten und schimpfen. Kein Zweifel: Die Regierung Erdo
an sprengt im Südosten der Türkei spätestens seit Juli 2015 alle Grenzen. Ausgangssperren, Belagerungen und zerstörte Städte. Vereine verboten und Zeitungen geschlossen, ohne jeden Gerichtsbeschluss. Gewählte Volksvertreter im Gefängnis, Folter und Hunderte toter Zivilisten.
Eine Woche nach dem Auftritt von Ercan Ayboğa in Kassel liegt eine Mail mit dem Betreff »Westliche Werte gefunden!« im Postfach. Absenderin: Mely Kiyak, Kurdin, 1976 in der Nähe von Bremen geboren. Thema ihrer Kolumne für das Maxim Gorki Theater in Berlin diesmal: die »deutsche Panzerfabrik Rheinmetall mitten in der Türkei«. Besser kann man das Thema nicht auf den Punkt bringen: »In der Türkei sagt man zum Krieg nicht Krieg. Man nennt es ›Operation‹ und begründet die Angriffe damit, dass man Terroristen fangen will. Dafür legt man ganze Städte in Schutt und Asche. Zündet Wälder an. Schiebt den Schutt beiseite, planiert. Die Bewohner werden enteignet, vertrieben. Wenige Meter weiter wird ein neues Dorf mit neuem Namen gegründet, zerlegt, planiert. Ich fasse gerade die letzten dreieinhalb Jahrzehnte zusammen. Anschließend wird neu kartographiert.«3
Von diesem Krieg wird schon deshalb zu sprechen sein, weil die deutschen Medien oft schweigen und weil dieser Krieg auch mit deutschen Panzern und mit deutscher Munition geführt wird. Nur: Die Kurden werden nicht erst seit gestern verfolgt und keineswegs nur in der Türkei. Auch in Syrien, im Irak und im Iran war dieses Volk zu groß, um einfach aufgesaugt zu werden von Staaten, die nach dem Ersten Weltkrieg am Reißbrett der Weltpolitik entstanden sind, und zu klein, um im Westen Gehör zu finden.
Heute überhört die Kurden niemand mehr. Spätestens seit Kobanê nicht mehr. »Wer weiß nicht, was Rojava ist?«, fragt Ercan Ayboğa im Sandershaus. Ein rhetorischer Trick. Die Schlacht gegen den Islamischen Staat, die Evakuierung der Stadt Kobanê an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei, ihre Befreiung im Februar 2015: All das war auch in Kassel Thema. Im Oktober 2014 hat sogar Volker Kauder öffentlich darüber nachgedacht, Waffen an die PKK zu liefern: »Die Hauptgefahr sind doch diese unmenschlichen IS-Terroristen.« Volker Kauder: Das ist fast Angela Merkel. Chef der Unionsfraktion im Bundestag, seit November 2005, länger als jeder andere vor ihm. Was Kauder sagt, wird normalerweise schnell Gesetz. In jenem heißen Herbst 2014 hat er via Spiegel Online Ankara gerügt. Es sei »nicht akzeptabel«, dass die Türkei den IS-Nachschub nicht stoppe, Kurden die Flucht aus Kobanê erschwere und obendrein »Stellungen der PKK« bombardiere. Zurück an den Verhandlungstisch, bitte.4 Ein paar Wochen vorher hatte die Bundesregierung beschlossen, die Peschmerga auszurüsten, die Armee von Masud Barzani, seit 2005 Präsident der Region Kurdistan im Irak. Die guten Kurden sozusagen, wenn denn die »Terroristen« von der PKK die schlechten sind.
Ohne Grenzen: die kurdische Frage
Auch darum geht es in diesem Buch: um die große Politik, für die die Kurden oft nur Spielball waren. Die genauer hinschaut, wenn es gerade passt, meist aber einfach wegsieht, Menschenrechte hin oder her. Die Türkei ist schließlich in der Nato und irgendwie schon immer Deutschlands Partner. Warum bekommen die einen Waffen, während die anderen nicht einmal ihre Fahnen zeigen dürfen? Wer sind die einen und wer die anderen? Wer entscheidet über Gut und Böse? Und: Was hat das alles mit uns in Deutschland zu tun? Niemand weiß genau, wie viele Kurden hier leben. Flüchtlinge zum Beispiel werden als Syrer registriert, als Türken, als Iraker. Berlin sieht die Kurden nicht anders als Ankara, Damaskus, Bagdad. Es bringt also nichts, deutsche Behörden zu fragen. Die Kurdische Gemeinde Deutschland schätzt die Zahl der Kurden im Land auf über eine Million. Eine Million Menschen, die in Deutschland studieren wollten oder arbeiten, die wegen der Familie fort sind, wegen des Krieges, wegen der Politik. Eine Million Menschen, die im Moment nicht zurückkönnen und oft auch gar nicht mehr zurückwollen. Viele haben inzwischen einen deutschen Pass, viele sind aber trotzdem auf der Straße, wenn es um ihre Heimat geht, um ihre Sprache, um ihre Kultur.
Kurdistan ist mitten in Deutschland. Ercan Ayboğa spricht in Kassel von Repressionen. Der Staat, die Polizei. »Wer sich engagiert, kann schnell mit Verfahren überzogen und inhaftiert werden.« Ercan Ayboğa ist nicht als Kämpfer auf die Welt gekommen. »Rüsselsheim«, sagt er und lächelt. »Opel«. Und der Main. Das Wasser. »Als Kind bin ich jeden zweiten Sommer nach Dersim gefahren, in den Urlaub.« Ercans Eltern sind aus dieser kurdischen Provinz vor einem halben Jahrhundert nach Deutschland gekommen. Unpolitische Leute. Wo Ercan aufwächst, in dem kurdischen Migrantenmilieu in Hessen, gibt es zwar Aktivisten, er selbst sagt aber heute, dass er damals nicht sehr kritisch gewesen sei. Wasser: Das war sein Thema. »Ich liebe das Schwimmen. In den Ferien haben wir im Fluss Munzur gebadet. Mich hat interessiert, wie das Wasser die Natur formt.« Nach dem Abitur schreibt er sich an der TU Darmstadt als Bauingenieur ein, beschäftigt sich mit Wasserbau, mit Wasserwirtschaft, mit Menschenrechten und mit Internationalismus. »Ich war sehr lange im AStA. Politisch schon engagiert, links. Der Wendepunkt kam dann 2000, als der Ilisu-Staudamm gebaut werden sollte, mit deutscher Beteiligung.«
Staat und Wirtschaft produzieren sich ihre Gegner selbst. Nicht nur in der Türkei oder in Syrien, sondern auch in Deutschland. Auch darum geht es in diesem Buch. Wir haben mit Menschen gesprochen, die in den 1990er Jahren gegen die neuen Rechten demonstriert haben, gegen Kriege und gegen Weltwirtschaftsgipfel, in München, in Coburg, und die dabei erlebt haben, dass die Polizei nicht die Nazis verprügelt, sondern sie, die Antifaschisten. Von da war es nicht mehr weit bis zu den »schnauzbärtigen Männern mit den bunten Fahnen« (Nikolaus Brauns). Wir haben mit Reimar Heider gesprochen, Arzt und katholisch erzogen, der solche Männer 1993 in der Hochschulgemeinde traf und in der Kirche. »Der Krieg in der Türkei war damals auf dem Höhepunkt. In Göttingen suchten die Kurden Räume für Sprachkurse. So habe ich mitbekommen, dass wir da ein Problem haben.«
1994 fuhr Heider in die Türkei, um Wahlen zu beobachten und Newroz, das kurdische Neujahrsfest, bei dem es ein Jahr zuvor in Cizre ein Massaker gegeben hatte. »Was ich dort gesehen habe, hat mich politisiert. Deutsche Panzer, deutsche Waffen überall. Morde auf offener Straße, abgebrannte Dörfer. Wir haben die noch richtig rauchen sehen. Und dann die Berichterstattung daheim. Nein, das stimmt nicht. Die Regierung sagt, es gibt dort keine deutschen Waffen.« Heider hat Türkisch gelernt und bei einem Praktikum in Diyarbakir erlebt, wie Soldaten seine Kollegen im Krankenhaus zwangen, Folteropfern Atteste zu schreiben. Nichts zu sehen an den geschundenen Körpern. »Die kamen mit Kalaschnikows in die Notaufnahme.« Heute übersetzt Heider die Bücher von Abdullah Öcalan, auch Jenseits von Staat, Macht und Gewalt. Der deutsche Staat macht aus Antifaschisten, radikalen Demokraten und christlich motivierten Menschenrechtlern Vorkämpfer für die kurdische Bewegung, weil er die kurdische Frage durch die Brille der türkischen Regierung sieht.
Grenzenlos: Wasser, Umwelt, Geschichte, Krieg
Bei Ercan Ayboğa war es das Wasser. Dieser riesige Staudamm, der den Tigris kurz vor der Grenze zum Irak und zu Syrien stoppen soll. Ein Projekt, bei dem es um mehr geht als nur um das kostbare Nass, das knapp ist in der Region und schon deshalb heiß umkämpft. Beim Projekt Ilisu geht es um alles. Um die Wiege der Menschheit im Zweistromland und um Hasankeyf, die Felsenstadt der Römer, um Zehntausende Landbewohner, die das Wasser in die Städte spülen würde und damit in die Arme jener Türken, die Atatürks Diktum von der einen und einzigen Nation verinnerlicht haben, um den Rückzugsraum der PKK-Kämpfer, den der Stausee schrumpfen lässt, um die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU. »Wir haben geschafft, dass die Europäer 2009 aussteigen mussten«, sagt Ercan Ayboğa. »Deutschland, Österreich und die Schweiz hatten ja Hermes-Bürgschaften gewährt. Züblin war zum Beispiel dabei, das Bauunternehmen, die DekaBank, Alstom, Andritz. Wir haben Unterschriften gesammelt, Veranstaltungen gemacht und so viele der großen Medien auf unsere Seite gebracht.«
Dass die Türkei später alleine gebaut hat, dass auch der Trumpf Hasankeyf nicht mehr stach? Ercan Ayboğa schüttelt den Kopf und murmelt etwas von einem historischen Erfolg. Er ist ein ruhiger und bedächtiger Mann, der auch in dem kleinen Saal im Sandershaus von Kassel lieber mit Mikro spricht. »Das gab es noch nie in der Geschichte. Dass eine Exportbürgschaft, die schon beschlossen war, wieder zurückgezogen wurde.« Dieses Gefühl, ein Projekt hinausschieben zu können, mehr als anderthalb Jahrzehnte. Die türkische Regierung zu zwingen, Gesetze zu ändern, und Menschen zusammenzubringen, die am Anfang vielleicht nur die Umwelt schützen wollten oder einen archäologisch einmaligen Ort und dann gemerkt haben, dass alles mit allem zusammenhängt. »Die Kampagne hat das Bewusstsein der Leute verändert, sozial, ökologisch, kulturell. Wir haben über Energiepolitik diskutiert und über Entwicklung. Müssen wir alles zubauen, müssen wir alles austrocknen? Wie können wir die Menschen vor Ort besser unterstützen? Wie wollen wir eigentlich leben?«
Im Rückblick war der Weg das Ziel. Das Netzwerk, das sich um Ilisu und Hasankeyf gebildet hat und das seitdem auch um die kurdische Frage weiß. Gewerkschaften, Frauen- und Umweltgruppen, Berufsorganisationen, NGOs, Kommunalverwaltungen. Die Erfahrung, nicht ganz ohnmächtig zu sein, auch wenn der Gegner bis an die Zähne bewaffnet ist. »Der Staat baut trotzdem, was er will«, sagt Ercan Ayboğa. »Aber verspätet und mit extremer Gewalt. Diese Regierung ist immer repressiver geworden. Ein Militärregime.« Ercan Ayboğa erzählt, wie Ankara den Krieg in Nordkurdistan genutzt hat, um die Arbeiter unter Druck zu setzen. Vorher habe es immer wieder Streiks gegeben und auch mal eine Entführung durch die Guerilla der PKK. »Zwei Unternehmer, die die Arbeit organisieren sollten. 2014. Da wurde das Ganze für ein halbes Jahr gestoppt.«
In diesem Sommer 2017 ist Hasankeyf Sicherheitszone. Das heißt: viel Polizei. Sehr viel Polizei. Keine Einreise für Aktivisten wie Ercan Ayboğa, keine Demos. »Wenn zehn Menschen zusammenkommen, werden sie festgenommen. Auch Mathias Depardon war ja in Haft, der französische Journalist, der das für den National Geographic fotografiert hat, zwei Jahre lang. Der musste von Macron rausgeholt werden. Eine Woche vorher hatten wir noch mit ihm gesprochen. Da ist es unheimlich schwierig, etwas auf die Beine zu stellen. Ich war ab Januar 2015 wieder dort. Wir hatten in diesem Jahr sechs Demonstrationen. Es gab Klagen, Anträge, internationale Unterstützung. Aber der Putsch hat dann alles viel, viel schwieriger gemacht. Ich meine nicht den Putschversuch, sondern den Putsch der Regierung. Den Ausnahmezustand. Da will kaum noch jemand protestieren. Es bringt ja nichts, mit fünf Leuten dazustehen.«
Grenzen sprengen: Rojava
Vom Wasser ist Ercan Ayboğa nach Rojava gekommen. Im Sandershaus von Kassel muss er nicht erklären, dass dieser Name für die kurdischen Gebiete im Norden Syriens steht und für das, was er in seinem Buch eine »Revolution« nennt. Eine Demokratie, in der tatsächlich jeder mitmacht und in der die Frauen eigene Räte haben, eigene bewaffnete Verbände und einen Platz in jeder Doppelspitze. »Demokratischer Konföderalismus«, sagt Ercan Ayboğa. Kommunen, die zusammenarbeiten und trotzdem selbstständig bleiben, die sich selbst versorgen, Schulen, Krankenhäuser und Kooperativen betreiben und dafür keinen Staat brauchen, keinen eigenen jedenfalls. Kein Groß-Kurdistan, keine neuen Grenzen.
Das ist nicht Straight Edge. Jan hat auf der documenta ein Video von Köken Ergun gesehen. »I, soldier«. Sieben Minuten auf zwei Leinwänden im Fridericianum. Grusel pur. Junge Türken im Stechschritt vor einem Stadionpublikum, martialische Musik und ein Kommandeur, der das noch toppt: »Der Soldat ist unsterblich. Sein Blut ist das Rot unserer Flagge. Kommt her, ihr Mutigen! Kommt her und lasst den Boden zittern! Versprich mir das eine, mein mutiger Junge. Es ist ein Segen zu sagen: Ich bin ein Türke.«5 Umso utopischer scheint die Idee Rojava.
Im Sandershaus neben Jan: viel junges Volk. Drei Nirvana-Shirts und ein paar blonde Studenten, die vorhin im Kurdischen Kulturzentrum schon dabei waren. Dennis schreibt gerade seine Masterarbeit über Räte in der Geschichte. München 1918/19 zum Beispiel. Kurt Eisner und der Versuch, in Bayern nach dem Ende des Krieges eine Rätedemokratie aufzubauen. Im Frühjahr 2017 war Dennis im Norden des Irak unterwegs. Schauen, wie das bei den Kurden heute läuft. Ob es tatsächlich so läuft, wie Abdullah Öcalan in seinen Büchern schreibt. Ja, sagt Ercan Ayboğa in Kassel. Es läuft so. Nicht alle machen mit, aber viele. Mindestens 50 Prozent. Sogar einige Araber. Es bleibt ihnen eigentlich auch gar nichts anderes übrig. Diesel, Bulgur, Zucker: am besten über die Kommunen. Diesel für neun Cent pro Liter. Ohne Diesel gibt es kaum Strom, und die Winter sind kalt in der Gegend.
»Diese Revolution stinkt nach Diesel«, sagt Ercan Ayboğa und schmunzelt. Im Sandershaus hat er ein Heimspiel und kann von all dem schwärmen, was sich seit 2014 getan hat. Schulunterricht auf Kurdisch, neue Lehrpläne, zwei Universitäten. Gesundheit? Jede Kommune bildet zwei Ärzte aus. Justiz? Die Friedenskomitees lösen 80 Prozent der Konflikte, ganz ohne Richter und Gefängnis. Essen? Genug für alle, auch für die vielen Flüchtlinge, die nach Rojava kommen. Und das alles, obwohl Krieg ist, obwohl es ein Embargo gibt und selbst die kurdischen Nachbarn nur das über die Grenze lassen, was ihnen passt, obwohl die Region einst das Armenhaus Syriens war und die Verteidigung heute 70 Prozent der Ressourcen frisst. »Wir probieren und experimentieren viel«, sagt Ercan Ayboğa. »Wir haben keine Lösung für alle Fragen der Gesellschaft. So viele Beispiele gibt es auf der Welt ja auch nicht.«
Das Beispiel Rojava wird in Deutschland übersehen. 15 Treffer hat die Schlagworte-Suche im Online-Archiv der Süddeutschen Zeitung Ende 2017 ergeben. 15 Texte, in denen das Wort Rojava steht. 15 Erwähnungen in dreieinhalb Jahren. Für die Süddeutsche Zeitung existiert Rojava nicht. Vielleicht wären sonst mehr als 40 Menschen ins Sandershaus gekommen. Selbst diese 40 haben Zweifel. Wie funktioniert das mit den Räten? Wie wird gesichert, dass tatsächlich alle zum Zug kommen, auch die, die keine Lust auf Sitzungen haben? Und vor allem: Wer kontrolliert das Öl und wer verhandelt mit Trump, mit Putin? Ercan Ayboğa kennt diese Zweifel. Er lächelt auch die Frage nach den Ehemännern weg. Wie kann es sein, dass manchmal nur Frauen bestimmen? Ist das im Einklang mit den Gesetzen?
Ercan Ayboğa erzählt von den Bergen und von der Guerilla, von den Kämpferinnen und Kämpfern der PKK. Seit 30 Jahren lebe man dort in Natur und Gemeinschaft. Insgesamt vielleicht 50 000 in all der Zeit. »Wenn du dich dort bewegst, triffst du Menschen, die ohne Kapitalismus auskommen.« Und dann die Erfahrungen, die die Kurden in der Türkei gesammelt haben, vor dem Sommer 2015, bevor die Regierung in Ankara die Friedensgespräche abbrach und die Waffen sprechen ließ. »Eine Form von Autonomie«, sagt Ercan Ayboğa. De facto, nicht de jure, weil der Gesetzgeber nichts wissen wollte von Selbstverwaltung und Doppelspitzen, von Stadtteilräten und Stadtteilhäusern, von Delegierten, die entscheiden, was der Apparat zu tun hat. »Es hat Jahre gedauert, bis wir einen Modus gefunden haben. Wie viele gewählte Vertreter, wie viele Menschen aus den sozialen Bewegungen, aus NGOs, von den Gewerkschaften? Wie bringen wir die Verwaltung dann dazu, Dinge umzusetzen, zu denen sie gesetzlich gar nicht verpflichtet ist? Ein großes Problem war der Kapitalismus. Es ist wahnsinnig viel Geld nach Nordkurdistan gekommen in den letzten 15 Jahren. Die Leute wollen investieren. Da stört es, wenn zu viele mitreden.«
Grenzen überwinden: Wie eine Nation geschaffen wird
Man könnte ein eigenes Buch schreiben über das, was da im Südosten der Türkei gerade läuft, und über die Hoffnungen, die Ercan Ayboğa trotzdem hat. »Wenn der Krieg aufhört, dann würde es schnell gehen mit dem Wiederaufbau. Innerhalb eines Jahres. Viele Menschen sind ja noch da. Die Frauenbewegung, die Ökologiebewegung. Das Bewusstsein ist noch da, auch wenn viele im Gefängnis sind.« Man könnte ein Buch nur über Rojava schreiben. Über die Utopie und über das, was dort wirklich passiert. Über junge Leute zum Beispiel, die von jetzt auf gleich mehr verdienen und besser leben wollen und deshalb fortgehen. Oder über Gleichaltrige, die Lehrer werden, obwohl ihre Eltern Kurdisch oft nicht schreiben und manchmal auch nicht sprechen können. Rojava würde schon deshalb ein Buch füllen, weil dieser Name bis nach Kassel strahlt, bis ins Sandershaus. Eine Insel der Demokratie im Meer der Krieger, Fundamentalisten, Dschihadisten. Ein Hoffnungsschimmer für Menschen wie den Studenten Jan, die DKP wählen, weil ihnen selbst die Linkspartei zu tief drinsteckt in dem System, das Geld und Wohlstand vermehrt und dabei die Welt zerstört.6 »Rojava muss unterstützt werden«, sagt Ercan Ayboğa. »Sonst gibt es keine halbwegs demokratische Lösung für die Region. Sonst gibt es dort nur noch Nationalisten und Islamisten.«
Die kurdische Frage ist größer als Rojava. Kurdistan gehört zusammen, selbst wenn Aktivisten wie Ercan Ayboğa sagen, dass sie keinen kurdischen Staat brauchen und wollen. Rojava ist nicht denkbar ohne das, was gerade in der Türkei und im Irak passiert und schon gar nicht ohne die Geschichte von Unterdrückung und Rebellion. Kardo Bokani, ein Politikwissenschaftler, geht einen Schritt weiter und sagt, dass das kurdische Nationalbewusstsein relativ jung sei, ermöglicht erst durch Internet und Satellitenfernsehen.7 Was uns als kurdische Geschichte präsentiert wird, ist in dieser Lesart nur das Futter, das jede gute Story braucht. Bokani ist selbst ein Propagandist der kurdischen Sache. Er erzählt von Bergen, Tälern und Schluchten, von einer Geografie, die lange verhindert habe, dass man sich trifft, miteinander spricht und so weiß, dass man zusammengehört. Keine Nation ohne Austausch. Keine Nation ohne ein dichtes Kommunikationsnetzwerk und (mindestens genauso wichtig) keine Nation ohne Orte, wo man die anderen Mitglieder sehen und körperlich spüren kann.
Normalerweise sorgen Staaten selbst für diese beiden Voraussetzungen: Sie bauen Straßen und Eisenbahnnetze, sie verordnen Zugehörigkeiten (etwa über Verwaltungen oder Schulen), sie regulieren Massenmedien oder besitzen diese gleich selbst (mindestens das Fernsehen). Benedict Anderson hat das Lesen von Zeitungen als »außergewöhnliche Massenzeremonie« beschrieben: Man sitzt zwar meist irgendwo allein mit seinem Blättchen, aber weiß doch, dass viele andere (fast) zur gleichen Zeit dasselbe lesen.8 Zeitungen ließen die Vielfalt der Sprachen und Dialekte schrumpfen, um möglichst viele Leser zu erreichen, und machten so das möglich, was Anderson als Nation definiert: eine »vorgestellte Gemeinschaft«, der die Medien unaufhörlich sagen, wer alles dazugehört und was es außerhalb dieser Gemeinschaft sonst noch so gibt.
Was das mit den Kurden zu tun hat? Vorhin im Kurdischen Kulturzentrum, als sich Ercan Ayboğa auf seinen Vortrag vorbereitet hat, lief Sterk TV im Hintergrund. Schrille Bilder, irgendeine Seifenoper. Egal. Die Kurden sehen dieses Programm. Sie sehen Kurden, die vielleicht eine andere Sprache sprechen, aber die gleichen Feste feiern, die gleichen Lieder singen. Ab wann sagt man zu einer Gruppe von Menschen Volk oder Nation? Die Wissenschaft ist sich da nicht einig, wie so oft. Heilige Orte braucht es, meinen manche. Ein Territorium, eine gemeinsame Kultur.9 Vor allem aber braucht es eine Sprache. Eine kurdische Einheitssprache gibt es nicht. Wird es nie geben. Wer Kurmandschi spricht (wie die meisten Kurden, die in der Türkei und in Syrien leben), versteht Sorani- (Iran, Irak) und Zazaki-Sprecher (Türkei, Diaspora) nur schwer. Grammatikalisch ist der Abstand so groß wie zwischen dem Deutschen und dem Holländischen.10
Also Satellitenfernsehen. Med TV, der erste kurdische Sender, gegründet 1994 in Großbritannien, erzählt schon mit seinem Namen eine nationale Geschichte: die der Meder, die lange vor Christus in Mesopotamien ein Reich gründeten und von manchen (auch von Kardo Bokani) heute als Vorfahren der Kurden gesehen werden. Und dann erst das, was da gesendet wurde. Trickfilme, ins Kurdische übersetzt. Foren zu nationalen Fragen, die vorher tabu waren, mit Anrufern, zu denen auch Abdullah Öcalan gehörte. Vielleicht noch wichtiger: das Nebeneinander der kurdischen Sprachen und Dialekte und entsprechenden Lerneffekte.11 Med TV hat 1999 seine Lizenz verloren, wie viele Nachfolger auch.12 Druck aus Ankara. Das nächste Kapitel wird zeigen, dass der türkische Staat seit seiner Gründung 1923 alles getan hat, um genau das zu verhindern, was die Kommunikationsrevolution ans Licht brachte: eine kurdische Nation. Was einmal online ist, lässt sich schwer kontrollieren und noch schwerer löschen.
Machmur, Südkurdistan, 2017: Newroz-Fest Foto: Kerem Schamberger
Machmur, Südkurdistan, 2017: »Apo« steht für Abdullah Öcalan Foto: Kerem Schamberger
Dass tatsächlich eine »vorgestellte Gemeinschaft« entstehen konnte, hat bei Kardo Bokani noch einen zweiten Grund: die Straße. Von der PKK umfunktioniert zu einem Ort, an dem sich Kurden begegnen können. Das beginnt mit Newroz, dem Neujahrsfest, wie die Meder ein Anker in der Erzählung über die kurdische Nation. Einst privat gefeiert und daheim, ist der 21. März seit den frühen 1990er Jahren ein Event, oft von kolossalen Dimensionen. Bei Bokani im gleichen Atemzug genannt: Märtyrerumzüge in der Türkei, die großen Demonstrationen in Westeuropa (allein in Bonn 1995 mit rund 200 000 Teilnehmern), Kulturfestivals. Die Straße habe dafür gesorgt, dass es bei der Diaspora und Kurdistan nicht einfach nur um Erinnerungen gehe, sondern um das Hier und Jetzt.13
So gesehen, hat sich die Fahrt nach Kassel für Ercan Ayboğa gelohnt. Er sei ein Vermittler, sagt er. Ein Aufklärer. Teil der kurdischen Freiheitsbewegung, solidarisch. »Aber schon auch kritisch. Ich will ja keine Propaganda machen. Das merken die Menschen.« Morgen wird er in der Schweiz sprechen und übermorgen wieder woanders. Verstehen, was in der Türkei passiert und was in Rojava, und das dann weitergeben. Westeuropa über das informieren, was nicht in den Zeitungen steht. Genau das will auch dieses Buch.
2 Die kurdische Frage, von Duisburg aus gesehen
Ismail Küpeli hat Jonas mitgebracht. Es sind noch Ferien in Duisburg. Jonas ist blond und hat ein Buch dabei. Im Tal der Dinosaurier. Er kennt das auswendig, aber man weiß ja nie. Wird vielleicht langweilig, wenn die Erwachsenen reden. Sein Vater wird ihn dann einmal kurz fortschicken aus dem kleinen Garten, hinein zum Wirt. Jonas soll diese Sachen nicht hören, noch nicht. Er kommt erst in die vierte Klasse.
Vielleicht hätten wir doch zurückgehen sollen bis zu den Gründungsmythen, die sich die Kurden erzählen. Nicht ganz bis zu den Dinosauriern, aber fast. In einer dieser Geschichten gibt es einen Drachenkönig, Sohak, Herrscher im Land Schahrazur, der jeden Tag zwei Kinderhirne fordert. Seine Untertanen können da nicht viel machen, denn dieser Sohak hat Schultern, aus denen Schlangen wachsen. Eine rechts und eine links, für jede ein Kinderhirn am Tag. Nicht ganz so gut sind offenbar Sohaks Augen und sein Kopf. Jedenfalls merkt er nicht, dass ihm die Menschen in seinem Palast hin und wieder Lammhirn unterjubeln. Kinder gerettet, in die Berge geschickt und dort ein Volk gegründet: die Kurden. Dieser Sohak wird übrigens von einem Schmied erschlagen, von Kawa, der all seine Lieben an den Drachenkönig verloren hatte und mit dem neuen Bergvolk ausgezogen war, das Monster zu töten. Die Kurden wissen auch, wann Kawa zum Hammer griff: am 21. März im Jahr 612 vor unserer Zeit.1 Die Saurier sind da schon fort, wie man weiß, aber Jonas hätte diese Geschichte bestimmt gefallen, zumal sie auch von den Freudenfeuern handelt, die die frohe Kunde vom Tod des Tyrannen überall verbreiten.
Die Kurden feiern am 21. März Newroz, ihr Neujahrsfest, ihr Frühlingsfest. Mit Feuer, wie sonst. Der Tag des Neuanfangs, der Tag, an dem Sohak starb, der Tag auch, an dem die Meder Ninive erobert und zerstört haben sollen, die Hauptstadt der Assyrer am Tigris, fast dort, wo heute Mossul liegt, die größte Stadt, die der Islamische Staat je kontrolliert hat. Das mit den Medern ist so eine Sache und das mit Sohak, dem Drachenkönig, natürlich erst recht. Geschichte verspricht Legitimation, eine lange und ruhmreiche Geschichte vor allem. Die Meder haben lange geherrscht in der Region, die heute teilweise Iran heißt und teilweise Irak. Die »Herren von Asien«, schreibt Kardo Bokani.2 Solche Vorfahren wünscht sich jeder. Nur: So ganz genau kann das niemand wissen. Was Archäologen finden, kann von diesem Stamm sein oder von jenem, und was später aufgeschrieben wurde, von Herodot zum Beispiel, könnte wie das Dinosaurier-Buch von Jonas gut und gern in der Reihe Das magische Baumhaus erscheinen, mit ein paar hübschen Bildern, versteht sich.
Machmur, Südkurdistan, 2017: Newroz-Demonstration Foto: Kerem Schamberger
Machmur, Südkurdistan, 2017: Newroz-Feuer Foto: Kerem Schamberger
Nationen sind nicht einfach da. Nationen werden geschaffen. Nationen sind ein »kulturelles Produkt«, entstanden Ende des 18. Jahrhunderts, als Bücher (richtige Bücher) alte Gewissheiten verschwinden ließen. Dass Herrschaft naturgegeben ist zum Beispiel und von Gottes Gnaden oder dass die Gelehrten die Wahrheit gepachtet haben. Benedict Anderson hat die Nation als »Erfindung« beschrieben, als eine Gemeinschaft, die sich vor allem auf Sprache stützt, auf eine gemeinsame Sprache, und als ein »Produkt unserer Vorstellungskraft«.3 Das stimmt, einerseits, weil keine Deutsche alle anderen Deutschen kennt und auch niemals kennenlernen wird. Die deutsche Nation gibt es nur in unseren Köpfen. Andererseits verwischen Begriffe wie »Erfindung« oder »Vorstellungskraft« den Link zur Macht. Das Interesse, das die Herrschenden an der Idee haben, es gebe so etwas wie einen »kameradschaftlichen Verbund von Gleichen«, trotz aller sozialer Ungleichheit, trotz aller Ausbeutung des einen durch den anderen. Die Nation: Dafür ziehen Menschen in den Krieg und sterben. Einfache Menschen. Die Nation weist über uns selbst hinaus in alle Ewigkeit. Eine Gemeinschaft, die selbstlos zu sein scheint, so natürlich wie die eigene Hautfarbe. Man wird als Frau geboren, weiß, Ende des 20. Jahrhunderts. Und als Deutsche, Russin, Kurdin. Kein Neugeborenes wählt bewusst die Nation, zu der es gehört. Nationen werden von oben geschaffen, sagt Eric Hobsbawm (von Staaten, von charismatischen Führern, von intellektuellen Eliten), müssen aber trotzdem von unten analysiert werden, weil sich die Hoffnungen, Interessen und Bedürfnisse der kleinen Leute mit ihnen verbinden. Wenn Sohak zur Universität gegangen wäre, dann hätte er wahrscheinlich eine Nation erfunden und kein Hirn fressen wollen.4
Machmur, Südkurdistan, 2017: Newroz-Feuer Foto: Willi Effenberger
Die Geschichte des Volkes, das von den Medern abstammt und vielleicht sogar von Kindern geschaffen wurde, die einem Ungeheuer entkamen, ist eine schöne Geschichte. »Eine der ältesten Gemeinschaften der Welt«, schreibt Kardo Bokani über sein Volk. Kurdistan: Das sei das Zweistromland. Der Ort, an dem Ackerbau und Viehzucht erfunden wurden. Der Ort, an dem das anfing, was wir Zivilisation nennen, an dem später Babylon stand und an dem sich die großen Handels- und Verkehrswege des Altertums kreuzten.5




























