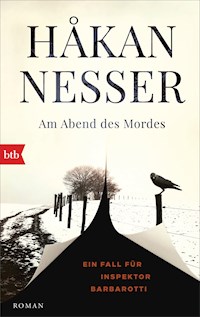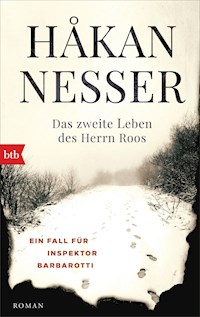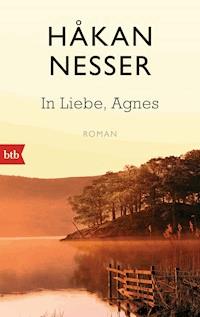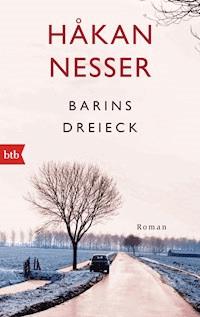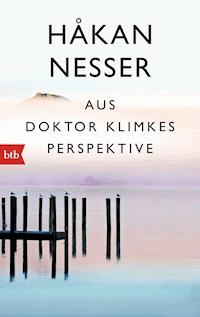10,99 €
Mehr erfahren.
Vorgestern beschloss ich, meinen Hund zu überleben. Das bin ich ihm schuldig …
Exmoor, eines Abends im November. Über dem kleinen Dorf Winsford in der südenglischen Moorlandschaft liegt dichter Nebel. Die mysteriöse Frau, die sich unter dem Namen Maria Anderson mit ihrem Hund im abseits gelegenen Haus auf der Heide niederlässt, bietet Stoff für Spekulationen. Was hat sie hier draußen in der Einöde zu suchen? Was hält ihr Mann von ihrem Aufenthalt an diesem Ende der Welt? Wo ist er überhaupt? Tatsächlich auf Reisen?
Irgendetwas Sonderbares umgibt die Fremde, die Tag für Tag im diesigen Nieselregen spazierengeht – auch wenn sie schon bald aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken ist. Nicht alle scheinen ihr jedenfalls wohlgesonnen. Wie anders wäre sonst zu erklären, dass plötzlich tote Vögel vor ihrer Türe liegen und ihr Hund tagelang verschwindet? Und die seltsamen Vorfälle häufen sich. Man könnte auch sagen: Je mehr sie sich auf die kleine Gemeinschaft einlässt, desto gefährlicher wird es für sie …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
HÅKAN NESSER
Die Lebenden und Toten von Winsford
ROMAN
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
»Für die Heide gilt, dass ihr im Wesentlichen Anfang und Ende fehlt. Von all den anderen Dingen, die man in dieser himmlischen Landschaft nicht finden wird, möchte ich drei erwähnen: Sackgassen, Ausflüchte sowie nicht zuletzt – Worte.«
Royston Jenkins (1866–1953),Gastwirt in Culbone
»… die teilnahmslose Wässrigkeit in einem Auge, das etwas vergessen wollte und deshalb schließlich alles vergaß.«
Roberto Bolaño: Amuleto
I.
1
Vorgestern beschloss ich, meinen Hund zu überleben. Das bin ich ihm schuldig. Zwei Tage später, also heute, beschloss ich, in Wheddon Cross ein Glas Rotwein zu trinken.
So schlage ich mich dieser Tage durch die Zeit. Ich fasse Beschlüsse und setze sie in die Tat um. Das ist nicht sonderlich schwierig, aber schwieriger als gedacht, was natürlich den besonderen Umständen geschuldet ist.
Der Regen hatte mich auf der ganzen Strecke durch die Heide begleitet, schon seit ich bei Bishops Lydeard von der A 358 abgefahren war, und die rasch einsetzende Abenddämmerung ließ in mir Tränen hervorquellen wie erkaltete Lava. Eine fallende Bewegung, eine ansteigende, aber vielleicht waren diese Tränen ja ein gutes Zeichen. Ich habe viel zu wenig geweint in meinem Leben, worauf ich noch zurückkommen werde.
Gegen eins war ich in London aufgebrochen, und nachdem ich mich durch Notting Hill und Hammersmith gequält hatte, war die Fahrt besser verlaufen als erwartet. Westwärts ging es, auf der M 4 durch Hampshire, Gloucestershire und Wiltshire, zumindest bilde ich mir ein, dass diese Grafschaften so heißen, und etwa zwei Stunden später ging es dann hinter Bristol auf der M 5 in Richtung Süden. Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass all diese Straßen ihre eigenen Nummern haben – und alle Orte ihre eigenen Namen –, aber dass man dies so empfindet, ist wahrscheinlich weniger beruhigend.
Besser als erwartet trifft es eventuell nicht ganz, aber meine Sorge, mich zu verfahren, die falsche Abfahrt zu nehmen und in deprimierenden Autobahnstaus in falschen Richtungen zu landen und deshalb nicht pünktlich anzukommen, hatte mich einen guten Teil der Nacht wachgehalten. Für die restliche Nacht übernahm das die alte Geschichte vom Liebhaber von Martins Schwester. Ich habe keine Ahnung, warum sie und er auftauchten, aber so war es. In den frühen Morgenstunden ist man so wehrlos.
Ich bin keine routinierte Autofahrerin, es hat sich so ergeben. Ich erinnere mich, dass ich in jungen Jahren fand, es sei mit einem gewissen Freiheitsgefühl verbunden, am Steuer zu sitzen und Herrin – oder eventuell Herrscherin – über sein Schicksal und seine Wege zu sein. In den letzten fünfzehn, zwanzig Jahren ist aber ausnahmslos Martin gefahren, und es ist lange her, dass sich überhaupt die Frage stellte, wer bei gemeinsamen Autofahrten auf dem Fahrersitz Platz nehmen sollte. Und für diese Navigationssysteme hatte er immer nur verächtliches Schnauben übrig.
Gibt es etwa keine Karten mehr? Was soll denn plötzlich an einer ehrenwerten Straßenkarte so verkehrt sein?
Und zu allem Überfluss der Linksverkehr in diesem alten, sturen Land, wodurch mir die Gefahr, dass die Sache auf irgendeine Weise gründlich schieflaufen könnte, ziemlich groß erschien. Aber es war alles gut gegangen. Ich hatte sowohl Londons Hexenkessel aus veralteten Verkehrslösungen als auch das Elend Autobahn bezwungen. Es war mir problemlos gelungen, zu tanken und in bar zu zahlen, und erst als ich auf die schmale Achterbahnstraße durch Exmoor gelangte, holte mich die Schwermut ein. Ich hielt dennoch auf keinem Parkplatz, um meinem schwerer werdenden Herzen neuen Mut zuzusprechen, was mir möglicherweise gutgetan hätte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt einen Parkplatz sah.
Aber da nach wie vor fast alles, was in diesem Land namentlich auf einer Karte auftaucht, auch einen Pub hat, parkte ich um kurz nach halb fünf neben einem weißen Lieferwagen mit dem Schriftzug »Peter’s Plumbing« an der Tür auf einem auffallend verlassenen Parkplatz neben einem auffallend verlassenen Kricketfeld. Eilte unter das schützende Dach, ohne dass Zeit für Reue oder Nachdenken gewesen wäre.
Also Wheddon Cross. Nie zuvor hatte ich meinen Fuß dorthin gesetzt, niemals von diesem Ort gehört.
Doch, ich dachte kurz darüber nach, erst eine kurze Runde mit Castor zu drehen, vor diesem Glas Wein, das tat ich wirklich. Aber er hält nicht viel von Regen und war anderthalb Stunden zuvor an unserer Tankstelle draußen gewesen. Ich glaube nicht einmal, dass er den Kopf hob, als ich die Autotür öffnete und wieder schloss. Er ruht sich gerne aus, mein Castor, und wenn es sich ergibt, kann er durchaus fünfzehn, sechzehn Stunden am Tag schlafen.
Das Lokal hieß The Rest and Be Thankful Inn. Außer von der blondierten Bedienung hinter der Bar mit dem üppigen Busen (in meinem Alter, vielleicht auch etwas jünger) wurde es an diesem späten Novembernachmittag von zwei Menschen bevölkert: einer spröden, Tee trinkenden, alten Dame mit einem Kreuzworträtsel sowie einem übergewichtigen, etwa dreißigjährigen Mann in einem Blaumann und mit schmutziger Baseballkappe. Ein leicht verschnörkeltes PP auf deren Schirm, das Bierglas festgewachsen in einer kräftigen Pranke auf dem Tisch. Ich nahm an, dass dies der fahrende Klempner war, aber weder er noch die Kreuzworträtselfrau blickten auf, als ich eintrat.
Was Bar-Blondie hingegen tat. Zwar erst, nachdem sie zunächst sorgsam das bauchige Glas in ihrer Hand abgetrocknet und auf einem Regal vor sich abgestellt hatte – aber immerhin.
Ich bestellte ein Glas Rotwein, sie fragte, ob ein Merlot recht sei, und ich erwiderte, das passe ausgezeichnet.
»Ein großes oder ein kleines?«
»Ein großes, bitte.«
Es ist möglich, dass sowohl PP als auch die Kreuzworträtsellöserin hierbei eine Anzahl von Augenbrauen hoben, doch war dies etwas, das ich auf die gleiche Art registrierte, wie man etwa den Flügelschlag eines Schmetterlings hinter seinem Rücken wahrnimmt.
»Es regnet«, stellte Blondie beim Einschenken fest.
»Ja«, erwiderte ich. »Das tut es weiß Gott.«
»Regen, Regen, Regen.«
Dies sagte sie in einem singenden Tonfall, und ich nahm an, dass es der Refrain eines alten Gassenhauers war. Ich weiß nicht, warum ich das Wort »Gassenhauer« wähle, schließlich bin ich nicht älter als fünfundfünfzig, aber es gibt gewisse Begriffe, die mein Vater regelmäßig benutzte, und mir ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit dazu neige, sie selbst zu verwenden. Tipptopp. Braut. Anderthalb, wie dem einen oder anderen aufgefallen sein mag.
Ich bekam mein Glas und setzte mich an einen Tisch, auf dem eine kleine Broschüre über Wanderwege in der näheren Umgebung lag. Um etwas zu haben, worauf ich den Blick richten konnte, tat ich so, als würde ich mich in sie vertiefen. Am liebsten hätte ich mein Weinglas in drei großen Schlucken geleert und wäre weitergefahren, aber es lag nicht in meiner Absicht, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Vielleicht würde ich in Zukunft zu diesem Pub zurückkehren – auch wenn die Tatsache, dass ich ausgerechnet hier Halt gemacht hatte, eigentlich gerade darauf hinauslief: nicht zurückzukehren. Eine einsame, fremde Frau reiferen Alters, die nachmittags hereinschaut und ein großes Glas Wein trinkt, hinterlässt in einem kleinen Dorf zweifellos Spuren. So lauten die Bedingungen, und wenn man keine Dichterin oder Künstlerin ist, macht es wenig Sinn, blind dagegen anzurennen. Ich bin weder das eine noch das andere.
Außerdem war Wheddon Cross nicht mein Dorf. Mein Dorf heißt vielmehr Winsford und müsste laut der Broschüre vor mir etwa ein halbes Dutzend Meilen weiter südlich liegen. Im dortigen Pub wird es wichtig sein, sich nicht danebenzubenehmen. Dort werde ich unter Umständen ein wiederkehrender Gast sein und mit meinen Mitmenschen Worte wechseln und Gedanken austauschen. Jedenfalls hatte ich eine solche Überlegung angestellt, und nach dem ersten Schluck konnte ich mich darüber freuen, dass sich die kalten Lavatränen offenbar zurückgezogen hatten. Rotwein besitzt eine samtweiche Seite, die mich zur Alkoholikerin machen könnte, aber ich habe nicht vor, mich in diese Richtung zu bewegen.
Ich habe generell nur eine vage Auffassung von Richtungen. Auch das hat sich so ergeben, und wie alles in einem halben Jahr aussehen wird, ist eine Frage von fast schon lachhafter Unberechenbarkeit. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschen Leben.
Wie man so sagt.
Die Abenddämmerung hatte sich in den zwanzig Minuten, die ich im The Rest and Be Thankful Inn verbracht hatte, zu Dunkelheit verdichtet, und der Regen war vorübergehend abgezogen. Ich gab Castor ein Leckerchen – getrocknete Leber, seine geheime Leidenschaft – und konsultierte die Karte. Fuhr vom Parkplatz auf die Straße und nahm die A 296 in Richtung Dulverton, bis nach einigen Meilen kurviger Fahrt rechterhand eine Straße und ein Schild auftauchten: Winsford 1. Diese neue Straße verlief durch ein schmales Tal, wahrscheinlich parallel zum Fluss Exe, der, wenn ich es recht sah, der ganzen Heidelandschaft ihren Namen gegeben hatte, doch der Flusslauf war vor dem Autofenster nicht mehr als eine schüchterne Ahnung. Oder wie ein Atemhauch oder ein sehr zurückgezogen lebendes Wesen: Es fiel nicht weiter schwer, sich in dieser fremden, unsichtbaren Landschaft, in der sich jetzt auch Nebel bildete, düsteren Fantasievorstellungen hinzugeben, und als meine Scheinwerfer die ersten Gebäude am Dorfrand einfingen, empfand ich eine fast primitive Erleichterung. Ich fuhr am örtlichen Lebensmittelladen, der zugleich Postamt war, vorbei, bog links ab und parkte, den Anweisungen folgend, die ich erhalten hatte, vor einem Kriegerdenkmal zu Ehren der Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Nahm Castor über eine schlichte Holzbrücke und ein fließendes Gewässer mit, lokalisierte vor dem unruhigen, bleidurchsetzten Himmel, nun plötzlich frei von Nebel, einen Kirchturm und ging eine Dorfstraße namens Ash Lane hinauf. Kein Mensch in Sicht. Gleich hinter der Kirche klopfte ich an eine blaue Tür in einem flachen Feldsteinhaus, und zehn Sekunden später wurde dieselbe Tür von Mr Tawking geöffnet.
»Miss Anderson?«
Das war der Name, den ich angegeben hatte. Ich weiß nicht, warum ich mich ausgerechnet für den Mädchennamen meiner Mutter entschieden hatte, möglicherweise aus dem einfachen Grund, dass ich ihn nicht vergessen würde. Anderson außerdem nur mit einem s, was in diesem Land die übliche Schreibweise war. Mr Tawking bat mich mit einer schlichten Handbewegung hinein, und wir ließen uns an einem flachen, dunklen Holztisch neben einem künstlichen Gaskaminfeuer in Sesseln nieder. Eine Teekanne, zwei Tassen, ein Teller Kekse, das war alles. Sowie zwei Schlüssel an einem Ring auf einem Blatt Papier; ich begriff, dass es der Mietvertrag sein musste. Er goss Tee ein, strich Castor über den Rücken und forderte ihn auf, sich vor der Feuerstelle ins Warme zu legen. Castor folgte seiner Anweisung, und es war unverkennbar, dass Mr Tawking in seinem Leben viel mit Hunden zu tun gehabt hatte. Momentan sah ich allerdings keinen. Mr Tawking war gebeugt und alt, sicher einiges über achtzig, vielleicht hatte er einen vierbeinigen Freund gehabt, der vor einem Jahr gestorben war, und vielleicht hatte er gespürt, dass es zu spät war, sich einen neuen anzuschaffen. Hunde sollten ihre Besitzer nicht überleben, zu diesem Schluss war ich immerhin erst kürzlich selbst gekommen.
»Sechs Monate ab gestern«, meinte Mr Tawking. »Vom ersten November bis zum letzten Tag im April. Tja, geben Sie mir nicht die Schuld.«
Er versuchte sich an einem Lächeln, aber seine Muskeln kamen nicht richtig mit. Vielleicht war es ja lange her, dass er einen Grund gehabt hatte, sich zu freuen, über ihm selbst und dem Raum, in dem wir saßen, hing tiefste Schwermut. Vielleicht hat ihn nicht nur ein Hund verlassen, dachte ich, sondern auch eine Ehefrau. Ehefrauen sollten ihre Männer wahrscheinlich überleben, was allerdings ein ganz anderes Thema war, und in der gegenwärtigen Situation hatte ich keine Lust, mich mit ihm zu beschäftigen, beim besten Willen nicht. Der Teppichboden war abgetreten und schmutzig, hielt ich stattdessen fest, die großgemusterte Tapete hatte Stockflecken, und aus irgendeinem Grund saß in der oberen rechten Ecke des Fernsehbildschirms ein kleiner Streifen rotes Klebeband. Ich spürte, dass ich diesen Ort möglichst schnell hinter mir lassen wollte. Meine eigenen düsteren Gefühle bedurften wahrlich keiner zusätzlichen Ermunterung, und nach weniger als einer Viertelstunde hatte ich den Vertrag unterschrieben, die vereinbarte Miete für ein halbes Jahr bezahlt, 3000 Pfund in bar (zusätzlich zu den 600, die ich zwei Tage zuvor an seine Bank überwiesen hatte), und die Schlüssel erhalten. Wir hatten keine anderen Themen als das Wetter und praktische Fragen berührt.
»Auf der Spüle liegt ein Leitfaden. Er ist natürlich eigentlich für Sommerurlauber gedacht, aber wenn etwas ist, werden Sie eben bei mir vorbeischauen oder mich anrufen müssen. Meine Nummer steht auch darin. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Feuer machen.«
»Kann man da oben mit dem Handy telefonieren?«
»Kommt auf Ihren Anbieter an. Sie können es auf dem Hügel auf der anderen Straßenseite versuchen. Da hat man eigentlich immer Empfang. Wo diese Frau begraben liegt und rundherum. Diese Elizabeth.«
Wir gaben uns die Hand, er strich Castor über den Rücken, und wir verließen ihn.
Hund und Frauchen kehrten auf der Ash Lane zu Denkmal und Auto zurück. Es war stürmisch geworden, der Wind zerrte und zog an Lärchen und Telefonleitungen, aber der Regen hielt sich fern. Der Nebel gestattete einem höchstens dreißig Meter freie Sicht. Weiterhin kein lebendes Wesen außer uns. Castor sprang auf seinen Platz im Wagen, und ich gab ihm noch ein Leber-Leckerchen. Ich wechselte einige beruhigende Gedanken mit ihm und versuchte, so gut es ging, die Fragen in seinen bekümmerten Augen auszulöschen. Danach nahmen wir vorsichtig die andere Straße durch das Dorf.
Halse Lane. Nach nur fünfzig Metern kamen wir am Dorfpub vorbei. Er hieß The Royal Oak Inn und war mit einem prächtigen, dicken Strohdach gedeckt, ein matter Lichtschein glomm durch die Fenster auf die Straße hinaus. Unmittelbar dahinter, wenngleich auf der gegenüberliegenden Seite, lag ein stillgelegtes Hotel namens Karslake House mit dunklen, akkurat angeordneten Fensterrechtecken.
Danach hörten sowohl die Bebauung als auch die Straßenbeleuchtung auf. Die Straße wurde noch enger als zuvor, war gerade einmal breit genug für ein Fahrzeug, aber in den sieben oder acht Minuten, die es dauerte, durch enge und schwer zu fahrende Kurven nach Darne Lodge hinaufzukommen, begegneten wir keinem einzigen Auto. Außerdem wurde die Sicht von hohen, uralten Gras- und Steinwällen versperrt – außer auf den letzten Metern, als sich die Heide urplötzlich in alle Richtungen ausbreitete, kurz erhellt von einem Vollmond, dem es gelungen war, für Sekunden die Wolken und Nebelschwaden zu verdrängen. Die Landschaft bekam auf einmal etwas Vergeistigtes, wie ein altes Gemälde – Gainsborough oder Constable vielleicht? Oder warum nicht Caspar David Friedrich?
Friedrich ist immer Martins Lieblingskünstler gewesen, schon als wir uns kennenlernten, hing ein Kunstdruck von Der Mönch am Meer in seinem Büro, und ein dubioses Gefühl von Grauen und Erleichterung durchströmte mich, als ich aus dem Wagen stieg, um das Tor aufzustoßen. Vielleicht hatte mich diese unheilige Allianz, die Dunkelheit und das Licht, aber auch schon seit jenem Strand außerhalb von Międzyzdroje begleitet.
Międzyzdroje, ich kann es nach wie vor nicht korrekt aussprechen, aber die Schreibweise stimmt, das habe ich überprüft. Mittlerweile sind es elf Tage: ein sicher schwer zugänglicher Zeitraum, in dessen Verlauf sich die unschönen Erstickungsgefühle trotz allem mit jedem neuen Morgen, jedem neuen Entschluss ein wenig abgeschwächt hatten; jedenfalls war das eine Vorstellung, der ich mich liebend gerne hingab.
Ich beschloss, mich ihr weiter hinzugeben.
Und sobald ich in Darne Lodge erst einmal ein Kaminfeuer und den Strom eingeschaltet und mir ein, zwei Gläser Portwein einverleibt hatte, lag an diesem Ort natürlich ein Ozean aus Stillstand vor mir. Sechs Monate Winter und Frühling in der Heide. Ohne eine andere Gesellschaft als Castor, mein eigener, alternder Körper und meine verirrte Seele. Ein Tag wie der andere, eine Stunde unmöglich von der vorherigen oder nächsten zu unterscheiden, nun ja, soweit ich überhaupt begonnen hatte, mir ein Bild von diesem kommenden Halbjahr zu machen, sah es zumindest so aus. Ein Eremitendasein aus Heilmitteln und Reflexion und Gott weiß was – aber sowohl Castor als auch ich waren gut darin, uns keine Sorgen um das Morgen zu machen, und als wir uns eine Stunde später auf einem Schaffell beziehungsweise in einem Schaukelstuhl vor dem offenen Kamin und seinem zögerlich knisternden Feuer aufhielten, schliefen wir, einer nach dem anderen, umgehend ein.
Es war der zweite November, es kann nicht schaden, das festzuhalten, und wir hatten uns weiter entfernt, als ich es mir je erträumt hätte, und wenn ich recht sah, hatten wir alle Spuren hinter uns verwischt. In dieser beruhigenden Gewissheit zogen wir kurz vor Mitternacht in das mittig durchhängende Doppelbett im Schlafzimmer um. Ich lag noch kurze Zeit wach und schmiedete ein paar vorläufige und praktische Pläne für den nächsten Tag. Lauschte dem Wind, der über die Heide fegte, und dem Kühlschrank, der in der Kombination aus Küche und Wohnzimmer brummte, und dachte, dass die Ereignisse der letzten Monate endlich ihren definitiven Schlusspunkt gefunden hatten. Genau genommen der letzten Jahre.
Noch genauer: meines Lebens, wie es bisher ausgesehen hatte.
2
Ich kann gut verstehen, dass ihr das Bedürfnis habt, wegzukommen«, hatte Eugen Bergman gesagt und uns über den Rand seiner altmodischen Lesebrille hinweg angeblickt. »Wenn man an diese verrückte Frau und das alles denkt. Und das literarische Timing könnte kaum besser sein. Was immer dabei herauskommt, wir werden es verkaufen können.«
Sie sollen nicht davon handeln, was gewesen ist, diese unsortierten Notizen – nur so viel soll gesagt werden, wie nötig ist, um das Gegenwärtige zu verstehen. Falls ich überhaupt Ambitionen hegen sollte, reichen sie jedenfalls nicht weiter. Man schreibt – und liest –, um zu verstehen, so habe ich es mir häufig eingebildet. Es gibt vieles, was ich nie begreifen werde, das hat mir die letzte Zeit mit mehr als wünschenswerter Deutlichkeit gezeigt, aber darf man nicht wenigstens versuchen, die Dinge ein wenig zu beleuchten? Ich habe viel zu spät angefangen, aber irgendetwas muss man ja tun, während man auf den Tod wartet, wie eine meiner Kolleginnen an manchen trüben Montagvormittagen im Affenstall zu sagen pflegte. Aber jetzt schweife ich schon ab, und Worte und Zeiten verrutschen. Zurück zu dem berühmten Verlagshaus am Sveavägen in Stockholm vor ziemlich genau einem Monat. Zu Eugen Bergman.
»Was immer dabei herauskommt?«, entgegnete Martin, als wäre ihm die entgegenkommende Ironie im Tonfall seines Verlegers entgangen. »Darf ich dich daran erinnern, dass ich dieses Material seit nunmehr dreißig Jahren unter Verschluss halte. Wenn eure Zahlenjongleure nicht kapieren, was es wert ist, gibt es woanders genügend andere Zahlenjongleure, die das tun werden.«
»Ich habe doch gesagt, dass wir es veröffentlichen werden«, wehrte Bergman mit dem für ihn typischen schiefen Lächeln ab. »Und du bekommst auch deinen Vorschuss. Was ist denn nur los mit dir, alter Junge? Ich kann dir schon jetzt mit Sicherheit sieben oder acht Übersetzungen versprechen. In England müsste sogar eine Auktion um die Rechte drin sein. Macht ihr euch ruhig auf den Weg, mein Gott, meinen Segen habt ihr. Abgabetermin ist Ende April nächsten Jahres. Aber ich schau mir natürlich auch schon vorher gerne Teile des Manuskripts an, das weißt du.«
»Das kannst du vergessen«, erwiderte Martin und nickte mir zu. »Kein Schwein liest auch nur eine Zeile, bevor die Sache in trockenen Tüchern ist.«
Ich begriff, dass es an der Zeit war, sich zu verabschieden. Wir hatten keine zehn Minuten in dem Büro verbracht, aber die Angelegenheit war natürlich schon im Vorfeld besprochen worden. Bergman ist seit zwanzig Jahren Martins Verleger und als solcher von einer alten, offenkundig aussterbenden Art. Jedenfalls behauptet Martin das immer. Jeder neue Vertrag – nicht, dass es so viele gewesen wären, sechs oder sieben Stück, wenn ich richtig rechne – wird in Bergmans Büro besiegelt. Eine Unterschrift, ein Handschlag, ein Fingerbreit Amaro aus kleinen, verkratzten Espressogläsern, die er in einer Schreibtischschublade aufbewahrt; das ist das übliche Prozedere, und so lief es auch an diesem Freitagnachmittag Anfang Oktober ab.
Am sechsten, um genau zu sein. Ein Altweibersommertag, wie er im Buche stand, zumindest in der Gegend um Stockholm. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum Martin auf meiner Anwesenheit bestanden hatte, aber wahrscheinlich sollte dadurch etwas klargestellt werden.
Leicht zu verstehen, was.
Dass wir weiterhin zusammengehörten. Dass die Turbulenzen der letzten Monate nicht in der Lage gewesen waren, das solide Fundament unserer Ehe zu erschüttern. Dass ich hinter meinem Mann stand, oder wo stand eine selbstständige, aber gute Ehefrau sonst? An seiner Seite vielleicht?
Außerdem muss ich gestehen, dass »darauf bestanden« nicht ganz zutrifft. Tatsächlich hatte Martin mich nur darum gebeten, sonst nichts. Eugen Bergman ist seit vielen Jahren ein guter Freund von uns, auch wenn wir seit dem Ableben seiner Frau Lydia 2007 keinen größeren Umgang mehr mit ihm gepflegt hatten. Es war also nicht das erste Mal, dass ich das chaotische Arbeitszimmer am Sveavägen besuchte. Weit gefehlt, und in neun von zehn Fällen hatte ich dort Amaro getrunken.
Als wir aus dem Verlagshaus traten, erklärte Martin, er habe zwei weitere Termine, und schlug mir vor, dass wir uns gegen sechs im Restaurant Sturehof treffen sollten. Wenn ich jedoch lieber nach Hause wolle, könne ich gerne das Auto nehmen, es mache ihm nichts aus, mit der S-Bahn zu fahren. Ich erwiderte, dass ich mich bereits mit dieser Violetta di Parma verabredet hätte, die während unserer Abwesenheit in unserem Haus wohnen sollte – was er übrigens eigentlich hätte wissen müssen, da ich es am Morgen während unserer Autofahrt in die Stadt gesagt hatte –, und dass mir sechs Uhr im Sturehof hervorragend passe.
Er nickte ein wenig geistesabwesend, umarmte mich flüchtig und ging den Sveavägen in Richtung Sergels torg hinunter. Aus irgendeinem Grund blieb ich auf dem Bürgersteig stehen und schaute ihm hinterher, als er sich durch den Strom fremder Menschen pflügte, und ich weiß noch, wie ich dachte, wenn ich während dieses Weihnachtsfests bei seinen grauenvollen Eltern vor dreiunddreißig Jahren nicht zufällig schwanger geworden wäre, dann wäre mein Leben sicher anders verlaufen. Und seines auch.
Aber das war natürlich ein Gedanke, der ebenso banal war wie Zellulitis und weder Trost noch Sinn spendete.
Im Wintersemester 1976 schrieb ich mich am Literaturwissenschaftlichen Institut der Universität ein. Ich war neunzehn Jahre alt, und gemeinsam mit mir schrieb sich mein Freund und meine erste Liebe Rolf ein. Ich studierte zwei Semester Literaturwissenschaft, und vielleicht hätte ich das Studium fortgesetzt, wenn Rolf im darauffolgenden Sommer nicht verunglückt wäre, aber sicher ist das nicht. Im Laufe des ersten Studienjahres hatten mich immer wieder Zweifel daran beschlichen, ob es wirklich meine wahre Berufung war, Texte mit engstirniger Lupe zu lesen, und obwohl ich die Klausuren ohne größere Probleme bestanden hatte – wenn auch nicht mit Glanz und Gloria –, bildete ich mir ein, dass es andere Arenen gab, in denen sich das Leben abspielen konnte. Oder wie man es nun ausdrücken soll.
Natürlich spielte Rolfs Tod eine entscheidende Rolle. In unserer Beziehung war er der große Literaturliebhaber und Bücherwurm gewesen. Voller Begeisterung hatte er nach sechs Gläsern Wein mitten in der Nacht Rilke und Larkin deklamiert, er hatte mich zu Seminaren beim Arbeiterbildungsverband und im Literaturverein Asynja geschleppt – und er war derjenige von uns, der sein letztes Geld lieber für ein halbes Dutzend gebrauchter Bücher von Ahlin, Dagerman und Sandemose in Rönnells Antiquariat ausgab, als dafür zu sorgen, dass wir am Wochenende etwas Essbares im Haus hatten. Wir kamen nie so weit, eine gemeinsame Haushaltskasse zu führen, aber wenn wir eine gehabt hätten, wären Konflikte vorprogrammiert gewesen.
Mitte August 1977 stürzte Rolf jedoch an einem Schweizer Bergmassiv fünfzig Meter in die Tiefe, so dass sich diese Frage niemals stellte. Ich gab mein Literaturstudium auf, und nach einigen Trauermonaten, in denen ich abwechselnd bei meinen Eltern wohnte und nachts als Rezeptionistin in einem Hotel auf Kungsholmen arbeitete, wurde ich im Januar zu einer Art Medienausbildung am Stadtrand von Stockholm angenommen, und in diesem Stil ging es dann weiter. Eineinhalb Jahre später bekam ich eine Stelle beim Schwedischen Fernsehen, wo bis vor drei Monaten mein Arbeitsplatz gewesen ist – abgesehen von zwei Geburten und dem einen oder anderen freien Projekt.
Es ist schon ein seltsames Gefühl, dass man ein Leben so handlich zusammenfassen kann, aber wenn man die Kindheit sowie alles, was man für bedeutsam hielt, ausklammert, steht dem eigentlich nichts entgegen.
Knapp ein Jahr nach Rolfs Tod ging ich zu einem Gartenfest in Gamla stan, der Stockholmer Altstadt. Es war Mitte Juni 1978; ich hatte mich von einer meiner Kommilitoninnen bei dieser Medienausbildung mitschleifen lassen und lernte an diesem Abend Martin kennen. Eigentlich hatte ich gar nicht mitkommen wollen, und so war es während des gesamten vergangenen Jahres gewesen. Ich trauerte nicht nur um einen Toten, sondern um zwei. Ein alter und ein neuer Todesfall, ich werde später darauf zurückkommen, und die Sache mit der Trauerarbeit lässt sich nicht klar definieren.
Es zeigte sich allerdings, dass ich Martin schon einmal begegnet war.
»Erkennst du mich nicht?«, wollte ein junger Mann wissen, der mit roter Bowle in einem großen Plastikbecher zu mir kam. Er hatte lange, dunkle Haare und Che Guevara auf der Brust. Rauchte Pfeife.
Das tat ich nicht. Ihn erkennen, meine ich.
»Wenn du dir die Frisur und Ernesto wegdenkst«, fügte er hinzu. »Literaturwissenschaft vor einem Jahr. Wo bist du abgeblieben?«
Daraufhin sah ich, dass er Martin Holinek war. Assistent am Institut, zumindest war er das während des Jahres gewesen, in dem ich dort studiert hatte. Wir hatten nur wenige Worte miteinander gewechselt, und er hatte keines der Seminare geleitet, an denen ich teilgenommen hatte, aber als bei mir endlich der Groschen fiel, erkannte ich ihn wieder. Er hatte in dem Ruf gestanden, ein junges Genie zu sein, und ich glaube, Rolf hatte sich häufiger mit ihm unterhalten.
»Die Sache mit deinem Freund«, sagte er jetzt. »Das war natürlich eine schreckliche Geschichte.«
»Ja«, erwiderte ich. »Es wurde alles zu viel für mich. Ich konnte nicht so weitermachen wie geplant.«
»Mein herzliches Beileid«, sagte er. »Bist du denn inzwischen wieder halbwegs auf die Beine gekommen?«
Ich hatte keine Lust, auf seine Frage einzugehen, auch wenn der mitfühlende Ton in seiner Stimme echt klang, so dass ich ihn fragte, was ihn mit den Gastgebern des Fests verbinde. Er antwortete, dass er im selben Häuserblock wohne und die meisten Gäste kenne, woraufhin wir uns über Gamla stan und die Vor- und Nachteile verschiedener Stadtteile Stockholms unterhielten. Vorort gegen Innenstadt und so weiter; wobei es uns auf mir unverständliche Weise gelang, den Aspekt zu umschiffen, dass dies eine Frage der gesellschaftlichen Stellung war und sonst nichts, zumindest ist es mir so in Erinnerung geblieben. Anschließend landeten wir an der langen Essenstafel nebeneinander, und ich merkte zu meiner Verwunderung, dass ich es nett fand. Nicht nur Martin, sondern die ganze Veranstaltung. Die Leute waren fröhlich und anspruchslos, es wimmelte von Kindern und Hunden, und der Frühsommer zeigte sich in all seiner Pracht. Seit dem Unfall war ich nicht besonders gesellig gewesen, war für mich geblieben und hatte meiner Trübsal die Stange gehalten, und ich glaube, es war das erste Mal seit jenem August, dass ich spontan über etwas lachte. Vermutlich über etwas, was Martin gesagt hatte, aber ich erinnere mich nicht mehr.
Dagegen weiß ich natürlich noch, was er mir damals über Griechenland erzählt hat. Schon in der nächsten Woche würde er sich in eine Maschine nach Athen setzen und anschließend die Fähre von Piräus nach Samos nehmen. Zum westlichen Teil von Samos, Südseite. Dort würde er wenigstens einen Monat in einer Art Schriftstellerkommune verbringen, was er bereits im Vorsommer gemacht hatte, und als er mir davon erzählte, begriff ich, dass es für ihn ein Erlebnis gewesen war, das fast alles andere in den Schatten stellte. Natürlich war dort gekifft worden, und es wurden auch verschiedene Arten von Gras geraucht, das gab er unumwunden zu – es versammelten sich dort einige Leute, die ursprünglich aus Kalifornien stammten –, aber Kern des Ganzen blieb trotzdem die literarische Arbeit. Eine Autorenschmiede, wenn man so wollte. An diesem ersten Abend gelang es ihm nicht wirklich zu erklären, was das im Klartext bedeutete, aber die gesamte Kolonie hielt sich in und um ein großes Haus herum auf, das dem englischen Dichter Tom Herold und seiner jungen amerikanischen Ehefrau Bessie Hyatt gehörte. Von diesem Paar hatte ich schon einmal gehört; Herold hatte eine ganze Reihe gefeierter Gedichtsammlungen veröffentlicht, obwohl er nicht sehr viel älter als dreißig sein konnte, und Bessie Hyatts Debütroman Bevor ich stürze war eines der meistdiskutierten Werke des Vorjahres gewesen. Nicht nur in den USA, sondern weltweit. Dass es allgemein hieß, es enthalte zahlreiche Anspielungen auf ihre komplizierte Beziehung zu Herold, machte die Sache nicht uninteressanter.
Natürlich war ich beeindruckt, und natürlich merkte ich, dass Martin Holinek stolz war, Teil eines solch illustren Kreises zu sein. Für einen Literaturwissenschaftler hieß dies immerhin, sich ausnahmsweise an der Quelle aufzuhalten – statt sich durch eine Menge von Diskursen, Analysen und Essays zu ackern, die auf jedem Text und jedem schriftstellerischen Werk von Bedeutung wuchern wie Schimmel in einem schlecht gelüfteten Keller. Ich wusste nicht, worüber Martin am Institut forschte, aber wenn er an einer Dissertation arbeitete, war es wahrscheinlich so, dass er sich mit etwas Schwedischem oder zumindest Nordischem beschäftigte.
Ich fragte ihn wohl nie danach, und als wir zwei Jahre später verheiratet waren und in unserer ersten gemeinsamen Wohnung in der Folkungagatan wohnten, war diese Kommune auf Samos im Grunde das Einzige, was mir von unserer ersten Unterhaltung in Erinnerung geblieben war.
Im Nachhinein sind mir Zweifel gekommen, ob wir überhaupt über so viel anderes gesprochen haben.
Ich bekam einen Job beim Schwedischen Fernsehen, weil ich gut aussah und eine klare Aussprache hatte.
Einer meiner männlichen Chefs – in verwaschenen Jeans, schwarzem Jackett und einem kleidsamen Dreitagebart – fasste das Auswahlverfahren einige Monate später mit diesen Worten zusammen. Er tat es im Anschluss an ein Fest in irgendeiner Stockholmer Kneipe, ich weiß nicht mehr, in welcher, und weil er bei diesem Verfahren seine Finger im Spiel gehabt hatte, war er der Meinung, dass wir ebenso gut in seine Fünfzimmerwohnung im vornehmen Stadtteil Östermalm gehen und eine Weile seinen einmaligen Coltrane-Aufnahmen lauschen könnten. Ich lehnte mit der Begründung ab, dass ich glücklich verheiratet und außerdem schwanger sei, aber wenn mich nicht alles täuscht, wurde mein Platz von einer rothaarigen und fröhlichen Kollegin eingenommen, die ihren Arbeitsvertrag wahrscheinlich auf Grund der gleichen soliden Qualifikation bekommen hatte wie ich.
Jedenfalls wurde der Affenstall mein Arbeitsplatz. So lautete in all den Jahren unsere private Bezeichnung für das Schwedische Fernsehen – seine Universität lief bei uns abwechselnd unter der Bezeichnung »Seniorenheim« oder »Sandkasten«. Ich arbeitete einige Jahre als Nachrichtensprecherin, war jahrelang Moderatorin verschiedener unentbehrlicher Sendungen und ging kurz nach der Jahrtausendwende dazu über, als Produzentin tätig zu sein. Ich hatte zwar noch immer eine saubere Aussprache, aber meine Schönheit hatte zu diesem Zeitpunkt jenen speziellen Reifegrad erreicht, der sich auf dem Bildschirm nicht mehr wohlfühlt. Worüber mich ein anderer männlicher Chef mit kleidsamem Dreitagebart aus gegebenem Anlass aufklärte.
Mein ganzes Leben als Erwachsene bin ich jedenfalls daran gewöhnt gewesen, dass mich wildfremde Menschen grüßen. Im Supermarkt, in der Stadt, in der U-Bahn. Halb Schweden erkennt mich, das ist die bittere Wahrheit, und obwohl Martin die Schlagzeilen im Mai und Juni ganz klar dominierte, das will ich ihm keineswegs streitig machen, spielten mein Name und mein Gesicht zweifellos eine gewisse Rolle für die Einschätzung der Nachricht.
Ich kündigte im Übrigen nicht beim Affenstall. Ich beließ es vielmehr dabei, mich ein Jahr beurlauben zu lassen – ein Antrag, dem kommentarlos und innerhalb von zwei Minuten von Alexander Skarman stattgegeben wurde, dem während der Urlaubszeit zuständigen Entscheidungsträger. Es war Mitte Juli und heißer, als es in einem Haus für namhafte Primaten sein sollte; er roch nach dem Mittagessen nach Riesling und stammte aus einer langgedienten und getreuen Medienfamilie, ohne in irgendeiner Weise ein Mogul oder auch nur halbwegs begabt zu sein. Er trug ein Oberhemd aus Leinen und eine kurze Hose. Die Zeiten haben sich geändert. Sandalen und schmutzige Füße.
Ich hatte für meinen Wunsch, mir freizunehmen, keine Begründung angegeben, was so, wie die Dinge lagen, allerdings auch nicht erforderlich war.
»Ab dem ersten September?«, stellte er lediglich fest.
»Im August habe ich Urlaub«, stellte ich meinerseits fest.
»Du hast einen Namen, das weißt du.«
Ich erwiderte nichts. Er unterdrückte ein Rülpsen und unterschrieb.
Unsere Kinder, Gunvald und Synn, riefen im Laufe des Sommers einige Male an – nicht wiederholte, nur einige Male –, aber es war schon fast Mitte August, bis eines von ihnen uns besuchte. Es war Synn, die zu einem dreitägigen Kurztrip aus New York einflog. »Wirst du Papa jetzt verlassen?«, war das Erste, was sie mich fragte, und in dem gehemmten Wust von Gefühlen, der in ihrer Stimme mitschwang, war es gespannte Erwartung, die ich am deutlichsten heraushörte. Sie und Martin haben sich nie gut verstanden, und ich nehme an, sie betrachtete das, was passiert war, als einen ordentlichen Schwall Wasser auf die Mühlen, die sie gemauert hatte, seit sie in die Pubertät gekommen war.
Aber ich dementierte. Versuchte dabei allerdings nicht besonders überzeugend zu klingen, sagte nur irgendetwas darüber, dass erst einmal ein wenig Gras über die Sache wachsen müsse und dass man dann weitersehen könne. Ich glaube, das hat sie akzeptiert. Ob während der vierundzwanzig Stunden, die sie in unserem Haus verbrachte, ein persönliches Gespräch zwischen Vater und Tochter zustande kam, weiß ich nicht. Martin erwähnte jedenfalls nichts dergleichen, und dass sie nicht noch länger bei uns blieb, fand er mit Sicherheit schön.
Gunvald habe ich seit Weihnachten nicht mehr gesehen; eigentlich hatten wir vorgehabt, auf dem Weg nach Süden einen Zwischenstopp in Kopenhagen einzulegen, um ihn zu besuchen, aber weil das mit Polen dazwischenkam, wurde daraus nichts. Vielleicht war es aber auch gar nicht vorgesehen gewesen, vielleicht gab es eine Abmachung zwischen Martin und Gunvald, manchmal bilde ich mir das ein. Ein Gentlemen’s Agreement, sich nicht von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, was sicher keine schlechte Idee ist; es scheint, dass wir unseren Kindern momentan den größten Gefallen tun, wenn wir sie in Ruhe lassen.
Ich schreibe wir, nehme jedoch an, dass ich das Pronomen zu einem ich kürzen sollte.
Übrigens eventuell für immer in Ruhe, ich gestehe, dass dies eine Frage ist, die in diesem Herbst immer drängender geworden ist. Aber das gilt für viele Fragen. Der Unterschied zwischen einem Tag, einem Jahr und einem Leben ist beachtlich geschrumpft.
3
Der erste Morgen war grau und nasskalt.
Zumindest im Haus war es nasskalt. Im Schlafzimmer stieg einem unverkennbar der Geruch heimisch gewordenen Schimmels in die Nase, aber ich dachte, dass ich schon noch lernen würde, damit zu leben. Das Haus verfügt nur über zwei, allerdings recht große, Zimmer, und die Fenster in beiden gehen in dieselbe Richtung: nach Süden. Dort beginnt die Heide hinter einer schiefen und moosüberwucherten Steinmauer, die das Grundstück in drei Himmelsrichtungen umschließt. Auf der Heide fällt das Gelände dann in einer langgezogenen Senke zu einem Tal hin ab, das vermutlich bis zum Dorf hinunterführt – aber die dicke Nebelwulst, die sich draußen breitgemacht hatte, erschwerte an diesem Morgen eine genauere Beurteilung der Topographie.
Insbesondere vom Kopfkissen aus, es dämmerte erst ansatzweise, und weder Castor noch ich verspürten große Lust, die Decke zur Seite zu schlagen und die relative Bettwärme zu verlassen, die wir in der Nacht gemeinsam erzeugt hatten.
Früher oder später muss jedoch jeder seine Notdurft verrichten, darin bildete auch dieser Morgen keine Ausnahme. Castor hält es zwar ewig aus, aber ich ließ ihn trotzdem hinaus, während ich selbst fröstelnd auf der eiskalten Klobrille saß. Als ich fertig war, wartete er Sitz machend vor der Tür und wirkte leicht vorwurfsvoll, wie er es bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit tut. Ich wischte seine Pfoten trocken und füllte die beiden pastellfarbenen Plastikschalen, die ich am Vorabend unter der Spüle gefunden hatte, mit Futter und Wasser für ihn. Seine angestammten Näpfe lagen noch im Auto, ich hatte es mir erspart, im Dunkeln auszupacken.
Anschließend setzte ich Teewasser auf, und es gelang mir, ein Kaminfeuer zu entfachen; die Unruhe, die hinter meiner Stirn gelegen und gebrodelt hatte, wurde langsam von der Wärme und dem diskreten Gefühl von Gemütlichkeit aufgelöst, das sich trotz allem einzustellen versuchte. Eine Wahrheit weit jenseits vermeintlicher Zivilisation und moderner Irrlichter präsentierte sich: Hält man das Feuer am Leben, dann hält man auch das Leben am Leben.
Das Haus entbehrt ansonsten genau wie sein Eigentümer jeglichen Charmes. Hier gibt es nur das Allernötigste, mehr nicht. Kühlschrank und Herd. Eine Couch, einen Sessel, einen Tisch mit drei Stühlen sowie einen altertümlichen Schreibtisch am Fenster. Einen Schaukelstuhl. Nichts passt zusammen. Ein ziemlich großes Bild von ein paar Ponys auf der Heide hängt schief über der Couch. Ein kleinerer gestickter Wandbehang, sechs schräg wachsende Bäume darstellend, er sieht nach einer Kinderhandarbeit aus.
Und, wie gesagt, die funktionierende Feuerstatt. Gott sei Dank. Castor streckte sich auf dem Schaffell vor dem Kaminfeuer aus, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Ich nehme an, dass er sich immer noch fragt, wo Martin geblieben ist, aber er lässt sich nichts anmerken. Nicht das Geringste.
In dem Wandkleiderschrank im Schlafzimmer fand ich die beiden elektrischen Heizkörper – für die ich Mr Tawking gesondert bezahlen muss, wenn ich sie benutze – und steckte in jedem Zimmer einen ein. Stellte beide auf die höchste Stufe und hoffte, so wäre auch ohne Hilfe des Feuers eine anständige Temperatur im Haus zu erzielen. Vielleicht auch, ein bisschen Schimmel in die Flucht zu schlagen.
Ich trank meinen Tee ohne Zucker und Milch, aß ein halbes Dutzend Zwiebacke und einen Apfel, das Einzige, was von meinem Reiseproviant übrig geblieben war. Anschließend führte ich eine einfache Bestandsaufnahme der Küchenutensilien in Schränken und Schubladen durch und begann, eine Liste der Dinge zu erstellen, die ich einkaufen musste. Zum Beispiel eine Reibe, zum Beispiel eine Bratpfanne und einen Nudelkochtopf, zum Beispiel ein ordentliches Brotmesser, und als es halb zehn war – wir waren um kurz nach sieben aufgewacht –, hatte ich außerdem alles aus dem Auto ins Haus getragen und in Schränken und Schubladen verstaut.
Es funktioniert, erdreistete ich mich zu denken. Ich tue eins nach dem anderen, und es funktioniert. Castor lag nach wie vor ausgestreckt vor dem Kaminfeuer, in aller Seelenruhe, soweit ich es beurteilen konnte, und ich dachte, dass es wirklich interessant wäre, für kurze Zeit einmal in seinen Schädel zu blicken. Wirklich interessant, statt eines Menschen ein Hund sein zu dürfen, und sei es auch nur für ein paar Augenblicke.
Wobei sich dies möglicherweise auch als eine außerordentlich beängstigende Erfahrung erweisen könnte.
Als das Einräumen und die praktischen Erledigungen abgehakt waren, stand ich eine Weile auf dem Hof und versuchte, die Lage zu beurteilen. Der Nebel hatte sich kaum gelichtet, obwohl von den höher gelegenen Teilen der Heide im Norden ein frischer Wind wehte. In manchen Richtungen betrug die Sicht kaum mehr als hundert Meter, und statt zu einem längeren Spaziergang aufzubrechen, was ich zunächst in Erwägung gezogen hatte, setzten wir uns ins Auto, um zum Dorf zu fahren und unsere Einkäufe zu erledigen.
Nur ein Bruchteil dessen, was ich zu benötigen glaubte, ließ sich im örtlichen Laden auftreiben – Winsford Stores. Die Inhaberin, eine rundliche Dame Mitte sechzig, war jedoch ausgesprochen hilfsbereit und erklärte, ich bräuchte mich bloß nach Dulverton zu begeben, dort würde ich sicher das meiste bekommen. Ihr lag möglicherweise die unausgesprochene Frage auf den Lippen, wer ich war und was mich in ihr kleines Winsford geführt hatte; ich hatte eine ebenso unausgesprochene Antwort auf den Lippen, aber weiter kamen wir an diesem ersten Morgen nicht. Stattdessen erhielt ich genaue Wegbeschreibungen; ich konnte zwischen zwei Routen wählen, zum einen die A 396 am Exe entlang, über Bridgetown und Chilly Bridge, zum anderen die B 3223 oben auf der Heide und am Barle entlang, dem zweiten größeren Flusslauf durch Exmoor, nach Dulverton hinunter. Wir konsultierten eine Straßenkarte, die ich ebenfalls kaufte, und einigten uns darauf, dass es sicher eine gute Idee wäre, die erste Route für den Hinweg und die zweite für den Rückweg zu wählen. Nicht zuletzt, wenn man oben in der Heide wohnte, was ich aus unklaren Gründen jedoch nicht offen zugab. Ich bezahlte für die Waren, die ich zusammengetragen hatte, unter anderem für ein Dutzend gesprenkelter Eier, die an diesem Morgen von der nur einen Katzensprung entfernten Fowley Farm gekommen waren und allen vernunftbegabten Geschmacksrichtern zufolge die leckersten und nahrhaftesten im gesamten Vereinigten Königreich waren. Ich bedankte mich für ihre Hilfe und wünschte ihr einen guten Tag. Sie wünschte mir das Gleiche, und auf dem Weg nach Dulverton trug ich ihre Wärme und ihr Wohlwollen noch längere Zeit in mir.
Eine halbe Stunde später parkte ich nahe einer alten Steinbrücke über den Fluss Barle vor The Bridge Inn. Dulverton ist zweifellos ein Städtchen, das für einen modernen – oder auch unmodernen – Menschen alles bereithält, was er eventuell benötigen könnte. Auf einem zehnminütigen Rundgang – grauweißer Himmel, der Nebel verschwunden, die Sonne möglicherweise kurz davor, die Wolkendecke zu durchbrechen – konnten Castor und ich feststellen, dass es hier sowohl Restaurants als auch eine Polizei- und eine Feuerwache, eine Apotheke, eine Bibliothek, verschiedene Geschäfte, Pub und Teesalon gab. Sogar ein Antiquariat, in dem wir unbedingt kurz vorbeischauen mussten, weil auf der klapprigen Tür ein Schild verkündete, vierbeinige Freunde seien besonders herzlich willkommen.
In gemächlichem Tempo erledigten wir unsere Einkäufe, unternahmen einen kürzeren Streifzug an einem munter fließenden Fluss Barle entlang – oh, was freut es mich, »munter fließend« schreiben zu dürfen, ich glaube, es handelt sich um eine Art Rehabilitierung –, und es fiel mir schwer zu begreifen, wo eigentlich das viele Wasser herkam. Zum Abschluss aßen wir im The Bridge Inn eine Quiche aus Hirschfrikassee mit einem Brei aus grünen Erbsen. Nun ja, Castor musste sich mit einer Handvoll Hundeleckerchen begnügen, die bereitwillig aus einem Vorrat unter der Theke hervorgeholt wurden.
Ich bemerkte, dass ein beträchtlicher Unterscheid zwischen einer alleinstehenden Frau mittleren Alters und einer alleinstehenden Frau mit Hund bestand. Castors Gesellschaft, wenn er ausgestreckt unter meinem Tisch im Pub liegt, verleiht mir eine Art selbstverständlicher Würde und eine Daseinsberechtigung, die ich nicht wirklich erklären kann. Wie eine Gnade, die man einfach unverdient genießt. Ich würde die Situation, in die ich geraten bin, niemals ertragen, wenn ich mich nicht auf seine beruhigende Gegenwart stützen könnte, ganz bestimmt nicht. Dennoch bin ich mir natürlich höchst unsicher, ob die Sache glücklich ausgehen wird, was immer mit diesem Klischee gemeint sein könnte, nicht einmal mit diesem famosen Gefährten an meiner Seite, aber ich werde zumindest die kurzen Zeitabschnitte einigermaßen gut bewältigen können. Die Minuten, die Stunden, vielleicht sogar die Tage. Wahrscheinlich sind das auch die Segmente, in denen Hunde denken und sich durchs Leben schlagen. Stück für Stück, in diesem Punkt sind sie eindeutig im Vorteil.
Dabei gehörte er eigentlich Martin. Er hatte darauf bestanden, dass wir ein Haustier bräuchten, als die Kinder uns verließen, und mit Haustier meinte er selbstverständlich einen Hund und sonst nichts. Er ist mit einer ganzen Reihe von Kläffern aufgewachsen, in meiner eigenen, durchorganisierten Kindheit war für solche Extravaganzen dagegen kein Platz, ich weiß im Grunde gar nicht, warum. Ich musste mich mit unzuverlässigen Katzen und einer Handvoll schnell sterbender Aquarienfische begnügen, das war alles. Na ja, und einem Bruder. Und einer kleinen Schwester, ich würde gerne um sie herumschreiben, in einem großen, weiten Bogen, aber mir ist bewusst, dass dies nicht funktionieren wird.
Er ist sieben, fast acht Jahre alt, mein Castor. Ein Rhodesian Ridgeback, eine Rasse, von der ich noch nie gehört hatte, als Martin mit ihm nach Hause kam. Ich glaube, er hegte den vagen Traum, dass der Hund in seinem Arbeitszimmer in der Universität zu seinen Füßen liegen und ihn eventuell sogar begleiten würde, wenn er im Hörsaal stand. Aber daraus wurde natürlich nichts. Stattdessen blieb es mir überlassen, mit Castor zu Kursen und zum Tierarzt zu gehen. Ich war es, die sich um alle praktischen Belange kümmerte, die damit zusammenhingen, einen Hund zu halten, und ich war es, die zweimal täglich lange Spaziergänge mit ihm machte.
Weil ich es war, die Zeit dafür hatte.
Oder richtiger, weil ich mir die Zeit dafür nahm, aber über diese Frage wurde nie diskutiert. Es machte mir einfach Spaß. Zwei Stunden täglich mit einem stillen und treuen Begleiter durch Wald und Wiesen spazieren gehen zu dürfen und kein anderes Ziel zu haben, als genau das zu tun – sich durch die Natur zu bewegen und still zu sein –, oh ja, das war eine Beschäftigung, die mir bereits nach wenigen Wochen das Wichtigste und Sinnvollste in meinem Leben zu sein schien.
Was vielleicht etwas über dieses Leben aussagt.
Als ich nach Darne Lodge zurückfuhr – auf der hochgelegenen Straße über die Heide –, hatte sich der Nebel endgültig aufgelöst, und man konnte meilenweit sehen. Ich ließ das Seitenfenster herunter und meinte in der Ferne das Meer erahnen zu können oder zumindest den Bristol Channel, woraufhin mich mit aller Macht das Gefühl überkam, sehr einsam und vollkommen bedeutungslos und ausgeliefert zu sein. Es ist in vieler Hinsicht leichter, ohne Horizonte zu leben, im Nebel und in der Enge, jedenfalls ist mir bewusst, dass ich mich an simple und praktische Tätigkeiten halten muss: wie gesagt, Beschlüsse fassen und sie in die Tat umsetzen, sonst könnten alle Dämme brechen. Wenn alles, jeder Schritt und jede Handlung und Unternehmung, ohne tieferen Sinn ist, wenn man ebenso gut etwas völlig anderes hätte tun können als das, was man gerade macht, und man es einfach nicht lassen kann, sich daran zu erinnern – und wenn das Einzige, was eventuell von Bedeutung ist, in den Fehlern und Missetaten zu bestehen scheint, die man in der Vergangenheit begangen hat –, tja, dann lauert der Wahnsinn hinter der nächsten Ecke.
In der Heide zu leben, bedeutet eine schöne und lebensgefährliche Freiheit, ich fange bereits an, dies zu verstehen. An einem kleinen Parkplatz hielt ich an und ließ Castor von der Rückbank auf den Beifahrersitz umziehen. Er mag das, legt die Nase über die Belüftung und verschafft sich so eine überirdisch große Dosis von Geruchseindrücken.
Oder er hängt den ganzen Kopf aus dem Fenster, wie Hunde auf dem Land es häufig tun. Kein Mensch in der Welt weiß, dass wir uns hier aufhalten.
Ich wiederhole: Kein Mensch in der Welt weiß, dass wir uns hier aufhalten.
4
A m frühen Morgen des zehnten April vergewaltigte mein Mann in einem Hotel in Göteborg eine junge Frau. Sie hieß Magdalena Svensson, war dreiundzwanzig Jahre alt und seit Jahresbeginn in dem Hotel angestellt. Anzeige erstattete sie, nach ungefähr drei Wochen Bedenkzeit, am zweiten Mai.
Oder er vergewaltigte sie nicht. Ich weiß es nicht genau, schließlich war ich nicht dabei.
Martin wurde vernommen und saß eine Nacht und einen Tag bei der Polizei, ehe er bis zum Prozessbeginn freigelassen wurde.
Gut zwei Wochen später, am achtzehnten Mai, hatte eine Boulevardzeitung Wind von der Nachricht bekommen – dass der bekannte Redner, Schriftsteller und Literaturprofessor Martin Holinek der Vergewaltigung beschuldigt wurde –, und in der darauffolgenden Woche war das Ereignis in aller Munde. Magdalena Svensson erzählte einer großen Zahl von Medienvertretern, was in jener Nacht passiert war, und fünf Tage lang stand es in den Schlagzeilen von Aftonbladet und Expressen. Mein Mann verweigerte jeden Kommentar, er ließ sich krankschreiben, es wurde in Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen debattiert. Aber vor allem in den sozialen Medien: In einem Blog gab beispielsweise eine andere Frau an, »dieser versaute Professor« habe auch sie vergewaltigt – in einem anderen Hotel in Umeå ein knappes Jahr zuvor. Er sei »so geil wie ein verdammter Schimpanse« gewesen – eine Formulierung, die sie offensichtlich von einem früheren Fall um einen bekannten französischen Bankier und Politiker entliehen hatte –, aber sie habe darauf verzichtet, den Vorfall anzuzeigen, da sie sich gefürchtet habe. Zwei andere Frauen schrieben in ihren Blogs, dass sie von ganz anderen Professoren vergewaltigt worden seien. Die Kommentare waren so zahlreich wie die Heuschrecken Ägyptens.
Als Sahnehäubchen bot einer der privaten Fernsehsender Martin und mir 50000 Kronen dafür an, wenn wir zu dritt in einer seiner Talkshows auftreten würden. Mit »zu dritt« waren gemeint: die Vergewaltigte, der Täter, die Ehefrau des Täters. Dies sei für die Öffentlichkeit von großem Interesse. Wir lehnten dankend ab, und ob Magdalena Svensson das Angebot angenommen hat, haben wir nie erfahren. Jedenfalls ich nicht.
Am zehnten Juni zog Fräulein Svensson ihre Anzeige zurück, und für ein paar Tage nahm das Ereignis daraufhin erneut Fahrt in den Medien auf. Es tauchten Spekulationen über illegale Drohungen auf und darüber, dass der Vergewaltiger sich nach traditioneller patriarchalischer Sitte freigekauft habe, sowie ähnliche Mutmaßungen gleichen Stils. Zu einer Demonstration gegen Männer, die Frauen hassen, kamen in Stockholm zweitausend Menschen auf den Sergels torg. Jemand stopfte ein mit Kot gefülltes Kondom in unseren Briefkasten.
Um der Gerechtigkeit Genüge zu tun: Eine Handvoll Stimmen ergriffen zu Martins Verteidigung das Wort, es waren die üblichen Stimmen. Er selbst blieb jedoch bei seiner Linie, sich nicht öffentlich zu äußern. So hielt es auch sein Anwalt, obwohl er zu den Führenden im Lande gehört und normalerweise kein Blatt vor den Mund nimmt.
Die Ermittlungen wurden eingestellt, der Fall zu den Akten gelegt.
Auch ich hatte zu der ganzen Angelegenheit herzlich wenig zu sagen, zählte in der schlimmsten Zeit vor unserem Haus in Nynäshamn jedoch mehr als zwanzig Journalisten und Fotografen. Eines späten Abends feuerte Martin mit seinem Elchstutzen zwei Schüsse durchs Fenster hinaus ab. Er zielte in den Himmel über dem Wald; die gesamte Heerschar bekam etwas, worüber sie berichten konnte, machte sich auf den Weg nach Stockholm und ließ uns vorübergehend in Ruhe. Ein Starreporter zu sein und vor einem Haus in Nynäshamn herumlungern zu müssen, ist gewiss kein Zuckerschlecken.
Ich weiß noch, dass Martin zufrieden auszusehen versuchte, als er die Waffe weggestellt hatte. »Das hätten wir«, sagte er. »Wollen wir ein Glas Wein trinken?«
Er klang jedoch alles andere als forsch, und ich lehnte seinen Vorschlag ab. Aus irgendeinem Grund wurde er nie dafür angezeigt, dass er in einem dichtbesiedelten Gebiet ein Gewehr abgefeuert hatte.
Darüber, was passiert war – was möglicherweise passiert war –, sprachen wir ein einziges Mal, danach nie wieder. Es war meine Entscheidung, das eine so gut wie das andere.
»Hast du mit dieser Frau geschlafen?«, fragte ich.
»Ich habe mit ihr geschlafen«, antwortete Martin.
»Hast du sie vergewaltigt?«
»Nie und nimmer«, antwortete Martin.
Es war der Tag, an dem die Zeitungen zum ersten Mal darüber berichteten, vorher hatte ich mich nicht durchringen können, ihn zu fragen, obwohl ich von der Sache wusste. Keines unserer Kinder meldete sich an jenem Abend bei uns. Auch sonst niemand aus unserem Bekanntenkreis, ich erinnere mich, dass unsere Telefone merkwürdig still blieben.
Abgesehen von Anrufern, deren Nummern uns unbekannt waren, natürlich, aber bei denen gingen wir nicht an den Apparat.
»Und diese Frau in Umeå?«, fragte ich dennoch ein paar Tage später, als diese Sache aufs Tapet kam.
»Du willst ja wohl nicht sagen, dass du ihr glaubst?«, entgegnete Martin.
Zu den Dingen, die mich den ganzen Sommer über mit einem seltsamen Gefühl erfüllten – in einem höheren Maße seltsam als schwierig, das muss betont werden –, gehörte es, dass ich mir keine Klarheit darüber verschaffen konnte, wo die Wahrheit lag. Ich nehme an, dass alles auf irgendeine Weise außerhalb meiner Reichweite war, es schien nicht wirklich verständlich zu sein, und wenn man etwas nicht begreift, kann man auch den Wahrheitsgehalt nicht beurteilen. Jedenfalls bilde ich mir ein, dass es sich so verhielt; morgens wachte ich regelmäßig auf und erinnerte mich nach den ersten leeren Sekunden, worin die neue Lage bestand. Und fand so die Antwort darauf, warum ich mich so müde und schwermütig fühlte – und während ich mich auf unwilligen Füßen zur Toilette begab, dachte ich, dass ich eine Schauspielerin war, die im falschen Film gelandet war. Im völlig falschen Film und fünfundzwanzig Jahre zu spät.
Sowohl Martin als auch ich hatten eine Affäre hinter uns, und beide Male war es uns geglückt, unsere Ehe danach wieder zu kitten. Erst hatte er eine, danach ich, als eine Art Rache. Es passierte, als die Kinder noch zu Hause wohnten, und es ist durchaus möglich, dass wir eine andere Entscheidung getroffen hätten, wenn sie schon aus dem Haus gewesen wären. Aber ich weiß es nicht, und es fällt mir schwer, darüber zu spekulieren; jedenfalls hätte keiner von uns das Verhältnis mit dem betreffenden Zweitpartner fortgesetzt, wenn sich eine solche Möglichkeit ergeben hätte. Das haben wir in den Jahren, die vergangen sind, seit es funkte, sowohl uns selbst als auch einander eingeredet. Sechzehn beziehungsweise vierzehn Jahre, um genau zu sein. Großer Gott, mit Schamesröte im Gesicht erkenne ich, dass ich einundvierzig war, als ich mit diesem jungen Aufnahmetechniker ins Bett ging. Er hätte ein Freund Gunvalds sein können, wenn Gunvald Kontakt zu Leuten wie ihm gehabt hätte.
Nachdem die schlimmste Zeit vorüber war, ungefähr ab Mitte Juli, spürte ich dennoch immer deutlicher, dass ich unbedingt wissen musste, was geschehen war. Was genau mein Mann mit besagter Kellnerin in besagtem Hotel getrieben hatte.
In der besagten Nacht.
Mein Problem war nur, dass es zu spät war, Martin danach zu fragen. Eine unsichtbare Grenze war überschritten, eine Art Waffenstillstand proklamiert worden, und ich hatte nicht das Gefühl, das Recht zu besitzen, ihn aufzukündigen. Ich finde heutzutage kaum noch Spaß an Sex und hatte deshalb wohl ein wenig gedankenlos vorausgesetzt, dass es Martin reichen würde, sich zu Fantasiebildern einer leidenschaftlichen Umarmung einen herunterzuholen, aber ganz so einfach lagen die Dinge offenbar nicht.
Die Scheidung verlangen? Natürlich, das war mein gutes Recht. Doch der Gedanke sagte mir nicht zu. Es lag etwas gekünstelt Banales in einer solchen Reaktion; immerhin waren wir seit dreißig Jahren verheiratet, wir hatten lange in einer Art angenehmem beiderseitigem Einverständnis parallele Leben geführt und auf dem Waldfriedhof ein Doppelgrab für uns reserviert.
Also rief ich sie schließlich an. Magdalena Svensson. Ihre Nummer fand ich im Internet, sie hielt sich daheim im Stadtteil Guldheden in Göteborg auf und meldete sich am Handy.
Drei Tage später, am zwanzigsten August, trafen wir uns in einem Café im Stadtteil Haga. Es war ein unglaublich heißer Tag, ich hatte einen frühen Zug aus Stockholm genommen. Da ich etwas zu früh war, beschloss ich, die gesamte Strecke vom Hauptbahnhof zu Fuß zurückzulegen, und war unangenehm verschwitzt, als ich schließlich ankam. Außerdem hatte sich in mir ein diffuser Ekel angestaut, und ich bezweifelte, dass mein Vorhaben klug war. Nur einen Häuserblock von Haga entfernt war ich deshalb kurz davor, einfach wieder umzudrehen. Ich hielt mein Handy in der Hand, wollte ihre Nummer eingeben und erklären, dass ich es mir anders überlegt hatte. Dass ich nicht mit ihr sprechen wollte und es für uns beide das Beste wäre, die ganze Geschichte zu vergessen.
So kam es dann jedoch nicht. Ich riss mich zusammen.
Sie saß an einem Tisch unter einem Sonnenschirm und wartete auf mich. Sie trug ein hellgrünes Kleid und einen dünnen weißen Leinenschal, und obwohl ich sie von den Bildern in den Zeitungen wiedererkannte, war es doch, als handelte es sich um einen ganz anderen Menschen. Sie war jung und süß, aber nicht sonderlich sexy. Wirkte schüchtern und bekümmert, und in Anbetracht der Umstände war das vielleicht auch nicht weiter verwunderlich.
Als sie mich sah, stand sie auf. Offensichtlich gehörte sie zur Hälfte des schwedischen Volks, die mich erkannte. Ich nickte ihr zu, um zu bestätigen, dass ich sie identifiziert hatte, und erst, als wir uns die Hand gaben und begrüßten, holte mich die paradoxe Hoffnungslosigkeit der Situation ein. Entweder war dieses verzagte kleine Wesen von dem Mann vergewaltigt worden, mit dem ich mein ganzes Leben verbracht hatte, und dann musste sie einem natürlich leidtun. Oder sie hatte sich freiwillig darauf eingelassen, Sex mit ihm zu haben, und dann brauchte sie einem kein bisschen leidzutun.
»Ich bin so traurig«, sagte sie.
So lauteten ihre ersten Worte, und ich nahm an, dass sie weitersprechen würde, aber sie blieb stumm. Ich dachte, wenn sie schon hier gesessen und auf mich gewartet hat – auf die dreißig Jahre ältere und betrogene Frau –, dann müsste sie eigentlich genügend Zeit gehabt haben, sich etwas Prägnanteres auszudenken, als mir zu sagen, sie sei traurig. Diese Talkshow, die nie zustande gekommen war, wäre eine zähe Angelegenheit geworden.
»Das bin ich auch«, erwiderte ich. »Aber ich bin nicht gekommen, um Ihnen zu erzählen, wie ich mich fühle.«
Sie lächelte unsicher, ohne wirklich meinem Blick zu begegnen.
»Und auch nicht, um herauszufinden, wie Sie sich fühlen, ich möchte lediglich, dass Sie mir erzählen, was passiert ist.«
Wir setzten uns.
»Wenn Sie nichts dagegen haben«, fügte ich hinzu.
Sie saugte die Unterlippe in den Mund, und ich merkte, dass sie nahe am Wasser gebaut hatte. Es fiel nicht weiter schwer, sich auszumalen, wie es zu den vielen Stellungnahmen in den Zeitungen gekommen war. Die Journalisten hatten sie angerufen, und sie war dumm genug gewesen, nicht aufzulegen.
»Ich bin so traurig«, wiederholte sie, »und es tut mir so leid. Das muss alles wirklich furchtbar für Sie sein. Daran habe ich nicht gedacht.«
Wann, dachte ich. Wann hast du daran nicht gedacht?
»Wie alt sind Sie?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort kannte.
»Dreiundzwanzig. Nächste Woche werde ich vierundzwanzig. Warum fragen Sie?«
»Ich habe eine Tochter, die fünf Jahre älter ist als Sie.«
»Aha?«
Sie schien nicht zu verstehen, worauf ich hinauswollte, und das tat ich selbst im Übrigen auch nicht. Eine Kellnerin kam zu unserem Tisch. Ich bestellte einen Espresso, Magdalena Svensson bat um eine weitere Tasse Tee.
»Mir ist bewusst, dass dies schwer für Sie ist«, sagte ich. »Es ist für uns beide nicht leicht. Aber für mich würde es die Sache bedeutend leichter machen, wenn ich erfahren könnte, was zwischen Ihnen und meinem Mann vorgefallen ist.«
Sie schwieg eine Weile, während sie sich an den Unterarmen kratzte und mit den Tränen kämpfte. Die Lippe verschwand wieder im Mund, es war fast unmöglich, kein Mitleid mit ihr zu empfinden. Es ist so gewesen, dachte ich. Er hat sie vergewaltigt.
»Es war meine Schwester«, sagte sie.
»Ihre Schwester?«
»Ja. Sie hat mich überredet, zur Polizei zu gehen. Ich bereue, dass ich das getan habe. Dadurch ist nichts besser geworden. Ich habe mich den ganzen Sommer so schlecht gefühlt, ich weiß bald nicht mehr, wie es weitergehen soll.«
Ich nickte. »Geht mir nicht anders«, erklärte ich.
»Meine Schwester, sie ist vergewaltigt worden«, fuhr Magdalena Svensson fort und schnäuzte sich in ein Papiertaschentuch. »Das ist jetzt fünf Jahre her, das haben wir gemeinsam. Obwohl sie den Mann nie angezeigt hat, der es getan hat. Und deshalb wollte sie, dass ich es tue.«
Plötzlich klang sie wie ein Schulmädchen. Eine Mittelstufenschülerin, die bei einem Ladendiebstahl oder beim Schuleschwänzen erwischt worden war. Für eine Sekunde tauchte vor meinem inneren Auge ein Bild von ihrem und Martins nackten Körpern in einem Hotelbett auf; es sah so absurd aus, dass es mir schwerfiel, es ernst zu nehmen.
Ließ sich so etwas ernst nehmen? Was bedeutete ernst?
»Sie hat gesagt, dass man den Täter immer anzeigen muss, sonst werden die Frauen niemals frei werden. Nie Gerechtigkeit bekommen … oder so. Und dann habe ich es getan. Sie hat mich zur Polizei begleitet. Sie heißt übrigens Maria, genau wie Sie.«
Ich nickte wieder. »Dann haben Ihre Schwester und Sie das also gemeinsam?«
»Ja.«
»Maria und Magdalena?«
»Ja, was ist damit?«
Ich schob den Gedanken beiseite. »Später haben Sie Ihre Anzeige dann wieder zurückgezogen?«
»Ja. Das habe ich getan.«
»Und warum?«
»Es wurde zu viel.«
»Zu viel?«
»Ja, mit den Zeitungen und allem.«
Der Kaffee und der Tee kamen, und wir schwiegen eine Weile.
»Entschuldigen Sie«, sagte ich und fühlte mich endgültig wie eine gestrenge Rektorin, die eine Schülerin an ihrer Lehranstalt für Mädchen aus besserem Haus ins Gebet nahm. »Entschuldigen Sie bitte, aber ich verstehe nicht ganz. Heißt das, Sie sagen, dass Sie wirklich von meinem Mann vergewaltigt wurden?«
Sie dachte einen Moment nach. »Ich bin unter Drogen gesetzt worden«, erklärte sie dann.
»Unter Drogen?«
»Ja. So muss es gewesen sein. Ich war völlig weggetreten. Und hinterher konnte ich mich an praktisch nichts mehr erinnern.«