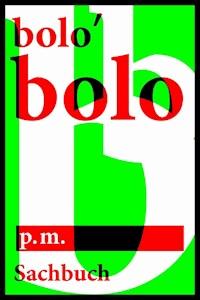Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn die Geschichte zu Ende ist, braucht man sie nicht aufzuarbeiten. Der Weg, den ich wähle, ist durch bestimmte Kriterien definiert: Sichtschutz, Unauffälligkeit, Unfallsicherheit. Unauffällig ist ein Weg, den auch andere genügend oft benutzen, sodass man nicht verdächtig wirkt. Es sollte links und rechts immer wieder Hausruinen und Unterstände geben. Der Überwachung durch Drohnen und Videokameras kann man nicht gänzlich entgehen; die Auswertung durch Algorithmen ist jedoch weniger ergiebig, wenn man weniger oft erfasst wird. Datenvermeidung ist immer gut. So aussehen wie viele andere ist gut: Ich trage einen Mantel, wenn Mäntel getragen werden, ich trage ein Jackett, wenn Jacketts getragen werden. Ich trage einen Hut, wenn man Hüte trägt. Ich wähle die Gesellschaft von alten Männern, weil ich ein alter Mann bin. Ich weiß, dass sie letztlich jeden kriegen. Doch sie geben sich keine Mühe, uns einzusperren, weil wir ja schon ausgesperrt sind. Die A-Zone ist mit hohen Mauern, Überwachungskameras und Stacheldraht gesichert. Die A-Bewohnenden bewegen sich nur per Helikopter. Was genau sie machen und wollen, wissen wir nicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Leitung
Ein Libretto
P.M.
Der Autor
P. M. wurde mit seinem ersten Roman Weltgeist Superstar (1980) bekannt. So behielt er sein damals gewähltes Pseudonym auch für seine zukünftigen Werke bei.
bolo’bolo, eine Art Glossar für eine andere Welt, erschien 1983 und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, unter anderem in Russisch, Türkisch und Hebräisch. Seitdem erschien eine ganze Reihe von Romanen, Sachbüchern, Spielen und Theaterstücken. P. M. war aktiv in der Zürcher Hausbesetzungsszene und engagiert sich im genossenschaftlichen Wohnungsbau und in der urbanistischen Diskussion. Zuletzt bei Hirnkost erschienen: Das Gesicht des Hasen. Ein terrestrischer Roman (2019), Warum haben wir eigentlich immer noch Kapitalismus? (2020) und ab 2020 der zehnbändige Mittelalter-Roman Die große Fälschung.
P.M.
Die Leitung
Ein Libretto
Inhalt
Der Autor
Die Leitung
Bernhard, Leo und ich sitzen wie so oft in der Ruine des Bürogebäudes Orcon und versuchen mit der Situation umzugehen. Die Situation ist seit Jahren die gleiche. Orcon wurde damals von einer Rakete getroffen und ist nun schon ziemlich von Stauden und Büschen überwuchert. Es blühen einige Osterglocken und Primeln. Wir sitzen auf den Resten einer Betonmauer, aus der verrostete Armierungseisen herausragen. Es ist einer dieser trügerischen Frühlingstage: Wird es schneien, oder wärmt uns noch die Sonne? Egal. Wir schauen einander an und stellen einen allmählichen Zerfall fest. Aber es gibt uns noch. Niemand hat sich die Mühe gemacht, uns umzusiedeln, irgendwo einzuweisen oder zu rehabilitieren. Oder gar umzubringen. Die Leitung hat uns wohl abgeschrieben als ebenso nutzlos wie harmlos. Solange wir nicht akut krank und daher sozial belastend werden, lässt sie uns in Ruhe und am Leben. Wir rasieren uns nur noch sporadisch. Es schaut uns ja niemand an. Seife ist knapp.
Jederzeit kann sich irgendetwas verändern.
Aber momentan sind wir noch da und versuchen, mit der Situation einigermaßen klarzukommen.
Die Leitung hat immer wieder versucht die Situation zu deblockieren, bleibt aber immer in Widersprüchen, partiellen Zusammenbrüchen und lähmenden Zielkonflikten stecken. Was ökonomisch ginge, scheiterte an unerwarteten Ressourcenknappheiten, was politisch aussichtsreich schien, führte zu einer langwierigen, unerklärlichen Lethargie. Niemand will partizipieren. Niemand kann sich vorstellen, woran man partizipieren sollte. Die Leitung, die Situation, der Stand der Dinge – es gibt sie, aber nichts ändert sich. Bewegungen bleiben wie zäher Schleim stecken, vertrocknen und lösen sich in Staub auf. Momentan ist große Flaute. Es sind einfach zu wenige übrig.
»Das Ding hat sich erschöpft«, sagt Bernhard immer wieder.
»Umso besser«, meint Leo.
»Dieser Saharastaub reizt die Schleimhäute«, sage ich und schnäuze meine Nase.
Seit Tagen ist der Himmel gelblich.
Wo sind die Vögel?
»Es gibt wieder Blutverdünner«, berichtet Leo nach einer Weile.
»Immerhin«, erwidere ich, »und die Ernährungsstation verteilt heute blaue Proteinklöße.«
»Niemand verhungert, aber zu essen gibt es nichts«, seufzt Bernhard.
Leo nickt.
»Erinnerst du dich an die Blutwürste damals?«
Wir erinnern uns gemeinsam.
Nicht, dass es früher wirklich besser war. Das Einzige, was besser war, war, dass man sich diese Zukunft nicht vorstellen konnte. Oder wollte. Diese Nicht-Zukunft. Diese Situation.
Es ist ein trüber Tag, aber nicht wirklich kalt. Man hält es aus.
Im Prinzip hält man es aus.
Die Leitung besteht, solange sie nicht zusammenbricht.
Gama Rinderknecht, vielleicht die Sprecherin der Leitung, wendet sich bisweilen im Radio an die Bewohnenden der Stadt. Sie verbreitet Zuversicht. Wir haben ihren Namen erfunden – wir kennen nur eine anonyme weibliche Lautsprecherstimme. Sie hat die Autorität einer Kindergartenerzieherin, oder einer Durchsage in der Tram. Diese fahren schon lange nicht mehr.
Die letzte Stimme, Kurba Sokion, war eines Tages einfach verschwunden. Sie war etwas rauchiger gewesen. Und hatte skandalöse Dinge gesagt.
Die Bewohnenden haben sich in den Ruinen einigermaßen eingerichtet. Die Straßen wurden behelfsmäßig geräumt, alle kennen die Pfade zu einem Schlafsaal, einer Wärmestube oder einer Ernährungsstation. Man wird untergebracht. Man weiß, wo man sich bei Regen unterstellen kann. Im Herbst werden Winterkleider verteilt. Bücher gibt es überall. Wozu soll man sie lesen? Unser Leben ist der ultimative Roman, den niemand lesen würde.
Leo hat Multivitaminkapseln dabei. Wir nehmen jeder eine. Dann machen wir unsere Übungen.
Bernhard insistiert. Wir nennen ihn »unseren Leiter».
Er grinst und kratzt sich am bärtigen Kinn.
»Gama meint, wenn jede*r jeden Tag zwei Meter Straße putzt, sähe die Stadt schon viel besser aus«, berichte ich.
»Das stimmt«, meint Leo und kickt einen Betonbrocken aus dem Pfad.
Wir sind kooperierende Bewohnende, aber nicht übereifrig.
Wir brauchen nicht viel und machen keinen Ärger. Wir ärgern uns auch nicht.
Weiter vorne, auf der Straße, die schon geräumt ist, fährt eines der weißen Panzerfahrzeuge der Leitung vorbei.
»Gama markiert Präsenz«, kommentiert Bernhard.
Wir stehen auf. Ein Steinhagel prasselt auf das Fahrzeug.
»Es sind die Jungen von der Siedlung«, meint Leo.
Wir setzen uns wieder.
»Na ja«, sage ich.
Ein paar Kratzer wird es schon abbekommen haben.
Ein Gejohle dringt zu uns durch.
Eine Gruppe von Jungen hat sich in der Ruine der Wohnsiedlung Grundbach eingerichtet. Sie sind ganz nett. Sie organisieren immer wieder einmal etwas für uns: Schokolade, eine Flasche Wein, ein Stück Käse, ein Medikament. Manchmal erzählen wir von früher, aber es ermüdet sie schnell. Vergangenheit ist eine Form von Ermüdung. Wir horchen uns um, wenn Agenten der Leitung – von uns Mediatoren genannt – sich herumtreiben, und warnen sie. Wir fallen nicht auf. Niemand beachtet alte Männer in grauen Mänteln.
»Habt ihr etwas von Susanna gehört?«, fragt Bernhard, als wieder Stille in der Umgebung eingekehrt ist.
Susanna war schon lange krank und schwach gewesen. Sie war gelegentlich vorbeigekommen und hatte über die Anagrammgruppe berichtet. Es ist schwierig, Kontakt zu halten. Es wird vermutet, dass die Leitung immer wieder eingreift. Leute verschwinden, Treffpunkte werden gemieden, Verstecke werden ausgehoben. Netzwerke werden plötzlich zerrissen. Nichts kann sich verfestigen. Es lohnt sich nicht, Freundschaften zu schließen. Feinde hat man sowieso keine.
Leo, der ehemalige Chemiker, stochert mit seinem Stock im sandigen Boden. Er bräuchte seit langem eine Hüftoperation, aber es klappt einfach nie mit den Terminen.
»Anarchisten bekommen keine neuen Hüftgelenke«, scherzt er hie und da.
Natürlich kümmert sich die Leitung keinen Deut um archaische ideologische Zuschreibungen.
»Das könnte Nora wissen«, sage ich, »ich sehe sie nachmittags vielleicht in der Wärmestube. Ich frag sie dann.«
»Ah, Nora«, sagt Leo, »war die nicht einmal die Freundin von Peter?«
»Nora und Peter waren ein Paar und hatten eine Tochter, Sila. Sila ist jetzt A3«, antwortet Bernhard und kratzt wieder in seinem schütteren, grauen Kinnbart.
Wir drei sind B3, Unterschicht, unbrauchbar, aber geduldet und noch knapp am Leben erhalten. Es gibt noch C1–3, die ganz Aussortierten, Abgeschobenen, Verdammten, Unbekannten. Wir haben also Glück.
»Dann hat Nora vielleicht Beziehungen zur Leitung«, meint Leo.
»Ich frag sie wegen Hüftoperationen«, verspreche ich. Wahrscheinlich werde ich es vergessen. Wie so vieles.
Leo hebt seinen Stock. Lässt ihn in den Schutt zurückfallen.
Ich werde versuchen ihn nicht zu vergessen.
Wir sitzen schweigend da.
Es gibt nichts mehr zu sagen.
Es hat keinen Sinn mehr, Absichten zu haben. Manchmal klappt etwas, meistens nicht.
»Drohne«, sagt Leo.
Wir sind schnell unten. Unter einer noch nicht zusammengebrochenen Betondecke, nur zwei Meter neben unserer Sitzmauer. Wir haben unseren Treffpunkt sorgfältig ausgewählt. Unbewohntes, unattraktives Areal, abseits von einer befahrbaren Straße, aber nicht allzu abgelegen, nahe an einer Vielzahl von Verstecken, auf mehreren Pfaden erreichbar, sodass wir aus verschiedenen Richtungen getrennt hin- und weggelangen können. Diese Zone wird gemieden, weil sie vermint war und der Boden verseucht ist. Es gibt keinen Grund, sie zu betreten.
Die Drohne surrt weit oben über uns hinweg. Es ist keine Kampfdrohne, nur Routineüberwachung.
Im synthetischen Bürgerkrieg, wie wir ihn nennen, wurden unzählige Raketen von Drohnen abgefeuert.
Wir klettern aus unserem Unterstand hervor.
Leo hat gute Ohren.
Früher wurden Drohnen häufig abgeschossen, aber jetzt hat niemand mehr Gewehre oder Munition.
Es gibt keinen Widerstand mehr. Wer ihn geleistet hat, ist tot oder invalid. Oder alt und müde, wie wir. Oder fort. Bei den meisten.
Die schlimmste mögliche Wendung ist eingetreten. Es gibt keinen Grund zu klagen und keinen zu hoffen.
»Vielleicht suchen sie die Jungen«, versetzt Bernhard nach einer Weile.
»Sie brauchen niemanden zu suchen«, widerspreche ich, »sie wissen, wo alle sind. Wir sind nur nicht wichtig genug, um etwas gegen uns zu unternehmen. Solange wir keine Gefahr darstellen, sparen sie sich den Aufwand. Und wir stellen keine Gefahr dar. Auch die Jungen nicht.«
»B3 ist für die Leitung nichts anderes als sozialer Müll«, stellt Leo fest.
Die Kategorien von A1 bis C3 sind unsere Erfindung, denn die Leitung erklärt weder ihre Konzepte noch ihre Strategien. Sie nennt sich nicht einmal Leitung. Sie erklärt überhaupt nichts, weil sie weder für sich noch für eine inexistente Öffentlichkeit Erklärungen braucht. Die Leitung führt keinen Diskurs. Komisch ist nur, dass diese Kategorien unter den Funktionären der Leitung inzwischen ganz selbstverständlich kursieren. Da haben wir also einen konstruktiven Beitrag geleistet. Vielleicht sind wir die Letzten, die sich überhaupt noch Gedanken zu den Zuständen machen und versuchen sie zu interpretieren. Aus alter Gewohnheit sozusagen. Weil unsere Gehirne einfach weiterdenken, im Leerlauf.
»Auch Müll will verwaltet sein«, sage ich.
Bernhard, der einmal Musiklehrer war, kramt aus seiner Manteltasche einen flachen, silbern glänzenden Metallgegenstand hervor.
»Ein Schlüssel«, erkennt ihn Leo.
»Und wozu passt er?«, frage ich automatisch.
»Er ist kodiert«, erklärt Bernhard und tippt auf eine Stelle auf dem Schlüssel.
»Das heißt, es war eine wichtige Tür«, sage ich, »zugänglich nur für bestimmte Personen.«
Bernhard nickt.
»Ein altes System, Barodorma«, erklärt er.
Leo meint: »Es liegen überall Schlüssel herum, aber die Türen, zu denen sie passen, gibt es nicht mehr.«
Bernhard erwidert: »Dieser Schlüssel ist besonders. Ich glaube zu wissen, zu welchem Schloss in welcher Tür er gehört.«
»Aha«, versetzt Leo.
»Da drüben«, Bernhard zeigt nach Südwesten, »stand doch dieses innovative Bürohochhaus namens Altair. Es besteht noch ein Zugang zum Untergeschoss. Da gibt es Türen, zu denen er passen könnte.«
»Und was hoffst du zu finden?«, will Leo wissen.
»Ich habe so meine Vermutungen«, antwortet Bernhard und steckt den Schlüssel wieder ein.
Was kann es schon sein – ausrangierte Computer, abgelegte Akten, Büromöbel, nie verteilte Drucksachen …
»Willst du, dass wir mitkommen?«, fragt Leo.
»Nicht heute«, erwidert Bernhard.
»Warum nicht heute?«, insistiert Leo.
»Heute ist ein seltsamer Tag.«
Ich schaue mich um und sehe nichts Seltsames. Ein trüber, kühler Frühlingstag. Es gibt kaum normalere Tage.
Ein paar Krähen zeigen sich endlich. Sie krächzen unflätig.
»Alfredo ist noch nicht gekommen«, stelle ich fest.
»Er kommt schon noch«, sagt Leo, »er kommt immer.«
»Er muss vorsichtig sein, wegen Mona«, ergänzt Bernhard.
»Hast du etwas für ihn?«, erkundigt sich Leo.
Bernhard klaubt einen kleinen, orangen Würfel Imitationskäse aus seiner Manteltasche und legt ihn einen Meter von uns entfernt auf die Betonmauer.
Die Krähen fliegen näher heran, wagen es aber nicht, zu landen.
Dann endlich ist er da: Alfredo, die braune Ratte. Er schaut sich kurz um, stellt sich auf die Hinterbeine, schnüffelt am Käse, packt ihn mit seinen kleinen Vorderpfoten, verputzt ihn hastig und ist schon wieder weg. Keine vier Sekunden hat es gedauert.
Wir sind zufrieden – wir haben ein Lebewesen glücklich gemacht.
Die Krähen hingegen lärmen empört.
Alfredo ist uns sympathischer als sie – vielleicht, weil er ein Säugetier ist wie wir. Eigentlich unfair.
»Da ist Mona«, bemerkt Bernhard und zeigt nach Süden.
Eine kleine, grau getigerte Katze schleicht eine Betonplatte entlang.
Sie macht einen Sprung und hat schon eine Maus in ihrem Maul.
»Eine richtige Killerin«, sagt Leo.
»An Mäusen herrscht kein Mangel«, stelle ich fest.
Die Ruinenlandschaften sind ein Paradies für kleines Getier aller Art: Mäuse, Eidechsen, Kröten, Wiesel, Käfer. Sogar Schlangen werden wieder gesehen. Füchse streifen herum. Verwilderte Hunde bilden eine Gefahr. Kojoten wurden vereinzelt gesichtet. Waschbären sind eine richtige Plage. Wölfe, Bären und Luchse hat man ganz selten gesehen.
Mona spielt mit ihrer Maus, wirft sie in die Luft, lässt sie etwas laufen, packt sie dann wieder.
»Die Patrouille kommt zurück«, erklärt Leo und steht zugleich auf.
»Wir verdrücken uns besser«, schlage ich vor.
Wir entfernen uns auf verschiedenen Wegen.
Innerhalb von Sekunden sieht man nichts mehr von uns.
Der Weg, den ich wähle, ist durch bestimmte Kriterien definiert: Sichtschutz, Unauffälligkeit, Unfallsicherheit. Unauffällig ist ein Weg, den auch andere genügend oft benutzen, sodass man nicht verdächtig wirkt. Er muss relativ eben, nicht sumpfig, aber doch nicht allzu bequem sein. Es sollte links und rechts immer wieder Hausruinen und Unterstände geben. Der Überwachung durch Drohnen und Videokameras kann man nicht gänzlich entgehen; die Auswertung durch Algorithmen ist jedoch weniger ergiebig, wenn man weniger oft erfasst wird. Datenvermeidung ist immer gut. So aussehen wie viele andere ist gut: Ich trage einen Mantel, wenn Mäntel getragen werden, ich trage ein Jackett, wenn Jacketts wieder getragen werden. Ich trage einen Hut, wenn man Hüte trägt. Ich wähle die Gesellschaft von alten Männern, weil ich ein alter Mann bin. Ich weiß, dass sie letztlich jeden kriegen. Doch sie geben sich keine Mühe, uns einzusperren, weil wir ja schon ausgesperrt sind. Die A-Zone ist mit hohen Mauern, Überwachungskameras und Stacheldraht gesichert. Die A-Bewohnenden bewegen sich nur per Helikopter. Was genau sie machen und wollen, wissen wir nicht.
Die Gebrechen nehmen zu. Ich habe Ausschläge an den Beinen. Ich habe Schwindelanfälle, Herzrasen, abgebrochene Backenzähne, arthritische Finger, Gedächtnisausfälle, Erschöpfungszustände und liege lange wach. Aber ich bewege mich jeden Tag, mache Bernhards Übungen, ergänze die synthetischen Klöße, Plätzchen und Breie der Ernährungsstation durch Beeren, Obst und Wildkräuter. Mehr aus Gewohnheit als aus Überzeugung. Wahrscheinlich ist es der Sammlerinstinkt. Auf Brachen wurden wilde Gärten angelegt, einige zerfetzte Obstbäume haben überlebt. Brombeersträucher und Holunderbäume wachsen und wuchern überall. Jüngst entdeckten wir einen blühenden Mandelbaum. Aus Hagebutten, Lindenblüten und Pfefferminze machen wir Tee. Wir überleben, nur wissen wir nicht wozu. Wir wollen es auch nicht wissen. Wir sind alle funktionale Buddhist*innen.
Auf dem Weg zur Ernährungsstation, die aus unerfindlichen Gründen die Nummer 264 trägt, komme ich an den zerbombten Hochhäusern vorbei, die wie von Karies zerfressene Zähne in den grauen Himmel ragen. Im orange-rosa-grauen Abendrot bilden sie bisweilen eine wild-romantische Kulisse. Wir geben Punkte von eins bis zehn. Ich grüße Bekannte. Der synthetische Bürgerkrieg mit seinen Vertreibungs- und Fluchtbewegungen hat Menschen aus allen Weltgegenden in unsere paraurbane Zone gespült. Sich einheimisch zu nennen ergibt keinen Sinn mehr. Ich bin schon länger da, Abdullah kam vor fünf Jahren, Jamalla vor drei. Wir stehen Schlange bei der Essensausgabe.
Das Kohlenhydratplätzchen ist heute gelb, die Proteinkugel an brauner Sauce blau, die Lipide glänzen grünlich. Brot gibt es keines – zu aufwendig in der Herstellung. Die Ernährungskomponenten werden aus Fabriken geliefert und in den Stationen aufgewärmt. Aromastoffe machen keine Umstände und sorgen für unendliche Abwechslung. Auch die Formen variieren. Alle identitären Ernährungsvorschriften, wie vegan, halal, koscher usw., die im Krieg zu Manipulationszwecken missbraucht worden waren, sind sowohl erfüllt wie hinfällig. Pflanzenbabys wie Körner oder Bohnen werden nicht mehr ermordet. Das gelbe Kohlenhydratplätzchen schmeckt nach Broccoli, die Kugel nach Kreuzkümmel und Kardamom, die Sauce nach geräuchertem Paprika.
»Ziemlich gut heute«, meint Jamalla, nachdem wir uns nebeneinander an einen der langen Tische gesetzt haben.
»Man kann nicht klagen«, gebe ich zurück und zerteile die Köftekugel mit dem Löffel. Es gibt nur Löffel. Manche bringen ihre eigenen.
In einem Kunststoffbecher hat man uns einen synthetischen Fruchtsaft ausgeschenkt, der neben Zucker alle Vitamine und Mineralien enthalten soll, die wir brauchen.
Abdullah verschmäht ihn, weil er glaubt, er enthalte Drogen, die uns apathisch und gefügig machen.
Doch auch er wirkt nicht besonders initiativ und dynamisch. Nur alt.
Und gefügig zu sein ist jetzt eher ein Segen.
Mir gegenüber sitzt Carmo, eine etwa vierzigjährige Frau, die schon oft aus ihrer Jugend in Brasilien (das Land soll man nicht nennen) berichtet hat. Sie hat graue Kraushaare und eine auffällige Narbe quer über der linken Wange. Von »Kampfhandlungen im Raum Lyon« hat sie einmal erzählt, obwohl man darüber nicht reden soll.
Und nun ist sie halt hier, bei uns. Kampfhandlungen gibt es keine mehr. Lyon ist ein Trümmerfeld.
»Ich mochte den Fischkloß gestern lieber«, kommentiert sie, »obwohl kein Fisch drin war.«
»Weil kein Fisch drin war«, bemerkt Ascha.
»Ich glaube, die Fabrik verteilt die Aromen mit einem Zufallsalgorithmus«, sagt Wen, der neben mir sitzt. Er war mit einer Luftlandebrigade in Osteuropa eingesetzt gewesen und ist nun pensioniert, wie er scherzhaft meint. Gestrandet trifft es wohl besser. Die Einsatzleitung in Beijing (gibts nicht mehr) hatte die Truppe ganz einfach vergessen. Wahrscheinlich meldete sie einen großen Sieg an der europäischen Front.
»Manchmal gibt es richtige Glückstreffer«, fährt Wen fort, »wie jene Lammkroketten an Honigsauce, ohne Lamm, ohne Honig, keine wirklichen Kroketten. Zen-Kroketten.«
»Oder die Königsberger Klopse«, bemerke ich. Wen grinst mich ratlos an. Auch er müsste dringend zum Zahnarzt.
»Was auch immer«, brummt Carmo.
»Pétanque?«, fragt mich Sirkka, die einarmige Frau zu meiner Linken.
»Klar.«
Auf den verkehrsfreien, unebenen Kiesstraßen lässt sich überall gut Pétanque spielen. Man findet immer Partner*innen und spielt endlos ohne Ambitionen. Die Mediator*innen sind froh, wenn wir uns auf diese kostengünstige und harmlose Weise unterhalten. Die Kugeln wurden geliefert. Auch Gartenschach wird gefördert. Wir alle haben noch kleine Jobs in den Abwaschküchen, Schlafstuben, Werkstätten, in den Außenräumen. Sie werden mit einem Zufallsalgorithmus zugeteilt – korrigiert nach Fähigkeiten. Doch heute habe ich frei. Es ist Tag 75. Wochen und Monate haben sie – als zu kulturspezifisch und zu kompliziert – längst abgeschafft; die Tage werden einfach durchnummeriert. Man vergisst leicht, welchen Tag man hat. Immerhin gibt es in den Schlafstuben Leuchttafeln, die sie anzeigen. Wenn du aufstehst, blinkt dir als erstes die rote Zahl 75 entgegen, und du weißt: Wir haben heute Tag 75, Temperatur 11 Grad. Muss irgendwann im Frühling sein.
Wenn es in die 300er-Tage geht, wird es kälter. Feiertage gibt es keine – es gibt ja auch nichts zu feiern. Und die meisten waren religiös oder national, also toxisch.
Nach dem Essen fragt der zuständige Mediator: »Liebe Menschen, wie geht es euch?«
Alle antworten: »Gut.«
Die meisten brummeln das aber nur.
Wen, der über seinem linken Auge eine schwarze Seidenklappe trägt, bringt die Kugeln und das Cochonnet. Kugeln gelten nicht als Waffen.
Bernhard, der zu uns gestoßen ist, schmeißt das Cochonnet.
Sirkka markiert die Linie im Kiesboden mit ihren zerschlissenen Tennisschuhen.
Carmo wirft. Abdullah wirft.
Auf der geräumten Durchgangsstraße schleicht ein weißer Schützenpanzer vorbei. Die Kamera auf dem Turm dreht sich langsam. Alles unter Kontrolle.
Sie spielen nur Pétanque.
Ich werfe.
Wen knallt mich raus.
»Ha!«, ruft er aus.
Die Sonne kommt hervor.
Einen Augenblick lang herrscht so etwas wie Glück. Oder wenigstens Wohlbefinden.
Einige schreiben in Notizbücher. Nur Gedichte sind erlaubt. Argumentierende Texte werden konfisziert. Ich hasse Poesie.
Lesen darf man alles. Tote Buchstaben gelten als ungefährlich. Neue Buchstaben verschwinden.
Ich bin wieder dran. Schlechter Wurf – Bernhard ist verärgert.
»Konzentrier dich«, sagt er.
Ich konzentriere mich. Mehrere Helikopter fliegen Richtung A-Zone, zum Totenberg, wie Leo ihn oft nennt. Da findet wahrscheinlich ein wichtiges Treffen statt.
Aber jetzt konzentriere ich mich.
Sirkka ist gut, mit ihrem einzigen Arm.
Aber ich knall sie weg.
»Geht doch«, lobt mich Abdullah.
Schließlich gewinnen wir diese Runde.
Wir setzen uns auf eine Betonmauer. Der Mediator geht vorbei und grüßt uns freundlich. Er hat Dienstschluss. Wir nennen ihn Breitmaul. Ein B1.
»Die haben alle Swimmingpools«, sagt Carmo und zeigt zum Totenberg.
»Nicht die B1«, meint Wen.
»Nein, die nicht«, erwidert Carmo.
Was Carmo sagen will: Sie möchte jetzt an einem Swimmingpool liegen und einen Caipirinha schlürfen. In der Sonne ist es relativ warm für diese Jahreszeit. Schon seit einigen Jahren.
Sirkka zeigt uns ihren verborgenen Garten. Es ist noch zu früh, um neu zu pflanzen, doch ihr Rosmarin, der Thymian, Sellerie, Schnittlauch und Liebstöckel sprießen schon schön. Ich zerreibe ein Salbeiblatt und rieche an meinen Fingern. Ich kenne den Geruch seit mindestens siebzig Jahren.
»Gut mit Spargel«, sage ich.
»Da hinten gibt es wilden Spargel«, erklärt Sirkka und zerrt uns um einen Trümmerhaufen herum.
Sirkka hat blonde Haare, ist ziemlich dick und hat einen fleckigen Teint. Ihr Einsatzkommando ist damals im Schwarzwald von Söldnern unbekannter Herkunft aufgerieben worden. Dort liegt auch ihr linker Arm.
Der Spargel sprießt tatsächlich. Sie reißt einige Schösslinge aus, die wir roh zerkauen.
Wir setzen uns auf eine mit einem Brett und Trümmerbrocken improvisierte Bank in die Sonne.
»Drohne«, sagt Bernhard.
Wir rühren uns nicht.
Vier Menschen, die in der Sonne sitzen. Rundherum Unkraut und Gebüsch.
Eine Eidechse.
»Erinnert ihr euch an Jean-François?«, fragt Sirkka nach einer Weile.
»Den Einbeinigen?«, sage ich, »klar.«
»Er sagte: ›Die Essenz eines Gebäudes ist seine Ruine.‹«
»Das ist totaler Unsinn«, wirft Bernhard ein, »das Wesen eines Gebäudes ist sein Nutzen für die Menschen.«
»Du hast recht, Bernhard, wie fast immer«, entgegnet Sirkka, »aber was wollte Jean-François mit diesem scheinbaren Paradox wohl sagen?«
»Er wollte sagen«, versucht es Wen, »dass der Zweck dieser Gebäude, deren Ruinen wir hier betrachten, immer schon ruinös war. Da waren die Banken drin, die schließlich die Welt in den Abgrund gestoßen haben. Da wurden eben gerade die Zwecke verfolgt, die zu diesen Trümmerhaufen führten. Das heißt, die Trümmerhaufen waren schon in den Seelen der Banker, bevor sie dann real entstanden.«
»Es waren wohl emergente Trümmerhaufen«, wende ich ein, »was wir hier sehen, ist unser Versagen. Die Banker und alle anderen haben nur gemacht, was wir sie machen ließen. Sie verkörperten die Trägheit unserer Seelen. Diese Ruinen sind die Essenz unserer Seelen.«
»Schön gesagt«, erwidert Sirkka, »ich finde, diese Trümmerlandschaft ist schöner als alles, was hier vorher stand.«
Ich versuche gerade, die Ruinen, die verrosteten Stahlskelette, die glitzernden Glashaufen und die neue Vegetation, die zwischen ihnen sprießt, schön zu finden.
»Nichts ist schön«, wirft Bernhard ein, »ihr versucht nur unser Versagen umzudeuten. Wir wollten das nicht. Wir wollten andere Städte, keine pseudo-romantischen Ruinenlandschaften. Stellt euch der Wahrheit: Wir haben versagt, wir sind jämmerliche Figuren, wir bleiben jämmerlich, und wir werden jämmerlich enden.«
»Die Natur erobert sich die Wüste zurück«, versucht es Sirkka, schon leiser und ohne große Überzeugtheit in ihrer Stimme.
»Die Natur kann Kultur niemals ersetzen«, beharrt Bernhard, der alte Lehrer.
»Du hast keine Chance, Sirkka«, meint Wen.
»Scheiße«, sagt Sirkka fröhlich grinsend.
Als wir zum Platz vor den Schlafstuben zurückkehren, hören wir Akkordeonmusik. Alexei, der blinde ehemalige Panzerfahrer, spielt Walzer, und ein halbes Dutzend Paare tanzen auf dem staubigen Platz. Rundherum sitzen und stehen unsere Mitbewohnenden und schauen zu.
Sirkka will mit mir tanzen, aber ich mag nicht. Wen tut ihr schließlich den Gefallen. Nora tanzt mit Carmo. Was Alexei spielt, ist sehr langsam, ziemlich halbherzig. Aber er spielt, und etwas löst sich in mir. Musik ist ewige Gegenwart, ein Triumph über die Zeit, die uns so heimtückisch hintergangen hat. So lege ich es mir zurecht.
Wir haben keine Rechte, aber wir dürfen Walzer tanzen.
»Ich hasse Musik«, brummt Bernhard neben mir, »Melodien sind verantwortungslos.«
»Du hast recht.«
»Fuck you.«